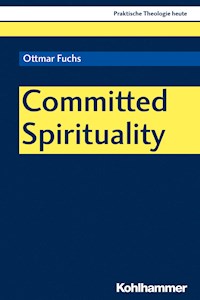Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Echter
- Sprache: Deutsch
Religionen werden nicht selten als Räume der Unfreiheit und Nötigung erlebt. Entweder die Menschen fügen sich ein oder sie sind draußen - und damit diesseitigem und jenseitigem Unheil überlassen. Es gibt aber auch andere religiöse Traditionen. Darin ist Gott so groß und weit, dass allen Menschen unermessliche Liebe und Freiheit zugedacht wird. Auch die Bibel hat diese Anteile. Eine japanische Auto-Werbung nimmt seit Jahrzehnten Anleihe an der biblischen Formulierung: "Nichts ist unmöglich!" Ihr Ursprung ist zurückzuholen. Dass für Gott alles möglich sei, befördert die gerade auch im Christentum mögliche und nötige postkoloniale Transformation. Wo ein grenzenlos solidarischer "Gott" ins Spiel kommt, gewinnt unbegrenzt solidarisches Handeln eine wichtige spirituelle Ressource.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ottmar Fuchs
Nichts ist unmöglich. Gott!
OTTMAR FUCHS
Nichts ist unmöglich.
Gott!
Aspekte einer postkolonialen Bibelhermeneutik
Der Umwelt zuliebe verzichten wir bei diesem Buch auf Folienverpackung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ‹http://dnb.d-nb.de› abrufbar.
1. Auflage 2023
© 2023 Echter Verlag GmbH, Würzburg
www.echter.de
Umschlag: Vogelsang Design, Jens Vogelsang, Aachen
Innengestaltung: Crossmediabureau
E-Book-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheim, www.brocom.de
ISBN
978-3-429-05849-4
978-3-429-05247-8 (PDF)
978-3-429-06596-6 (ePub)
Inhalt
Vorwort
Überblick
Mein Anliegen
0. Einleitung
0.1 Katastrophale Praxis
0.2 Barmherzige Seelsorge
0.3 Im Feuilleton
0.4 In der Genderfrage
0.5 Aufdringliche Ver-HERR-ung
0.6 Gefährliche Weihnachtsidylle
1. Umkehr: postkolonial!
1.1. Postkoloniale Perspektive in der Antisemitismusdebatte
1.1.1 Aktuelle Hinführung
1.1.2 Nicht ohne die anderen
1.1.3 Gegenseitige Wahrnehmung
1.1.4 Gefährliche biblische Texte
1.1.5 „Schweres Erbe“
1.1.6 Immer selbst im Glashaus
1.2. Dynamik der Gnade
1.2.1 Erlösende Botschaft Jesu!
1.2.2 Exegese und theologische Kritik
1.2.3 „Die Bibel und die Frauen“
1.2.4 Kritik „von außen“ und „von innen“
1.2.5 Biblische Transformationen
1.2.6 Universale Rettung vom Kreuz her
1.2.7 Biblisches Widerspruchsrecht
1.3. Wege zur Freiheit
1.3.1 Berührung des Unmöglichen
1.3.2 Agonale Offenbarung
1.3.3 Differenz bis zum Äußersten
1.3.4 Gnade als Wahrnehmungspriorität
1.3.5 Am Beispiel „Erwählung“
2. Neuralgische Themen
2.1. Irritierendes Arschloch-Verhalten
2.1.1 Lizenz zum Widerstand
2.1.2 Mut zur Blasphemie
2.1.3 Faktoren und Merkmale
2.1.4 Biblische Beispiele
2.1.5 Gegendynamiken
2.1.6 Systemische Kontexte
2.1.7 Widerstand als Selbstachtung
2.2. Gewalt(ät)iger Gott?
2.2.1 Zwischen Omnipräsenz und Verharmlosung
2.2.2 Signatur der Unbegreiflichkeit Gottes?
2.2.3 Signatur der eschatologischen Geschichtsmacht Gottes
2.2.4 Nicht Nachahmung, sondern Delegation
2.2.5 Erschrecken über uns selbst
2.2.6 Martyriale Kriteriologie
2.2.7 Der Weg der Kirchen
2.3. „Weinen und Zerknirscht-sein“: in oder fern der Liebe?
2.3.1 Unendlichkeit der Liebe?
2.3.2 Schrei nach Vergeltung
2.3.3 Hoffnung: felix dolor
2.3.4 Eschatologische „Genugtuung“
2.3.5 Verwundungen
2.3.6 Entdualisierender Dualismus
2.3.7 Christologisch ermöglichte Sühne
2.3.8 Was für ein Himmel!
2.3.9 Konsequenzen für die Seelsorge
3. Vertiefungen und Ausblick
3.1. Freiheit zur Verantwortung
3.1.1 Der Fluch wörtlicher Auslegung
3.1.2 Halacha vom Tod zum Leben
3.1.3 Konkrete und entzogene Wahrheit
3.1.4 „Gott“ mit uns
3.1.5 Verlorene Unschuld Gottes
3.1.6 Horizontverschmelzung zwischen Text und Gegenwart
3.1.7 Freiheit „poetischer Hermeneutik“
3.2. Radikales Wagnis bis zum Tod
3.2.1 Totalität des Todes
3.2.2 Vom Zwang zur Befreiung
3.2.3 Der zerrissene Gott
3.2.4 Mysterium stricte dictum
3.2.5 Inhalt des Todes
3.3. Sich lieben lassen!
3.3.1 Fußwaschung passiv!
3.3.2 Politischer Horizont
3.3.3 Niemals Liebesentzug
3.3.4 In der Nicht-Notwendigkeit notwendig
3.3.5 Gericht über alle Lieblosigkeit
3.3.6 Solidarisches Beten
Eigene Vorarbeiten
Register
Vorwort
Religionen werden von vielen Menschen als Räume der Unfreiheit und Nötigung erlebt. Entweder sie fügen sich in die vorgegebenen Religionsbereiche oder sie sind draußen, und damit meist auch dem diesseitigen und jenseitigen Unheil ausgesetzt. So funktioniert der Gottesbegriff als Ausgrenzung derer, die nicht an ihn glauben, denn Gott liebt nur die Gläubigen bzw. Dazugehörigen, nicht aber die anderen. Es gibt aber auch Anteile in den Religionen, wie etwa in ihren mystischen Traditionen, in denen Gott so groß und weit, so unermesslich wahrgenommen wird, dass alle Menschen von dieser Unermesslichkeit an Liebe und Freiheit profitieren. Gott funktioniert dann nicht mehr als Begrenzung, sondern als Entgrenzung, in der Gottesvorstellung wie auch im sozialen Verhalten.
Was heute als Übergang vom kolonialen zum postkolonialen Verhalten diskutiert wird, ist mit diesem Gegensatz in und zwischen den Religionen ins Gespräch zu bringen. Denn dies ist der bleibende Widerspruch: eine eigene Wohlstandswelt zu bauen, ohne und auch gegen die anderen bzw. auf ihre Kosten; oder: Wohlstand, Gerechtigkeit und Heil nicht ohne die anderen und nur mit ihnen im Blick. Theologisch geht es um die Frage: Projizieren gläubige Menschen auf Gott ihre eigenen Blockaden und Grenzziehungen und zementieren diese rückwärts mit dem angeblichen Willen Gottes, oder besser dieses Götzen, oder aber wird die Gottesbeziehung selbst zum Raum permanenter Entgrenzung des säkularen und religiösen Heils?
Eine besonders eindrückliche Entgrenzungsformulierung für die Unermesslichkeit Gottes ist der Ausdruck, dass (bei) Gott nichts unmöglich sei. Derart sprengt Gott die begrenzten Möglichkeiten des Lebens auf andauernde Entgrenzungen hinein, die am Ende, in der neuen Welt, nichts mehr unmöglich sein lassen, und zwar in die Richtung von Liebe, Freiheit und Gerechtigkeit für alle. Programmatische Bedeutung gewinnt hier Mk 10,17–29 (siehe unten Kap. 1.2.5):
17 Als sich Jesus wieder auf den Weg machte, lief ein Mann auf ihn zu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? 18 Jesus antwortete: Warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer der eine Gott. 19 Du kennst doch die Gebote: Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen, du sollst keinen Raub begehen; ehre deinen Vater und deine Mutter! 20 Er erwiderte ihm: Meister, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. 21Da sah ihn Jesus an, gewann ihn liebund sagte: Eines fehlt dir noch: Geh, verkaufe, was du hast, gib es den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben; dann komm und folge mir nach! 22 Der Mann aber war betrübt, als er das hörte, und ging traurig weg; denn er hatte ein großes Vermögen. 23 Da sah Jesus seine Jünger an und sagte zu ihnen: Wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen! 24 Die Jünger waren über seine Worte bestürzt. Jesus aber sagte noch einmal zu ihnen: Meine Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen! 25Leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt.26 Sie aber gerieten über alle Maßen außer sich vor Schrecken und sagten zueinander: Wer kann dann noch gerettet werden? 27 Jesus sah sie an und sagte: Für Menschen ist das unmöglich, aber nicht für Gott; denn für Gott ist alles möglich.
Eine Auto-Werbung hat seit Jahrzehnten Anleihe von dieser religiösen Formulierung genommen: „Nichts ist unmöglich…!“ Die damit angeeignete bzw. enteignete religiöse Konnotation war offensichtlich sehr erfolgreich. Im Titel meines Buches möchte ich diese Anleihe wieder zurückgewinnen für den Bereich, aus dem sie ursprünglich kommt: für Gott und seine in den Religionen mögliche und nötige postkoloniale Transformation. Legt man dem Satz „Nichts ist unmöglich!“ einen derart unendlichen und in die Richtung der je größeren Liebe gehenden Gottesbegriff zugrunde, dann wird zugleich deutlich, dass sich der Mensch hoffnungslos überschätzt, wenn er diesen Satz auf sich selbst beziehen will. Denn im Diesseits ist niemals nichts unmöglich. Es handelt sich eher um eine völlig unangemessene Selbstdivinisierung, die zwar Werbezwecken unterworfen werden kann, aber in ihrem totalitären Anspruch verlogen ist. Denn die Begrenzungen, die es bei den Menschen gibt, gibt es nur im Gottesbegriff per definitionem nicht.
Gott wird also zur Metapher und darin auch zur Energie, die nicht, wie im fundamentalistischen Bereich, die Innen-Außen-Grenzen verschärft und andere dem Unheil überlässt, sondern die radikal gegenteilige Dynamik in Bewegung bringt. Alle Eigenschaften Gottes haben Anteil am unendlichen und unerschöpflichen Gottsein selbst. Wo der grenzenlose „Gott“ ins Spiel kommt, werden koloniale Verhältnisse und Beziehungen aufgesprengt und werden postkoloniale Haltungen und Handlungen mobilisiert. Die in ihrer Unmöglichkeit (weil jenseits unseres Seins) mögliche Unbegrenztheit Gottes ist die religiöse Basis für die menschlich-relative Unbegrenztheit zwischenmenschlicher Solidarität, sofern Gott als unendliche Liebe und Freiheit und Gerechtigkeit gedacht wird.
Mir geht es bei alledem nicht um die Schmähung und Verkleinerung der Bibel und ihrer Bedeutung, auch nicht ihrer Offenbarungsqualität, sondern um eine genaue Sicht auf die innere Komplexität und agonale Struktur dieser Offenbarung. Am Ende, so glaube ich, gewinnt die Bibel noch mehr Authentizität und realitätsnahe Normativität für menschliches Leben.
Überblick
Ein Überblick mag als Lesehilfe dienen. Die Kapitel können voneinander eigenständig gelesen werden. Die Anmerkungen beginnen mit ihren Erstnennungen der Publikationen jeweils neu, weshalb es keine eigene Literaturliste gibt.
Das Buch beinhaltet zum Teil Vorarbeiten, die zwar noch nicht unter dem Stichwort des Postkolonialen publiziert wurden, die aber zum Thema haben, was damit gemeint ist. Das Thema berührt viele und unterschiedliche Text- und Lebensbereiche und man kann diese sicher nur fragmentarisch abschreiten. Es ist also kein linearer Text, sondern ein sternförmiger: Immer wieder geht es um das gleiche Zentrum, um die gleiche Fragestellung, aber jeweils in verschiedenen textlichen und erfahrungsbezogenen Ausstrahlungen, eher impressionistisch als konsekutiv. Querverweise vernetzen die Kapitel. Manche Einsichten sind für mehrere Zugänge wichtig, weshalb sie in unterschiedlichen Kontexten wiederholt begegnen.
Die Weite und Vielfalt des postkolonialen Themas zeigt sich bereits in den diversen Mosaiken der Einleitung. Immer geht es darum, ob Menschen fähig sind zu teilen, Besitz, Ideen, religiöses Heil u.v.a., oder wenn sie das, was sie zu besitzen glauben, ganz und ausschließlich halten und behalten wollen und damit anderen entziehen bzw. die anderen ausgrenzen, um nicht teilen zu müssen.1
Im ersten Teil zur postkolonialen Umkehr geht es mir in Kapitel 1.1 um eine Vorstellung der postkolonialen Perspektive in gegenwärtigen Diskursen und Praktiken, auch hinsichtlich der in Deutschland akuten Israeldebatte. Diese thematische Konzentration scheint mir besonders geeignet, weil es auch im Bibelbezug eine Debatte um den Umgang mit den Antijudaismen in der Bibel gibt.
In Kapitel 1.2 versuche ich eine inhaltlich normative Hermeneutik in Bezug auf die Differenz zwischen „schlechten“ und „guten“ Texten zu entwickeln, bezogen auf eine Offenbarung, die in sich selbst agonal, also widersprüchlich geschaffen ist. Im Zentrum steht die Dynamik zu je größerer Gnade und je weiterer Entgrenzung.
Kapitel 1.3 vertieft den Aspekt der mit der gottgegebenen Freiheit ins Unmögliche und ins Unendliche dessen, was Gott inhaltlich ausmacht, vor allem mit dem Basisereignis des Kreuzes, dem sich im Sprachfeld des Christentums die totale Entgrenzung des Heils verdankt.
Es folgen im zweiten Teil drei neuralgische Zuspitzungen: Der nordamerikanische Philosoph Aaron James hat vor einigen Jahren eine durchaus seriöse wissenschaftliche Untersuchung zu der Frage publiziert, wann Menschen einen anderen Menschen als Arschloch bezeichnen, mit empirischen und konzeptionellen Überlegungen. Bezieht man seine Analyseergebnisse auf biblische Kommunikationen zwischen Menschen wie auch zwischen Gott und den Menschen, ergeben sich bestürzende Analogien (in Kapitel 2.1).
In Kapitel 2.2 habe ich einen älteren Text übernommen und überarbeitet, weil man die Frage nach der Gewalt in der Bibel im Zusammenhang dieses Themas nicht gut auslassen kann.
Auch das Problem der Hölle und die Möglichkeit ihrer postkolonialen Interpretation gehören unbedingt hierher (Kapitel 2.3).
Der dritte Teil bringt einige Vertiefungen zu den bisherigen Ausführungen: In Kapitel 3.1 wird die Distanz zwischen Text und Rezeption auf der einen und in ihrer spannungsreichen Verbindung auf der anderen Seite präzisiert. Von der postkolonialen Perspektive her verändert sich dann auch die Rekonstruktion der Tradition: im Gegensatz zu bisherigen Traditionsfestlegungen, die als ungerecht und exkludierend (vor allem für Frauen) erfahren werden.
Dann, in Kapitel 3.2, geht es um die inhaltliche Bedeutung des Todes in einer Gottesbeziehung, die keine Zugriffe mehr nötig hat.
Kapitel 3.3 beendet dieses Buch mit der Ermutigung, sich lieben zu lassen, was alles andere als selbstverständlich ist.
Mein Anliegen
Gott ist, von unserem Sein her gesehen, die Summe aller Unmöglichkeiten, und darin auch der unendliche „Raum“, in dem das Unmögliche möglich ist. Die Astrophysik hat eine Ahnung davon, wie im unendlichen Universum das, was man für unmöglich gehalten hat, in einer Neuentdeckung plötzlich möglich ist. Wird Gott noch größer und noch weiter gedacht, dann kann seine Spiegelung im Diesseits nur die permanente Entgrenzung bestehender Grenzen und Möglichkeiten bedeuten. Darin dann selbstverständlich immer nur unvollkommen, im Detail, im Fragment und im Gebrochenwerden vorhandener Grenzen und Egoismen. Genau diese Dynamik vertreten die besten biblischen Texte gegenüber den weniger guten. Gleichzeitig geben sie dieser Dynamik eine inhaltliche Richtung: nämlich zu mehr Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, zu mehr Versöhnung und Gnade. Das alles kann man auch ohne Religion. Aber dass die Religion nicht zum Durchlauferhitzer kolonialer Ideologien und Praktiken wird, dafür möchte ich hier für die christliche Seite einige theologische, näherhin bibeltheologische Grundlagen erörtern.
Dies ist der rote Faden, der die folgenden Kapitel, so divers sie sind, verbindet, nämlich „Gott“ und die postkoloniale Debatte zusammenzudenken und mit dem in dieser Debatte vielerorts heftig aufbrechenden Menschheitsproblem zu verknüpfen: Die Erde wird nur dann eine Zukunft haben, wenn Menschen nicht mehr auf Kosten von anderen Menschen, von den Tieren und der Natur existieren, sondern gleichstufige Solidarität leben und erleben, mit der unaufdringlichen, verletzlichen, denkbar schwachen Hoffnung, dass rettende Liebe die Zukunft schlechthin sein wird.
Es ist auf den ersten Blick vielleicht nicht leicht erkennbar, was die unterschiedlichen Zugänge mit diesem Grundanliegen zu tun haben. Die Antwort ist: Die Überlegungen setzen sich durchgehend für Haltungen ein, die die bisherigen Grenzen in der Wahrnehmung sowie in der praktischen Solidarisierung erweitern: beispielsweise im Erlernen des postkolonialen Blickes in politischen Bereichen und wie er dort schärfer sehen lässt (Kap. 1.1), im nichtfundamentalistischen Umgang mit der eigenen Tradition und ihren Texten (Kap. 1.2–1.3), gegenüber identitären Versuchungen in biblischen Texten (Kap. 1.1), gegenüber problematischen Handlungsweisen Gottes (Kap 2.1), in dem in den Religionen schwierigen Verhältnis von Liebe und Freiheit (1.3 und 3.1), in der Frage nach dem Verhältnis von Gottes und der Menschen Gewalt (Kap. 2.2), in der Eschatologie in der Frage nach der Hölle (Kap. 2.3), im spirituellen Umgang mit dem Sterben und dem Tod (Kap. 3.2), in der Fähigkeit, sich lieben zu lassen (Kap. 3.3).
Dabei sind jeweils in aller Schärfe die vielfältigen Facetten des Negativen zu benennen, die den erstrebten Haltungen entgegensteuern.
Ich danke dem Lektor des Echter Verlags, Herrn Reiner Bohlander, für seine Unterstützung dieses Projekts und für das umsichtige Lektorat. Für die zuverlässige Schreibarbeit danke ich Frau Dr. Barbara Körber-Hübschmann und für die abschließende Durchsicht des Manuskripts Herrn Rolf Bechmann.
Lichtenfels
Am Fest Mariä Empfängnis 2022
Ottmar Fuchs
1Zum Teilen als Überlebensstrategie der Menschheit vgl. Manfred Böhm, Ottmar Fuchs, Würde statt Verwertung in der Arbeitswelt, Würzburg 2022, 19–22.
0.Einleitung
0.1Katastrophale Praxis
Vor einigen Wochen war ich bei einer Taufe aus der Verwandtschaft eingeladen. Der Diakon war sehr freundlich und zuvorkommend, er hatte mit den Eltern vorher gesprochen und passte in der Feier vieles dem an, was Mutter und Vater gerne in der Zeremonie haben wollten. Das war alles gut so! Es war die Rede von Heil und Rettung, von Glaube und Erlösung. Doch auf einmal kam der Satz, übrigens mit dem gleichen Lächeln formuliert, wie das andere gesagt wurde: „Nur wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden!“ (nach Mk 16,16). Das war also das Vorzeichen vor dem ganzen freundlichen Schauspiel: wenn es nicht stattfindet, ist das zu taufende Kind verloren. In meiner unmittelbaren Nähe reagierten einige sofort mit der Frage halblaut: „Und die anderen?“ Etliche der Anwesenden waren wohl kirchenfern oder dachten an ihre Söhne und Töchter, an befreundete Menschen, die schon ausgetreten sind. Irgendwie lag Widerstand in der Luft, aber es kam natürlich nicht zum Tumult. Zumal der Diakon freundlich weitermachte.
Was soll nun dieses hinterhältige Liebesversprechen, wenn es derartig drohend auf Kosten der Freiheit geht? Bisher haben viele Menschen, waren sie nicht fundamentalistisch eingestellt, diese Zwiespältigkeit überhört oder nicht allzu wichtig genommen, hier habe ich gemerkt: Das scheint sich geändert zu haben! Befremdlich war auch: Am Ende ließ der Diakon ausgerechnet und ausdrücklich das „Vater unser“ wegfallen, weil das Ganze dann zu lange dauern würde, begründete er. Hier hätten wohl alle unbedroht mitbeten können.
Was steht hier auf dem Spiel? Es geht um zwei Probleme, die hier aber innigst zusammenhängen. Zuerst geht es darum, dass Menschen auch gegenüber Religionen frei sein können, ohne bedroht, missachtet oder, in ganz bestimmten autokratischen Kontexten, benachteiligt, am Ende getötet zu werden. Von der Bedrohung durch ewige Verdammnis ganz zu schweigen! Aus dieser Perspektive haben Katholizismus und Protestantismus eine schlimme Geschichte aufzuweisen, indem sie die Zugehörigkeit zur Kirche bzw. die Zugehörigkeit zum Glauben als exklusive Heilsbereiche verkündigt haben und immer noch in weiten Kreisen so verkündigen, mit entsprechenden degradierenden Wirkungen nach außen. Luther durchbricht zwar den katholischen Kollektivismus und stärkt im Glauben das Individuum, etwa nach dem Motto, bediene dich deines eigenen Glaubens!, aber das exklusive System bleibt erhalten, wenn Menschen die Freiheit außerhalb dieses Glaubens beanspruchen. Es geht nur um die Freiheit des Christenmenschen! Insofern tritt Luther zwar in diese Richtung eine historische Dynamik los, erreicht aber mitnichten die Weite der Aufklärung, in der sich die Menschen der eigenen Vernunft bedienen und dies auch gegenüber einem religiösen Glauben beanspruchen dürfen. Nur eine Freiheit, die auch gegen den Glauben realisiert werden darf, und zwar völlig unbedroht, theologisch also im Heil bleibend und niemals herausfallend, kann mit der universalen Liebe Gottes zusammengedacht werden.
Die soziale Form eines solchen Glaubens, und das ist das zweite Problem, sind nichtidentitäre Gemeinschaften, die genau dies in der Art ihrer Kommunikation zwischen innen und nach außen darstellen und bezeugen. Oder umgekehrt: Wo ein solches Zeugnis gelebt wird, wird auch der Glaube an die universale Liebe Gottes sozial ermöglicht. Nur die religiöse Entdrohung ermöglicht sanktionsfreie Freiheit. Und nur postkoloniales Verhalten und von daher postkoloniale Hermeneutiken vergangener Texte und gegenwärtiger Herausforderungen führen zu einem religiösen Glauben, der offen ist für die Unendlichkeit von Liebe und Freiheit Gottes selbst. Nicht zu übersehen ist, dass sich gerade darin Gerechtigkeit ereignet bzw. dass darin der Wille zur Gerechtigkeit stark ist, weil nichts ohne die anderen geht, und weil auch die anderen immer mitgedacht und miteinbezogen sind.
Es ist die Grundfrage aller Religionen: Denken sie die Unendlichkeit des Geheimnisses Gottes inhaltlich in die Unendlichkeit von Liebe und Freiheit, oder müssen die Menschen an einem Willkür-Gott verzweifeln, dessen letzte Identität darin besteht, sich an der Unterdrückung der Gläubigen und am ewigen Leid der Ungläubigen zu erfreuen (siehe unten Kap. 2.1.7)?
0.2Barmherzige Seelsorge
Schon immer gab es in der Seelsorge, die Trost zu spenden wusste und die Lebenshilfe wichtiger nahm als eigene Machtausübung, die Dynamik zu der je größeren Barmherzigkeit Gottes, auch gegenüber Kirchengeboten, göttlichen Geboten überhaupt und Drohungsinhalten. Das aber konnten nur ichstarke Hauptamtliche in der Seelsorge, die sich selbst nicht auf das pastorale Regelwerk reduziert wissen wollten und das entsprechende Selbstbewusstsein hatten und haben, darüber hinauszugehen. Solche Dynamik zur Gnade hatte manchmal sogar etwas Kriminalisiertes und Unerlaubtes an sich, weshalb der Klerus versucht war, hier die Schotten dichtzuhalten. Die Gnade erschien als Ausnahme, nicht als Regel. Die Wenn-dann-Struktur wurde davon wenig berührt, allenfalls im Ernst- und Extremfall touchiert. Nur im Sterbefall, in articulo mortis, sind fast alle Schotten offen! Warum nicht immer gleich?
Längst ist eine neue hermeneutische Situation entstanden und zu verfolgen: die maximale Gnade nicht nur auf den Extremfall zu beschränken, sondern den Menschen von Geburt an die unbegrenzte, unbedingte Gnade zu eröffnen und von daher die Pastoral gestaltet sein zu lassen. Also nicht von der Erfüllung der Wenndann-Struktur zur Gnade als Verdienst, und selten als Gnade darüber hinaus, sondern von der unendlichen Gnade her zu den dann von daher ermöglichten leidverhindernden Ressourcen und Freiheits-Verantwortungen.
In der Geschichte der Pastoralmacht gab es also die seelsorgerliche Unterbrechung der regelgeleiteten Verwaltung der Gnade, nämlich wenn gute priesterliche Seelsorger zu den moralisierenden Bedingungen dann immer wenigstens noch dazugesagt haben, dass man alles am Ende der Gnade Gott überlassen darf, wo am Ende die Barmherzigkeit Gottes dann doch größer gesehen wird als die Wohlverhaltens- und Zugehörigkeitskriterien zum registrierbaren religiösen Heil. Es ist die Grundstruktur, die auch bei Jesus in seiner Begegnung mit dem reichen Jüngling zum Vorschein kommt (vgl. Mk 10,17–27): nämlich erstens, dass vom Bild des Nadelöhrs gesehen kein reicher Mensch in den Himmel kommt, dass aber, wenn Gott als Subjekt des Handelns in den Blick kommt, von ihm her wieder alles in die Richtung der je größeren Gnade möglich und die Rettung gegeben ist. Diese Gnade ist immer offen für ein Drittes, etwas, was bisherige Gegensätze überwindet, nicht im binären Entweder-oder zuhause ist, denn jedes Entweder-oder schafft für eine Seite Nachteile, wenn dieses Oder ausgegrenzt und degradiert wird.
Während bisher solche Öffnungen des Kolonialen und Identitären in biblischen Narrativen eher übergangen oder als Trostpflaster vernachlässigt wurden, weil der jeweils erste Teil des Narrativs übergewichtig blieb, auch weil damit sozial gesehen besser operiert werden konnte und kann, gilt es nun, diese Öffnungen programmatisch aufzufassen und gegen ihren Vortext zu stemmen, mit ihrer gegen den Vortext von Gott her gesehen universaleren Heilsbedeutung. Diese Wende verbindet sich mit einer Spiritualität, die schon immer in den Kirchen und vor allem in ihren mystischen Anteilen von großer Bedeutung war und ist, nämlich mit der Doxologie,1 in der die Menschen Gott immer größer sein lassen als sich selbst, mit der Anbetung, als ihre eigenen Grenzen, ihre eigenen Vorstellungen und Unmöglichkeiten.
0.3Im Feuilleton
Die im engeren Sinn theologische Begründung und Ermöglichung postkolonialer Perspektiven und Einstellungen ist jedenfalls eine Gottesvorstellung, in der alles Gute, was man in Gott glauben oder phantasieren will, für alle Menschen bereitsteht, unbegrenzt, bedingungslos und für alle Zeit.
Christian Geyer hat in der FAZ Magnus Striet vorgeworfen, Gott dem säkularen Freiheitsdenken zu unterwerfen. Er zitiert Striet: „dass kein Gott akzeptiert werden könne, der nicht freiheitsachtsam ist und Autonomie will“.2 Und Geyer schreibt weiter: „Ist das noch der Gott der Zehn Gebote, der hier antitheologisch diszipliniert werden soll?“3 Geyer verwechselt hier Gottes Anderssein-Dürfen uns gegenüber mit seinem Recht, den Menschen gegenüber Befehle aussprechen zu dürfen, die die Menschen widerspruchslos erfüllen müssen.
Alternativ ist diese Kommunikationsform absolut nicht! Sie ist sattsam als Unterdrückung bekannt! Im Horizont zeigt sich dann ein Sklavenhalter-Gott, dem man folgen muss, um die entsprechenden Gratifikationen zu bekommen (siehe unten Kap. 2.1.3 und 3.2.2). Gerade dies ist umgekehrt ein Zugriff auf die Autonomie Gottes selbst, der sich dann diesem Bedingungsverhältnis auch selbst zu unterwerfen hat. Hierin wurzelt die eingebildete Sicherheit des Fundamentalismus (siehe unten Kap. 2.2).
Und inhaltlich gesehen: Das Alternativste, das es zur menschlichen Existenz gibt, ist die schwierige Kombination von Liebe und Freiheit. Dies ist ein Anderssein Gottes, das auf Grund dieser Inhaltlichkeit selbst auf abgrenzende Bestimmungen verzichtet, oder nochmal anders formuliert: Dies ist die entscheidendste Andersbestimmung menschlichen Lebens, um zu sich selbst zu kommen. Ein ganzes Leben braucht man/frau dazu, und der Tod ist die Erfahrung der letzten Hingabe an dieses unerschöpfliche Geheimnis, er ist der totale Herrschaftsverlust bzw. -verzicht und die radikale Freigabe gegenüber Gott und den Menschen (siehe unten Kap. 3.2.5).
Auch die biblischen Texte haben sich den Menschlichkeitsansprüchen zu unterwerfen, wie umgekehrt solidaritätstragende und freiheitsschenkende Texte der Bibel anderslautende biblische und gegenwärtige Texte und Realitäten der Kritik aussetzen. Wenn der biblische Gott nicht „menschlich“ ist und wenn er nicht Menschlichkeit ermöglicht, kann er der Menschheit gestohlen bleiben. Es ist ein böser „theologischer“ Trick, Gottes unmenschliche Züge und jene Anteile, die Unmenschlichkeit provozieren, durch seine Geheimnishaftigkeit legitimieren zu wollen. Wo Gott derart entschuldigt und immunisiert wird, ist auch jeder Klage, Anklage (und das sind starke biblische Gebetsakte) und Kritik der Boden entzogen. Gottes Unergründlichkeit ist kein rechtfertigendes Argument für Gottes Unmenschlichkeit, sondern lässt deren Skandal ins Unermessliche explodieren. Gott wäre sonst ein Terrorist par excellence.4
Es ist die Grundfrage aller Religionen: Denken sie die Unendlichkeit des Geheimnisses Gottes inhaltlich in die Unendlichkeit von Liebe und Freiheit hinein und hinaus, oder müssen die Menschen an einem Willkür-Gott verzweifeln, dessen letzte Identität darin besteht, sich an der Unterdrückung und am Leid der Menschen zu erfreuen? Diese Kriteriologie ist gegenüber den Texten in Anschlag zu bringen?5 Denn die Bibel legt sich nicht selber aus, sondern wird ausgelegt, denn das Subjekt der Priorisierung befindet sich außerhalb des Textes. Rezeptionsästhetisch ist die Bibel nicht besser oder schlechter als der Umgang mit ihr.
0.4In der Genderfrage
So lautete die aktuelle Meldung in „Katholisch.de“ vom 28.08.2017: „Der Passauer Bischof Stefan Oster hat sich gegen die Priesterweihe für Frauen ausgesprochen. Zum ‚Geheimnis von Schöpfung und Erlösung‘ gehöre, dass Jesus ein Mann war, sagte er in einem Interview der aktuellen ‚Herder Korrespondenz‘. Deshalb könne der Priester, der ‚in Persona Christi‘ handle, keine Frau sein.“ … Dass Frauen in der Kirche ausgegrenzt worden seien und Unterdrückung erfahren hätten, „das ist eine Sünde der Kirche, das geht nicht“, sagte Oster weiter. Der Vorbehalt des Priestertums für Männer gehöre vom Grundsatz her jedoch nicht in diese „sündigen Strukturen“, das Verbot der Frauenordination sei vielmehr ‚lehramtlich geklärt‘.“6
Der Ausschluss der Frauen vom Priesteramt wird von der Kurie gerne als endgültig vorgegebene Lehre vorgeschrieben, obgleich diese Lehre bislang, wenn auch mit harschen Formulierungen, textsortenmäßig nur in Verlautbarungen des ordentlichen Lehramts und darin nicht als Wahrheitsaussage, sondern als Befindlichkeitsaussage über die Kirche, dass sie sich zur Zulassung von Frauen zum Ordo nicht für berechtigt hält, formuliert wurde. „Mit der Feststellung, dass sich die Kirche nicht für berechtigt hält, ist mitnichten die Frage beantwortet, ob sie nicht entgegen ihrer Einschätzung in Wahrheit dazu berechtigt ist. Die Wahrheitsfrage wird durch die Form, in der man diesen Standpunkt vorträgt, nicht zum Thema.“7
Und da zwar auf die Berufung der Zwölf durch Jesus, nicht aber auf die Offenbarungsaussagen Bezug genommen wird, dass Frauen für die Botschaft Jesu vom Reich Gottes wie auch für die Verkündigung der Auferstehung unentbehrlich sind, gilt: „Von einer Definition der Lehre, Frauen nicht zur Priesterweihe zuzulassen, kann daher schon aus formalen Gründen nicht die Rede sein.“8 Auch weil damit die priesterliche Würde aller Gläubigen durch die Taufe in ihrer kirchenamtlichen Entfaltung halbiert wird und weil nicht zur Kenntnis genommen wird, welche Bedeutung Frauen überhaupt in neutestamentlichen Texten und in der Geschichte der Kirchen haben. Die Zeichen der Zeit sind klar: Es geht um die auch christlich motivierte Herausforderung der Gendergerechtigkeit. Wo Letztere nicht gegeben ist, handelt es sich in Gesellschaft und Kirche um eine „sündige Struktur“, in der Kirche auch um eine Versündigung an den entsprechenden Berufungen von Männern und Frauen und an der sakramentalen Präsenz in den Gemeinden.
Es kommt ja auch kaum jemand auf die Idee, im Horizont der Prä- und Postexistenzchristologie (in Gott und in der Schöpfung) die Präsenz der zweiten göttlichen Person in der Schöpfung nur auf Männliches zu beziehen. Die Christologie darf nicht von der Schöpfungstheologie abgetrennt werden, insofern nach Kol 1,16 durch Christus alles (auch alles Weibliche!) geschaffen ist, was im Himmel und auf Erden ist.
Diese Einsicht radikalisiert die Inkarnationstheologie, wie sie sie davor bewahrt, ungeschichtlich verallgemeinert zu werden und aus der Menschwerdung der zweiten göttlichen Person eine überkontextuelle Mannwerdung zu machen, oder anders: Aus der Mannwerdung der zweiten göttlichen Person diese selbst rückwirkend zum Mann zu machen und in solchem Zirkelschluss „schlüssig“ zu beweisen, dass die bereits in der Trinität ihrer Übergeschichtlichkeit beraubte und als Maskulinum existierende zweite göttliche Person es völlig verbiete, für den heilsökonomischen Welt- und Menschenbezug weibliche Symbolisierungen zuzulassen.
Doch wartet die Tradition selbst mit Gegenentwürfen auf: Es gibt eine eindrucksvolle theologische Tradition, Christus auch als Frau und Mutter zu begegnen und anzurufen, wie etwa bei Peter Claver und bei Franz von Sales, der Christus am Kreuz mit einer schwangeren Frau, die ihre Geburt erwartet, vergleicht.9 Anselm von Canterbury nimmt Christus Jesus als „Gebärende“ wahr. Juliana von Norwich hat in ihren „Offenbarungen der Liebe“ gerade dieses Motiv reich entfaltet.10 Dorothee Sattler unterstreicht diese vergessene Erinnerung „von der lebenstiftenden Sterbebereitschaft“ der werdenden und gebärenden Mutter.11
So ist die zweite göttliche Person nach Mt 25,35ff. selbstverständlich nicht nur „in persona“ gegenwärtig in den männlichen Kranken, Nackten, Obdachlosen, Fremden, Unterdrückten und kaputten Menschen, sondern genauso auch in den weiblichen. So ist die zweite göttliche Person im Kontext der Nachfolgetheologie in all denen vorhanden, die sich mit den Leidenden solidarisieren, darin etwas und am Ende sich riskieren und derart Jesus nachfolgen, natürlich nicht nur in den entsprechenden Männern, sondern auch in den Frauen. Und das gilt selbstverständlich auch für das „in persona“ von Männern und Frauen im sakramentalen Amt.
Auch wenn diese Bemerkungen banal klingen, sind sie es doch nicht, wenn man an die Worte von Bischof Oster denkt.
0.5Aufdringliche Ver-HERR-ung
In den neuen liturgischen Büchern zur Leseordnung, die die neue Einheitsübersetzung enthalten, glotzt einem nur so das „HERR“ entgegen, mit der völlig gegenteiligen Wirkung gegenüber der Absicht, dass es sich hier nicht um eine Genderbezeichnung, sondern um eine Symbolbezeichnung handele. Das kann man noch so oft dazu sagen: wenn das Schriftbild und das Hörbild nur noch den Herrn vermittelt und nichts mehr dahinter anderes vermuten lässt, dann ist dies pragmatisch gesehen ein enormer Schub androzentrischer Gottesbezeichnung und -anrede. In dem Wort „Verherrung“ funktioniert die Vorsilbe „ver“ tatsächlich wie, nicht immer (wie bei „vertrauen“), aber doch ziemlich oft im Sprachgebrauch, als destruktive Anzeige: wie bei vernichten, verstören, verschmutzen u.ä. Das jeweilige Verb wird soweit getrieben, dass es zerstörende Ausmaße bekommt.
Es wird niemand behaupten, dass die Analogierede von Gott geschlechtlich festgelegt sei.12 Nach dem 4. Laterankonzil ist ohnehin alle Rede von Gott, auch die der Offenbarung, also auch der Bibel und der Dogmen, Gott unähnlicher als ähnlich.13 In diesem unendlichen und unerschöpflichen Mysterium „stricte dictum“ lösen sich alle Zuschreibungen auf. So dass die Gottesrede im Diesseits dieses Geheimnisses offen ist für viele Metaphern, die Gott je nach kultureller Gegebenheit bzw. dem Wunsch, sich von ihr zu befreien, so oder/und so bebildern und mit den Erfahrungen der Menschen verbinden. Es sind die jeweils herrschenden Menschen selbst, die es nicht verhindern, die Rede von Gott ausgrenzend und degradierend gegenüber anderen bzw. gegenüber dem anderen Geschlecht zu benutzen, und die keine diesbezüglich reziprok inklusive Weise zulassen. So blendet jede dauerhafte Fixierung in der Rede von den drei göttlichen Personen auf das Männliche (Vater, Sohn und Heiliger Geist) diese plurale Offenheit, mit der sich die jenseitige Übergeschlechtlichkeit Gottes im Diesseits spiegelt, aus dem Bewusstsein aus.
Hierin ist auch die Bibel nicht unschuldig. Und auch nicht Bibelübersetzungen: wenn z.B. die Neue Einheitsübersetzung den hebräischen Gottesnamen YHWH mit HERR wiedergibt. Der notwendige Respekt vor dem jüdischen Gottesverständnis hätte sich mit einem analogen Respekt vor den Frauen verbinden können, vor allem jenen, denen das Herrsein Gottes allüberall schon längst auf die Nerven geht und die sich dabei auf die Lehre von der Übergeschlechtlichkeit Gottes berufen können. Denn es ist ja gerade eine aktuelle Ernstnahme der heiligen Geheimnishaftigkeit Gottes, seinen Namen nicht mit den „Vokalen“ eines Herrsein-Wortes zu vereindeutigen. Auch wenn die Großbuchstaben ein Textsignal andeuten, beinhaltet HERR semantisch eine androzentrische Eindeutigkeit, wie sie mit dem Textsignal YHWH niemals gegeben war, und verfehlt damit das Anliegen, der jüdischen Seite (heiliges Geheimnis YHWHs) gerecht zu werden, verfehlt aber auch die Weigerung (um einer noch radikaleren Ehrfurcht willen), die „adonai“ (Herr)-Vokalisierung des Tetragramms zu überwinden.
Mehr und sensiblere Phantasie wäre hier nötig gewesen. Hier hat sich die „Übersetzung in gerechter Sprache“ mehr Mühe gemacht.14 Die paradoxe Chance, semantische Unaussprechlichkeit auch im Deutschen aussprechbar zu machen und derart die Doxologie der Herranrede „herrenfrei“ zu gestalten, ist gründlich vertan. Mir schlägt das Herr-Gerede zunehmend auf den Magen, nicht nur in Solidarität mit den Frauen, sondern auch in Solidarität mit Gottes unendlicher Weite selbst. Es ist höchste Zeit, damit zu beginnen, die Herr-Anrede Gottes (wo sie sich nicht auf Jesus bezieht) vor allem auch in den liturgischen Vorgaben abzubauen: ein immenses Innovationsprojekt, das einer dominanten Sprachtradition zuwiderläuft.
Die prinzipielle Übergeschlechtlichkeit Gottes bezieht sich selbstverständlich auch auf die zweite göttliche Person, die zwar im Mann Jesus Mensch geworden ist, die aber sowohl in Gott selbst wie auch in ihren anderen innergeschichtlichen Seinsweisen für androgyne Bebilderungen bzw. Realisierungen offen ist. Die jeweilige Offenheit bezieht sich auf den Kontext und wird darin entsprechend geschenkt bzw. beansprucht, wie sich die Menschwerdung der zweiten göttlichen Person auf Grund des jüdischen Kontextes so und nicht anders ereignet hat. Dahinter stehen soziokulturelle Gründe im Kontext einer patriarchalen Religion und Gesellschaft, aber noch wichtiger im Kontext der Durchbrechungen dieses Systems in Israel selbst (durch wichtige Interventionen vor allem in der Prophetie).
So dass sich in der Menschwerdung in einem Mann im Kontext des erwählten Volkes die schärfsten Dialektiken, Ambivalenzen und Widersprüche kreuzen (siehe unten Kap. 3.2.2): „Denn Gott bin ich und nicht Mann, in deiner Mitte der Heilige, ich will nicht in Zornglut kommen“ (Hosea 11,9). Mannsein ist also in diesem Kontext religiös wie kulturell etwas Hochambivalentes und Zweischneidiges. Indem Gott in solchem Kontext in einem Mann Mensch wird, tut er dies an der in der damaligen Kultur gendermäßig sündigsten Seite des Menschseins, um darin die unbegrenzte Reichweite der Erlösung darzustellen. Denn: „Was in der Menschwerdung nicht angenommen worden ist, das ist auch nicht geheilt; was aber mit Gott vereint ist, das wird auch gerettet“ (Gregor von Nazianz).
Auch dem Argument gegenüber, dass gendermäßig die Potentialität zu Gut und Böse allen Menschen ähnlich gegeben ist, ist die Frage nach der strukturellen Macht und Anfälligkeit zu stellen, der das männliche Geschlecht in einem Patriarchat ausgeliefert ist bzw. wodurch das Patriarchat verstärkt wird. Die Kriegsgeschichte ist nun einmal mit hoher Dominanz eine Geschichte darin verantwortlicher und kämpfender Männer. So ist in Christus auch dieses kulturell und religiös gefährlichste Geschlecht (gender) angenommen, auch im Sinne von 2 Kor 5,21, wonach Gott die zweite göttliche Person in Jesus „zur Sünde gemacht“ hat.15 Gott kommt als Mann, auch um in diesem Kontrast ein ganz anderes Mannsein darzustellen, eines, das nicht herrscht, sondern dient und sich auf ein mitmenschliches Menschsein hin öffnet. Damit wird androzentrisches Verhalten nicht bestätigt, sondern bekämpft, was sich dann auch in manchem Verhalten Jesu gegenüber Frauen zeigt.
Nimmt man ernst, was sich in der Inkarnation der zweiten göttlichen Person an Handlungen inkarniert, sind dies vor allem die Nähe Jesu zu den Armen und Leidenden auf der einen Seite und die dazu gegensätzliche „Nähe“ zu den Sündern und Sünderinnen, zu den Bösen, auf der anderen Seite. Jesus geht beiden nicht aus dem Weg. Sei es in Solidarität, sei es in Konfrontation, sei es in Versöhnung. Nimmt man dieses Handeln als Hermeneutik für die Inkarnation selbst, dann hätte die zweite göttliche Person auch bzw. eigentlich in einer Frau Mensch werden müssen, denn Frauen waren in dieser Gesellschaft diejenigen, die strukturell am wenigsten zu sagen und am meisten zu ertragen hatten. Diese Perspektive spiegelt sich vor allem im Magnifikat. Denkt man allerdings daran, dass im Inkarnationsgeschehen eine Frau die Gebärende sein muss, und fasst man Maria in dieser Hinsicht als „Miterlöserin“16 auf, dann legt sich die Menschwerdung in einem Mann nahe, um darin den größten Widerspruch seiner Sendung zur bestehenden Realität des Bösen in seiner leidschaffenden Macht zum Vorschein kommen zu lassen. Diese Epiphanie ereignet sich zugunsten benachteiligter Menschen genauso wie zugunsten der Sühnenotwendigkeit der Bösen.
0.6Gefährliche Weihnachtsidylle
Was die Menschheit in fürchterlicher Weise immer wieder charakterisiert, sind Massenmorde und Genozide. In der Erinnerung der Sieger werden sie als für die Aufrechterhaltung der Herrschaft oder der Ordnung oder für die Ausbreitung bzw. das Überleben des eigenen Volkes notwendige Strategien instrumentalisiert. Das damit verbundene Leiden auf Seiten der unterlegenen und vernichteten Menschen wird möglichst unsichtbar gemacht.
Von einem Massenmord ist auch im Zusammenhang der Weihnachtsgeschichte in den Liturgien der Kirchen und vorher schon im Neuen Testament im Matthäusevangelium Kapitel 2 die Rede. Die Geschichte vom Kindermord in Bethlehem gehört zur Weihnachtsgeschichte. Entsprechend sind auch die liturgischen Kalender der Kirchen gestaltet. Die Erinnerung an die ermordeten unschuldigen Kinder erfolgt jeweils im Zeitraum einer Woche nach dem eigentlichen Geburtsfest, also in der Weihnachtszeit.
Herodes will seine Herrschaft sichern, wie er vorher bereits mögliche Gegner aus der eigenen Familie durch Ermordung ausgeschaltet hat.17 Jetzt also der flächendeckende Kindermord in Bethlehem und Umgebung. Das Imperium schlägt zurück, es ist auf Gewalt und Unterdrückung aufgebaut und kann nicht zulassen, dass eine andere Gewalt stark oder stärker wird. Noch dazu, wenn dieser andere „Herrscher“ mit einer anderen Gewalt kommt, mit der Gewalt der Liebe und des Friedens und der Gerechtigkeit. Was später am Kreuz tatsächlich geschieht, hätte bereits am Kind Jesus geschehen können und wurde in letzter Minute verhindert. Aber um welchen Preis?
Um den Preis dafür, dass dafür andere Kinder geopfert werden. Und hier geschieht dann eigenartigerweise so etwas wie eine Inanspruchnahme, wie eine Instrumentalisierung des Kindermords für die neue „Herrschaft“ des Messias, für die Wahrheit seiner Sendung und für seine Autorität. So hat der Kindermord bereits im Evangelium nur eine relative Bedeutung. Er wird benutzt, um mit Bezug auf Jeremia zu beweisen, dass sich mit Jesus die Voraussage des Messias erfüllt.
Meine Frage ist hier nicht: Hat der Kindermord tatsächlich stattgefunden oder nicht? Wahrscheinlich nicht.18 Für mich gilt als historisches Datum, dass es diese Geschichte in einem Text gibt, der seinerseits historisch ist und eine historisch belegbare Rezeptionsgeschichte hat. Für Letztere ist unerheblich, ob die Geschichte historisch belegbar ist.19
Was die Anzahl der ermordeten Kinder anbelangt, hatte die Tradition weitgehend eine Vorstellung von einem Massenmord: 14.000 im griechischen Bereich, 144.000 bei mittelalterlichen Annahmen und schließlich in der neueren Zeit realistisch an der Größe Bethlehems gemessen ein bis zwei Dutzend. Der Text selber ist auf eine Steigerung angelegt, er betont, dass alle Knaben und dazu noch in der ganzen Umgebung getötet wurden. Die Zahl ist also bereits bei Matthäus potentiell nach oben offen.20
Dahinter steht die grundsätzliche theologische Frage, warum Gott eigentlich das Negative braucht, um darin seine Autorität, um auf diesem Hintergrund die Messianität entsprechend profiliert sein zu lassen. Warum diese unverhältnismäßige Brutalität, mit der und auf deren Hintergrund sich erst das göttliche Heil zeigen kann? Der Gedanke, dass Gott auf krummen Zeilen gerade zu schreiben vermag, müsste mit dem anderen Satz konterkariert werden, dass Gott selbst diese krummen Zeilen erst einmal nicht verhindert, ja sogar selbst betreibt. Was Gott tut, ist nicht wohlgetan! Und es ist erst wohlgetan, wenn etwas nicht wohlgetan ist?
Schaut man sich die liturgischen Kalender der katholischen und evangelischen Kirche an, dann kümmert man sich darin nicht um das Leiden der Kinder, nicht um das Grauen eines Massenmordes, sondern dieses Geschehen wird dem Weihnachtsgeschehen als zusätzliche Bestätigung untergeordnet und so um seine eigene Wucht gebracht. Dass diese Instrumentalisierung des Kindermords für die Bestätigung Jesu als Messias bereits im Matthäustext erfolgt, macht das Ganze nicht besser. Immerhin wird darin noch Jeremia zitiert, wobei das Geschehen dann doch eine gewisse Eigenwertigkeit bekommt, „ein Geschrei war in Rama zu hören, lautes Weinen und Klagen: Rahel weinte um ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn sie waren dahin.“ (Mt 2,18). Hier ist wenigstens noch von Geschrei, Weinen, Klagen und Sich-nicht-tröstenlassen die Rede. Auch wenn dies dann insgesamt der Erfüllungsstrategie dient.
In der evangelischen Agende begegnet das Evangelium im ersten Sonntag nach dem Christfest, im katholischen Messbuch kommen die „unschuldigen Kinder“ wenigstens im Titel des Tages vor, um die unschuldigen Kinder aber dann doch für die Verherrlichung des geborenen Christus in Gebrauch zu nehmen. So lautet das Tagesgebet: „Vater im Himmel, nicht mit Worten haben die unschuldigen Kinder dich gepriesen, sie haben dich verherrlicht durch ihr Sterben.“21 In der Einleitung zu diesem Festtag ist zu lesen „Kirchenväter haben die kindlichen Märtyrer gerühmt, denen es vergönnt war, nicht nur als Zeugen für Jesus, sondern stellvertretend für ihn zu sterben.“22 Diese heilsgeschichtliche Unterstellung entzieht den Kindern ihren Subjekt- und dem Geschehen seinen Objektcharakter. Nicht weniger problematisch ist das Gabengebet: „Herr unser Gott, du hast den unschuldigen Kindern die Krone der Märtyrer geschenkt, obwohl sie noch nicht fähig waren, deinen Sohn mit dem Munde zu bekennen.“ Hier wird ein Doppeltes deutlich: einmal die ungefragte Beanspruchung der Kinder als Märtyrer und Zeugen für den Messias, zum anderen die hintergründige Vorstellung, dass ansonsten die Krone des Himmels all denen nicht zukommt, die den Sohn nicht mit dem Munde bekennen.
Immerhin war es die christliche Kunst, die der Dramatik des Kindermords in eigengewichtigen dramatischen Bildern Ausdruck verleiht, womit sie der Wucht und Selbstwertigkeit dieses Geschehens zu entsprechen versucht. Hier wehrt man sich wenigstens gegen das Empathiedefizit der einschlägigen kirchlichen Texte. Das Leiden der Kinder und der Mütter wird sichtbar gemacht. „Pieter Brueghel d.Ä. malte den Kindermord als Dorfszene in flämischer Winterlandschaft, gemünzt auf Gräueltaten der spanischen Besatzer. Auch Giotto, Fra Angelico, der ältere Cranach und Rubens schufen Versionen. Das Blutbad der Kinder wurde zum Inbegriff des fünften Gebots: DU SOLLST NICHT TÖTEN! Es symbolisiert die Verletzlichkeit des Menschen, seine Ohnmacht, seinen unverrechenbaren Eigenwert. Der Mensch, als Kind entwaffnet. Kinder sind schuldlos. Sie verantworten weder Ideologien noch deren Schlachten. Der Kindermord entlarvt und markiert das schlechthin Böse, den totalen Krieg.“23
Herodes steht im biblischen Text für diejenigen, die ihre Herrschaft ohne Rücksicht auf die Leiden der Menschen durchsetzen und aufrechterhalten, immer wieder bestrebt, dieses Leiden nicht sichtbar werden zu lassen. Die Herodesgeschichte ist eine generative Geschichte für die Analyse solcher Verhältnisse durch die ganze Geschichte hindurch. Es ist die Unfähigkeit, Macht um der Ohnmächtigen willen zu teilen. Wer aber nicht teilt, muss töten!24
Dieses Eigengewicht der Herodesgeschichte für die Wahrnehmung von Geschichte überhaupt kommt in der kirchlichen Verkündigung nicht oder ganz wenig vor. Dafür überstrahlt in der kirchlichen Rezeption die Idylle von Weihnachten (die ja auch keine ist!) alles andere. Dagegen muss die Weihnachtsgeschichte konstitutiv mit der Kindermordgeschichte verbunden werden, nicht die Letztere als Beleg für die Erstere, sondern als der schreckliche Kontext, in dem die Weihnachtsgeschichte selbst geschieht. Es gibt die Weihnachtsgeschichte von der Geburt des Messias nicht ohne ihre Konfrontation mit den dazu gegenteiligen Imperien, in denen sie stattfindet. Es geht um Konfrontation, nicht um eine heimliche oder unheimliche Instrumentalisierung für die eigene Selbstbehauptung, auch noch auf dem Rücken der Opfer, so subtil diese dann auch sein mag. Der Kampf gegen die Instrumentalisierung der Unterdrückung für imperiale Mächte ist ein Weihnachtskampf schlechthin, in dem das Messianische, so hilflos es erscheint, Kraft gewinnt. Dafür steht das ebenfalls weihnachtliche umstürzlerische Magnifikat Marias (Lk 1,26–56).25
1Vgl. Ottmar Fuchs, Doxologie: Anerkennung Gottes in der Differenz, in: Jahrbuch für Biblische Theologie, Bd. 32 (2017): Beten, Göttingen 2019, 291–315.
2Vgl. Christian Geyer, Sylter Hochzeitsstreit. Ihre Preise verdirbt die Kirche im Hörsaal, nicht auf Hochzeiten: Ein Freiburger Freiheitsapostel stellt den Bundesfinanzminister in den Schatten, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 14.07.2022, mit Bezug auf Magnus Striet, Alles eine Frage der Berufung? Über Kirche und Macht, in: Stefan Kopp, Macht und Ohnmacht in der Kirche. Wege aus der Krise, Freiburg i.Br. 2020, 148–162.
3Geyer, Hochzeitsstreit.
4Die Sonderausgabe des französischen Satiremagazins „Charlie Hebdo“ ist zum Jahrestag der Mordanschläge Anfang Januar 2016 mit einem Gott als flüchtenden bewaffneten Täter auf dem Titel erschienen, mit dem Text: „Ein Jahr danach – der Mörder ist immer noch auf freiem Fuß“.
5Vgl. Gerlinde Baumann, Gottesbilder der Gewalt im Alten Testament verstehen, Darmstadt 2006; Ottmar Fuchs, Gewaltanfälligkeiten im Gottesglauben. Einige Aspekte zur Entzwingung des Glaubens, in: Theologische Quartalschrift 191 (2011) 4, 354–384.
6Vgl. Katholisch.de, Aktuelle Artikel, Kirche, Freiburg – 28.08.2017, Zugriff 30.08.2017, vgl. dazu „Ich bin ein Suchender“, Interview mit dem Jugendbischof Stefan Oster, in: Herder Korrespondenz 71 (2017) 8, 18–22.
7Elmar Klinger, Christologie im Feminismus, Regensburg 2001, 235.
8Klinger, Christologie, 235.
9