
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
"Nichts bedeutet irgendwas, deshalb lohnt es sich nicht, irgendwas zu tun." Mit diesen Worten schockiert Pierre alle in der Schule. Um das Gegenteil zu beweisen, beginnt die Klasse alles zu sammeln, was Bedeutung hat. Doch was mit alten Fotos beginnt, droht bald zu eskalieren: Gerda muss sich von ihrem Hamster trennen. Auch Lis Adoptionsurkunde, der Sarg des kleinen Emil und eine Jesusstatue landen auf dem Berg der Bedeutung. Als Sofie ihre Unschuld und Johan seinen Zeigefinger opfern mussten, schreiten Eltern und Polizei ein. Nur Pierre bleibt unbeeindruckt. Und die Klasse rächt sich an ihm ... Eine erschütternde Parabel über das Erwachsenwerden, Erziehung und Gewalt in unserer Gesellschaft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Janne Teller
NICHTS
Was im Leben wichtig ist
Aus dem Dänischen von Sigrid C. Engeler
Carl Hanser Verlag
Die Originalausgabe erschien 2000 unter dem Titel Intet.
Published by agreement with The Gyldendal Group Agency, Denmark.
Die Schreibweise in diesem Buch entspricht den Regeln der neuen Rechtschreibung.
eBook ISBN 978-3-446-23682-0
© 2000 by Janne Teller
Alle Rechte der deutschen Ausgabe:
© Carl Hanser Verlag München 2010
Umschlag: Stefanie Schelleis, München
Satz: Satz für Satz. Barbara Reischmann, Leutkirch
Datenkonvertierung eBook:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele
andere Informationen finden Sie unter
www.hanser-literaturverlage.de
FÜR PETER, PIL UND KRISTINE
I
Nichts bedeutet irgendetwas,
das weiß ich seit Langem.
Deshalb lohnt es sich nicht, irgendetwas zu tun.
Das habe ich gerade herausgefunden.
II
Pierre Anthon verließ an dem Tag die Schule, als er herausfand, dass nichts etwas bedeutete und es sich deshalb nicht lohnte, irgendetwas zu tun.
Wir anderen blieben.
Und auch wenn die Lehrer sich bemühten, rasch hinter ihm aufzuräumen – sowohl im Klassenzimmer als auch in unseren Köpfen –, so blieb doch ein bisschen von Pierre Anthon in uns hängen. Vielleicht kam deshalb alles so, wie es kam.
Es war in der zweiten Augustwoche. Die Sonne brannte und machte uns faul und leicht reizbar, der Asphalt klebte an den Sohlen unserer Turnschuhe, und die Äpfel und Birnen waren gerade eben so reif, dass sie perfekt als Wurfgeschoss in der Hand lagen. Wir schauten weder links noch rechts. Der erste Schultag nach den Sommerferien. Das Klassenzimmer roch nach Reinigungsmitteln und langem Leerstehen, die Fensterscheiben warfen gestochen scharfe Spiegelbilder, und an der Tafel hing kein Kreidestaub. Die Tische standen in Zweierreihen so gerade wie Krankenhausflure und wie sie es nur an ebendiesem einen Tag im Jahr tun. Klasse 7 A.
Wir gingen zu unseren Plätzen, ohne uns über die vorgegebene Ordnung aufzuregen.
Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Unordnung. Aber nicht heute!
Eskildsen begrüßte uns mit demselben Witz wie in jedem Jahr.
»Kinder, freut euch über den heutigen Tag«, sagte er. »Ohne Schule gäbe es auch keine Ferien.«
Wir lachten. Nicht, weil wir das witzig fanden, sondern weil eres sagte.
Genau da stand Pierre Anthon auf.
»Nichts bedeutet irgendetwas«, sagte er. »Das weiß ich schon lange. Deshalb lohnt es sich nicht, irgendetwas zu tun. Das habe ich gerade herausgefunden.« Ganz ruhig bückte er sich und packte die Sachen, die er gerade herausgenommen hatte, wieder in seine Tasche. Mit gleichgültiger Miene nickte er uns zum Abschied zu und ging hinaus, ohne die Tür hinter sich zu schließen.
Die Tür lächelte. Es war das erste Mal, dass ich sie das tun sah. Mir kam die angelehnte Tür wie ein breit grinsendes Maul vor, das mich verschlingen würde, wenn ich mich dazu verlocken ließ, Pierre Anthon nach draußen zu folgen. Wem lächelte es zu? Mir, uns allen. Ich sah mich in der Klasse um, und die ungemütliche Stille sagte mir, dass die anderen es auch bemerkt hatten.
Aus uns sollte etwas werden.
Etwas werden bedeutete jemand werden, aber das wurde nicht laut gesagt. Es wurde auch nicht leise gesagt. Das lag einfach in der Luft oder in der Zeit oder im Zaun rings um die Schule oder in unseren Kopfkissen oder in den Kuscheltieren, die, nachdem sie ausgedient hatten, ungerechterweise irgendwo auf Dachböden oder in Kellern gelandet waren, wo sie Staub ansammelten. Ich wusste es nicht. Pierre Anthons lächelnde Tür erzählte es mir. Mit dem Kopf wusste ich es immer noch nicht, aber trotzdem wusste ich es.
Ich bekam Angst. Angst vor Pierre Anthon.
Angst. Mehr Angst. Am meisten Angst.
Wir lebten in Tæring, einem Vorort einer mittelgroßen Provinzstadt. Er war nicht vornehm, aber ziemlich. Daran wurden wir oft erinnert, auch wenn es nicht laut gesagt wurde. Auch nicht leise. Ordentlich gemauerte, gelb verputzte Häuschen und rote Eigenheime mit Gärten ringsum, neue graubraune Reihenhäuser mit Vorgärten, und dann die Wohnungen, wo die wohnten, mit denen wir nicht spielten. Es gab auch ein paar alte Fachwerkhäuser und ehemalige Bauernhöfe, deren Land eingemeindet worden war, und einige wenige weiße Villen, wo die wohnten, die noch mehr ziemlich vornehm waren als wir anderen.
Die Schule von Tæring lag an einer Ecke, wo zwei Straßen aufeinandertreffen. Alle, bis auf Elise, wohnten an der einen, dem Tæringvej. Elise machte manchmal einen Umweg, um mit uns anderen zur Schule zu gehen. Jedenfalls bis Pierre Anthon nicht mehr zur Schule ging.
Pierre Anthon wohnte mit seinem Vater und der Kommune im Tæringvej Nr.25, einem ehemaligen Bauernhof. Pierre Anthons Vater und die Kommune waren Hippies, die in den Achtundsechzigern stecken geblieben waren. Das sagten unsere Eltern, und auch wenn wir nicht richtig wussten, was das bedeutete, sagten wir das auch. Im Vorgarten dicht an der Straße stand ein Pflaumenbaum. Der Baum war groß und alt und krumm und neigte sich über die Hecke und lockte mit bereift-staubigen Victoria-Pflaumen, die für uns unerreichbar waren. In vergangenen Jahren waren wir hochgesprungen, um sie zu erwischen. Damit hörten wir auf. Pierre Anthon war von der Schule abgegangen, um im Pflaumenbaum zu sitzen und mit unreifen Pflaumen zu werfen. Manche trafen uns. Nicht, weil Pierre Anthon auf uns zielte, das sei die Mühe nicht wert, beteuerte er. Der Zufall wolle es halt so.
Und er rief hinter uns her.
»Alles ist egal«, schrie er eines Tages. »Denn alles fängt nur an, um aufzuhören. In demselben Moment, in dem ihr geboren werdet, fangt ihr an zu sterben. Und so ist es mit allem.«
»Die Erde ist vier Milliarden sechshundert Millionen Jahre alt, aber ihr werdet höchstens hundert!«, rief er an einem anderen Tag. »Das Leben ist die Mühe überhaupt nicht wert.«
Und er fuhr fort:
»Das Ganze ist nichts weiter als ein Spiel, das nur darauf hinausläuft, so zu tun als ob – und eben genau dabei der Beste zu sein.«
Es hatte übrigens bisher nichts darauf hingedeutet, dass Pierre Anthon der klügste von uns war, aber plötzlich wussten wir es alle. Denn irgendetwas hatte er begriffen. Auch wenn wir uns nicht trauten, das zuzugeben. Weder unseren Eltern noch den Lehrern oder den anderen gegenüber. Nicht einmal uns selbst gegenüber. Wir wollten nicht in der Welt leben, von der uns Pierre Anthon erzählte. Aus uns sollte etwas werden, wir wollten jemand werden.
Die lächelnde Tür nach draußen lockte uns nicht.
Gar nicht. Überhaupt nicht!
Deshalb kamen wir darauf. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, denn eigentlich brachte uns Pierre Anthon auf die Idee.
Es war eines Morgens, nachdem Sofie zwei harte Pflaumen unmittelbar nacheinander am Kopf getroffen hatten und sie richtig wütend auf Pierre Anthon geworden war, weil er einfach nur da oben in diesem Baum saß und uns andere entmutigte.
»Du sitzt bloß da und gaffst in die Luft. Ist das vielleicht besser?«, rief sie.
»Ich gaffe nicht in die Luft«, antwortete Pierre Anthon ruhig. »Ich schaue in den Himmel und übe mich darin, nichts zu tun.«
»Den Teufel tust du!«, schrie Sofie wütend und warf ein Stöckchen nach oben in den Pflaumenbaum zu Pierre Anthon, aber es landete in der Hecke tief unter ihm.
Pierre Anthon lachte und rief so laut, dass es bis zur Schule zu hören war:
»Wenn es etwas gibt, über das es sich lohnt sauer zu werden, gibt es auch etwas, worüber es sich lohnt sich zu freuen. Wenn es etwas gibt, über das es sich lohnt sich zu freuen, gibt es auch etwas, was etwas bedeutet. Aber das gibt es nicht!« Er hob die Stimme noch mehr und brüllte: »In wenigen Jahren seid ihr alle tot und vergessen und nichts, also könnt ihr genauso gut sofort damit anfangen, euch darin zu üben.«
Da wurde uns klar, dass wir Pierre Anthon wieder vom Pflaumenbaum herunterholen mussten.
III
Ein Pflaumenbaum hat viele Äste.
Viele lange Äste.
Viel zu viele, viel zu lange Äste.
Die Schule von Tæring war groß und rechteckig und betongrau und zwei Stockwerke hoch und an sich sehr hässlich, aber kaum einer von uns hatte Zeit, darüber nachzudenken, und nun schon gar nicht, wo wir unsere ganze Zeit brauchten, um nicht über das nachzudenken, was Pierre Anthon sagte.
Genau an diesem Dienstagmorgen, acht Tage nach Beginn des neuen Schuljahrs, war es allerdings so, als träfe uns die Hässlichkeit der Schule wie eine Handvoll der bitteren Pflaumen Pierre Anthons auf einmal.
Ich ging zusammen mit Jan-Johan und Sofie durch das Tor auf den Schulhof. Gleich nach uns kamen Marie-Ursula und Gerda, und als wir um die Ecke bogen und das Gebäude sahen, verstummten wir. Es lässt sich nicht erklären, aber es war geradeso, als hätte uns Pierre Anthon dazu gebracht, es zu sehen. Als hätte uns das Nichts, das er uns oben aus dem Pflaumenbaum hinterherrief, auf dem Weg überholt und wäre zuerst angekommen.
Die Schule war so grau und hässlich und eckig, dass es mir fast den Atem verschlug, und es war plötzlich so, als wäre die Schule das Leben, und so sollte das Leben doch nicht aussehen, aber das tat es trotzdem. Mich packte ein unbändiger Drang, zum Tæringvej 25 zu laufen und zu Pierre Anthon in den Pflaumenbaum zu klettern und in den Himmel zu schauen, bis ich ein Teil von draußen und nichts geworden wäre und nie mehr über etwas nachdenken müsste. Aber aus mir sollte ja etwas und jemand werden, deshalb lief ich nirgendwohin, schaute bloß in die andere Richtung, ballte die Faust und presste die Nägel so fest in die Handfläche, bis es richtig wehtat.
Lächelnde Tür. Mach auf. Mach zu!
Ich war nicht die Einzige, die hörte, dass das Draußen rief.
»Wir müssen etwas unternehmen«, flüsterte Jan-Johan leise, so dass es die aus der Parallelklasse, die ein Stück vor uns gingen, nicht hören konnten. Jan-Johan spielte Gitarre und sang Songs der Beatles, dass man den Unterschied zwischen ihm und den echten fast gar nicht hörte.
»Ja«, flüsterte Marie-Ursula, die ich in Verdacht hatte, auf Jan-Johan zu stehen, und Gerda kicherte auch sofort und stieß einen Ellbogen seitwärts in die Luft, weil Marie-Ursula in der Zwischenzeit einen Schritt weitergegangen war.
»Aber was?«, flüsterte ich und lief los, denn inzwischen waren uns die aus der Parallelklasse bedenklich nahe gekommen, und unter ihnen waren ein paar Spaßvögel, die mit Gummis und trockenen Erbsen nach den Mädchen schossen, sobald sich eine Gelegenheit ergab, und es sah fast so aus, als könnte sich die Gelegenheit sehr schnell ergeben.
Jan-Johan schickte in der Mathestunde einen Zettel herum, und unsere Klasse traf sich nach der Schule unten am Fußballplatz. Alle außer Henrik waren da, denn Henrik war der Sohn unseres Biologielehrers, und wir durften nichts riskieren.
Es kam mir sehr lange vor, wie wir erst mal nur dort standen und über anderes redeten und so taten, als würden wir nicht alle ein und dasselbe denken. Aber schließlich richtete sich Jan-Johan auf und sagte fast feierlich, dass wir alle mal gut zuhören sollten.
»So kann es nicht weitergehen«, begann er seine Rede, und so beendete er sie auch, nachdem er kurz das gesagt hatte, was wir alle wussten, nämlich dass wir nicht immer weiter so tun konnten, als hätte etwas etwas zu bedeuten, wenn doch Pierre Anthon oben im Pflaumenbaum saß und uns zurief, dass nichts etwas zu bedeuten habe.
Wir waren gerade in die siebte Klasse gekommen, und wir fühlten uns alle so modern und kannten uns im Leben und in der Welt aus, und wir wussten natürlich längst, dass sich alles mehr darum drehte, wie etwas aussah, als wie es tatsächlich war. Unter allen Umständen war am wichtigsten, dass aus einem etwas wurde, das nach etwas aussah. Zwar hatten wir von diesem Etwas nur ungenaue Vorstellungen, aber es ging jedenfalls nicht darum, in einem Pflaumenbaum zu sitzen und Pflaumen auf die Straße zu werfen.
Pierre Anthon sollte nicht glauben, er könne uns anderen das weismachen.
»Sobald es Winter wird, kommt er schon runter«, sagte die hübsche Rosa.
Das half nicht so viel.
Denn erstens stand die Sonne am Himmel und verhieß uns noch einige Monate bis zum Winter. Und zweitens gab es keinen Grund, warum Pierre Anthon im Winter nicht auf dem Pflaumenbaum sitzen sollte, selbst wenn keine Pflaumen mehr da waren. Er konnte sich doch einfach dicker anziehen.
»Dann müsst ihr ihn verprügeln.« Ich schaute die Jungen an, denn die Hauptsache blieb natürlich an ihnen hängen, auch wenn wir Mädchen ihm ein paar Kratzer zufügen konnten.
Die Jungen sahen sich an.
Sie fanden die Idee nicht gut. Pierre Anthon war breit und kräftig und hatte eine Menge Sommersprossen auf der Nase, die einmal gebrochen war, als er in die Fünfte ging und mit seinem Kopf gegen den Kopf von einem aus der neunten Klasse in der Stadt schlug. Trotz der gebrochenen Nase hatte Pierre Anthon den Kampf gewonnen. Der Junge aus der Neunten war mit einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gekommen.
»Sich prügeln ist eine schlechte Idee«, sagte Jan-Johan und die anderen Jungen nickten, und dann wurde darüber nicht weiter geredet, auch wenn wir Mädchen wegen dieser Sache ein bisschen die Achtung vor ihnen verloren.
»Wir müssen zu Gott beten«, sagte der fromme Kai, dessen Vater zur Inneren Mission gehörte und dort irgendetwas Höheres war und die Mutter sicher auch.
»Halt die Klappe«, zischte Ole und kniff den frommen Kai, bis der fromme Kai nicht mehr die Klappe halten konnte, sondern quiekte wie ein Schwein beim Schlachter und wir anderen Ole dazu bringen mussten, aufzuhören, damit das Quieken nicht den Hausmeister auf den Plan rief.
»Wir können uns auch über ihn beschweren«, schlug die kleine Ingrid vor, die so klein war, dass uns nicht immer klar war, dass sie da war. Aber heute war es uns klar, und wir antworteten wie aus einem Munde:
»Bei wem?«
»Bei Eskildsen.« Die kleine Ingrid bemerkte unsere ungläubigen Blicke. Eskildsen war unser Klassenlehrer, und Eskildsen trug einen schwarzen Regenmantel und eine goldene Uhr und machte sich nichts aus Problemen, egal ob sie klein oder groß waren. »Dann beim Rektor«, fuhr sie fort.
»Beim Rektor«, schnaubte Ole und hätte Klein Ingrid gekniffen, wenn sich Jan-Johan nicht schnell zwischen die beiden gestellt hätte.
»Wir können uns nicht beschweren, weder bei Eskildsen noch beim Rektor oder irgendwelchen anderen Erwachsenen, denn wenn wir uns über Pierre Anthon im Pflaumenbaum beschweren, müssen wir erzählen, warum wir uns beschweren. Und dann müssen wir erzählen, was Pierre Anthon sagt. Und das können wir nicht, denn die Erwachsenen wollen nicht hören, dass wir wissen, dass nicht wirklich etwas etwas zu bedeuten hat und dass alle nur so tun als ob.« Jan-Johan machte eine große Geste, und wir stellten uns alle die Experten und Pädagogen und Psychologen vor, die kommen und uns studieren und mit uns reden würden und uns überzeugen wollten, bis wir am Ende aufgeben und wieder so tun würden, als ob doch etwas etwas zu bedeuten habe. Jan-Johan hatte recht: Das war nur Zeitverschwendung und würde uns nicht weiterbringen.
Eine Weile sagte niemand etwas.
Ich sah mit zusammengekniffenen Augen in die Sonne und danach zu dem weißen Fußballtor ohne Netz, dann nach hinten zu der Kugelstoßanlage, den Hochsprungmatten und der Hundertmeterbahn. Eine leichte Brise fuhr durch die Buchenhecke, die sich um das gesamte Fußballfeld zog, und plötzlich war es wie in einer Sportstunde und wie jeden Tag, und ich hätte beinahe vergessen, warum Pierre Anthon vom Pflaumenbaum heruntersollte. »Meinetwegen kann er dort oben sitzen bleiben und rufen, bis er schwarz wird«, dachte ich. Ich sagte es nicht. Der Gedanke war nur in dem Augenblick wahr, als er gedacht wurde.
»Lasst uns Steine nach ihm werfen«, schlug Ole vor, und darauf folgte eine längere Diskussion, woher wir die Steine bekommen und wie groß sie sein sollten und wer werfen sollte, denn die Idee an sich war gut.
Gut. Besser. Am besten.
Wir hatten sonst keine.
IV
Ein Stein. Zwei Steine. Viele Steine.
Sie lagen im Zeitungswagen des frommen Kai, den er sonst immer benutzte, um dienstagnachmittags die lokale Zeitung und am ersten Mittwoch im Monat das Kirchenblatt auszufahren. Wir hatten sie unten am Fluss geholt, denn dort waren sie groß und rund, und der Wagen war so schwer wie ein totes Pferd.
Wir warfen alle.
»Zwei für jeden, mindestens«, kommandierte Jan-Johan.
Ole achtete darauf, dass sich niemand drückte. Sogar Henrik der Kriecher war dabei und warf seine beiden, die den Pflaumenbaum nicht mal annähernd erreichten. Die von Maike und Sofie kamen ihm schon etwas näher.
»Fürchtet ihr euch etwa vor dem Nichts?«, rief Pierre Anthon und sah Marie-Ursulas Stein nach, der kläglich in der Hecke landete.
»Du sitzt da oben, weil dein Vater in den Achtundsechzigern feststeckt!«, rief der große Hans und warf einen Stein. Der traf eine Pflaume, dass das Fruchtfleisch spritzte.
Wir johlten laut.
Auch ich, obwohl ich ganz genau wusste, dass weder das eine noch das andere stimmte. Pierre Anthons Vater und die Kommune bauten ökologisches Gemüse an und kümmerten sich um exotische Religionen und waren empfänglich für Geister, alternative Behandlungen und andere Menschen. Aber das war nicht der Grund, weshalb es nicht stimmte. Es stimmte deshalb nicht, weil Pierre Anthons Vater einen Bürstenhaarschnitt hatte und in einer Computerfirma arbeitete. Und das war sehr modern und hatte weder mit Achtundsechzig noch mit Pierre Anthon etwas zu tun.




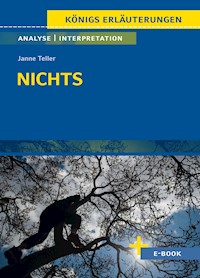














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









