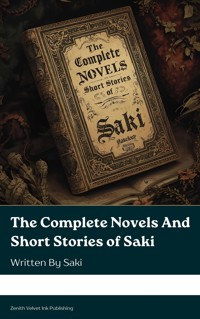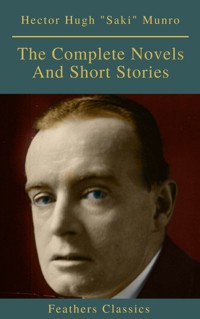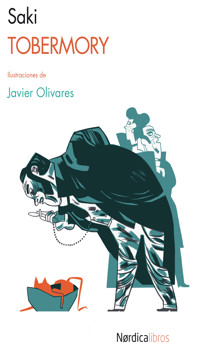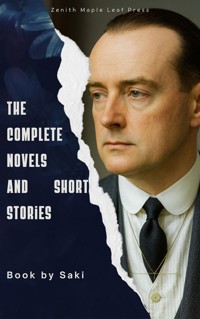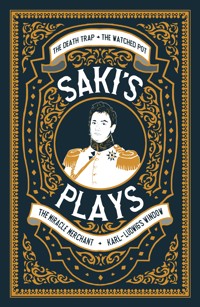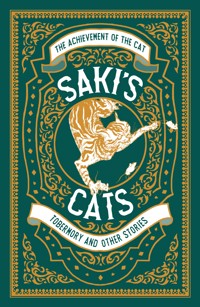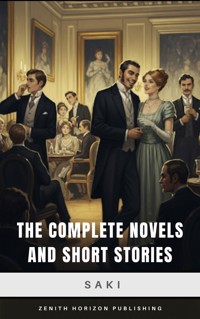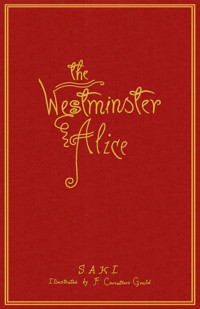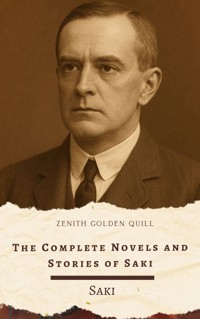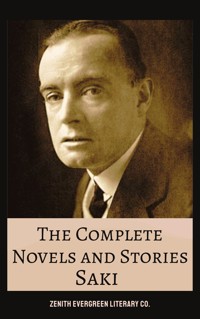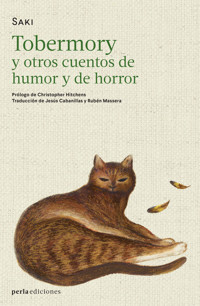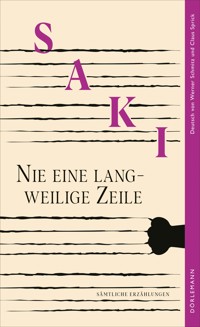
33,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dörlemann eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Frau, die mit einer Hauslehrerin verwechselt wird und den Irrtum erst nach mehreren Tagen Unterricht aufklärt, ein Junge, der sich als Werwolf erweist, eine sprechende Katze namens Tobermory und der Erfinder der sagenhaften Unruhekur sind nur einige der unvergesslichen Figuren, die Sakis Erzählungen bevölkern. Sie alle haben gemeinsam, dass nichts darin so ist, wie es zunächst scheint – und dass einem beim Lesen bisweilen das Lachen im Halse steckenbleibt. In seinen satirischen und bisweilen auch makabren Geschichten, deren Stil mit dem Dorothy Parkers verglichen wird, nimmt Saki die bessere Gesellschaft Großbritanniens brillant aufs Korn. Ein ebenso köstliches wie hinterhältiges Lesevergnügen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1087
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Saki
Nie eine langweilige Zeile
Sämtliche Erzählungen
Aus dem Englischen von Werner Schmitz und Claus Sprick
Dörlemann
Inhalt
Reginald und die Blutfehde von Toad-Water
Reginald
Reginald über Weihnachtsgeschenke
Reginald über die Kunstausstellung
Reginald im Theater
Reginalds Friedensgedicht
Reginalds Kirchenchorveranstaltung
Reginald über Sorgen
Reginald über Einladungen
Reginald im Carlton
Die Frau, die die Wahrheit sagte: Reginald über Gewohnheitssünden
Reginalds Theaterstück
Reginald über Zölle
Reginalds weihnachtliche Lustbarkeit
Reginalds Unschuld
Reginald in Russland
Die Wortkargheit der Lady Anne
Der verlorene Sandschak
Das Geschlecht, das nicht einkauft
Ein Epos aus dem West County: Die Blutfehde von Toad-Water
In zwei Szenen: Das jung-türkische Verhängnis
Judkin mit den Paketen
Gabriel-Ernest
Der Heilige und der Kobold
Die Seele des Laploshka
Die Tasche
Der Stratege
Gegenströme
Das Bäckerdutzend
Die Maus
Die Clovis-Chroniken
Esmé
Der Kuppler
Tobermory
Mrs Packletides Tiger
Lady Bastable nimmt Reißaus
Die Kehrseite
Hermann der Reizbare – eine Geschichte vom Großen Wehgeschrei
Die Unruhekur
Arlington Stringham scherzt
Sredni Vashtar
Adrian oder Wie man sich einlebt
Der Kranz
Die Suche
Wratislav
Das Osterei
Filboid Studge oder Wie die Maus dem Löwen half
Die Musik auf dem Hügel
Die Geschichte von St. Vespaluus
Der Weg in die Milchkammer
Das Versöhnungsspektakel
Der Friede von Mowsle Barton
Tarrington läuft auf
Die Meute des Schicksals
Der Abgesang
Eine Sache des Gespürs
Die heimliche Sünde des Septimus Brope
Engelland oder Minister von hohen Gnaden
Groby Lingtons Metamorphosen »Einen Mann erkennt man an dem Umgang, den er pflegt«
Biest und Überbiest
Die Wölfin
Laura
Der Eber
Amor
Das Huhn
Die offene Tür
Das Schatzschiff
Das Spinnennetz
Die Verschnaufpause
Der schwerste Schlag
Die Flunkerer
Die Schartz-Metterklume-Methode
Das siebte Küken
Der wunde Punkt
Im Zwielicht
Ein Hauch von Realismus
Base Theresa
Die Yarkand-Manier
Das Byzantinische Omelett
Der Nemesis-Tag
Der Träumer
Der Quittenbaum
Die verbotenen Bussarde
Der Einsatz
Clovis über Kinderstube
Eine Freizeitbeschäftigung
Der gemästete Ochse
Der Geschichtenerzähler
Ein harter Brocken
Der Elch
Ein Federstreik
Der Namenstag
Die Rumpelkammer
Der Pelz
Die Wohltäterin und der zufriedene Kater
Zur Ansicht
Das Friedens-Spielzeug und Das eckige Ei
Das Friedens-Spielzeug
Louise
Tee
Das Verschwinden der Crispina Umberleigh
Die Wölfe von Cernogratz
Louis
Die Gäste
Die Buße
Der Geister-Lunch
Pleite mit Butterbrot
Berties Heiligabend
Vorgewarnt
Die Eindringlinge
Wachtel-Saat
Canossa
Die Drohung
Ausgenommen Mrs Pentherby
Mark
Das Stachelschwein
Im Gehege
Schicksal
Der Bulle
Morlvera
Die Schocktherapie
Die sieben Sahnekännchen
Der Garten der Gelegenheit
Das Schaf
Das Versehen
Hyacinth
Das Bildnis der Verlorenen Seele
Der Purpur der Balkankönige
Der Schrank des Vorgestern
Das eckige Ei (Blick aus der Dachsperspektive auf den Kriegsschlamm in den Schützengräben)
Vögel an der Westfront
Eine unbekannte Episode aus der römischen Geschichte: Das Gala-Programm
Das Höllenparlament
Die Leistung der Katze
Die alte Stadt Pskow
Clovis über die angebliche Romantik des Geschäftslebens
Moung Kas Kommentare
Der Almanach
Der Teich
Der Almanach
Ein Volltreffer
Die Lösung eines unlösbaren Dilemmas: Unter einem Dach
Ein Notopfer
Der heilige Krieg
Editorische Notiz
Über Saki
Über die Übersetzer
Reginald und die Blutfehde von Toad-Water
Deutsch von Werner Schmitz
Reginald
Eigentlich hätte ich es mir denken können. Ich habe Reginald zum Besuch der Gartenparty der McKillops überredet, gegen seinen Willen.
Wir alle begehen mitunter einen Fehler. »Die wissen, dass Sie hier sind, und werden es reichlich seltsam finden, wenn Sie nicht kommen. Und eben jetzt will ich es mir gerade bei Mrs McKillop nicht verderben.«
»Ich weiß, Sie sind auf eins ihrer Perserkätzchen aus als potenzielle Gattin für Wumples – oder Gatte?« (Reginald hegt eine kolossale Geringschätzung für Einzelheiten, die nicht seine eigene Kleidsamkeit betreffen.) »Und ich soll mich gesellschaftlichem Martyrium unterziehen, zur Begünstigung des Ehestands –«
»Reginald! Nichts dergleichen, ich bin nur sicher, dass Mrs McKillop sich freuen würde, wenn ich Sie mitbrächte. Junge Männer mit Ihren brillanten Reizen haben bei solchen Gartenpartys Seltenheitswert.«
»Im Himmel hoffentlich auch«, bemerkte Reginald gefällig.
»Von Ihrer Sorte werden nur sehr wenige dort sein, falls Sie das meinen. Aber im Ernst, Ihre Geduld wird keiner allzu großen Belastung ausgesetzt sein; ich verspreche Ihnen, Sie werden weder Krocket spielen noch mit der Frau des Erzdiakons sprechen noch sonst irgendetwas tun müssen, das Sie strapazieren könnte. Sie brauchen nur Ihre feinsten Kleider und eine gelind freundliche Miene zu tragen, und mit dem Appetit eines blasierten Papageis Schokoladencreme zu essen. Mehr wird von Ihnen nicht verlangt.«
Reginald schloss die Augen. »Da werden mich zermürbend modebewusste junge Damen fragen, ob ich San Toy schon gesehen habe; die weniger fortschrittlich Veranlagten werden vom Diamond Jubilee – dem historischen Ereignis, nicht dem Pferd – zu hören begehren. Mit ein wenig Aufmunterung werden sie sich erkundigen, ob ich die Alliierten in Paris habe einmarschieren sehen. Warum sind Frauen so darauf versessen, die Vergangenheit aufzurühren? Sie sind so verdrießlich wie Schneider, die sich unweigerlich daran erinnern, wie viel man ihnen für einen Anzug schuldet, den man längst nicht mehr trägt.«
»Ich werde den Lunch für ein Uhr bestellen; so haben Sie zweieinhalb Stunden Zeit für Ihre Toilette.«
Reginald zog die Stirn in gequälte Falten, und ich wusste, dass ich mich durchgesetzt hatte. Er sann darüber nach, welche Krawatte am besten zu welcher Weste passen würde.
Selbst dann hatte ich noch meine Bedenken.
Während der Fahrt zu den McKillops war Reginald von einem tiefen Frieden erfüllt, was nicht völlig dadurch zu erklären war, dass er seine Füße in Schuhe gezwängt hatte, die ihm eine Nummer zu klein waren. Mir schwante Schlimmeres denn je, und nachdem ich Reginald einmal auf dem Rasen der McKillops von der Leine gelassen hatte, stellte ich ihn neben eine verführerische Platte marrons glacés und so weit entfernt wie möglich von der Frau des Archdiakons auf; indem ich mich in diplomatischen Abstand zurückzog, hörte ich mit schmerzlicher Deutlichkeit, wie ihn die älteste Mawkby-Tochter fragte, ob er San Toy schon gesehen habe.
Es kann nicht mehr als zehn Minuten später gewesen sein, ich hatte leidlich angenehm mit der Gastgeberin geplaudert, hatte versprochen, ihr Die ewige Stadt und mein Rezept für Kaninchen-Mayonnaise zu leihen, und wollte soeben ihrem dritten Perserkätzchen ein Heim in Aussicht stellen, als ich aus den Augenwinkeln bemerkte, dass Reginald nicht mehr da war, wo ich ihn zurückgelassen hatte, und die marrons glacés noch unberührt dastanden. Im gleichen Augenblick stellte ich fest, dass der alte Colonel Mendoza gerade zu seiner klassischen Geschichte ausholte, wie er einst das Golfspiel in Indien eingeführt hatte, und dass Reginald in gefährlicher Nähe stand. Es gibt Gelegenheiten, da ist Reginald Kaviar für den Colonel.
»Als ich 76 in Poona war –«
»Mein lieber Colonel«, schnurrte Reginald, »wie können Sie derartiges nur preisgeben! So sein Alter auszuplaudern! Ich würde niemals zugeben, schon 76 auf diesem Planeten geweilt zu haben.« (Auch bei seinen mutwilligsten Entgleisungen ins Wahrhaftige bekennt sich Reginald höchstens zu zweiundzwanzig.)
Der Colonel nahm die Farbe einer zur höchsten Reife gediehenen Feige an, und Reginald, der meine Bemühungen, ihn zu unterbrechen, ignoriert hatte, entglitt in einen anderen Teil des Gartens. Einige Minuten darauf fand ich ihn glücklich damit beschäftigt, dem jüngsten Rampage-Jungen die bewährte Theorie des Absinth-Mixens beizubringen, in voller Hörweite von dessen Mutter. Mrs Rampage hat in den hiesigen Abstinenzler-Kreisen eine hervorragende Stellung inne.
Sobald ich dieses nicht viel versprechende Tête-à-Tête unterbunden und Reginald an einem Platz abgestellt hatte, wo er zusehen konnte, wie die Krocketspieler ihre Fassung verloren, begab ich mich hinweg, um meine Gastgeberin zu suchen und die Verhandlungen wegen der Katze dort wieder aufzunehmen, wo sie unterbrochen worden waren. Es gelang mir nicht gleich, sie aufzuspüren, und schließlich war sie es, Mrs McKillop, die mich ausfindig machte, und ihr Gespräch drehte sich nicht um Katzen.
»Ihr Vetter diskutiert mit der Frau des Erzdiakons über Zaza; zumindest diskutiert er; sie hat ihren Wagen bestellt.«
Sie sprach mit dem trockenen Stakkato einer Person, die eine Französisch-Lektion aufsagt, und ich wusste, dass Wumples, soweit Millie McKillop den Gang der Dinge bestimmte, zu lebenslänglichem Zölibat verdammt war.
»Wenn es Ihnen recht ist«, sagte ich hastig, »dann möchten wir unseren Wagen auch bestellt haben«, und machte mich grimmig auf den Weg zum Krocketrasen.
Dort redete alles nervös und fieberhaft vom Wetter und dem Krieg in Südafrika, bis auf Reginald; er rekelte sich in einem bequemen Sessel mit dem verträumten, entrückten Gesichtsausdruck eines Vulkans, der eben ein paar Dörfer in Lava und Asche gelegt hat. Die Frau des Erzdiakons knöpfte mit einer konzentrierten, schrecklich anzusehenden Absichtlichkeit ihre Handschuhe zu. Ich werde meinen Beitrag zu ihrem Fonds für Beschauliche Sonntagabende verdreifachen müssen, ehe ich meinen Fuß wieder über ihre Schwelle zu setzen wage.
Genau in diesem Augenblick schlossen die Krocketspieler ihre Partie ab, die sich ohne Anzeichen einer Beendigung über den ganzen Nachmittag hingezogen hatte. Warum, frage ich, musste sie ausgerechnet dann abgebrochen werden, als etwas Ablenkendes so unbedingt erforderlich war? Jedermann schien dem Gebiet der Turbulenz zuzustreben, deren Mittelpunkt von den Stühlen der Frau des Erzdiakons und Reginalds gebildet wurde. Die Unterhaltung erstarb, und über die Gesellschaft senkte sich jenes erwartungsvolle Schweigen, das der Morgendämmerung vorauszugehen pflegt – falls Ihre Nachbarn nicht zufällig Geflügel halten.
»Was kann das Kaspische Meer?«, fragte Reginald mit erschreckender Plötzlichkeit.
Vorboten einer Panik machten sich bemerkbar. Die Frau des Erzdiakons blickte mich an. Kipling oder sonst jemand beschreibt den Blick, mit dem ein gestrandetes Kamel der Karawane nachschaut, die weiterzieht und es seinem Schicksal überlässt. Der wiederkäuerische Vorwurf im Blick der guten Lady brachte mir die Stelle anschaulich in Erinnerung.
Ich spielte meine letzte Karte.
»Reginald, es wird spät, und vom Meer zieht Nebel auf.« Ich wusste, dass die kunstvolle Locke über seiner rechten Augenbraue nicht beschaffen war, einen Meeresnebel zu überstehen.
»Nie, nie wieder werde ich Sie zu einer Gartenparty mitnehmen. Nie wieder … Sie haben sich abscheulich aufgeführt … Was kann das Kaspische mehr?«
Ein Schatten echten Bedauerns über schlecht genutzte Gelegenheiten zog über Reginalds Gesicht.
»Jedenfalls glaube ich«, sagte er, »hätte eine aprikosenfarbene Krawatte besser zu der lila Weste gepasst.«
Reginald über Weihnachtsgeschenke
Eines wünsche ich eindeutig klarzustellen (sagte Reginald): Ich möchte zu Weihnachten kein »George, Prince of Wales«-Gebetbuch geschenkt bekommen. Diese Tatsache kann sich gar nicht weit genug herumsprechen.
Die Wissenschaft vom Schenken (fuhr er fort) sollte in eigenen Lehrgängen unterrichtet werden. Niemand scheint die leiseste Ahnung zu haben, wessen ein anderer bedürftig ist, und die auf diesem Gebiet grassierenden Vorstellungen sind eines zivilisierten Gemeinwesens unwürdig.
Da gibt es zum Beispiel die weibliche Verwandte vom Lande, die weiß, »dass man eine Krawatte immer brauchen kann«, und einem irgendein gepünkteltes Grauen schickt, das man nur heimlich oder auf der Tottenham Court Road tragen kann. Sie wäre zu etwas brauchbar gewesen, wenn sie sie behalten und damit Johannisbeersträucher zusammengebunden hätte, so wären gleich zwei Zwecke erfüllt gewesen, die Unterstützung der Zweige und das Abschrecken der Vögel – denn es ist eine ausgemachte Tatsache, dass die handelsübliche Meise über einen solideren ästhetischen Geschmack verfügt als die durchschnittliche ländliche Verwandte.
Dann wären da noch die Tanten. In geschenklicher Hinsicht ist nie mit ihnen auszukommen. Das Problem besteht darin, dass man sie niemals richtig jung zu fassen bekommt. Wenn man sie endlich zur Einsicht erzogen hat, dass man im West End keine roten Wollhandschuhe trägt, sterben sie dahin, zerstreiten sich mit der Familie oder tun etwas gleichermaßen Rücksichtsloses. Deswegen ist es um die Versorgung mit wohldressierten Tanten immer so misslich bestellt.
Par exemple meine Tante Agatha, die mir vorige Weihnachten ein Paar Handschuhe schickte und es sogar fertiggebracht hatte, eine Spielart auszuwählen, die man damals gerade trug und die dazu noch über die korrekte Anzahl von Knöpfen verfügte. Doch – sie hatten Größe Neun! Ich habe sie einem Knaben geschickt, den ich von Herzen hasse: Natürlich hat er sie nicht getragen, aber er hätte es tun können – hier kam die Bitterkeit des Todes ins Spiel. Das war mir fast so tröstlich, als wenn ich zu seinem Begräbnis weiße Blumen geschickt hätte. Natürlich habe ich meiner Tante geschrieben, genau diese Handschuhe hätten mir noch gefehlt, mein Dasein wie eine Rose aufblühen zu lassen; ich fürchte, sie hat mich für leichtfertig gehalten – sie stammt aus dem Norden, wo man in Furcht vor dem Himmel und dem Grafen von Durham lebt. (Reginald schützt eine erschöpfende Kenntnis politischer Sachverhalte vor, was ihm eine vorzügliche Entschuldigung dafür bietet, sie nicht diskutieren zu müssen.) Tanten mit einer Spur fremdländischer Herkunft sind, was das Verständnis dieser Dinge angeht, noch am befriedigendsten; aber wenn man sich seine Tante nicht aussuchen kann, tut man auf lange Sicht am klügsten daran, sich das Geschenk selbst auszusuchen und ihr die Rechnung zukommen zu lassen.
Selbst gleichgesinnte Freunde, die es eigentlich besser wissen sollten, sind auf diesem Gebiet merkwürdigen Wirrungen unterworfen. Ich sammle nun mal keine Exemplare der billigeren Ausgaben von Omar Khayyám. Die letzten vier, die ich erhielt, habe ich dem Liftboy geschenkt, und ich ergötze mich an der Vorstellung, wie er sie, mitsamt Fitzgeralds Anmerkungen, seiner betagten Mutter vorliest. Liftboys haben grundsätzlich betagte Mütter; was ihre Feinfühligkeit meiner Meinung nach so schön zutage bringen lässt.
Ich persönlich vermag nicht einzusehen, was an der Wahl passender Geschenke so schwierig ist. Niemand, der sich selbst anständig erzogen hat, wird eine jener dekorativen Likörflaschen nicht zu würdigen wissen, die in Morels Schaufenster so ehrfurchtsvoll inszeniert worden sind – und auch gegen Duplikate hätte niemand etwas einzuwenden. Und immer dieser exquisite Augenblick entsetzlicher Spannung, ob nun crème de menthe oder Chartreuse darin wäre! – wie das erwartungsvolle Zittern, bevor Ihr Partner beim Bridge seine Karten aufdeckt. Die Leute mögen über den Verfall des Christentums sagen, was sie wollen; eine Religion, die den grünen Chartreuse hervorgebracht hat, kann nie wirklich untergehen.
Und dann kommen natürlich noch Likörgläser in Betracht, und kandierte Früchte und Tapisserien und massenhaft andere Lebensnotwendigkeiten, die vernünftige Geschenke abgeben – ganz zu schweigen von Luxusartikeln wie seine Rechnung bezahlt zu bekommen, oder irgendetwas Hübsches mit Juwelen. Im Gegensatz zu der angeblich Tüchtigen Frau in der Bibel bin ich nicht edler als die köstlichsten Perlen. Die muss übrigens, als man sie gefunden hatte, zur Weihnachtszeit ein ziemliches Problem dargestellt haben; nichts unter einem Blankoscheck wäre der Situation angemessen gewesen. Vielleicht ist es doch besser, dass sie ausgestorben ist.
Was an mir so reizvoll ist (schloss Reginald), ist, dass ich so leicht zufriedenzustellen bin. Aber bei einem »Prince of Wales«-Gebetbuch mache ich nicht mehr mit.
Reginald über die Kunstausstellung
»Die Akademie besucht man aus Notwehr«, sagte Reginald. »Dies ist das Einzige, was man mit den Vettern vom Lande gemeinsam hat.«
»Bei denen ist das nahezu ein religiöses Brauchtum«, sagte der andere. »Eine Art künstlerisches Mekka; und wenn die Guten sterben, gehen sie –«
»Zur Votivmesse. Rätselhaft ist, woher die auf dem Lande den Gesprächsstoff nehmen.«
»Auf dem Lande gibt es zwei Gesprächsthemen: Dienstboten, und: Lässt sich Geflügel rentabel halten? Das erste ist, glaube ich, obligatorisch, das zweite freigestellt.«
»Als Ereignis«, fasste Reginald zusammen, »ist die Akademie ein Missgriff.«
»Sie meinen, ohne die Bilder wäre sie erträglich?«
»Die Bilder sind auf ihre Weise schon in Ordnung; schließlich kann man sie immer anschauen, wenn einen die Umgebung langweilt oder man einer drohenden Bekanntschaft aus dem Wege gehen will.«
»Auch das ist nicht immer die Rettung. Da ist etwa das unvermeidliche Frauenzimmer, dem man einmal in Devonshire oder in den Matoppo Hills oder sonst wo vorgestellt worden ist: Sie stürmt auf einen zu mit dem Ausruf, wie komisch es doch ist, dass man in der Kunstausstellung stets auf Bekannte stößt. Ich persönlich finde das nicht komisch.«
»Dergleichen ist mir gerade erst widerfahren«, sagte Reginald missmutig, »und zwar von einer Frau, deren Beteuerung ich hinnehmen muss, dass sie mich vorigen Sommer in der Bretagne kennengelernt hat.«
»Hoffentlich sind Sie nicht zu brüsk geworden?«
»Ich habe ihr lediglich mit reizender Schlichtheit erklärt, die Kunst des Lebens bestünde im Umgehen des Unerreichbaren.«
»Hat sie versucht, das auf dem Umschlag ihres Katalogs auszuarbeiten?«
»Nicht auf der Stelle. Sie murmelte etwas von ›geistreich‹. Man stelle sich vor, die Akademie besuchen, um geistreich zu sein!«
»Am Nachmittag geistreich sein deutet darauf hin, dass man noch keine Einladung zum Abendessen hat.«
»Was mich daran erinnert, dass ich nicht mehr weiß, ob ich die Ihre für heute Abend bei Kettner’s angenommen habe.«
»Andererseits kann ich mich mit verblüffender Deutlichkeit daran erinnern, Sie nicht eingeladen zu haben.«
»Ein solches Maß an Gewissheit ist in der Jugend unschicklich; betrachten wir das also als erledigt. Wovon sprachen Sie noch? Ach, von Bildern. Ich persönlich halte ziemlich viel davon; sie sind so erfrischend wirklich und wahrscheinlich und lenken von den Unwirklichkeiten des Lebens ab.«
»Hin und wieder entflieht man sich gerne selbst.«
»Darin besteht der Nachteil eines Porträts; in der Regel können auch die verbittertsten Freunde nicht mehr verlangen als die treue Unähnlichkeit, mit der man der Nachwelt ausgeliefert wird. Ich hasse die Nachwelt – sie ist so versessen darauf, das letzte Wort zu behalten. Natürlich gibt es bei Porträts Ausnahmen.«
»Zum Beispiel?«
»Zu sterben, bevor man von Sargent gemalt worden ist, bedeutet einen verfrühten Einzug in den Himmel.«
»Mit der nötigen Umsicht und Auflehnung kann man diese Katastrophe vermeiden.«
»Wenn Sie grob werden«, sagte Reginald, »werde ich morgen auch noch mit Ihnen dinieren. Die größte Unsitte der Akademie«, fuhr er fort, »ist ihre Nomenklatur. Warum etwa sollte ein unzweideutiger Forellenbach mit einem handgreiflichen Kaninchen im Vordergrund ›Abendtraum ungetrübten Friedens‹ genannt werden, oder Ähnliches dieser Art?«
»Sie meinen«, sagte der andere, »ein Titel sollte eher die Beschreibung ersparen als die Fantasie anregen?«
»Im Grunde sollte er beides. Zum Beispiel meine Katze zu Hause; ich habe sie Derry getauft.«
»Das ruft in meiner Fantasie nichts anderes wach als langwierige Belagerungen und religiöse Feindseligkeiten. Natürlich kenne ich Ihre Katze nicht –«
»Ach, Sie sind albern. Das ist ein feiner Name, und sie reagiert darauf – falls sie Lust hat. Und wenn es nächtens irgendwelche unziemlichen Geräusche gibt, lassen sie sich bündig erklären: Derry und Tom.«
»Die Reklame könnten Sie beinahe in Rechnung stellen. Aber auf Bilder angewandt – meinen Sie nicht, Ihr System wäre, etwa für die Vettern vom Lande, ein wenig zu subtil?«
»Jede Neuerung fordert ihre Opfer. Man darf nicht erwarten, dass das gemästete Kalb die Begeisterung der Engel über die Rückkehr des Verlorenen Sohnes teilt. Eine weitere Lieblingsschwäche der Akademie besteht darin, dass keine ihrer Leuchten über Nacht ›ankommen‹ muss. Man kann sie jahrelang heraufziehen sehen, wie eine Balkankrise oder einen Straßenausbau, und wenn sie erst einmal ein rundes Tausend Quadratyards Leinwand bepinselt haben, wird ihr Werk allmählich anerkannt.«
»Jemand, Der Keine Widerrede Duldet, hat einmal gesagt, wer mit Dreißig noch nicht zu Erfolg gekommen sei, schaffe es nie.«
»Dreißig zu werden«, sagte Reginald, »bedeutet, im Leben versagt zu haben.«
Reginald im Theater
»Jedenfalls«, sagte die Herzogin vage, »gibt es gewisse Dinge, von denen man sich nicht losmachen kann. Recht und Unrecht, gutes Benehmen und moralische Geradheit besitzen klare, wohldefinierte Grenzen.«
»Diese allerdings«, erwiderte Reginald, »besitzt auch das Russische Reich. Der Haken ist nur, dass die Grenzen nicht immer an derselben Stelle bleiben.«
Reginald und die Herzogin betrachteten einander mit gegenseitigem, von einem wissenschaftlichen Interesse gemäßigten Argwohn. Reginald war der Meinung, die Herzogin habe noch viel zu lernen; besonders, nicht aus dem Carlton zu stürmen, als fürchte sie den letzten Bus zu verpassen. Eine Frau, sagte er, die keinen Wert auf ihr äußeres Abtreten legt, ist imstande, vor dem Goodwood-Rennen aus der Stadt zu gehen und zum falschen Zeitpunkt an einer unmodischen Krankheit zu sterben.
Die Herzogin dachte, Reginald habe die Grenzen des sittlichen Anstands, welchen die Umstände erforderten, nicht überschritten.
»Natürlich«, fuhr sie streitbar fort, »neigt die heute vorherrschende Mode dazu, an ewigen Wechsel und Veränderlichkeit und all dergleichen zu glauben und zu behaupten, wir alle seien nichts als verbesserte Ausgaben urzeitlicher Affen – Sie pflichten dieser Lehre natürlich bei?«
»Ich halte sie für entschieden voreilig; bei den meisten Leuten, die ich kenne, ist dieser Prozess bei Weitem noch nicht abgeschlossen.«
»Und gewiss sind Sie gleichermaßen religionsfeindlich eingestellt?«
»Aber durchaus nicht. Die gegenwärtige Mode ist eine römisch-katholische Gemütsverfassung mit agnostischem Bewusstsein: So verbindet man das mittelalterlich Pittoreske des einen mit den neuzeitlichen Annehmlichkeiten des anderen.«
Die Herzogin verkniff es sich, die Nase zu rümpfen. Sie zählte zu jenen Leuten, die der Kirche von England mit gönnerhafter Zuneigung zugetan sind, so als sei diese etwas, was in ihrem Küchengarten aufgewachsen wäre.
»Aber es gibt noch anderes«, fuhr sie fort, »von dem ich annehme, dass es selbst Ihnen in gewissem Grade heilig ist. Patriotismus zum Beispiel, und das Königreich, und die Verantwortung des Britischen Reichs, und Blut-ist-dicker-als-Wasser und dergleichen mehr.«
Reginald hielt sich ein paar Minuten mit der Antwort zurück, solange der Lord of Rimini die akustischen Möglichkeiten des Theaters vorübergehend für sich allein in Anspruch nahm.
»Das ist das Schlimmste an einer Tragödie«, bemerkte er, »dass man kaum sein eigenes Wort versteht. Selbstverständlich akzeptiere ich die Idee des Weltreichs und seine Verantwortung. Schließlich denke ich doch lieber in Kontinenten als sonst wo. Und eines Tages, wenn die Saison vorüber ist und Sie einmal Zeit haben, werden Sie mir die genaue Blutsbrüderschaft und all das erklären, die etwa einen Franko-Kanadier, einen sanften Hindu und einen Yorkshire-Menschen gemeinsam verbindet.«
»Ja, sicher, ›Herrschaft über Palmen und Kiefern‹«, zitierte die Herzogin hoffnungsfroh, »natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass wir alle dem großen Angelsächsischen Weltreich angehören.«
»Das seinerseits rapide zu einem Vorort Jerusalems verkommt. Ein recht liebenswürdiger Vorort, wie ich zugeben muss, und ein ganz reizendes Jerusalem. Aber doch nur ein Vorort.«
»Also wirklich, gesagt zu bekommen, man bewohne einen Vorort, wenn man in dem Bewusstsein lebt, die Wohltaten der Zivilisation über die ganze Welt auszubreiten! Philanthropie – Sie werden vermutlich sagen, dies sei bloß ein tröstlicher Wahn; und doch müssen selbst Sie zugeben, dass wir, wann immer und wo immer, wie fern und unzugänglich es auch sei, von Mangel, Elend oder Hungersnot erfahren, unverzüglich und im großzügigsten Maßstab Hilfe leisten und sie, wenn es sein muss, bis ans äußerste Ende der Welt bringen.«
Im Gefühl des endgültigen Triumphes hielt die Herzogin inne. Dieselbe Bemerkung hatte sie schon bei einem Gesellschaftsempfang angebracht und war damit außerordentlich gut angekommen.
»Ich frage mich«, sagte Reginald, »ob Sie schon jemals an einem Winterabend am Embankment entlangspaziert sind?«
»Du liebe Zeit, nein, Kind! Warum fragen Sie mich das?«
»Ich nicht; ich habe mich nur gewundert. Außerdem muss auch Ihre Philanthropie, ausgeübt in einer Welt, in der alles auf Wettbewerb gerichtet ist, sowohl über eine Soll- als auch über eine Haben-Seite verfügen. Die jungen Raben schreien nach Nahrung.«
»Und werden gefüttert.«
»Ganz recht. Was voraussetzt, dass sonst jemand als Futter dient.«
»Ach was, Sie wollen mich doch nur reizen. Sie haben so lange Nietzsche gelesen, bis Ihnen jedes Gefühl für moralische Ausgewogenheit abhandengekommen ist. Darf ich fragen, ob Sie sich überhaupt von irgendwelchen Verhaltensregeln leiten lassen?«
»Es gibt gewisse feststehende Regeln, nach denen man sich zur eigenen Bequemlichkeit richtet. Zum Beispiel: Sei niemals leichtfertig grob zu irgendeinem harmlosen graubärtigen Fremden, dem du in Kiefernwäldern oder Hotels auf dem Kontinent begegnen magst. Er entpuppt sich regelmäßig als der König von Schweden.«
»Diese Zurückhaltung muss Ihnen entsetzlich lästig sein. In meiner Jugend waren Knaben Ihres Alters noch nett und unschuldig.«
»Jetzt sind wir nur noch nett. Man muss sich heutzutage spezialisieren. Was mich an einen Mann erinnert, von dem ich in irgendeinem heiligen Buch gelesen habe: Dem wurde die Erfüllung seines größten Wunsches gewährt. Und da er nicht um Titel und um Ehren und um Würden bat, sondern nur um unermesslichen Reichtum, so fielen ihm diese anderen Dinge auch noch zu.«
»Ich bin sicher, dass Sie das nicht in einem heiligen Buch gelesen haben.«
»Doch, doch; ich glaube, es stand im Debrett.«
Reginalds Friedensgedicht
»Ich schreibe zurzeit ein Gedicht über den Frieden«, sagte Reginald nach gründlicher Durchsuchung einer Büchse gemischter Kekse, in deren Tiefen sich noch die eine oder andere Makrone versteckt haben mochte.
»Mir scheint, in dieser Richtung sind bereits Versuche unternommen worden«, sagte der andere.
»Ja, ich weiß; aber vielleicht kommt die Gelegenheit nie mehr. Im Übrigen habe ich einen neuen Füllfederhalter. Ich will gar nicht so tun, als hätte ich mich um sonderlich originelle Zeilen bemüht; wenn man über den Frieden schreibt, geht es darum, zu sagen, was alle anderen auch sagen, nur besser. Es hebt an mit der üblichen ornithologischen Stimmung:
Westwärts wandt’ die Waube ihre
Schwingen,
Hört’ Leute sich vereinigingen,
Hört’ ihr Schreien, hört’ ihr Singen –«
»Vereinigingen ist gut, aber wieso Waube?«
»Warum nicht? Alles, was sich westwärts wendet, fängt natürlicherweise mit einem W an.«
»Muss es sich denn westwärts wenden?«
»Irgendwohin muss der Vogel doch. Er kann ja nicht herumhocken und dumm dreinschauen. Danach lasse ich ein hartgeprüftes Hartebeest über das wüste Veldt galoppieren.«
»Ihnen ist natürlich bekannt, dass es in diesen Regionen so gut wie ausgestorben ist?«
»Das ist nicht meine Schuld, und es galoppiert so hübsch. Ich lasse es alle möglichen Arten unvermuteter Sehnsüchte hegen:
Mutter, darf ich lustig nach Begehr
Zum Halten bringen den Verkehr?
Sie werden freilich einwenden, in dem kahlen und sonnenversengten Veldt gebe es keinen nennenswerten Verkehr; aber mir fällt kein anderes Wort ein, das sich auf Begehr reimt.«
»Himmelsheer?«
Reginald dachte nach. »Das ginge an, aber mit Engeln habe ich später noch viel vor. Engel gehören unbedingt in ein Friedensgedicht hinein; ich weiß recht wenig über ihre Lebensweise.«
»Sie können unerwartete Dinge tun, wie das Hartebeest.«
»Sicher. Darauf wende ich mich London zu, der Stadt Schauriger Nachtstücke, die von Freudenhymnen und Dankgebeten schallt:
Und der Schläfer schlug das Aug’ auf,
Hörte jemand, der von Dolly Gray auf
Ewig wortreich Abschied nahm;
Er wälzt’ sich matt auf seinem Rollbett,
Drauf pries der Imkerchor im Falsett
Das Geißblatt, was er auch vernahm.
Dergleichen hat Longfellow zu seinen besten Zeiten nicht geschrieben.«
»Da stimme ich Ihnen zu.«
»Ich wünschte, das täten Sie nicht. Ich habe ein sanftes Gemüt, aber ich kann Zustimmung nicht ausstehen. Und das Okapi tut mir so leid.«
Reginald starrte elendiglich die Keksdose an, die jetzt nur noch eine wenig attraktive Versammlung von verschmähten Kringeln bot.
»Ich glaube«, murmelte er, »wenn ich eine Frau mit einem unbefriedigten Gelüste nach Kringeln fände, sollte ich sie heiraten.«
»Worin besteht die Tragödie mit dem Okapi?«, fragte der andere teilnehmend.
»Ach, einfach darin, dass es keinen Reim drauf gibt. Die ganze Zeit beim Anziehen habe ich darüber nachgedacht – und es ist übel, beim Anziehen nachzudenken – und während des ganzen Essens; und es geht mir noch immer nach. Ich komme mir vor wie einer dieser pechsträhnigen Automobilisten, die mitten in der meistbegangenen Straße wie motorische Versager plötzlich auf der Strecke bleiben. Ich fürchte, ich werde das Okapi herauslassen müssen, dabei hat es dem Ganzen so ein herrliches Lokalkolorit verliehen.«
»Immerhin haben Sie ja noch das hartgeprüfte Hartebeest.«
»Und einen dekorativen Beitrag zur moralischen Belehrung – wenn man den Sinn herausgewrungen hat –
Lass, Krieg, dein Schlachtgetös’
und Schwerterzücken
Und unsern Friedenskrug nur um so
werter schmücken!
Immer noch passender, als wenn sich Wärter um den Pflug scharen. Jetzt kommt noch etliches über die Segnungen des Friedens, soll ich weiterlesen?«
»Vor die Wahl gestellt, wäre es mir doch lieber, man würde mit dem Krieg fortfahren.«
Reginalds Kirchenchorveranstaltung
»Man soll nie«, schrieb Reginald an seinen teuersten Freund, »Pionier sein. Der zuerst aufgestandene Christ bekommt den fettesten Löwen.«
Reginald war, auf seine Weise, Pionier.
Niemand aus seiner übrigen Familie hatte irgendetwas Ähnliches wie tizianrotes Haar oder Sinn für Humor aufzuweisen, und man verwendete Primeln als Tischdekoration.
Daraus folgt, dass sie kein Verständnis hatten für Reginald, der stets zu spät zum Frühstück herunterkam, seinen Toast benagte und despektierliche Dinge über das Universum sagte. Die Familie aß Haferbrei und glaubte an alles, sogar an die Wettervorhersage.
Daher atmete die Familie auf, als die Tochter des Vikars Reginalds Bekehrung in die Hand nahm. Ihr Name war Amabel, es war des Vikars einzige Extravaganz. Amabel galt als eine Schönheit und intellektuell begabt; sie spielte kein Tennis und soll Maeterlincks Leben der Bienen gelesen haben. Wer sich in einem kleinen Dorf auf dem Lande des Tennisspielens enthält und Maeterlinck liest, ist notwendigerweise ein Intellektueller. Außerdem war sie zweimal in Fécamp gewesen, um einen untadeligen französischen Akzent von den dort weilenden Amerikanern zu erwerben; demzufolge besaß sie eine Kenntnis der Welt, die ihr im Umgang mit einem Weltling zustattenkommen mochte.
Und deswegen beglückwünschte sich die Familie, als Amabel die Bekehrung ihres widerspenstigen Mitglieds in die Hand nahm.
Amabel eröffnete den Feldzug, indem sie ihren arglosen Schützling zum Tee in den Pfarrhausgarten einlud; sie glaubte an den heilsamen Einfluss einer natürlichen Umgebung, da sie noch nicht in Sizilien gewesen war, wo die Dinge etwas anders liegen.
Und wie jede Frau, die je einem unbußfertigen Jüngling innere Umkehr gepredigt hat, hielt sie ihm eindringlich die Sündhaftigkeit eines eitlen Lebens vor, welches auf dem Lande, wo die Leute sich früh erheben, um nachzusehen, ob über Nacht eine neue Erdbeere stattgefunden habe, immer noch ungemein skandalöser scheint.
Reginald erinnerte an die Lilien auf dem Felde, »die einfach dasaßen und schön aussahen und jeglichen Wettbewerb verschmähten«.
»Aber das ist doch kein Beispiel, dem wir folgen sollten«, stöhnte Amabel.
»Leider können wir uns das nicht leisten. Sie ahnen ja nicht meine unendlichen Mühen, um es den Lilien in ihrer kunstvollen Schlichtheit gleichzutun.«
»Sie sind mit Ihrem Äußeren wahrhaftig unanständig eitel. Ein gutes Leben gilt unendlich viel mehr als ein gutes Aussehen.«
»Sie werden mir beipflichten, dass das eine mit dem anderen unvereinbar ist. Ich sage immer: Schönheit vergeht – aufs Angenehmste.«
Amabel dämmerte die Erkenntnis, dass das Schlachtenglück nicht immer bei den Zielstrebigen ist. Mit den urdenklichen Kriegslisten ihres Geschlechts ließ sie von dem Frontalangriff ab und schob ihre mühselige beistandslose Gemeindearbeit, ihre geistige Einsamkeit, ihre Entmutigungen in den Untergrund – und zauberte im günstigen Augenblick Erdbeeren mit Schlagsahne auf den Tisch. Von Letzteren war Reginald offensichtlich angetan, und als seine Erzieherin ihm den Vorschlag machte, das Tätige Leben durch seine unterstützende Aufsicht über die jährliche Landpartie der ländlichen Jugend zu beginnen, aus der sich der Dorfchor zusammensetzte, da leuchteten seine Augen mit der unheildrohenden Begeisterung eines Bekehrten.
Reginald verlegte sich, soweit es Amabel anging, allein auf das Tätige Leben. Auch die tugendhafteste Frau ist nicht gefeit gegen feuchtes Gras, und Amabel lag mit einer Erkältung darnieder. Reginald nannte das Vorsehung; es war der Traum seines Lebens gewesen, einmal bei einem Chorausflug Regie zu führen. Mit strategischem Weitblick lenkte er seine schüchternen, rundschädeligen Zöglinge zum nächstgelegenen Waldbach und bewilligte ihnen ein frisches Bad; er selber legte sich dann auf ihre hingestreuten Kleider und sann über ihre unmittelbare Zukunft nach, die, wie er verfügte, in einer bacchantischen Prozession durchs Dorf gipfeln sollte. In kluger Voraussicht hatte er bereits für einen Vorrat an Blechpfeifen gesorgt, die Beteiligung eines Ziegenbocks aus einem angrenzenden Obstgarten war ein begnadeter nachträglicher Einfall. Eigentlich, bemerkte Reginald, hätten noch Pantherfelle zur Ausstattung gehört; unter den Umständen durften aber alle, die getüpfelte Taschentücher mitgebracht hatten, sich diese ersatzweise umhängen, was sie auch dankbar taten. Reginald sah die Unmöglichkeit ein, seinen fröstelnden Novizen in der zu Gebote stehenden Zeit einen Preisgesang auf den Gott Bacchus beizubringen, weshalb er sie mit einer bekannteren, wenn auch weniger passenden Temperenzlerhymne auf den Weg trieb. Was zählt, sagte er, ist schließlich der Geist einer Unternehmung. Der Gepflogenheit von Dramatikern an Premierenabenden folgend, blieb er diskret im Hintergrund, während sich die Prozession reichlich verzagt mit Ach und Weh und ihrem Ziegenbock dem Dorf zuwandte. Der kümmerliche Gesang war schon lange vor dem Erreichen der Hauptstraße erstorben, doch das erbärmliche Gefiepe der Pfeifen lockte die Einwohner an ihre Haustüren. Reginald sagte aus, er habe Ähnliches schon auf Gemälden gesehen; den Dörflern hingegen war Derartiges in ihrem Leben noch nie unter die Augen gekommen, und sie ließen ihren Äußerungen freien Lauf.
Die Familie hat Reginald nie verziehen. Sie hatte eben keinen Sinn für Humor.
Reginald über Sorgen
Ich habe (sagte Reginald) eine Tante, die sich Sorgen macht. Im Grunde ist sie keine echte Tante – eher eine Art Amateurin, und es sind im Grunde keine echten Sorgen. Sie hat gesellschaftlich Erfolg und keine erwähnenswerten Tragödien in ihrem Haus, also adoptiert sie alles, was an dekorativen Kümmernissen im Schwange ist, mich eingeschlossen. Auf diese Weise ist sie die Antithese, oder wie immer das heißt, zu jenen bekanntlich feinen, niemals klagenden Frauen, denen einmal Böses zugestoßen ist und die seither Scheuklappen tragen. Natürlich hat man sie darum von Herzen gern, doch muss ich gestehen, dass sie mir Unbehagen verursachen; sie erinnern einen so an eine Ente, die mit ingrimmiger Heiterkeit noch lange umherflattert, nachdem man ihr den Kopf abgeschnitten hat. Enten haben einfach keine Ruhe. Nun, meine Tante hat eine Haarfarbe, die ihr steht, eine Köchin, die sich mit den anderen Dienstboten herumzankt, was immer ein hoffnungsvolles Zeichen ist, und ein Gewissen, das etwa elf Monate im Jahr abwesend ist und nur zur Fastenzeit auftritt, um die Verwandten ihres Gatten zu traktieren, die beträchtlich unterhalb der Engel stehen: Ausgestattet mit all diesen natürlichen Vorzügen – sie gibt ihren besonderen bronzenen Farbton als einen natürlichen Vorzug aus, und über diesen Vorzug selber kann man gar nicht geteilter Meinung sein –, muss sie sich ihre Heimsuchung freilich ins Haus liefern lassen, gleich jenen Restaurants, die über keine Konzession verfügen. Diese Methode hat den Vorteil, dass man seine Schicksalsschläge stets passend zu den anderweitigen Verpflichtungen auswählen kann, wohingegen echte Sorgen sich während der Mahlzeiten, beim Ankleiden oder in anderen feierlichen Augenblicken einzustellen belieben. Ich kannte einmal einen Kanarienvogel, der monate- und jahrelang versucht hatte, sich eine Familie auszubrüten, was von jedermann als verzeihliche Vernarrtheit angesehen wurde, wie etwa der Verkauf der Delagoa-Bai, der, würde er je abgeschlossen, die Presseagenturen teuer zu stehen käme; und eines Tages brachte es der Vogel tatsächlich zuwege, und dies mitten während des Familiengebets. Ich sage zwar mittendrin, aber es war auch das Ende: Man kann nicht weiterhin für sein tägliches Brot danken, wenn man sich fragt, womit denn eigentlich frisch geschlüpfte Kanarienvögel gefüttert werden wollen.
Gegenwärtig befindet sie sich wegen der Behandlung der Juden in Rumänien in einer ziemlich balkanischen Verfassung. Ich persönlich finde, dass die Juden schätzbare Eigenschaften besitzen; sie sind so freundlich zu ihren eigenen Armen – und zu unseren eigenen Reichen. Ich möchte meinen, in Rumänien ist es nicht sonderlich kostspielig, über seine Verhältnisse zu leben. Hier bei uns besteht das Problem, dass so viele Leute, die mit ihrem Geld um sich werfen, so vage Vorstellungen davon zu haben scheinen, wohin sie es werfen sollen. Da gibt es zum Beispiel diesen Fonds zur Unterstützung der Opfer jäher Katastrophen – was eine jähe Katastrophe ist? Nehmen wir Marion Mulciber, die sich das Bridgespielen zutraute, so wie sie sich zutraute, mit dem Fahrrad einen Berg hinunterzufahren; bei jener Gelegenheit kam sie ins Krankenhaus, und jetzt ist sie in einen Nonnenorden gegangen – hat alles verloren, was sie besaß, wissen Sie, und den Rest dem Himmel vermacht. Und doch kann man das nicht als jähes Unglück bezeichnen; das fand bereits bei der Geburt der armen lieben Marion statt. Die Ärzte haben damals behauptet, sie werde die nächsten zwei Wochen nicht überleben, und seitdem probiert sie nur noch aus, ob es nicht doch geht. Frauen sind ja so eigensinnig.
Und dann die Erziehungsfrage – nicht dass ich in dieser Richtung irgendetwas sähe, worüber man sich sorgen müsste. Meiner Ansicht nach ist Erziehung eine absurd überschätzte Angelegenheit. Zum Mindesten hat man sie in der Schule, wo doch alles getan wurde, sie einem deutlich unter die Nase zu reiben, nie sonderlich ernst genommen. Alles Wissenswerte bringt man sich doch praktisch selbst bei, und das Übrige drängt sich früher oder später von allein auf. Der Grund, warum die eigenen Vorgänger so vergleichsweise wenig wissen, liegt darin, dass sie so vieles wieder verlernen müssen, was sie vor unserer Geburt durch ihre Erziehung erworben haben. Selbstverständlich glaube ich an das Studium der Natur; wie sagte ich doch zu Lady Beauwhistle: Wenn Sie eine Lektion in behutsamer Geziertheit brauchen, beobachten Sie einfach einmal, mit welch einer kunstvollen Gleichgültigkeit eine Perserkatze einen überfüllten Salon betritt, und dann gehen Sie hin und üben das fleißig zwei Wochen lang. Wissen Sie, die Beauwhistles waren nicht in Samt und Seide geboren, sind aber auf dem besten Wege dorthin – nach dem System der Ratenzahlung: soundsoviel in bar, und den Rest, wenn man gerade Lust hat. Sie sind von Herzen gutmütig, und sie vergessen nie einen Geburtstag. Ich weiß nicht mehr, was er eigentlich war, irgendetwas in der City, wo der Patriotismus herkommt; und sie – nun ja, ihre Kleider werden in Paris geschneidert, aber sie trägt sie immer mit stark englischem Akzent. Sie ist immer aufs Gemeinwohl bedacht. Ich denke, sie muss sehr streng erzogen worden sein, sie bemüht sich so verzweifelt, die falschen Dinge korrekt auszuführen. Nicht dass das heutzutage wirklich etwas ausmacht, wie ich ihr sagte: Ich kenne einige vollkommen tugendhafte Leute, die überall willkommen sind.
Reginald über Einladungen
Der Nachteil ist, dass man seine Gastgeber und Gastgeberinnen nie richtig kennt. Man lernt ihre Foxterrier und ihre Chrysanthemen kennen und findet heraus, ob die Geschichte mit dem Laufwagen im Salon von der Leine gelassen werden kann oder, aus Angst vor öffentlichem Anstoß, jedem Mitglied der Party unter vier Augen erzählt werden muss; nur Gastgeber und Gastgeberin sind eine Art menschliches Hinterland, zu dessen Erforschung stets die Zeit fehlt.
Ich war einmal bei einem Herrn in Warwickshire zu Gast; der bestellte zwar sein eigenes Land, war aber ansonsten recht solide. Ich hätte ihm nie eine Seele zugemutet, doch nicht sehr lange darauf ist er mit der Witwe eines Löwenbändigers durchgebrannt und hat sich irgendwo am Persischen Golf als Golflehrer etabliert; natürlich furchtbar unmoralisch, da er nur ein mittelmäßiger Spieler war, aber immerhin bewies er Fantasie. Seine Frau war wirklich zu bemitleiden, weil er der einzige Mensch im Haus gewesen war, der mit den Launen der Köchin zurechtkam; und jetzt muss sie Deo volente auf ihre Dinnereinladungen schreiben. Freilich ist das noch immer besser als ein Familienskandal; eine Frau, die ihre Köchin verlässt, wird ihre gesellschaftliche Stellung nie wieder ganz zurückgewinnen.
Das mag wohl umgekehrt auch für die Gastgeber gelten; sie sind selten mit ihren Gästen mehr als oberflächlich vertraut, und gerade wenn sie einen tatsächlich ein bisschen näher kennengelernt haben, liegt ihnen an der Bekanntschaft schon nichts mehr. Ein Hauch von Winter lag in der Luft, als ich damals Abschied nahm von jenen Leuten in Devonshire. Ich war da nämlich zur Jagd eingeladen gewesen, und in dergleichen bin ich alles andere als beschlagen. Eine tödliche, öde Gleichartigkeit haftet diesen Rebhühnern an; wenn man eines verfehlt hat, hat man alle verfehlt – zumindest habe ich diese Erfahrung gemacht. Im Rauchsalon versuchten sie mich dann wegen meiner Unfähigkeit, auf fünf Yard Entfernung einen Vogel zu treffen, aufzuziehen; ihre rindsmäßige Plumpheit daran erinnerte mich an Kühe, die um eine Viehbremse herumsummen und sie damit zu reizen meinen. Also stand ich am nächsten Morgen mit der ersten Dämmerung auf – ich weiß, dass es Dämmerung war, weil Lerchengezirpe vom Himmel herunterkam und das Gras aussah, als hätte es die ganze Nacht draußen gelegen –; ich stöberte das auffälligste gefiederte Prachtstück auf, das in Reichweite vorzufinden war, maß den Abstand, so gut es der Vogel zuließ, und feuerte drauflos. Hinterher wollte man mir weismachen, der Vogel sei recht zahm gewesen; das ist schlichtweg dumm, denn nach den ersten paar Schüssen war er ganz schön wild geworden. Danach beruhigte er sich ein wenig, und als seine Beine einmal aufgehört hatten, der Landschaft Lebewohl zu winken, ließ ich ihn von einem Gärtnerburschen ins Vestibül schleppen, wo er jedermann auf dem Weg zum Frühstück in die Augen springen musste. Ich selbst hatte oben gefrühstückt. Ich vernahm später, dass das Mahl einen sehr unchristlichen Anstrich gehabt hatte. Vermutlich bringt es Unglück, wenn man Pfauenfedern in ein Haus bringt; der Blick, mit dem mich meine Gastgeberin beim Abschied bedachte, hatte jedenfalls etwas von einem Rotstift an sich.
Manche Gastgeberinnen verzeihen natürlich alles, bis hin zum Pavonizid (gibt es so ein Wort?), solange man nur adrett aussieht und hinreichend ungewöhnlich ist, um einige der anderen aufzuwiegen; und es gibt andere – zum Beispiel das Mädchen, das Meredith liest und mit unnatürlicher Pünktlichkeit zu den Mahlzeiten in einem Kleid erscheint, das in Eile verfertigt und in Muße bereut worden ist. Am Ende findet ihresgleichen den Weg nach Indien und einen Ehemann und kehrt dann wieder heim, um die Königliche Akademie zu bewundern und sich dem häuslichen Wahn hinzugeben, eine mittelmäßige Currygarnele sei jederzeit ein wirksamer Ersatz für alles, was wir als Lunch zu verehren gelernt haben. Erst dann wird sie wirklich gefährlich; aber auch im schlimmsten Fall ist sie nicht so verheerend wie die Frau, die Markt-und-Börsenfragen auf einen losfeuert, ohne den geringsten Anlass. Stellen Sie sich vor, wie ich neulich gerade alles daransetzte, meine eigenen Aussagen zu begreifen, da werde ich von einer dieser Sucherinnen nach ländlichen Binsenwahrheiten gefragt, wie viel Hühner sie in einem zehn mal sechs Fuß oder was weiß ich großen Gehege halten könne! Ich antwortete ihr Jede Menge, solange sie nur die Tür verschlossen halte, und die Idee schien sie unvorbereitet zu treffen; wenigstens hat sie bis zum Schluss der Mahlzeit darüber nachgebrütet.
Natürlich kennt man, wie gesagt, sein Terrain im Grund nie richtig, und man mag gelegentlich einen Fehler begehen. Andererseits erweisen sich manche dieser Fehler auf lange Sicht als Aktivposten: Wenn wir unsere amerikanischen Kolonien nicht so stümperhaft verspielt hätten, wären wir nie in den Genuss unseres Vetters aus den Staaten gekommen, der uns belehrt, wie wir das Haar zu tragen und unsere Kleider zuzuschneiden haben, und man muss seine Ideen schließlich von irgendwoher beziehen. Wahrscheinlich ist sogar der Rabauke eine chinesische Erfindung, Jahrhunderte bevor wir auch nur an ihn dachten. England muss erwachen, wie der Herzog von Devonshire oder sonst wer kürzlich sagte. Ah, ja, dann war es halt jemand anders. Nicht dass ich mich der Verzweiflung über die Zukunft je hingäbe; es hat schon immer Männer gegeben, die mit Verzweiflung über die Zukunft hantiert haben, und wenn die Zukunft dann eingetreten ist, geht sie hin und sagt nette, überlegene Dinge darüber, dass diese Leute auch nur ihr Bestes gegeben hätten. Entsetzliche Vorstellung, dass sich anderer Leute Enkel dereinst erheben und einen liebenswürdig nennen könnten.
Es gibt Augenblicke, da man sich in Herodes’ Lage versetzen kann.
Reginald im Carlton
»Ein höchst unbeständiges Klima«, sagte die Herzogin; »und wie beklagenswert, dass wir dieses kalte Wetter ausgerechnet zu einer Zeit haben mussten, wo die Kohle so teuer war! Wie bedrückend für die Armen!«
»Jemand hat einmal festgestellt, die Vorsehung sei stets auf der Seite der hohen Dividenden«, bemerkte Reginald.
Die Herzogin verspeiste eine Sardelle auf schockierte Weise; sie war hinreichend altmodisch, um mangelnde Hochachtung vor Dividenden zu missbilligen.
Die Wahl des Futterplatzes hatte Reginald ihrer weiblichen Intuition überlassen, den Wein aber wählte er selbst, denn er wusste, dass weibliche Intuition vor einem Claret haltmacht. Eine Frau mag frohgemut Gatten für ihre weniger attraktiven Freundinnen auswählen oder in einer politischen Kontroverse Partei ergreifen, ohne von den dazugehörigen Tatsachen die geringste Kenntnis zu haben – aber noch keine Frau hat je frohgemut einen Claret ausgewählt. »Horsd’œuvres sind für mich seit je von tragischem Reiz«, sagte Reginald: »Sie erinnern mich an die Kindheit, die man durchlebt mit der Frage, wie wohl der nächste Gang sein werde – und im weiteren Verlauf des Menüs wünscht man sich dann, man hätte mehr von der Vorspeise gegessen. Macht es Ihnen keinen Spaß zu beobachten, wie verschieden die Leute ein Restaurant betreten? Da gibt es die Frau, die hereingestürmt kommt, als würde ihr ganzer Lebensplan von einer einzigen Nadel des Despotismus zusammengehalten, die jederzeit ihren Dienst versagen könnte; man ist geradezu erleichtert, wenn man sie ihren Platz in Sicherheit erreichen sieht. Dann gibt es Leute, die mit einer Miene lästiger Pflichterfüllung hereinmarschiert kommen, als seien sie Todesengel, die in eine pestverseuchte Stadt einziehen. Diesen Typus des Briten trifft man sehr häufig in Hotels im Ausland an. Allgegenwärtig sind heutzutage die Johannes-Bourgeois, die eine Vom-Kap-bis-Kairo-Stimmung verbreiten – man könnte das vielleicht als Rand-Gebaren bezeichnen.«
»Apropos Hotels im Ausland«, sagte die Herzogin, »ich sammle zurzeit Notizen für einen Vortrag im Klub über die bildende Wirkung des modernen Reisens, worin ich mich hauptsächlich mit dem moralischen Aspekt dieses Problems beschäftige. Ich sprach neulich mit Lady Beauwhistles Tante – sie ist gerade aus Paris zurück, wissen Sie, was für eine feine Frau –«
»Und was für eine törichte. In diesen Zeiten der Über-Bildung der Frau eine erquickende Ausnahme. Man sagt, manche Leute hätten die Belagerung von Paris mitgemacht, ohne zu wissen, dass Frankreich und Deutschland gegeneinander Krieg führten; die Tante Beauwhistle hingegen soll den ganzen Winter in Paris unter dem Eindruck verbracht haben, die Humberts seien eine Fahrradmarke … Gibt es nicht einen Bischof oder so was, der glaubt, wir würden sämtlichen Tieren, die wir auf Erden kennengelernt haben, in einer anderen Welt wiederbegegnen? Welch furchtbar peinliche Vorstellung, einen ganzen Schwarm Weißfische wiederzusehen, die man zuletzt bei Prince’s vor sich gehabt hat! In meiner Verlegenheit würde ich bestimmt von nichts anderem reden als von Zitronen. Und doch möchte ich meinen, dass sie genauso beleidigt wären, wenn man sie nicht gegessen hätte. Mich jedenfalls würde es, wenn ich bei einem Kannibalenfest aufgetischt würde, schrecklich ärgern, wenn jemand an mir aussetzte, ich sei nicht zart genug oder zu lange gelagert worden.«
»Ich beabsichtige mit meinem Vortrag«, ergriff die Herzogin hastig das Wort, »die Frage aufzuwerfen, ob das promiskuitive Bereisen des Kontinents nicht zu einer Schwächung des moralischen Rückgrats des gesellschaftlichen Bewusstseins führt. Man kennt doch Leute – recht nette Leute, solange sie in England sind –, die sich schlagartig verändern, sobald sie sich irgendwo auf der anderen Seite des Kanals befinden.«
»Das sind die Leute mit den Tauchnitz-Sitten, wie ich das nenne«, bemerkte Reginald. »Im Großen und Ganzen, denke ich, bekommen sie von zwei sehr wünschenswerten Welten das Beste ab. Und außerdem berechnet man auf manchen dieser ausländischen Linien so viel fürs Zusatzgepäck, dass es wahrhaftig ein Gebot der Sparsamkeit ist, seinen Ruf gelegentlich einmal zurückzulassen.«
»Ein Skandal, mein lieber Reginald, sollte in Monaco oder sonst einem dieser Orte ebenso sehr vermieden werden wie in Exeter, zum Beispiel.«
»Skandal, meine liebe Irene – ich darf doch Irene zu Ihnen sagen?«
»Ich wüsste nicht, dass Sie mich dazu schon lange genug kennen.«
»Ich kenne Sie länger, als Ihre Paten Sie kannten, als die sich die Freiheit nahmen, Sie bei diesem Namen zu nennen. Skandal ist nichts weiter als das mitleidige Zugeständnis, das die Lebenslustigen den Langweilern machen. Überlegen Sie doch, wie viele untadelige Leben von den funkelnden Indiskretionen anderer Leute aufgehellt werden. Sagen Sie mal, wer ist denn die Frau da mit den altmodischen Spitzen am Tisch links von uns? Ach, das macht nichts: Heutzutage ist es ganz modern, Leute anzustarren, als wären sie einjährige Fohlen bei Tattersall’s.«
»Mrs Spelvexit? Eine ganz reizende Frau; von ihrem Mann getrennt –«
»Einkommensverhältnisse nicht zureichend?«
»O nein, nichts dergleichen. Durch Meilen zugefrorenen Ozeans, wollte ich fortfahren. Er erforscht Treibeis-Schollen und studiert die Wanderungen der Heringe und hat ein höchst interessantes Buch über das häusliche Leben der Eskimos geschrieben; sein eigenes häusliches Leben kommt dabei freilich arg zu kurz.«
»Ein Ehemann, der mit dem Golfstrom nach Hause kommt, wäre in der Tat ein ziemlich fest angelegter Vermögensposten.«
»Seine Frau löst das auf ungemein vernünftige Weise. Sie sammelt Briefmarken. Das ist ja so entspannend. Die Leute da bei ihr sind die Whimples, ganz alte Bekannte von mir; sind ständig in Schwierigkeiten, die armen Leutchen.«
»Schwierigkeiten gehören nicht zu jenen Grillen, die man jederzeit annehmen und aufgeben kann; damit verhält es sich wie bei einer Moorhuhn-Zucht oder beim Opiumrauchen – hat man einmal damit angefangen, muss man damit fortfahren.«
»Ihr ältester Sohn hat sie schwer enttäuscht; sie wollten, dass er Linguist würde, und gaben unendlich viel Geld für seine Sprachausbildung aus – ach, Dutzende von Sprachen! –, und dann wurde er Trappistenmönch. Und der Jüngste, der für den amerikanischen Heiratsmarkt vorgesehen war, hat politische Neigungen entwickelt und verfasst Pamphlete gegen die Wohnverhältnisse der Armen. Natürlich ist das ein durchaus wichtiges Problem, dem ich selbst an den Vormittagen einen guten Teil meiner Zeit widme; aber man sollte, wie Laura Whimple sagt, erst einmal selbst ein Dach über dem Kopf haben, bevor man über das anderer Leute agitiert. Das geht ihr bitter nahe, aber ihren fröhlichen Appetit behält sie immer, was ich doch für sehr selbstlos halte.«
»Es gibt verschiedene Arten, mit Enttäuschungen fertig zu werden. Ich kannte einmal ein Mädchen, das einen reichen Onkel mit wahrhaft christlicher Seelenstärke durch eine lange Krankheit hin pflegte. Und dann starb er und hinterließ sein Geld einem Hospital für Schweinepest-Kranke. Darauf stellte sie fest, dass sie ihren Vorrat an Seelenstärke nahezu aufgebraucht hatte; und jetzt rezitiert sie auf Salonempfängen Verse. So was nenne ich nachtragend.«
»Das Leben ist voller Enttäuschungen«, bemerkte die Herzogin, »und ich denke mir, die Kunst, glücklich zu sein, besteht darin, sie als Illusionen zu verkleiden. Aber das, mein lieber Reginald, wird mit zunehmendem Alter immer schwieriger.«
»Ich glaube, das ist viel weiter verbreitet, als Sie sich vorstellen. Die Jungen haben Hoffnungen, die sich nie erfüllen; die Alten haben Erinnerungen an Dinge, die nie geschehen sind. Nur die Leute mittleren Alters sind sich ihrer Beschränkungen wirklich bewusst – eben darum sollte man mit ihnen so nachsichtig sein. Aber das ist man nie.«
»Immerhin«, sagte die Herzogin, »mögen die Ernüchterungen des Lebens davon abhängen, wie wir es einschätzen. In den Köpfen derer, die nach uns kommen, wird man sich unserer womöglich aufgrund von Eigenschaften und Erfolgen erinnern, die wir überhaupt nicht an uns wahrgenommen haben.«
»Es ist nicht immer gefahrlos, sich auf das Erinnerungsvermögen unserer Nachfahren zu verlassen. Auch im Leben der mittelalterlichen Heiligen mag es Enttäuschungen gegeben haben, aber sie wären wohl kaum zufriedener gewesen, wenn sie hätten vorhersehen können, dass ihre Namen heutzutage hauptsächlich mit Rennpferden und billigeren Weinsorten in Verbindung gebracht werden. Und jetzt wollen wir, falls Sie sich von den Salzmandeln losreißen können, unter den Palmen, die zu unserem Unbehagen so unerlässlich sind, einen Kaffee trinken gehen.«
Die Frau, die die Wahrheit sagte: Reginald über Gewohnheitssünden
Es war einmal (erzählte Reginald) eine Frau, die die Wahrheit sagte. Natürlich nicht auf einen Schlag, sondern die Gewohnheit kam allmählich über sie wie Flechten über einen scheinbar gesunden Baum. Sie hatte keine Kinder – sonst wäre es wohl anders verlaufen. Es begann mit Kleinigkeiten, aus keinem besonderen Grund, als dass sie eben ein ziemlich leeres Leben führte und man dann leicht auf die Gewohnheit verfällt, in Kleinigkeiten die Wahrheit zu sagen. Und dann wurde es schwierig, die Grenze zu den bedeutenderen Dingen zu ziehen, bis sie sich am Ende darauf verlegte, sogar ihr Alter anzugeben; sie sagte, sie sei zweiundvierzig Jahre und fünf Monate alt – Sie sehen, damals war sie wahrhaftig bis zu den Monaten. Das mag den Engeln ein Wohlgefallen gewesen sein, aber ihre ältere Schwester war alles andere als erfreut. Zum Geburtstag der Frau schenkte ihr die Schwester anstelle der erhofften Opernkarten eine Ansicht von Jerusalem vom Ölberg aus, was nicht ganz dasselbe ist. Die Rache einer älteren Schwester mag lange auf sich warten lassen, doch wie der Süd-Ost-Express trifft sie früher oder später doch noch ein.
Die Freunde der Frau versuchten ihr die übertriebene Schwelgerei auszureden, aber sie sagte, sie sei mit der Wahrheit vermählt; worauf die Bemerkung fiel, daraus folge keine Notwendigkeit, so häufig zusammen in der Öffentlichkeit aufzutreten. (Keine wirklich vorausblickende Frau speist regelmäßig mit ihrem Gatten zu Mittag, wenn sie ihm beim Abendessen als plötzliche Offenbarung aufzutreten wünscht. Man muss ihm Zeit zum Vergessen einräumen; ein Nachmittag reicht dazu nicht aus.) Und nach einer Weile begann die Zahl ihrer Freundinnen strähnenweise dahinzuschwinden. Ihre Hingabe an die Wahrheit war mit einer gesellschaftlichen Entfaltung nicht zu vereinbaren. So sagte sie Miriam Klopstock genau, wie sie auf dem Ball der Ilexes ausgesehen habe. Sicher hatte Miriam nach ihrer aufrichtigen Meinung gefragt, aber die Frau sprach auch jeden Sonntag in der Kirche Gebete für den Frieden in unserer Zeit, und das war ja nun nicht zu vereinbaren.
Wie jedermann beipflichtete, traf es sich schlecht, dass sie keine Familie hatte; bei einem oder zwei Kindern im Haus wird eine allzu freimütige Hingabe an die Wahrheit schnell im Zaum gehalten. Kinder sind uns gegeben, uns vor besseren Wallungen Bange zu machen. Eben deshalb kann die Bühne, trotz all ihrer Bemühungen, nie so künstlich sein wie das Leben; selbst in einem Drama von Ibsen muss man dem Publikum Dinge offenbaren, die man vor Kindern oder Dienstboten verschweigen würde.
Das Schicksal mag die Wahrhaftigkeit von allem Anfang an angeordnet haben und sollte daher gerechterweise auch seinen Teil des Tadels abbekommen; durch ihre Kinderlosigkeit aber hat sich die Frau zumindest der fahrlässigen Mittäterschaft schuldig gemacht.
Nach und nach dämmerte ihr, dass sie zu einer Sklavin dessen wurde, was einmal als bloße müßige Neigung angefangen hatte; und eines Tages sah sie klar. Jede Frau erzählt ihrer Schneiderin neunzig Prozent der Wahrheit; die restlichen zehn sind das Existenzminimum an Täuschung, das keine Kundin mit noch einem Funken Selbstachtung unterschreitet. Madame Dragas Hauswesen war ein Treffpunkt nackter Wahrheiten und allzu drapierter Fiktionen, und hier kam der Frau der Einfall zu einem letzten Versuch, die arglose Verhüllung vergangener Zeiten wiederaufleben zu lassen. Madame selbst war inspirierender Laune und gebärdete sich wie eine Sphinx, die alles wusste und das meiste davon zu vergessen vorzog. Als Kriegsministerin hätte sie berühmt werden können, doch gab sie sich damit zufrieden, lediglich reich zu sein.
»Wenn ich hier etwas abnehme, und – Miss Howard, einen Moment bitte – und dorthin, und dann so im Kreis – so etwa – ich dächte doch, Sie müssten das ganz einfach finden.«
Die Frau zögerte; es schien nur so wenig Mühe zu erfordern, sich schlicht in Madames Ansichten zu fügen. Aber die Gewohnheit war übermächtig geworden. »Ich fürchte«, sagte sie schwankend, »es ist um eine winzige Haaresbreite zu –«
Und mit dieser winzigen Haaresbreite vermaß sie nun die Abgründe und Ewigkeiten ihrer Unterworfenheit unter die Tatsachen. Madame war nicht allzu erfreut über diesen Widerspruch in einer professionellen Angelegenheit, und wenn Madame die Geduld verlor, bekam man dafür später gewöhnlich die Rechnung.
Und endlich geschah das Entsetzliche, so wie es die Frau schon immer vorhergesehen hatte; es war eine jener lumpigen kleinen Wahrheiten, über die sie sich von früh bis spät zermartert hatte. An einem rauen Mittwochmorgen nannte sie die Köchin mit wenigen schlecht gesetzten Worten unverblümt eine Trinkerin. Später war ihr die Szene so lebhaft in Erinnerung, als sei sie ihr von Abbey ins Gedächtnis gemalt worden. Die Köchin war eine gute Köchin, wenn man’s recht bedenkt, und die gute Köchin, die es recht bedachte, ging.
Am nächsten Tag kam Miriam Klopstock zum Lunch. Frauen und Elefanten vergessen eine Beleidigung nie.
Reginalds Theaterstück
Reginald schloss seine Augen mit dem umständlichen Überdruss eines Mannes, der hübsche Augenlider hat und dies zu verbergen nicht für nötig hält.
»Eines Tages«, sagte er, »werde ich ein wahrhaft großes Drama schreiben. Niemand wird verstehen, worauf es hinauswill, aber alle werden nach Hause gehen mit einem vagen Gefühl der Unzufriedenheit mit ihrem Leben und ihrer Umgebung. Dann werden sie neue Tapeten aufhängen und die Sache vergessen.«
»Aber was ist mit denen, die im ganzen Haus Eichentäfelung haben?«, fragte der andere.
»Die können jederzeit neue Treppenläufer verlegen«, fuhr Reginald fort, »und überhaupt ist es nicht meine Aufgabe, das Publikum mit einem glücklichen Ende zu versehen. Das Stück würde allen ganz ordentlich an den Nerven zerren. Ich sollte einen Bischof dafür gewinnen, es für unmoralisch und prachtvoll zu erklären – daran hat noch kein Dramatiker je gedacht, und alles würde herbeiströmen, um den Bischof zu verdammen, und vor schierer Nervosität ausharren. Schließlich erfordert es eine beträchtliche Portion moralischen Mutes, mitten im zweiten Akt vor aller Augen pointiert hinauszugehen, wenn die Kutsche erst für Mitternacht bestellt ist. Anfangen würde es mit Wölfen, die in einsamer Wüste etwas zerfleischen – natürlich sähe man sie nicht; aber man würde sie knurren und nagen hören, und vielleicht sollte ich einen Hauch von Wolfsgeruch über die Rampe streichen lassen. Wie gut sich das auf dem Programm machen würde: ›Wölfe im ersten Akt, von Jamrach.‹ Und die alte Lady Whortleberry, die keine Premiere auslässt, würde kreischen. Sie ist ständig nervös, seit dem Verlust ihres ersten Mannes. Er starb ganz plötzlich als Zuschauer bei einem Grafschafts-Kricketmatch; während sieben Läufen waren zweieinhalb Zoll Regen gefallen, und man nahm an, dass die Aufregung ihn umgeworfen hatte. Jedenfalls hat sie das ziemlich hergenommen; es war ja auch der erste Ehemann, den sie verloren hatte, und jetzt kreischt sie immer, wenn irgendetwas Ergreifendes zu früh nach dem Abendessen passiert. Und hätte das Publikum einmal die Whortleberry kreischen gehört, dann käme die Sache ordentlich in Gang.«
»Und die Handlung?«
»Die Handlung«, sagte Reginald, »wäre eine dieser alltäglichen Tragödien, die man überall um sich her wahrnimmt. Mir schwebt der Fall der Mudge-Jervises vor, der unterschwellig auf seine schlichte Art eine geradezu balladenhafte Intensität besitzt. Sie waren nur rund achtzehn Monate lang verheiratet, und die Umstände hatten verhindert, dass sie einander allzu oft sehen konnten. Er hatte andauernd in verschiedenen Landesteilen Viererpartien und dergleichen zu absolvieren und Revanche zu geben, und sie verlegte sich darauf, Slums zu besuchen, und zwar mit einem solchen Ernst, als handle es sich um sportliche Betätigung. Bei ihr war es das wohl auch. Sie gehörte der Zunft der Armen Guten Seelen an, von denen als einzigartige Leistung verbürgt ist, dass sie beinahe einmal eine Waschfrau reformiert hätten. Wirklich reformiert hat noch niemand je eine Waschfrau, weshalb der Wettbewerb auf diesem Gebiet so hart geführt wird. Putzfrauen lassen sich mit ein wenig Tee und persönlicher Anziehungskraft schockweise bekehren, aber bei Waschfrauen sieht das anders aus; die Löhne sind zu hoch. Diese spezielle Wäscherin, sie stammte aus Bermondsey oder so einem Ort, war in der Tat ein ziemlich verheißungsvolles Unterfangen, und am Ende glaubte man, sie ohne Gefahr als ein Exempel für erfolgreiches Wirken vorführen zu können. Also präsentierte man sie bei einem Salonempfang bei Agatha Camelford; es war schieres Pech, dass unter die Erfrischungen versehentlich ein paar Likörpralinen geraten waren – echte Likörpralinen mit sehr wenig Schokolade drum herum. Und selbstverständlich hat sie das alte Haus aufgespürt und sich den gesamten Vorrat gesichert. Es war, als habe sie mitten in der Wüste eine Muschelbude gefunden, wie sie hinterher bekannte. Als die Liköre zu wirken anfingen, begann sie Imitationen von bäuerlichen Nutztieren, wie sie in Bermondsey bekannt sind, anzustimmen. Den Anfang machte sie mit einem tanzenden Bären, und Sie wissen, Agatha hat etwas gegen das Tanzen, falls es nicht im Buckingham-Palast unter angemessener Aufsicht stattfindet. Und dann bestieg sie das Piano und gab ihnen einen Drehorgel-Affen; vermutlich war ihr aber an realistischer Darstellung eher gelegen als an einer Maeterlinckschen Behandlung des Themas. Schließlich stürzte sie in den Flügel und gebärdete sich wie ein Papagei in einem Käfig, und für eine improvisierte Vorstellung fand ich das durchaus schlagfertig; so etwas hatte noch niemand je erlebt, abgesehen von der Baronin Boobelstein, die einmal einigen Sitzungen des Österreichischen Reichsrates beigewohnt hatte. Agatha versucht’s nun mit einer Ruhekur in Buxton.«
»Aber die Tragödie?«
»Ach ja, die Mudge-Jervises. Nun, die kamen recht glücklich miteinander aus, und ihr Eheleben bestand aus einem unablässigen Austausch von Bildpostkarten; und sie wurden eines Tages auf irgendeinem neutralen Boden zusammengebracht, auf dem sich Viererpartien und Waschfrauen überschnitten, und entdeckten, dass sie in der Fiskalfrage hoffnungslos uneins waren. Sie hielten es für das Beste, sich zu trennen, und sie darf nun neun Monate im Jahr die Aufsicht über die Perserkatzen führen, die im Winter, wenn sie im Ausland ist, zu ihm zurückkehren. Da haben Sie den Stoff für die Tragödie, unmittelbar aus dem Leben gegriffen – und der Titel des Stücks könnte lauten: ›Das Weltreich hat seinen Preis.‹ Natürlich wären noch Studien über den Kampf angeborener Anlagen gegen das Milieu und all dergleichen einzubauen. Der Vater der Frau könnte Gesandter an irgendeinem der kleineren deutschen Fürstenhöfe gewesen sein; von dort hätte sie ihre Leidenschaft für Armenbesuche her, trotz ihrer so sorgfältigen Erziehung. C’est le premier pa qui compte, wie der Kuckuck sagte, als er seinen Pflegevater verschlang. Ich halte dies für ausgesprochen klug.«
»Und die Wölfe?«