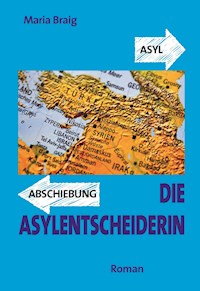Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Querverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Fadia, die Tochter marokkanischer Einwanderer, erfährt, dass ihr Vater sie zwangsverheiraten will, läuft sie von zu Hause weg. Wenige Kilometer weiter strandet Damaris aus Saudi-Arabien auf der Flucht in Deutschland. Als ihr Mann, von dem sie unterwegs getrennt wurde, sie ausfindig macht, möchte sie nicht zu ihm zurück, denn in den vielen Monaten nach der Trennung hat sie ihre Selbstständigkeit entdeckt und sich mit Jane aus Uganda angefreundet. Als Jane ihr dann gesteht, dass sie sich in sie verliebt hat, stellt das Damaris vor Entscheidungen, die ihr bisheriges Weltbild ins Wanken bringen. Fadia und Damaris treffen in einem Frauenhaus zusammen. Als sie dort eines Tages von den Männern der Familien entdeckt und mit Gewalt weggeholt werden sollen, kommt Hilfe aus einer völlig unerwarteten Ecke. nie wieder zurück ist ein bewegender Roman, der das Konstrukt fester Kulturen infrage stellt und zeigt, wie Frauen sich ihr Recht auf Entfaltung und ein selbstständiges Leben nehmen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alle Charaktere, Schauplätze und Handlungen in diesem Roman sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden und toten Personen sind unbeabsichtigt.
© Querverlag GmbH, Berlin 2019
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag und grafische Realisierung von Sergio Vitale unter Verwendung einer Fotografie © mauritius images / Wavebreakmedia.
ISBN 978-3-89656-661-4
Bitte fordern Sie unser Gesamtverzeichnis an:
Querverlag GmbH
Akazienstraße 25, 10823 Berlin
www.querverlag.de
Kapitel 1
Was bedeutet es, deutsch zu sein?
Die sechzehnjährige Fadia kaute an ihrem Bleistift. Sie schrieb nie direkt am Laptop oder Tablet. Zuerst hielt sie ihre Gedanken auf einem Blatt Papier fest und – das war das Wichtigste dabei – sie schrieb die Rohfassung mit Bleistift, eben weil es sich so schön darauf kauen ließ.
Als kleines Mädchen hatte sie schon gerne auf den Buntstiften herumgekaut, mit denen sie die Bilder in ihren Malbüchern ausmalte. Dabei war meist der Lack abgesplittert und sie war mehr am Spucken als am Malen. Dann hatte ihre Mutter umweltfreundliche, nicht lackierte Stifte entdeckt und seither war Fadia dem Kauen noch mehr verfallen. Als sie keine Buntstifte mehr benutzte, weil ihr die Malbücher mit Blumen und Tieren und allen möglichen Figuren aus Walt-Disney-Filmen, von denen sie nur wenige selbst gesehen hatte, eines Tages kindisch vorkamen, stieg sie auf Bleistifte um. Wann immer möglich, schrieb sie damit anstelle des Füllers, der eigentlich in der Schule vorgeschrieben war. Das Zedernholz, aus dem die Stifte hergestellt wurden, schmeckte nach Ferne, es war weich und dokumentierte die Spuren ihrer Zähne. Wenn sie zur Mine vorstieß, weil die letzte Faser der Umhüllung abgekaut war, brach sie das Ende des Stiftes ab und alles begann von vorne.
Fadia versuchte sich zu konzentrieren, aber ihre Gedanken schweiften ab. Was war das aber auch für ein bescheuertes Aufsatzthema. Was bedeutet es, deutsch zu sein?
Sie hatte keine Ahnung. Darüber hatte sie noch nie nachgedacht, aber nun stand das Thema im Ethikunterricht auf dem Lehrplan. Frau Kaminski hatte ihnen einen Zeitungsartikel über die sogenannte deutsche Leitkultur mitgebracht.
„Dieser Begriff“, so erklärte Frau Kaminski der Klasse, „ist vor Jahren schon einmal aufgekommen, dann aber in der Versenkung verschwunden. Nun versuchen ihn einige ewig Gestrige wiederzubeleben und erneut zu einem gesellschaftlichen Thema zu machen. Auch hier in Bremen gibt es Anhänger von Pegida und AfD. Deshalb müssen wir uns damit auseinandersetzen.“
Allgemeines Gemurmel war die Antwort. Niemand schien Lust auf dieses Thema zu haben, aber Frau Kaminski kannte kein Erbarmen.
Nachdem sie gemeinsam den Artikel gelesen hatten, fragte die Ethik-Lehrerin: „Was bedeutet es denn für euch, deutsch zu sein?“
Niemand meldete sich, allgemeines Schweigen und Blicke in die Ferne. Möglichst nicht anwesend sein, um nicht angesprochen zu werden und diese Frage beantworten zu müssen, signalisierten die Blicke, und die Folge war nun eben dieser Aufsatz.
„Wenn ihr keine Antwort wisst, dann müsst ihr euch dringend dazu Gedanken machen.“ Frau Kaminski schien von der Reaktion ihrer Schülerinnen und Schüler nicht überrascht zu sein. „Bis zum nächsten Mal schreibt ihr mir auf, was Deutschsein für euch bedeutet, und im Anschluss sprechen wir darüber, was mit dieser Leitkultur gemeint ist, wer hinter diesen Gedanken steckt und was damit bezweckt wird. Für heute machen wir Schluss.“
Sie durften eine halbe Stunde früher nach Hause gehen, aber dafür mussten sie sich nun mit der schriftlichen Beantwortung dieser Frage herumquälen, auf die Fadia, wie die meisten anderen in der Klasse auch, keine Antwort wusste.
Was bedeutet es, deutsch zu sein?
Fadias Eltern waren vor vielen Jahren aus Marokko nach Deutschland gekommen. Sie selbst war hier geboren, sie war in Bremen zu Hause, in dieser Stadt, die zufällig in Deutschland lag, also war sie gerade so deutsch wie ihre beste Freundin Alisa, mit der sie schon seit dem Kindergarten unzertrennlich war. Auch Alisas Eltern stammten ursprünglich nicht aus der Region, aber sie kamen nicht aus Marokko, sondern aus Bayern, was für die beiden Mädchen keinen Unterschied machte. Beides war weit weg und beide fuhren sie jedes Jahr in den Sommerferien dorthin, um die Großeltern zu besuchen.
Dann war da noch Jil, die Dritte im Bunde. Erst im Gymnasium war sie zu ihnen gestoßen. Jils Eltern waren nicht weit weg in einem Dorf im Emsland geboren und aufgewachsen. Den Namen des Dorfes hatte Fadia längst vergessen.
„Immerhin haben sie es bis nach Bremen geschafft“, sagte Jil einmal zu den beiden Freundinnen. „Gott sei Dank. Sonst müsste ich jetzt auf dem Land versauern und hätte euch nie kennengelernt.“
Jil beneidete Fadia und Alisa um ihre Reisen nach Marokko und Bayern. Bayern war nicht weit von Österreich, der Schweiz und Italien und das war für Jil bereits die weite Welt. Von Marokko in Afrika ganz zu schweigen. Sie selbst verbrachte mit ihren Eltern und ihrem kleinen Bruder jedes Jahr die Sommerferien an der Nordsee. Das war nicht weit zu fahren und die Eltern zog es nicht ins Unbekannte. Jil schon.
Fadia sah keinen Unterschied zwischen sich und den beiden anderen Mädchen. Als sie klein waren, hatten sie sowieso keinen Gedanken daran verschwendet, aber auch später waren sie einfach Freundinnen und lebten gemeinsam in der Stadt, in der sie geboren waren und die sie als ihre Heimat empfanden. Alle drei fühlten sich in Jeans und Sweatshirt am wohlsten und gemeinsam machten sie sich über die Mädchen in der Klasse lustig, die einen Großteil ihrer Zeit vor dem Schminktisch und in Nagelstudios verbrachten. Meist waren sie zu dritt bei einer von ihnen zu Hause, gingen ins Kino oder saßen im Sommer im Eiscafé, „um Jungen zu beobachten“, oder sie zogen mit „den paar halbwegs Normalen in der Klasse“, wie Alisa sich ausdrückte, wenn sie die mode- und schminkbewussten Mitschülerinnen ausschließen wollte, durch die Stadt.
In der Klasse gab es auch ein paar andere, deren Eltern, wie die von Fadia, nicht aus Deutschland stammten, aber niemand kümmerte sich wirklich darum. Es waren schließlich die Eltern, die anderswo aufgewachsen waren, nicht sie. Nur hin und wieder, wenn es aus irgendwelchen Gründen Streit gab, warf man sich gegenseitig „Kanake“ und „Kartoffel“ an den Kopf, aber schon kurze Zeit später, wenn der Streit beigelegt war, war auch das wieder vergessen.
Je mehr Fadia über dem Aufsatz grübelte, umso mehr Begebenheiten und Äußerungen fielen ihr ein, die ihr zu diesem Thema begegnet waren. Es hatte sie nie wirklich interessiert, geschweige denn beeindruckt, aber nun tauchten diese Dinge langsam, aber unaufhaltsam aus ihrem Unterbewusstsein auf. Anscheinend hatte sie eben doch alles irgendwo abgespeichert, anscheinend war es eben doch auf eine bestimmte Art und Weise wichtig für sie gewesen.
Je älter sie wurde, desto häufiger wurde sie, wenn es irgendwo in der Welt einen islamistischen Terroranschlag gab, darauf angesprochen. „Was hältst du davon? Wie stehst du dazu?“ Zunächst hatte sie gedacht, es hinge mit dem Älterwerden zusammen, und es als eine Art Kompliment aufgefasst, dass die Erwachsenen sie nach ihrer Meinung zu politischen Geschehnissen befragten. Dann hatte sie bemerkt, dass immer nur sie gefragt wurde, nie Alisa oder Jil, und sie hatte sich erst gewundert und im Lauf der Zeit darüber geärgert.
Was interessierten sie denn diese Terroranschläge? Jedenfalls nicht mehr als ihre Freundinnen auch. Was ging es sie an, wenn irgendein Ausländer austickte und seine Ex-Frau angriff? Was hatte sie damit zu tun, wenn nordafrikanische Männer Frauen und Mädchen begrapschten? Nie hatte sie jemand gefragt, was sie davon hielt, dass der alte Stövermann, der allein in einem kleinen Haus in der Nachbarschaft wohnte, sobald ein junges Mädchen auftauchte, sie dumm anquatschte, in sein Haus einlud und versuchte, sie zu betatschen. Er war halt der alte Stövermann, die Mädchen wurden vor ihm gewarnt, sie sollten ihm am besten aus dem Weg gehen und sich fernhalten. Das war’s. Man hatte sie auch nie gefragt, was sie davon hielt, dass vor einiger Zeit ein Arbeitsloser in der Agentur für Arbeit Amok gelaufen war und mit einem Messer seine Sachbearbeiterin verletzt hatte. Diese Leute waren Deutsche ohne irgendwelche ausländischen Wurzeln, das wurde Fadia jetzt klar. Sie verhielten sich zwar falsch, aber das kam eben immer mal vor. Sobald jedoch diejenigen, die sich falsch verhielten, Ausländer waren oder ausländische Eltern hatten, so wie sie selbst, dann war das anscheinend etwas, das zu den Ausländern gehörte. Kein Einzelfall, sondern typisch. Und dann war sie selbst plötzlich nicht mehr einfach Fadia, die schon immer hier lebte, wie Alisa und Jil auch, sondern dann war sie eine Ausländerin, eine potenzielle Terroristin oder zumindest auf irgendeine undurchsichtige Art mitverantwortlich für das, was „ihre“ Leute getan hatten.
„Das ist eben ihre Kultur“, hatte sie in letzter Zeit immer öfter aufgeschnappt. „Das ist eben eure Kultur“, hatte sie selbst zu hören bekommen, aber lange Zeit nicht weiter beachtet. Abgehakt unter „dumme Sprüche“ und neben „Kanake“ in den Papierkorb geworfen. Aber, so bemerkte sie nun, auch was im Papierkorb lag, war nicht weg. Es war genauso wie auf ihrem Laptop. Von der Oberfläche zwar verschwunden, vergessen, vorbei – aber doch noch greifbar. Und jetzt kam alles von ganz allein nach oben.
„Das ist eben deine Kultur.“
Plötzlich stand dieser Satz neben der Frage „Was bedeutet es, deutsch zu sein?“ und brachte sie noch mehr durcheinander.
Meine Kultur, deine Kultur. Sie lebte hier genauso wie ihre Freundinnen, seit sie denken konnte. Sie lebte kaum anders als ihre Freundinnen. Zu Hause wurde Weihnachten gefeiert mit geschmücktem Tannenbaum und Geschenken, aber ohne Krippe und Gottesdienst. Es gab auch den Ramadan und das Zuckerfest und Fadia hatte es als Kind immer sehr genossen, zweimal beschenkt zu werden, während ihre Freundinnen nur Weihnachten hatten. Die Eltern fasteten während des Ramadan, stellten ihrer Tochter aber frei, dies zu tun oder zu lassen, und sie hatte sich fürs Lassen entschieden. Fadia fand, in ihrer Familie lebte es sich, was die Religion anging, wesentlich entspannter als bei Alisa, die katholisch war und jeden Sonntag und auch sonst immer mal wieder zur Kirche gehen musste. Alisa beklagte sich oft bei Fadia über die vielen Regeln, die ihre Religion bestimmten, und die strengen Eltern, die versuchten, aus ihr eine gute Katholikin zu machen.
Fadia hatte keine Lust mehr; für den Aufsatz war auch morgen noch Zeit. Sie klappte das Laptop zu, legte sich aufs Bett und dachte an Moritz.
Fast zeitgleich hatten sich Alisa und Fadia vor einiger Zeit verliebt. Glücklicherweise nicht in denselben Jungen, wie sie kichernd feststellten, als Jil, die bemerkt hatte, dass die beiden kaum mehr Zeit für gemeinsame Unternehmen zu dritt hatten, sie darauf ansprach. Die beiden Jungen waren in einer Klasse mit den Mädchen. Der zurückhaltende, fast ein wenig schüchterne Moritz hatte es Fadia angetan und Alisa hatte sich in Ahmed verguckt, dessen Großvater vor vielen Jahren als Gastarbeiter aus der Türkei gekommen war und seine Frau bald nachgeholt hatte. Das war aber auch schon alles, was Ahmed außer seinem Namen mit der Türkei verband. Seine Mutter war Deutsche wie ihre Eltern und Großeltern auch und sein Vater war fast noch deutscher als die Mutter, fand Ahmed. Er selbst war protestantisch getauft und erzogen worden, das war die Bedingung der Großeltern gewesen, sonst hätten sie der Heirat ihrer Tochter mit einem Türken nicht zugestimmt.
„Meine Eltern haben ein riesiges Problem damit, dass mein Freund nicht katholisch ist“, berichtete Alisa, nachdem ihre Eltern von Ahmed erfahren hatten. „Von Mischehe reden sie. Habe ich was von heiraten gesagt? Die spinnen doch.“
„Dann will ich aber deine Trauzeugin sein.“ Fadia konnte sich das Lachen nicht verkneifen. „Wann ist es denn so weit?“
„Halt bloß die Klappe“, schimpfte Alisa. „Das ist nicht lustig. Warum sind sie nur so altmodisch? Ob das damit zusammenhängt, dass sie in Bayern aufgewachsen sind? Ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert, da sollte es doch egal sein, was für eine Religion einer hat.“
„Du kannst es ja mal mit einem Muslim versuchen“, schlug Fadia vor. „Vielleicht ist ihnen das lieber.“
Sie selbst hatte mit den Eltern nicht über die Freundschaft mit Moritz gesprochen, dafür hatte ihr bisher der Mut gefehlt. Auch wenn sie sich über Alisas Eltern lustig machte, so wusste sie doch, dass ihre eigenen auf keinen Fall lockerer waren, was die Beziehung zu einem Jungen anging. Nur einmal hatte sie versucht, mit ihrer Mutter über Freundschaften zwischen Jungen und Mädchen zu sprechen, aber das war gründlich danebengegangen.
Fadia war Einzelkind. Sie lebte mit ihren Eltern in einem kleinen Haus mit einem noch kleineren Vorgarten nicht weit von Alisa und Jil. Ihr Vater Manzir, der seine Jugend in Marokko verbracht hatte, war als junger Mann nach Deutschland gekommen, um Laila, die in Bremen als Tochter eines marokkanischen Gastarbeiters aufgewachsen und nun Fadias Mutter war, zu heiraten. Im Lauf der Jahre hatte er sich zum Facharbeiter einer Bremer Werft hochgearbeitet. Seit Fadia zur Schule ging, arbeitete auch ihre Mutter als Verkäuferin in einem großen Kaufhaus, und so hatten sich die Eltern, kurz bevor Fadia ins Gymnasium kam, endlich den Traum eines eigenen Hauses erfüllen können, in dessen Küche Mutter und Tochter gerade das sonntägliche Essen vorbereiteten, als Fadia ganz vorsichtig das Thema Jungen angesprochen hatte.
„Du bist noch viel zu jung“, hatte ihre Mutter gesagt und der Vater, der unerwartet dazugekommen war und das Gespräch hörte, hatte seine Tochter gleich angeblafft: „Wenn ich dich mit einem Jungen erwische, schicke ich dich umgehend nach Marokko und verheirate dich mit deinem Cousin Kamal.“
Fadia hatte gelacht, weil sie dachte, der Vater mache Witze. Schließlich war Kamal viel älter als sie – und überhaupt, was sollte sie in Marokko?
Aber ihr Vater fuhr sie an: „Was gibt es da zu lachen?“
Erschrocken antwortete Fadia: „Aber das ist doch völlig unlogisch. Mutter sagt, ich wäre zu jung für die Freundschaft mit einem Jungen, und du willst mich gleich verheiraten?“
„Dann weiß ich wenigstens, mit wem du zusammen bist und dass du keine Dummheiten machst“, knurrte der Vater und verließ die Küche. Fadia widmete sich wieder den Zwiebeln, die sie schälen und in kleine Stücke schneiden sollte.
„Das meint er aber doch nicht ernst, oder?“, fragte sie fast ängstlich, was überhaupt nicht zu dem sonst so taffen Mädchen passte.
Ihre Mutter rührte in einem Topf auf dem Herd, wandte Fadia den Rücken zu und antwortete nicht. Fadia war unsicher, ob sie überhaupt gehört worden war, legte das Messer weg, stand auf und stellte sich neben ihre Mutter, die wie meist, wenn sie zu Hause war, eine Kittelschürze trug. Beide Frauen waren ungefähr gleich groß, Fadia jedoch schlanker und muskulöser als ihre etwas mollige Mutter. Sie hatte eine weiße Schürze umgebunden, darauf war ein Rotarmist mit einem Besen in der Hand zu sehen, der mit dem Zeigefinger auf den Betrachter deutete, und in schwarzer Schrift stand da der Spruch: „Auch du hältst die Küche sauber, Genosse.“ Fadia war stolz auf diese Schürze, die sie bei einem Ausflug mit ihren Freundinnen auf den Flohmarkt entdeckt hatte. Laila hatte nur mit dem Kopf geschüttelt, als ihre Tochter zum ersten Mal damit in der Küche aufgetaucht war. Da Fadia sich aber bisher immer strikt geweigert hatte, eine Schürze zu tragen, sagte sie nichts.
Gerne hätte Fadia ihre Mutter jetzt einfach an den Schultern gepackt und zu sich herumgedreht, aber das wagte sie nicht. Stattdessen hielt sie den Kochlöffel fest, mit dem die Mutter gedankenverloren immer weiter in der Soße rührte.
„Das meint er aber doch nicht ernst, oder?“, wiederholte Fadia nun lauter als beim ersten Mal und sah ihre Mutter fragend an.
„Täusch dich nicht“, antwortete sie, nahm den Kochlöffel aus dem Topf und legte ihn auf einen Teller, der neben dem Herd stand. Sie drehte den Temperaturregler auf drei und setzte sich an den Küchentisch, wo Auberginen und Zucchini neben einem großen Messer auf einem Holzbrett bereitlagen.
„Fadia, was ist mit den Zwiebeln?“
Fadia ließ sich auf ihren Stuhl fallen und setzte ihre Arbeit fort.
„Täusch dich nicht“, wiederholte die Mutter, während sie die Auberginen in Scheiben schnitt. „Dein Vater liebt dich sehr und er lässt dir viele Freiheiten, weil er weiß, dass du in einer anderen Welt lebst als die, in der er selbst groß geworden ist. Aber es gibt Grenzen. Wenn er fürchten muss, dass du die Ehre der Familie beschmutzt, dann hört es für ihn auf.“
„Aber Mama!“ Fadia unterbrach ihre Arbeit und sah auf. „Was redest du denn da? Die Ehre der Familie beschmutzen, so was Altmodisches hat bei uns doch noch nie gezählt.“ Sie nahm die nächste Zwiebel und begann sie mit unnötiger Gewaltanwendung zu zerkleinern.
„Dein Vater hat sich bemüht, dir ein Leben zu ermöglichen, wie es deine deutschen Freundinnen führen. Das heißt aber nicht, dass er seine Grundsätze aufgegeben hat“, antwortete ihre Mutter ernst und bearbeitete die nächste Aubergine.
„Meine deutschen Freundinnen? Ich bin genauso deutsch wie sie. Ich lebe hier, immer schon. Ich spreche kaum Arabisch, ich fahre in den großen Ferien nach Marokko wie andere Touristen auch. Ich bin deshalb doch keine Marokkanerin. Was soll das denn plötzlich?“
Fadias Mutter unterbrach ihre Arbeit. „Fadia. Die Zwiebel kann nichts dafür, mach sie nicht zu Mus, sondern nimm die nächste.“ Sie sah Fadia, die nun das Messer weglegte und die Mutter böse anstarrte, in die Augen. „Du bist dabei, erwachsen zu werden, Fadia. Das haben wir zu lange nicht wahrhaben wollen. Du warst für uns immer noch unser kleines Mädchen, aber das stimmt wohl nicht mehr. Also müssen wir uns darauf einstellen, dass du nun bald eine Frau sein wirst. Wir können dir nicht mehr alles durchgehen lassen. Du hast vergessen, woher du stammst, scheint mir. Wir haben vieles versäumt und es wird Zeit, dass du lernst, wie sich eine marokkanische Frau zu benehmen hat.“
Fadia nahm das Messer und spießte eine Zwiebel auf.
„Ich glaube es nicht. Was erzählst du denn da? So hast du noch nie mit mir gesprochen.“
„Die Leute reden schlecht über uns, wenn du dich nicht benimmst, wie es sich gehört. Dein Vater wurde bereits von Onkel Aziz angehalten, sich besser um deine Erziehung zu kümmern“, rutschte es der Mutter heraus.
Fadia kehrte zurück in die Gegenwart. Das Gespräch in der Küche, das sie damals mit ihrer Mutter geführt hatte, war mit diesem Hinweis auf ihren Onkel Aziz, der mit seiner Familie in einem anderen Stadtteil in Bremen wohnte, noch nicht zu Ende gewesen. Ihre Mutter hatte Fadia einen Vortrag gehalten, über den sie sich jetzt, da sie sich daran erinnerte, immer noch aufregte.
„Man kann als Mitglied einer marokkanischen Familie der eigenen Tochter nicht alles durchgehen lassen, wenn sie aus dem Kindesalter heraus ist“, hatte die Mutter gepredigt. „Du hast recht, wir leben nicht viel anders als die Deutschen, aber es gibt eben Grenzen. Wer sich darüber hinwegsetzt, bekommt Schwierigkeiten mit konservativen Verwandten, wie deinem Onkel Aziz und den anderen Marokkanern, die an den alten Sitten und Gebräuchen festhalten, weil sie sich in Deutschland nie wirklich zu Hause gefühlt haben.“
„Ich fühle mich aber hier zu Hause“, hatte Fadia verärgert gerufen, war aufgestanden, hatte die Schürze ausgezogen und wütend auf den Stuhl geworfen.
„Trotzdem“, antwortete die Mutter. „Die Familie ist der wichtigste Rückhalt, den wir haben, und deshalb wirst du in Zukunft tun, was dein Vater dir sagt.“
Fadia verließ daraufhin die Küche und knallte mit Schwung die Tür hinter sich zu. Als sie zum Essen gerufen wurde, schob sie Kopfschmerzen vor.
Fadia schüttelte die Schatten ab, die so unverhofft über ihr aufgetaucht waren, und widmete sich wieder den schönen Seiten des Verliebtseins.
„Sollen wir am Wochenende gemeinsam ins Kino gehen? Du, Ahmed, Moritz und ich?“, fragte sie Alisa per WhatsApp und hatte ein schlechtes Gewissen, weil sie ohne Jil gehen wollte. Aber mit zwei Pärchen allein, das wäre doch auch für Jil nicht so schön, beruhigte sie ihre innere Stimme schnell wieder.
Alisa stimmte zu und auch Ahmed und Moritz hatten Lust auf Kino, wie sie schnell herausfanden.
Jil hatte sich mittlerweile damit abgefunden, dass sie hin und wieder als fünftes Rad am Wagen galt und nicht mehr wie bisher bei allem, was die anderen beiden unternahmen, willkommen war. Sie selbst hatte keinen Freund, vermisste das aber auch nicht. Dabei hätte sie wohl am wenigsten Probleme mit der neuen Situation gehabt, da ihre Eltern zwar nie weit in die Welt hinausgekommen, aber auch nicht besonders religiös waren und auch sonst keine sonderlich engen Vorstellungen davon hatten, was das Liebesleben ihrer Tochter anging. Sie selbst hatten früh heiraten müssen, weil Jil unterwegs war und es auf dem Land noch immer nicht gern gesehen wurde, wenn ein uneheliches Kind zur Welt kam. Jils Mutter erinnerte sich noch gut an die Katastrophe, die die Schwangerschaft in ihrem Elternhaus ausgelöst hatte, und Jils Vater, dem es nicht viel anders ergangen war, nannte sie heute noch manchmal liebevoll seinen „kleinen Bastard“.
Die Folge dieser Erfahrung war, dass Jil schon sehr früh über Verhütung aufgeklärt wurde und ihre Mutter angeboten hatte, wann immer ihre Tochter es für notwendig halte, sich mit Jil gemeinsam um die Pille zu kümmern.
„Auch wenn dir das jetzt noch nicht notwendig erscheint“, hatte sie hinzugefügt, als Jil meinte, sie würde es ihr sagen, wenn sie so weit wäre, „man weiß ja nie, was geschieht.“ Mit diesen Worten hatte sie ihr ein paar Kondome zugesteckt, die Jil, mehr überrumpelt als überzeugt, entgegennahm.
„Es schadet nichts, so was bei dir zu haben, auch wenn du nicht vorhast, sie zu benutzen.“
Als Jil sie erstaunt angesehen hatte, da sie sich mit dem Fall der Fälle bisher noch so gar nicht auseinandergesetzt hatte, fügte ihre Mutter hinzu: „Manchmal gibt es auch eine Freundin, die dir dankbar ist, wenn du aushelfen kannst.“
Jil hatte genickt und die bunten Päckchen eingesteckt. Auch wenn sie sich überrollt vorkam, war sie doch ganz froh darüber, dass ihre Mutter so offen mit dem Thema umging. Sie hatte die Kondome hinten in ihrer Nachttischschublade deponiert und das Thema erst einmal wieder vergessen. Als sich ihre beiden besten Freundinnen fast zeitgleich verliebten, waren ihr die Kondome wieder eingefallen. Sie versicherte sich, dass das Haltbarkeitsdatum der „Verhüterli“, wie man in der Schweiz sagte – dieses Wort gefiel ihr und Jil grinste in sich hinein – noch nicht abgelaufen war, und steckte sie in ihren kleinen Rucksack, den sie immer und überall mit sich herumschleppte. Vielleicht wären ihr die Freundinnen schon bald dankbar, wenn sie aushelfen konnte. Noch dachten die beiden zwar nicht daran, mit Moritz und Ahmed zu schlafen, hatten sie Jil erklärt, aber wer wusste schon, wie sich so etwas entwickelte. Das war für sie alle drei Neuland und besser, man sorgte vor, da hatte die Mutter schon recht.
Als sich die Mädchen am folgenden Montagmorgen in der Schule trafen, lag ein Schatten über Fadia, so schien es Jil. Alisa blickt sie wissend an und teilte ihr mit, dass nach der Schule dringend eine Besprechung unter sechs Augen fällig sei. Heute hatten sie früher Schluss und so konnten sie sich, bevor sie nach Hause zum Mittagessen mussten, noch in dem kleinen Café in der Fußgängerzone treffen, in dem sie schon so manche schulfreie Stunde verbracht hatten und auch einige, die sie sich einfach selbst frei genommen hatten.
Direkt nach dem Unterricht zogen sie los. Fadia war heute sehr still, bemerkte Jil, etwas musste am Wochenende geschehen sein. Vielleicht hatte sie sich mit Moritz gestritten, das kam ja ab und zu vor, aber bisher war der Streit zwischen den beiden jedes Mal schnell beigelegt gewesen und alles war wieder gut.
Sie fanden einen Tisch in einer stillen Ecke, bestellten Cappuccino, Kakao und Latte Macchiato und dann hielt Jil es nicht länger aus.
„Was ist denn los? Hast du Ärger mit Moritz, Fadia?“, fragte sie, ohne weiter abzuwarten, bis die anderen ihr erklärten, um was es ging.
Fadia schüttelte den Kopf.
„Nein, mit Moritz ist alles in Ordnung. Also jedenfalls zwischen Moritz und mir.“ Sie schluckte. „Das ist ein wenig kompliziert. Alisa weiß auch nicht viel mehr als du, Jil, außer dass wir eben gemeinsam im Kino waren und ich anschließend zu Hause Ärger bekam, weil es später geworden ist als abgemacht.“
„Ihr seid zu spät nach Hause gekommen. Wo ist dann das Problem?“, fragte Jil erstaunt. „Das ist ja nicht das erste Mal, wir haben doch schon öfter überzogen und uns alle drei eine kleine Abreibung dafür abgeholt. Aber so ist das halt mit den Eltern. Wer weiß, wie wir mal später sind, wenn wir Kinder haben“, grinste Jil wissend.
„Nein, diesmal war es anders“, unterbrach Alisa. „Wir sind wie immer zusammen nach Hause gegangen. Erst haben wir Moritz bei sich daheim abgeliefert, dann waren wir bei Fadia und schließlich hat Ahmed mich nach Hause gebracht. Das liegt ja auf dem Weg. Aber als wir vor Fadias Haus ankamen, ging die Tür auf und ihr Vater stand da. Er starrte Ahmed an und knurrte: ‚Lass die Finger von meiner Tochter, sonst passiert was!‘ Ahmed wusste erst gar nicht, was los war, dann nahm er mich in den Arm und sagte nur ‚Entschuldigung, ich will nichts von Ihrer Tochter, ich bin schon vergeben.‘ Wir küssten uns, um ihm ganz klar zu zeigen, wer hier zu wem gehört, und gingen dann nach Hause. Den Rest muss du erzählen, Fadia“, schloss Alisa.
Fadia löffelte die Sahne von ihrem Kakao und wusste nicht recht, wie sie beginnen sollte. Schließlich gab sie sich einen Ruck.
„Also es war so: Während Alisa und Ahmed noch rumknutschten, zog mich mein Vater ins Haus und knallte die Tür hinter mir zu. Es war gut gemeint von euch“, wandte sie sich an Alisa, „aber es hat alles noch schlimmer gemacht. Als mein Vater sah, wie ihr euch geküsst habt, ist er endgültig ausgerastet. Ich glaube, er war erst mal sauer, weil er sich mit Ahmed so blamiert hatte. Und außerdem spinnt mein Vater gerade total. Bis vor Kurzem fand er alles cool, was ich gemacht habe, und jetzt plötzlich kann ich nichts mehr richtig machen. Irgendwer hat mich mit Moritz gesehen und uns bei ihm verpfiffen und seither hat er voll einen an der Waffel. Meine Mutter sagt, es gab Ärger mit meinem Onkel Aziz und seinen marokkanischen Freunden. Die haben meinem Vater erzählt, ich hätte einen Freund, einen Deutschen noch dazu, und das könne er doch nicht durchgehen lassen. Er solle gefälligst etwas unternehmen. Jetzt denkt er wohl, sie halten ihn für einen Schwächling, dem die Tochter auf der Nase rumtanzt, wenn er nichts sagt. Aber dass er sich nun so aufführen muss, das verstehe ich nicht.“
Fadia verstummte. Sie verstand die Welt nicht mehr. Ihr Vater hatte sich in kurzer Zeit um 180 Grad gedreht, mindestens, und das verwirrte sie dermaßen, dass sie keinen klaren Gedanken mehr fassen konnte.
„Wenn die Töchter ihren ersten Freund haben, spinnen doch alle Eltern“, sagte Alisa in der Hoffnung, Fadia ein wenig trösten zu können.
„Meine nicht“, warf Jil ein.
„Aber du hast doch gar keinen Freund.“ Alisa wusste nicht, worauf die Freundin hinauswollte. Die kramte in ihrem Rucksack und warf ein paar Kondome auf den Tisch.
„Da, das hat mir meine Mutter gegeben, weil sie meinte, man könne ja nie wissen. Manchmal ginge das eben schnell mit einem Freund. Und wenn ich einen festen Freund habe, dann besorgt sie mir auch die Pille, hat meine Mutter gesagt.“
Fadia und Alisa sahen Jil bewundernd an.
„Ehrlich wahr?“ Alisa konnte das kaum glauben. „Wenn mich meine Mutter mit Kondomen oder mit der Pille erwischt, dann kriegt sie die Krise. Aber wir sind auch katholisch und da ist das mit der Pille verboten, sagt meine Mutter“, seufzte Alisa resigniert. „Aber noch wichtiger ist was anderes, glaube ich. Dauernd bekomme ich zu hören ‚Hast du dir überlegt, was die Leute sagen? Es fällt alles auf uns zurück!‘ Mein Vater hat neulich, als er mich mit Ahmed in meinem Zimmer auf dem Bett erwischt hat – wir haben nur DVD geguckt, nichts weiter –, gesagt: ‚Wenn du dir von dem ein Kind anhängen lässt, dann kannst du sehen, wo du bleibst.‘ Bestimmt meint er das nicht so, aber es nervt trotzdem total.“
„Sei dir bloß nicht zu sicher“, mischte sich jetzt Fadia ein. „Ich habe auch gedacht, dass mein Vater es nicht so meint, als er neulich gesagt hat, wenn er mich mit einem Jungen erwischt, dann schickt er mich nach Marokko und verheiratet mich mit meinem Cousin. Ich habe bloß laut gelacht und da war er stinksauer und meine Mutter hat mir erklärt, ich solle vorsichtig sein, bei dem Thema verstünde er keinen Spaß. Nach dem, was an diesem Wochenende gelaufen ist, habe ich Angst, dass sie vielleicht doch recht hat. Keine Ahnung, was mit ihm passiert ist. Wir haben uns immer gut verstanden und er hat mir fast nie etwas verboten. Und jetzt erzählt er so eine Scheiße. Am Wochenende hat er es mir noch einmal gesagt: ‚Du bist noch viel zu jung für einen Freund. Du kannst mit Alisa befreundet sein, aber ich will dich nie mehr mit ihr und diesem Ahmed zusammen sehen. Wenn ich dich mit einem Jungen erwische, der etwas von dir will, dann bist du schneller eine verheiratete Frau in Marokko, als du dir das vorstellen kannst.‘“
Fadia schwieg. Sie hatte Angst vor ihrem Vater bekommen, als er so zornig vor ihr stand, aber schlimmer noch war die Enttäuschung darüber, wie er mit ihr sprach. Sie liebte ihren Vater sehr, war als kleines Mädchen immer ein Papakind gewesen und sie waren beide gemeinsam durch dick und dünn gegangen. Und jetzt war etwas passiert, was sie nicht verstehen konnte, und ihr „Baba“ war einfach von heute auf morgen verschwunden und hatte jemand anderen an seiner Stelle zurückgelassen. Der sah zwar so aus wie ihr Vater, aber er war ein völlig Fremder für sie.
„Was machst du denn jetzt?“, fragte Jil. „Trennst du dich von Moritz oder was?“
„Spinnst du?“ Die alte Fadia war wieder da, so konnte man jedenfalls meinen. „Ich liebe Moritz. Wir müssen halt aufpassen, dass sie uns nicht erwischen. Ganz ehrlich: Ich weiß gerade nicht, was ich von all dem halten soll. Mein Vater hörte sich in seiner Wut richtig gefährlich an, aber ich will das einfach nicht glauben, dass er wirklich meint, was er sagt. Der lebt doch nun auch schon ewig in Deutschland, meine Mutter geht arbeiten und hat mindestens genauso viel zu sagen wie er. Jedenfalls habe ich das immer gedacht. Der kann doch nicht plötzlich wie ein alter Marokkaner denken, wie sein eigener Großvater oder so.“
„Aber ganz sicher bist du dir nicht, oder?“, fragte Alisa vorsichtig.
„Ich habe echt keine Ahnung. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Auch dass meine Mutter einfach so mitmacht, anstatt zu mir zu halten. Wir haben ein paar altmodische Verwandte, vor allem Aziz, der ältere Bruder meines Vaters, ist von vorgestern und auch ein paar Freunde der beiden sind anscheinend im marokkanischen Mittelalter hängengeblieben. Aber ich verstehe nicht, warum er sich von denen plötzlich was sagen lässt. Früher hat er doch auch gemacht, was er wollte. Die finden das auch nicht gut, wie er mit meiner Mutter umgeht, glaube ich. Dass er sie sogar vor ihnen nach ihrer Meinung fragt, dass er sie mit entscheiden ließ, als sie damals das Haus gekauft haben und all so was, darüber machen die sich immer schon lustig. Aber das war ihm bisher egal.“
„Eine Tochter ist was anderes.“ Alisa schien aus Erfahrung zu sprechen. „Wir haben auch ein paar Verwandte, dagegen sind meine Eltern der personifizierte Fortschritt. Aber wenn meine Oma meinem Vater ins Gewissen redet oder auch meiner Mutter, dann werden die plötzlich wieder ganz klein und sagen nur noch ja und Amen. Zum Glück ist sie weit weg, in Bayern, und sieht uns nur in den Ferien. Ich versteh das auch nicht, aber es ist einfach so. Meine Oma erzählt mir auch immer solchen Blödsinn: ‚Mädchen, lass den Ahmed, du musst dich für die Ehe aufbewahren. Den ersten Mann wirst du nie vergessen, deshalb muss der Erste dein Ehemann sein.‘“
Fadia lachte.
„Ach herrje, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Jil, ich glaube, du bist ein Alien, oder wenigstens deine Eltern sind welche. Kannst du uns mitnehmen auf deinen Planeten?“
„Nun kriegt euch mal wieder ein. So toll ist das bei uns auch nicht. Meine Eltern mussten schließlich heiraten, als ich unterwegs war. Ihr müsstet mal meine Omi zu dem Thema hören, heute noch. Der einzige Unterschied ist, dassmeine Eltern anscheinend lernfähig sind. Manchmal muss der Mensch eben auch Glück haben im Leben“, grinste Jil und damit war die Krisensitzung beendet. Denn lernfähig hin oder her, marokkanische, bayrische oder außerirdische Vorfahren: Um ein Uhr stand das Mittagessen auf dem Tisch und dazu hatte man sich einzufinden.
Fadia wusste später nicht mehr, warum sie das Kondom, das Jil auf den Tisch legte, eingesteckt hatte. Vielleicht war es ihr einfach nur peinlich gewesen, das quadratische Tütchen, das jeder auf den ersten Blick als das erkannte, was es war, in aller Öffentlichkeit neben ihrer Kakaotasse liegen zu lassen. Zugleich hatte es etwas Verschwörerisches, wie jede der drei Freundinnen eines davon in die Hosentasche steckte. Auf eine seltsame Art war es ein Zeichen der Auflehnung gegen die Eltern mit ihrer altmodischen Einstellung. Fadia wusste genau, dass sie dieses Ding nicht haben durfte, und genau deshalb war das unscheinbare Kondom ein Zeichen des Widerstands, ein Zeichen des Erwachsenwerdens. Sie hatte nicht vor, es zu benutzen. So weit waren sie und Moritz noch nicht. Und außerdem wusste sie auch selbst, wie und wo sie sich im Bedarfsfall die notwendigen Utensilien besorgen konnte. Aber sie steckte es ein, vergaß es sofort wieder und hatte damit, ohne es zu ahnen, das Ende ihrer doch ziemlich unbeschwerten Kindheit und Jugend eingeleitet.
Die Woche über trug Fadia die Hose noch, dann warf sie sie in die Wäsche und kümmerte sich nicht weiter darum.
Als wenige Tage später ihre Mutter mit vorwurfsvollem Blick und der Jeans in der Hand in ihrem Zimmer auftauchte, während Fadia gerade am Schreibtisch über einer komplizierten Mathematikaufgabe grübelte, erwartete Fadia die übliche Standpauke, weil sie wieder mal vergessen hatte, die Hosentaschen auszuleeren und „Papiertaschentücher die ganze Wäsche mit weißen Krümelchen bedecken, die man fast nicht mehr wegbekommt, und das habe ich dir schon tausendmal gesagt!“
Aber es war nicht das übliche Papiertaschentuch, das sie vergessen hatte, es war auch nicht der übliche vorwurfsvolle Blick, bemerkte Fadia sofort, als sie sich mit ihrem Schreibtischstuhl der Mutter entgegendrehte und sie fragend ansah, weil diese, nachdem sie ins Zimmer getreten war, die Tür hinter sich schloss und keinen Ton von sich gab.
„Was ist los?“
Die Mutter hob mit der einen Hand die Jeans hoch und mit der anderen ein quadratisches Plastiktütchen. Fadia erstarrte, ihr wurde eiskalt und sie schwor sich, in Zukunft immer, aber wirklich immer alle Taschen genau zu durchsuchen und auszuleeren, bevor sie jemals wieder eine Hose in die Wäsche gab.
„Fadia, was ist das?“, fragte ihre Mutter mit eisiger Stimme.
Fadia fiel keine gute Antwort ein und so schwieg sie lieber, aus Angst, mit einem falschen Satz die Mutter noch mehr in Rage zu bringen. Sie saß einfach nur da, die Hände in den Taschen ihres Sweatshirts vergraben, und wartete ab.
„Hast du nicht gehört, was dein Vater gesagt hat? Er will dich nicht mit einem Jungen sehen, du bist dazu noch zu jung. Und nun finde ich so was“ – so was hörte sich richtig unappetitlich an, wie die Mutter es betonte – „in deiner Hosentasche.“
„Aber Mutter, ich habe das Kondom doch nur eingesteckt, weil Jil es mir unbedingt geben wollte. Moritz und ich, wir sind noch lange nicht so weit.“
Fadia biss sich auf die Lippen, aber es war zu spät.
„Moritz? Wer ist Moritz? Also ist da doch ein Junge, mit dem du dich herumtreibst, und es waren nicht nur dumme Geschichten, die sie deinem Vater erzählt haben? Und was heißt das: Ihr seid noch lange nicht so weit? Du bist ein Mädchen, ein Mädchen ist erst so weit, wenn es verheiratet ist. Hast du das immer noch nicht verstanden?“
„Das sagen Alisas Eltern auch“, rutschte es Fadia heraus, aber ihre Mutter hatte wohl nicht zugehört, jedenfalls stand sie schweigend im Zimmer und erwartete eine Rechtfertigung ihrer Tochter. Vielleicht hoffte sie insgeheim noch immer, alles würde sich als ein Missverständnis herausstellen.
„Ich weiß, dass ihr jungen Mädchen heute anders seid, als wir es in unserer Jugend waren“, begann sie schließlich, als Fadia stumm blieb. „Aber es gibt Grenzen, die auch heute noch gelten.“ Sie wurde lauter. „Grenzen, die auch meine Tochter einzuhalten hat.“
Fadia beobachtete ihre Mutter, sah, wie es in ihr arbeitete und wie sie sich bemühte, einigermaßen ruhig zu bleiben, und sie versuchte mit aller Kraft, die Fäuste geballt in den Taschen, selbst nicht auszurasten. Sich jetzt zu streiten würde alles nur noch schlimmer machen.
„Ich treibe mich nicht herum, Mama.“ Ihre Stimme klang belegt vor lauter Anstrengung, Ruhe zu bewahren. „Ich habe einen Freund, ja, Moritz heißt er. Ich hätte ihn dir gerne mal vorgestellt, aber in dieses Haus darf man ja keinen Jungen bringen.“ Fadia schluckte. „Wir machen nichts, was wir nicht dürfen, wir sind einfach nur gut befreundet. Das Kondom wollte ich gleich wieder wegwerfen, nachdem Jil gegangen war, aber dann habe ich es einfach vergessen.“ Sie drehte sich mit dem Schreibtischstuhl hin und her und wartete ab. Fadia wusste nichts mehr zu sagen. „Pubertät ist, wenn die Eltern schwierig werden“, hatte sie neulich irgendwo gelesen. Wo, wusste sie nicht mehr, aber da war was dran, stellte sie nüchtern fest. Sie hatte sich nie selbst als pubertär empfunden, aber nach der Reaktion ihrer Mutter zu schließen, war sie es wohl doch.
„Du erinnerst dich, was dein Vater gesagt hat?“, unterbrach die Stimme der Mutter die Stille im Zimmer. Rhetorische Frage mit kunstvoller Pause, stellte Fadia fest. Ihre Gedanken machten sich gerade auf eine seltsame Art und Weise selbständig, fiel ihr auf, aber sie konnte nichts dagegen tun.
„Ich muss es ihm sagen, dass du gegen sein Verbot mit einem Jungen zusammen bist. Du hast es dir selbst zuzuschreiben, was jetzt passiert.“
Als ihre Mutter zu weinen begann, packte Fadia die Angst. Die Situation schien wirklich ernst zu sein und lief Gefahr, außer Kontrolle zu geraten. Aber ihr Baba würde sie doch nicht wirklich nach Marokko schicken. Das konnte sich Fadia trotz allem nicht vorstellen. Es würde ein riesiges Theater geben, schlimmer als bei ihren bisherigen kleinen Kindervergehen, aber dann hätte er sie wieder lieb und würde bestimmt sogar eines Tages Moritz akzeptieren. Moritz war ein hübscher Junge, schmal, aber nicht mager und nur wenige Zentimeter größer als Fadia. Seine blonden Haare waren kurz geschnitten und manchmal ein wenig verstrubbelt. Dann gefielen sie Fadia am besten. Er achtete darauf, ordentlich gekleidet zu sein und vor allem: Moritz konnte sehr charmant sein, wenn er wollte.