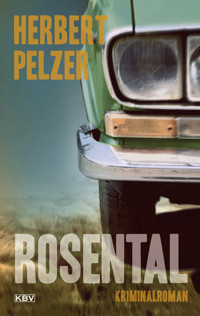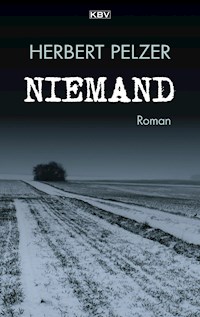
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: KBV Verlags- & Medien GmbH
- Kategorie: Krimi
- Serie: KBV-Krimi
- Sprache: Deutsch
Langsam kriechen die Schatten der Vergangenheit heran Als an einem Wintertag ein ausgesetzter Säugling auf den verschneiten Feldern am Nordrand der Eifel gefunden wird, tauft man den Jungen auf den Namen Martin Niemand – sein Schicksal scheint vorherbestimmt. Doch dank seines unbändigen Willens und der fürsorglichen Zuwen-dung einiger Dörfler gelingt es ihm, zu einem erfolgreichen Mann heranzuwachsen und eine Familie zu gründen. Dann fallen die Bomben, und das Glück findet ein jähes Ende. Als Martins Sohn Kaspar Jahre später aus der amerikanischen Kriegsgefangenschaft zurück-kehrt, steht er fassungslos vor den Trümmern seines Elternhauses, und obwohl auch er sich bemüht, sein Leben zum Guten zu wenden, gerät es zu einer Achterbahnfahrt: Er betätigt sich als Schwarzmarkthändler, schuftet in der Brikettfabrik und verfällt als Brauereiarbeiter dem Alkohol. Eine Leiche, die eines Tages vor seinem Wohnhaus gefunden wird, weckt grausame Erinnerun-gen. Es ist nicht der erste geheimnisvolle Tote im Umfeld seiner Familie. Kaspar sieht keinen anderen Ausweg, als im zwielichtigen Milieu der Dürener Nordstadt unterzutauchen …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Vom Autor bisher bei KBV erschienen:
Es wird jemand sterben
Herbert Pelzer, geb. 1956, lebt und schreibt auf dem platten Land vor den Toren Kölns. Zuletzt hat er bis zum Frühjahr 2020 in der Film- und Fernsehausstattung gearbeitet, daneben widmet er sich seit einigen Jahren dem Schreiben.
Seit 2008 verfasst er Beiträge zur Regionalgeschichte, 2017 erschien mit Durch die Jahre sein Debütroman. 2021 veröffentlichte er bei KBV Es wird jemand sterben, die erste Kriminalerzählung, die – wie viele seiner Texte – in die Nachkriegszeit seiner Heimat, der Voreifel, führt.
HERBERT PELZER
NIEMAND
Roman
Originalausgabe
© 2022 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheim
www.kbv-verlag.de
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0 65 93 - 998 96-0
Umschlaggestaltung: Ralf Kramp
unter Verwendung von © Herbert Pelzer
Lektorat: Volker Maria Neumann, Köln
Print-ISBN 978-3-95441-608-0
E-Book-ISBN 978-3-95441-618-9
Für Rhodin, Amrei und Rike
Da sind die bleichen Geister wieder,Die Schatten längst vergangner Zeit,Sie singen düstre, wilde Lieder,Und zeigen auf ihr blutig Kleid.
Max Waldau
Inhalt
Prolog
Die erste Generation.
1. KAPITEL Feldmann
2. KAPITEL Der Krieg und der Birnbaum
3. KAPITEL Blutbrot
4. KAPITEL Liam Parsons
5. KAPITEL Anni
6. KAPITEL Vom Leben und Sterben
7. KAPITEL Zeitenwende
8. KAPITEL Unergründliche Wege
9. KAPITEL Zu den Waffen
Die zweite Generation.
10. KAPITEL Freie Männer
11. KAPITEL Die Organisatoren
12. KAPITEL Altes und neues Geld
13. KAPITEL Frost im Rosenbeet
14. KAPITEL Der oder ich
15. KAPITEL Rosemarie Ramisch
16. KAPITEL Das Lächeln im Sonnenschein
17. KAPITEL Der schöne Forello
18. KAPITEL Zelle sechs
19. KAPITEL Der Kohlenkeller
EPILOG
PROLOG
Sein Kopf schien ihm eine unförmige, taube Masse zu sein. Jedes Gefühl, jede Empfindung war von dem höllischen Schmerz überlagert, der sich mitten in der Nacht in ihm ausgebreitet hatte. So musste es sich anfühlen, wenn der Satan höchstselbst in einen menschlichen Körper einfuhr.
Seit Wochen schon wusste er um den kranken Zahn in seiner Backe, sein fauliger Atem hatte es ihm verraten. Mit weit aufgerissenem Maul hatte er vor dem Spiegel gestanden und umständlich seinen Kopf verrenkt, um das vermaledeite Ding zu betrachten. Groß und pechschwarz steckte es in seinem rosigen Zahnfleisch, doch damals hatte er noch keinen Schmerz verspürt und darum beschlossen, das Geld für den Zahnarzt wie gewohnt in Schnaps zu investieren. Sollte das schwarze Ding sich melden, konnte er immer noch den Weg nach Kerpen zum Zahnarzt antreten.
Den Haferbrei zum Frühstück hatte er nicht angerührt, speiübel ist ihm gewesen, seine Augenlider brannten, und der Schmerz drohte ihm den Verstand zu rauben. Sofort nachdem er die Kühe gemolken hatte, war er zum Bauern gegangen und hatte ihn gebeten, den Zahnarzt aufsuchen zu dürfen.
»Du lieber Gott, wie siehst du aus? Man könnt glauben, ein Toter steht vor einem«, hatte der Bauer gesagt.
Bis zum Mittag dürfe er wegbleiben, das solle ausreichen, wenn er an den Gasthäusern vorüberginge und auch sonst nirgendwo einkehre. Mit dieser Mahnung hatte der Bauer ihn fortgeschickt, und Johann Kreutzer war in seine alten Stiefel gesprungen und vom Hof geeilt.
Draußen vor dem Dorf blies ihm ein eisiger Nordwind ins Gesicht. Wege und Felder waren unter einer zarten Schneedecke verborgen, der Himmel spannte sich als ein blassgraues Nichts über die Szenerie. Mit ausholenden Schritten strebte er dem gut sieben Kilometer entfernten Ort Kerpen zu. Es war zu der Zeit, als in Düsseldorf die hochschwangere Emmi Gründgens der Geburt ihres Sohnes Gustav entgegensah und Kaiser Wilhelm II. in Berlin vor einem lodernden Kaminfeuer saß und von leicht bekleideten Schönheiten in der Südsee träumte. In wenigen Tagen würde das neue Jahrhundert beginnen, das ein Durchbruch der Moderne werden sollte. Der Stallknecht Johann Kreutzer verschwendete an solch epochale Ereignisse keinen Gedanken, sein Sinnen war auf die Stelle in seinem Mund fixiert, an der der schmerzende Zahn saß.
Gleich nachdem er die Gebäude von Gut Ving passiert hatte, führte ihn der Weg in einem sanften Schwenk nach rechts geradewegs auf Kerpen zu. Frischer Schnee knirschte unter seinen Schritten, Pfützen waren mit einer milchig weißen Eisschicht bedeckt. Zu seiner Rechten stießen in einiger Entfernung die Schornsteine der Brikettfabrik Hubertus dunklen Rauch in den Himmel, Kreutzers Blick war fest auf sein Ziel gerichtet. Er war noch nicht weit gekommen, als ihm drüben bei den kahlen Büschen an der Wegkreuzung etwas auffiel. Dort lag was auf dem Boden, noch konnte er nicht erkennen, was es war, doch als er näher herangekommen war, schien es ihm, als ob es sich bei dem Ding um eine Kiste handelte. Dann erkannte er es, es war ein Korb, groß wie eine Weinkiste, mit einem gebogenen Henkel daran. Als er das Ding fast erreicht hatte, glaubte er, es wäre bis obenhin mit Lumpen gefüllt. Schließlich stand er neben dem Korb und wollte schon weitergehen, als er bemerkte, dass es keine Lumpensammlung, sondern eine saubere Wolldecke war. Sein Zahn schmerzte, er musste sich sputen, doch die Decke sah gut aus, sie schien neu zu sein. Dann trat er näher und strich mit der Hand darüber, sie war weich und trocken. Neugierig sah er sich um, niemand war zu sehen. Mit seinen schwieligen Fingern rieb er sich das unrasierte Kinn, eine solche Decke besaß er nicht, es wäre zu schade, sie hier jemand anderem zu überlassen.
Dann beugte er sich noch einmal hinunter und befühlte sie erneut. Vorsichtig steckte er seine Hand in den Korb, hob die Decke ein wenig an – und prallte zu Tode erschrocken zurück. In der Tiefe des Korbes tauchte das rosige Köpfchen eines neugeborenen Säuglings auf. Wie vom Donner gerührt stand er da und betrachtete das Kind, es hatte die Augen geschlossen und gab keinen Laut von sich. Sein Herz schlug wie verrückt, noch einmal sah er sich um, menschenleer und mucksmäuschenstill lag die winterliche Feldflur um ihn herum da.
Vielleicht ist es tot, schoss es Schang, wie er von allen genannt wurde, durch den Kopf. Teufel noch mal, ausgerechnet heute musste das geschehen. Für einen kurzen Moment war der Schmerz in seinem Kopf vom Schrecken verdrängt worden, tausend Gedanken gleichzeitig wirbelten darin wie toll durcheinander. Was sollte er tun? Ein toter Säugling lag hier zu seinen Füßen, er musste Hilfe holen, die Gendarmen und der Pfarrer mussten benachrichtigt werden. Mit Mühe bezwang er seine Panik. Und plötzlich fiel ihm ein weiterer Gedanke direkt vor die Füße: Vielleicht ist das Kind ja gar nicht tot. Noch einmal beugte er sich zum Korb hinab, befühlte mit seinen Fingerspitzen das Köpfchen und zuckte zurück. Es war warm. Noch immer hielt das Kind die Augen geschlossen, doch jetzt begann sein kleiner Kiefer ganz leicht zu zittern – und Speichelbläschen zeigten sich zwischen den blassen Lippen.
In dieser Sekunde erfasste Schang Kreutzer die Situation in voller Klarheit. Intuitiv begann er zu handeln; er entnahm dem Korb den Säugling mitsamt der wollenen Decke, öffnete seine Lodenjacke, die nach Kuhstall roch, und verbarg das Bündel darunter. Schneller als er bisher unterwegs gewesen war, eilte er zum Dorf zurück. Soweit es sein alter Körper zuließ, verfiel er in einen schwerfälligen Laufschritt. Als er an Gut Ving vorüberhastete, vergab er die Gelegenheit, das Kind bereits hier in die Wärme zu bringen. Schon tauchte der Kirchturm vor ihm auf, bald war er am Ziel, das Atmen fiel ihm schwer, helle Nebelschleier bildeten sich vor seinem Mund. Einmal wäre er um ein Haar auf einer zugefrorenen Pfütze ausgerutscht, Schweißperlen traten auf seine Stirn, während er mehr und mehr die Wärme des Menschleins an seiner Brust verspürte.
Der gusseiserne Ofen bollerte, behagliche Wärme breitete sich im Raum aus. Dichte Rauchschwaden waberten um den Kopf des Pfarrers, der bequem in seinem Lehnstuhl saß und die obligatorische Morgenpfeife paffte. Wie so oft zu dieser Stunde ruhte er ein wenig und dachte dabei über den Lauf der Welt nach. Die Kälte während der Frühmesse in der ungeheizten, feuchten Kirche steckte ihm noch in den Knochen, und obwohl er seine Zehen in den dicken Filzpantoffeln ständig bewegte, waren sie immer noch nicht warm geworden. Genüsslich tat er einen weiteren Zug an seiner Gesteckpfeife mit dem gedrechselten Holm und dem hübsch bemalten Pfeifenkopf aus weißem Porzellan, als es an der Tür klopfte.
»Was denn?«, rief er unwirsch. Die Haushälterin wusste doch um seinen ausdrücklichen Wunsch, zu dieser Stunde nicht gestört zu werden.
Zaghaft wurde die Klinke gedrückt, ihr fülliger Oberkörper erschien im Türspalt. »Entschuldigen Sie bitte, aber der Schang steht draußen. Mit einem Kind.«
Immer noch in die wollene Decke gewickelt, lag das Kind bald auf dem schweren Eichentisch in der Küche des Pfarrhauses. Vier Augenpaare schauten auf das kleine Bündel herab, die Sache war von höchster Dringlichkeit, weshalb man eiligst nach dem Bürgermeister geschickt hatte.
»Das lag da, in einem Korb, und kein Mensch war zu sehen«, berichtete Kreutzer.
Das Kleine hatte unterdessen seine Augen geöffnet, verzog das Gesichtchen und begann mit schriller Stimme zu schreien. Behutsam nahm die Haushälterin es auf, wiegte es in ihren Armen und sprach ihm beruhigend zu. Die Männer beobachteten sie mit ernster Miene.
»Wir müssen es so schnell wie möglich der Fürsorge übergeben«, entschied der Pfarrer, und niemand widersprach.
Das Kind ließ sich nicht beruhigen, sein Schreien schien den ganzen Raum zu erfüllen, weshalb der Bürgermeister sehr laut wurde, als er sagte: »Es gehört in ein Waisenhaus, wenigstens so lange, bis man die Mutter ausfindig gemacht hat.«
Wäre in diesem Moment nicht der Stallknecht Johann Kreutzer eingeschritten, dann wäre das Kind wohl tatsächlich in eines der völlig überfüllten Waisenhäuser der Umgebung gebracht worden. Wo es wie all die bedauernswerten Kinder dort unter den herrschenden Missständen zu leiden gehabt hätte. Später würde Schang sich fragen, woher er den Mut genommen hatte, sich gegen die Honoratioren des Dorfes zu stellen. Doch er tat es, und bis zum Ende seines langen Lebens sollte ihn dies mit Stolz erfüllen.
»Das Kind sollte im Dorf bleiben. Wegen der Mutter, die ist bestimmt hier ganz aus der Nähe«, gab er zu bedenken, und der Bürgermeister sah ihn erstaunt an.
Dann richtete er seine kleinen Äuglein unter den buschigen Brauen auf den Pfarrer, der seine Brille abnahm und auf das Kind blickte. Er dachte nach, während seine Haushälterin mit dem immer noch greinenden Kind vor dem Küchentisch auf und ab ging.
Schließlich setzte der Pfarrer seine Brille wieder auf, räusperte sich und verkündete: »Wir geben es einstweilen den Kroppens, zumindest bis seine Mutter ausfindig gemacht werden kann, was uns mit Gottes Hilfe gelingen möge.«
Die schmale Gasse führte von der Dorfstraße abzweigend nach Westen hinaus in die Felder. Im Sommer wirbelte hier der einfallende Wind den Staub auf und blies ihn durch jede noch so kleine Ritze. Im Frühjahr und Herbst verwandelte der Regen die Gasse in eine morastige Piste, in der die Dörfler knöcheltief durch den wässrigen Schlamm wateten. Jetzt im Winter war der Boden hart gefroren. Fast am Ende der Gasse, gleich vor einer windschiefen Scheune, in der sich zu allen Jahreszeiten die Ratten und Marder und anderes Getier tummelten, lag das kleine Tagelöhnerhaus. Eine dünne Rauchfahne kräuselte sich über dem Kamin, als die dreiköpfige Delegation vor dem Haus eintraf. Aus einem schäbigen Verschlag an der Giebelseite drang das heisere Meckern einer Ziege. Der Bürgermeister trug ein wenig unbeholfen den Säugling in seinen Armen, der Pfarrer hielt sich dicht hinter ihm, und Johann Kreutzer war trotz seiner immer noch infernalischen Zahnschmerzen nicht davon abzubringen gewesen, die beiden zu begleiten. Auf ihr Klopfen öffnete sich die Brettertür sofort. Mit einem leisen Knarzen in den Angeln gab sie den Blick frei in die im Halbdunkel liegende Behausung.
Gerald Kroppen war genau wie seine Vorfahren Tagelöhner, stinkend faul und gewalttätig. Das Haus hatte er von seinem Vater übernommen, der es wiederum von seinem bekommen hatte. Sie alle waren die erstgeborenen Söhne gewesen, weshalb sie jeweils den Besitz geerbt hatten, der aus nichts weiter als dieser Bruchbude bestand. Nachdem er die mittellose Magd Gudula aus dem Nachbarort geheiratet hatte, hatte er ihr in den vergangenen 16 Jahren zwölf Kinder gemacht, wovon drei jeweils noch vor dem Erreichen des ersten Lebensjahres verstorben waren. Für die Überlebenden bedeutete ihre Herkunft drei Generationen schwieriger Familiengeschichte mit bitterer Armut, Gewalt und Alkoholmissbrauch. Erst wenige Tage zuvor hatten Gerald und Gudula wieder einmal ihr jüngst geborenes Kind der kalten Erde übergeben müssen, es war ein Mädchen gewesen, und seitdem betäubte Gerald seinen Schmerz schon vom frühen Morgen an mit billigem Fusel.
»Wir wollen zu deinem Vater«, sagte der Bürgermeister zu Kroppens ältester Tochter Klara, die scheu hinter der Tür hervorlugte. Wortlos gab das Mädchen den Weg frei. Durch das einzige Fenster drang nur spärliches Licht in den Raum, der Küche, Wohnraum und Schlafstube zugleich zu sein schien. Schwer hing der üble Geruch von Kohl, vergorener Milch und menschlichen Ausdünstungen in der Luft. Gudula war nicht zu sehen. Gerald saß auf einem abgewetzten Kanapee, ein Mädchen in einem schmutzigen Kleid stand am Herd und rührte unbeteiligt in einem rußgeschwärzten Topf herum.
»Guten Morgen, Gerald«, ergriff der Pfarrer das Wort, »wir sind gekommen, um dir etwas mitzuteilen.«
Aus trüben Augen glotzte der Angesprochen die Besucher an, die Flasche auf dem Tisch vor ihm war halb leer.
»Wir haben beschlossen, dieses Findelkind«, er deutete auf das Bündel in den Armen des Bürgermeisters, »in deine Obhut zu geben. Zunächst so lange, bis man die Mutter ausfindig gemacht hat. Niemand kann sagen, wann das sein wird.«
»Was haben Sie?«, stammelte Gerald, sein Griff ging zur Flasche, doch der Pfarrer war schneller. Mit einer raschen Bewegung nahm er sie an sich und erklärte dem Trunkenbold die Situation, als spräche er mit einem Kind. Es sei wegen Gudula, der nach dem unergründlichen Willen des Herrn ihr Neugeborenes noch im Kindbett verstorben war und die darum nun in der Lage sei, dieses verlorene Menschenkind, wieder deutete er auf das Bündel in des Bürgermeisters Armen, an ihre Brust zu legen. Es sei die Pflicht eines jeden Christenmenschen, sich dem Wunsche des Herrn zu beugen. Dann sah er auf die Flasche und übergab sie mit einem Kopfnicken an Kreutzer, der in der offenen Tür stand. Er nahm sie an sich, wandte sich ab, tat einen Schritt vor das Haus und trank einen letzten Schluck aus der Flasche, bevor er den restlichen Inhalt in den schmutzigen Schnee goss.
»Trunksucht ist eine schwere Sünde, Gerald, vergiss das nicht!«, mahnte der Pfarrer, dann wollte er wissen, wo Gudula sei, worauf Gerald stumm zur Türe in den Nebenraum wies. Der winzige Raum war mit dem Ehebett, einer schweren Kommode und einer Kinderwiege vollgestopft. In der Ecke lag ein Stapel fadenscheiniger Decken auf einem Strohsack. Gudula lag im Ehebett, ihr Gesicht war schweißnass, das ungekämmte Haar klebte ihr in wilden Strähnen am Kopf. Der Bürgermeister trat ein in den Raum, in dem es noch dunkler war als in dem anderen, und hielt Gudula das Kind entgegen. Müde schaute sie das Bündel an, betrachtete interessiert die saubere wollene Decke, doch sie machte keine Anstalten, sich aufzurichten und das Kind an sich zu nehmen.
»Für Gottes Lohn kann ich es aber nicht tun«, brachte Gerald hervor, der jetzt hinter dem Pfarrer im Türrahmen erschien.
»Nun, wir haben beschlossen, dir aus der Armenkasse den Betrag von einer Mark per Monat zu zahlen«, flötete der Pfarrer jovial, während er sich Gerald zuwendete.
»Ich will zwei!«
»Du unverschämter Crétin wagst es, Forderungen zu stellen? Hüte deine Zunge, sonst sorge ich dafür, dass du keinen einzigen Pfennig bekommst!« Laut wie ein Donnerschlag erfüllte die zornige Stimme des Pfarrers den Raum. Mit hochrotem Kopf starrte er den verschüchterten Gerald an.
Der schien etwas erwidern zu wollen, doch schließlich gab er nach »Nimm es!«, blaffte er Gudula an und schlurfte zurück zum Kanapee.
Schon zwei Tage später, am 22. Dezember des Jahres 1899, am gleichen Tag, an dem im fernen Düsseldorf Emmi Gründgens ihren Sohn Gustav in Steißlage gebar, an einem klirrend kalten Freitag, wurde das Findelkind getauft. Gerald Kroppen war es tatsächlich gelungen, seit der Ermahnung durch den Pfarrer vom Alkohol zu lassen. Zwei Tage wütende Prügel bei jeder Gelegenheit hatte das für die Familie bedeutet. Ohne Rücksicht auf Alter und Geschlecht waren die Kinder hart geschlagen worden. Niemand war vor seinem Zorn sicher, und am Abend hatte Klara auf ihrem Nachtlager liegend darum gebetet, dass der Vater doch bald wieder trinken möge. Gekleidet in der einzigen Kleidung, die sie besaßen, notdürftig mit viel zu dünnen Jacken und Mänteln, verfilzten Mützen und Schals vor der grimmigen Kälte geschützt, zogen die Kroppens über den gefrorenen Morast in ihrer Gasse hinunter zur Kirche. Die sechsjährige Klara vertrat ihre Mutter, die noch immer geschwächt im Kindbett lag. Sie ging voran, trug den Säugling sicher in ihren Armen, während die Geschwister und ein grimmig dreinblickender Vater ihr in einigem Abstand folgten. Drüben beim Dorfweiher erschallten die Rufe der Kolkraben in den kahlen Baumwipfeln. Geduldig warteten die pechschwarzen Vögel auf die Lämmer, die zu dieser Zeit geboren wurden und nach der Überlieferung nur allzu oft ihre leichte Beute wurden.
Das Findelkind war ein Knabe, sie tauften es auf den Namen Martin Niemand, und von der ersten Mark, die Gerald Kroppen aus der Armenkasse erhielt, kaufte er noch am gleichen Tag eine Flasche Schnaps.
Die erste Generation.
1. KAPITEL
Feldmann
Wie an jedem Abend lief die alte Moni voran, und alle anderen folgen ihr in immer gleichem Trippelschritt. Strahlend hell wie der Vollmond sei ihr Fell, hatte der Großvater bei ihrer Geburt gesagt, weshalb seine Enkel dem Zicklein sofort den Namen Moni gaben. Mittlerweile hatte sie selbst schon einige Zicklein geboren und gab ihren Besitzern schon seit vielen Jahren zuverlässig an jedem Abend ihre fette Milch. Die kleine Herde näherte sich dem Dorf vom Teufelsmaar her, hierhin trieb sie der Junge immer erst am späten Nachmittag. Die besten Kräuter sollten sie erst ganz zum Schluss bekommen. 23 Ziegen zogen jetzt vor ihm auf das Dorf zu, köttelten auf den staubigen Feldweg, und wie immer achtete der Junge darauf, dass seine Schuhe sauber blieben.
Hinter dem Dorf stand die Sonne schon tief, ihr grelles Licht ließ die schwarz glasierten Dachpfannen auf den Dächern der exakt 87 Wohnhäuser glänzen. In etwa zwei Stunden würde es dunkel sein, das wusste der Junge, und wie an jedem Tag würde er müde und hungrig auf sein Nachtlager sinken. Das Dorf, sein Dorf, lag umgeben von Feldern und Wiesen in der flachen Börde, die so flach war, dass man bei gutem Wetter die Eifel und in der entgegengesetzten Richtung das Siebengebirge ausmachen konnte. Der stramme Westwind nahm über die freie Ebene derart an Kraft zu, dass er in jedem Herbst und Frühjahr schwarz glasierte Dachpfannen durch die Luft wirbeln und an Mauern und auf Wegen zerplatzen ließ. Die meisten Dorfbewohner waren Bauern – mit einer Reihe schmaler Ackerparzellen um das Dorf herum, einer Handvoll dünner Kühe, ein paar Schweinen und Hühnern im Stall und einem brutal harten Tagwerk, das sie früh altern und schon bald sterben ließ. Daneben gab es die Handwerker: den Schreiner, den Schmied, den Metzger, den Bäcker, den Schuster und noch andere mehr. Jedes Gewerk war vertreten, und genau wie die Bauern, so schufteten auch sie von früh bis spät, ohne mehr als nur ein paar Mark auf ihrem Konto bei der Raiffeisenkasse zu besitzen.
Ganz unten in der Hierarchie standen die Tagelöhner. Ohne Besitz, ohne Bildung und ohne jede Chance, ihre Situation zu verbessern. Sie alle ertrugen ihre Armut mit Gelassenheit, in dem festen Glauben an die von Gott gewollte Form ihres Daseins. Dem Kaiser und dem lieben Gott schuldete man Gehorsamkeit, jeder an seinem Platz, ein Leben lang.
Bald hatte Moni die ersten Häuser des Dorfes erreicht. Hier und da bröckelte der Lehmputz zwischen den Fachwerkbalken von den Wänden, vor denen alte Männer mit runzelig gewordener Haut und zahnlosen Mündern auf groben Holzbänken saßen, um die letzten wärmenden Sonnenstrahlen des Tages aufzunehmen. Jede Ziege kannte den Weg in ihren Stall. Nach und nach verließen sie die kleine Herde, um durch die offenstehenden Hoftore zu ihrem Besitzer zurückzukehren.
In der Mitte des Dorfes, wo die Wasserpumpe neben dem alten Kastanienbaum stand, dort scherten die beiden Gescheckten aus. Mit lautem Gemecker eilten sie ihrem Stall zu, und der Junge wollte schon weiterziehen, als er ihnen nachsah und stutzte. In der Hofeinfahrt lag ein Hund auf dem Boden, er winselte laut und schien nicht mehr auf die Beine zu kommen. Vor ihm stand der Bauer, er war aufgebracht, immer wieder stieß er das Tier mit seinen groben Stiefeln an. Neugierig ging der Junge näher heran.
»Los, auf mit dir«, brüllte der Bauer, doch der braune Mischlingsrüde hob nur seinen Kopf und winselte kläglich.
»Was ist mit ihm?«, wollte der Junge wissen.
Der Bauer sah ihn kurz an, dann wendete er sich wieder dem Hund zu, stieß ihn noch einmal, jetzt schon kräftiger, mit der Stiefelspitze an und sagte: »Er ist mir vor die Karre gelaufen, ein Rad hat ihn überrollt. Sieht so aus, als hätt’ er sich was gebrochen.«
Als der Hund seinen Kopf wieder auf den schmutzigen Boden abgelegt hatte, scharrte er – anscheinend vom Schmerz gequält – mit den Vorderläufen. Sein Hinterteil lag völlig reglos da, ein Bein war unnatürlich verdreht.
»Los! Mach, das du wegkommst«, herrschte der Bauer den Jungen an, dann ging er hinüber zum Stall und langte nach der schweren Schaufel, die dort an die Wand gelehnt stand.
Der Junge begriff sofort. »Das dürfen Sie nicht, er wird bestimmt wieder gesund«, ging er den Bauern an, doch der stellt sich in Position, bereit zum Zuschlagen. »Ich nehm ihn mit, ich kümmer mich um ihn«, bettelte der Junge. Mit einem Satz war er vor das Tier gesprungen, hielt die Arme ausgebreitet und sah den Bauern flehend an.
Der zögerte, dann ließ er ab von seinem Vorhaben. Langsam wich die Härte aus seinem Gesicht, ein feines Grinsen zeigte sich sogar darin, als er sagte: »Meinetwegen kannst du ihn mitnehmen, auf einen Hungerleider mehr oder weniger kommt es bei Kroppens jetzt auch nicht mehr an.« Damit ließ er den Jungen stehen. Sein rauer Husten drang neben dem warmen Muhen der Kühe aus dem Stall, als der Junge den Hund vorsichtig aufnahm und davontrug.
Die alte Scheune stand schon so lange dort, wie er denken konnte. Gleich hinter ihrem Haus, am Ende der Gasse, war das windschiefe Gebäude zum Schandfleck für das Dorf geworden. Das Dach hing durch, an mehreren Stellen fehlte die Eindeckung, und der verbretterte Westgiebel war so löchrig, dass Regen und Schnee ungehindert eindringen konnten. Behutsam legte Martin Niemand den verletzten Hund auf einem alten Lumpen ab, den er über einem Haufen faulen Strohs ausgebreitet hatte. Regungslos blieb das Tier dort liegen, sah seinen Retter mit großen Augen an und winselte unentwegt vor sich hin. Da versuchte Martin ihn abzutasten, doch der Hund jaulte laut auf und schnappte nach seinen Händen.
Später behielt Martin eine Handvoll Brei von seinem spärlichen Abendmahl zurück, hockte sich in der Scheune vor das verletzte Tier und hielt ihm den Brei unter die Nase. Der Hund schnupperte daran, zögerte nur kurz und schleckte dann Martins Hand gierig bis auf den letzten Krümel ab. Auch vom Regenwasser, das Martin ihm in der alten Emaille-Schüssel anbot, trank er. Mit niemandem im Haus hatte der Junge über den Hund gesprochen, sie würden es nicht dulden, darum wollte er ihn hier versteckt halten, bis er wieder gesund war.
Behutsam streichelte Martin den Kopf des Hundes; er befürchtete, dass der braune Rüde schwer verletzt war. Vermutlich hatte das eisenbeschlagene Rad der Karre seine Hüfte zertrümmert, vielleicht aber auch nur ein Bein gebrochen. Um ganz sicher zu sein, wollte er ihn am nächsten Morgen ganz früh zum alten Schang bringen. Schang mochte ihn, das wusste Martin. Jedes Mal, wenn sie sich im Dorf begegneten, lächelte der Alte den Jungen an, grüßte freundlich, und manchmal zwinkerte er ihm sogar zu. Hin und wieder saßen sie am Abend gemeinsam auf der Bank am Dorfrand und blickten schweigend hinaus auf die Felder. Dann tat Schang einen kräftigen Schluck aus seiner Schnapsflasche und begann, über die großen und kleinen Geheimnisse der weiten Welt da draußen und über die schreiende Ungerechtigkeit zu reden, die sich wie ein hässliches Geschwür unter der Menschheit ausgebreitet hatte. Martin saß daneben, folgte aufmerksam seinen Worten, während er in das runzelige Gesicht des alten Mannes blickte, und registrierte fasziniert, wie viel Wissen ein Mensch in einem langen Leben anzuhäufen vermochte. Darum vertraute Martin dem alten Knecht, der ständig nach Kuhstall roch und über den manche Leute lachten, weil sie den alten Trunkenbold für dumm hielten. Schang ist schlau, dachte Martin, er wird es schaffen, er wird mir helfen den Hund wieder auf die Beine zu bringen.
Martin Niemand war jetzt zwölf Jahre alt; dass er eigentlich nicht zu den Kroppens gehörte, wusste er schon immer. Warum er trotzdem bei ihnen lebte, das hatte ihm bis zu diesem Tag allerdings noch niemand gesagt. Finstere Vermutungen hatten sich in seinem Kopf eingenistet. Vielleicht waren seine Eltern tot oder krank und konnten sich darum nicht um ihn kümmern. Oder, und diese Vorstellung war die Furchtbarste von allen, sie hatten ihn nicht gewollt. Die Ungewissheit nagte an seiner kleinen Seele, und irgendwann hatte er sich getraut, danach zu fragen. Doch anstelle einer Antwort hatte er Prügel bekommen.
»Du bist jetzt hier, und gut ist!«, hatte Gerald Kroppen Martin angebrüllt, nachdem er mit einem Holzprügel auf ihn eingedroschen hatte. Wenn Martin seinen Ziehvater ansprach, dann sagte er wie von ihm verlangt, so wie alle anderen Kinder auch, Vater zu ihm. Doch in seinem Kopf war dieser Mensch immer nur der Kroppen. Kroppen! Der leibhaftige Teufel, der Martin ebenso erbarmungslos schlug, wie er seine leiblichen Kinder schlug. Der trank, bis er das Bewusstsein verlor. Der seine Frau ins Grab gebracht hatte, weil er auch sie brutal schlug, ohne Rücksicht auf ihre Gebrechlichkeit, die eine Folge ihrer vielen Schwangerschaften war. Vierzehn Kindern hatte sie das Leben geschenkt, davon waren drei schon im Säuglingsalter verstorben. Ihr Letztgeborenes war neun Jahre zuvor sofort nach der Geburt gestorben. Winzig klein und blau wie ein neugeborenes Kaninchen hatte der Junge auf dem blutigen Laken gelegen. Noch bevor sie die Nabelschnur durchtrennt hatte, hatte die Hebamme nach dem Pastor geschickt, doch ehe der das Tagelöhnerhaus erreicht hatte, war der Kleine schon tot. Obwohl Kroppen auch jetzt nicht von ihr abließ, war das ihre letzte Schwangerschaft gewesen. Fünf Jahre später, im Alter von 44 Jahren, war Gudula Kroppen dann plötzlich an einem nebligen Novembertag verstorben.
Heute, an diesem schönen Sommertag im Jahr 1912, dem Jahr, in dem seine Majestät Kaiser Wilhelm II. nun schon seit 24 Jahren über dieses Land herrschte, lebten neben Martin nur noch der schwachsinnige Anton und die älteste Tochter Klara im Haus. Alle anderen Kinder hatten es schon sehr früh verlassen. Die älteren Töchter hatten jung geheiratet, lebten in den Dörfern der näheren Umgebung und hatten mittlerweile selbst schon eine beachtliche Schar eigener Kinder bekommen. Die beiden Söhne Friedrich, den sie Fritz nannten, und Karl hatten trotz ihres bekannt schlechten Elternhauses eine Arbeit als Knechte bei einem der größeren Bauern in der Umgebung gefunden. Die jüngsten Töchter, 17 und 15 Jahre alt, waren nach Euskirchen gezogen, hatten ein kleines Zimmer in einer schäbigen Mietskaserne bezogen und schufteten als ungelernte Arbeiterinnen in einer Tuchfabrik. Alle waren sie bestrebt gewesen, dem erbärmlichen Leben im Tagelöhnerhaus, mit all dem Schmutz und Elend, mit all seiner Gewalt und Trostlosigkeit, so früh wie möglich zu entkommen, und waren letzten Endes doch nur von einer Hölle in die nächste geschliddert.
Nachdem der Bürgermeister Gudula Kroppen das Findelkind vor zwölf Jahren in die Arme gelegt hatte, hatten alle Bemühungen, seine leibliche Mutter zu finden, keinen Erfolg gebracht. Weder dem Pfarrer noch den Gendarmen war es gelungen, etwas in Erfahrung zu bringen. Der Bürgermeister hatte nur ratlos mit den Schultern gezuckt, was sollte er auch unternehmen, wenn niemand etwas von einer schwangeren Frau wusste, die entbunden hatte, ohne danach einen Säugling bei sich zu haben? In der ganzen Gegend forschte man nach einer solchen Person, gefunden hatte man sie nicht.
Selbst Jüdd Laib, der tagein, tagaus über Land zog und Viehhandel betrieb, konnte nicht helfen. Dabei war er oft derjenige, der die Neuigkeiten als Erster erfuhr und in Windeseile verbreitete. Er wusste, wer gestorben war und wer ein Kindlein bekommen hatte. Doch damals, im Dezember 1899, hatte er sich beim besten Willen nicht an eine Schwangere ohne Säugling erinnern können. Schließlich drängte sich die Vermutung auf, dass Martins Mutter keine Hiesige gewesen sein konnte. Vermutlich gehörte sie dem fahrenden Volk an, das rastlos umherzog und den Leuten die Wäsche von der Leine und die Hühner aus dem Stall stahl. Ohne Skrupel wird sie das Kind ausgesetzt haben und spurlos verschwunden sein. Zu dieser Überzeugung gelangten Bürgermeister und Pfarrer, nachdem man bis in das nächste Frühjahr hinein nach ihr gesucht hatte. Darum beschloss man, den Jungen einfach bei den Kroppens zu belassen.
So wuchs Martin im Tagelöhnerhaus heran. Als ungeliebtes Anhängsel, als lästige Begleiterscheinung in einer Familie, die getrost als katastrophaler Misserfolg bezeichnet werden konnte. Gudula Kroppen verbrachte ihre Tage einem willenlosen Zombie gleich zwischen Herd, Waschzuber und Wochenbett. Ständig umringt von ihrer hungrigen Kinderschar, die sie doch niemals satt bekam und die sich um das bisschen Liebe und Zuneigung balgte, die Gudula zu geben in der Lage war. Die Größeren schlugen die Kleineren, die Stärkeren nahmen den Schwächeren ihr Brot weg, während Gerald sie alle schlug, ohne jede Rücksicht bei den Mahlzeiten die größte Portion verschlang und Gudula sich mit dem begnügen musste, was er ihr übrig ließ. Immer wieder ging Gerald den Pfarrer um zusätzliches Geld an, Geld für Kleidung, Geld für Nahrung. Stets sollte es für Martin sein, doch von dem Wenigen, das der Pfarrer zu geben bereit war, wurden niemals auch nur ein paar Pfennige für den ungeliebten Bastard ausgegeben. Das Meiste vertrank Gerald sofort, und von dem, was übrig blieb, kaufte Gudula beim Lumpenkrämer gebrauchte Kleidung für ihre eigenen Kinder. Bis diese dann endlich von Martin getragen wurde, war sie zigfach notdürftig hergerichtet und machte ihn so auf der Straße für jeden sofort als Armeleutekind kenntlich.
Doch obwohl Martin unter solch erbärmlichen Bedingungen aufwuchs, entwickelte er sich gut. Wo Kroppens Kinder krumm und mit gesenktem Kopf daherkamen, wuchs er zu einem hoch aufgeschossenen Kerl mit gerader Körperhaltung und klarem Blick heran. Wo Kroppens Kinder begriffsstutzig und einsilbig waren, bewies er einen klaren Verstand und Redegewandtheit. Gierig sog er auf, was Klara und der alte Schang ihm an Wissen vermittelten. Klara war sechs Jahre älter als Martin und im Tagelöhnerhaus die Einzige, die ihm zugetan war. Wenn Kroppen ihn mit Essensentzug strafte, steckte sie ihm heimlich etwas von ihrer Ration zu. Wenn Martin krank war, pflegte sie ihn fürsorglich. Wenn er sich abends auf seinem Nachtlager in den Schlaf weinte, kam sie zu ihm, nahm ihn in ihre Arme und trocknete seine Tränen. Sie lehrte ihn das Sprechen, das Laufen, Zählen bis 100 und das Alphabet. Martin verehrte sie wie eine Heilige, sie und Schang waren die einzigen Menschen, denen er vertraute.
Dann kam dieser sonderbare Tag im November 1907. Es war der Tag des heiligen Martinus, der Tag, an dem die Knechte und Mägde und auch die Tagelöhner von den Bauern ihren Jahreslohn erhielten. Gerald Kroppen hatte in diesem Jahr für seine Verhältnisse viel gearbeitet, weshalb er mit einer recht erklecklichen Menge Geld nach Hause kam. Er war angetrunken, und betatschte Gudulas Hintern, bevor er sich auf das alte Kanapee schmiss und einen lauten Furz ließ.
Das Abendmahl verlief an diesem Tag ohne den sonst üblichen Streit zwischen Gerald und Gudula. Ohne dass er herumbrüllte und ohne seine gefürchteten Ohrfeigen an die Kinder zu verteilen, schlang Gerald sein Essen hinunter. Er war bester Laune, das Geld lag auf dem Tisch, und nachdem er gegessen und getrunken hatte, verkündete er, was davon angeschafft werden sollte. Eine neue Hose für Anton, ein Arbeitskittel für Gudula, Klaras Schuhe sollten geflickt werden, »und der«, dabei zeigte er mit der Flasche in der Hand auf Martin, » der geht ab morgen in die Schule.«
Alle schauten auf. Martin war acht Jahre alt, hatte bisher noch an keinem einzigen Tag die Dorfschule besuchen dürfen. Dieses Privileg war nur den Kroppen, Jungen vorbehalten, und auch die hatte er nur unregelmäßig zum Unterricht geschickt. »Soll keiner sagen, der Kroppen ist schuld, wenn seine Kinder doof bleiben.« Dann lachte er heiser und nahm erneut einen Schluck aus der Flasche.
An diesem Tag hatte sich Martin zum ersten Mal in seinem Leben gut behandelt gefühlt. Regungslos hatte er dagesessen, hatte seine Freude unterdrückt und inständig gehofft, dass Kroppen nicht losprusten und verkünden möge, dass er nur einen Scherz gemacht habe. Doch Kroppen prustete nicht los. Es war kein Scherz. Schon zwei Tage später, am Mittwoch, dem 13. November 1907, machte sich Martin Niemand am frühen Morgen auf den Weg in die Schulgasse. Dort stand das alte, langgestreckte Haus mit dem tief herabgezogenen Dach und der weiß getünchten Fassade, an der hier und da der Putz abbröckelte. In einem einzigen Klassenraum bot die Schule Platz für alle Kinder des Dorfes, die jeweils zu zweit auf schmalen Holzbänken hockten und nur dann sprachen, wenn sie dazu aufgefordert wurden. An diesem kalten Morgen war der Raum spärlich geheizt von einem mickrigen Feuerchen in dem kleinen Ofen, neben dem der Lehrer Hans Simbach stand. Mit finsterem Blick musterte er seinen neuen Schüler.
Simbach war 44 Jahre alt, er stammte aus dem winzigen Dörfchen Neroth in der Eifel. Zeitlebens hatte er davon geträumt, aus Neroth weggehen zu können. Eine Anstellung in der Stadt strebte er an, in Koblenz, Trier oder Köln, ganz egal wo, er würde überall hingehen, wenn er nur der kargen Eifel und der Armut seiner Familie entfliehen konnte. Doch seine Hoffnung hatte sich nicht erfüllt. Statt in der Stadt war er hier in diesem Kaff gelandet, in dem er mit seiner Familie eine klimperkleine Wohnung zur Miete in einem Haus bewohnte, von dem der Westwind im Winter die Pfannen vom Dach wehte. Die Arbeit als Dorfschullehrer frustrierte ihn, die Bezahlung war schlecht, und seine Schüler hielt er für dumme Bauerntölpel, bei denen alle Mühe vergebens war. Und nun stand wieder einer dieser Tölpel vor ihm: acht Jahre alt und noch keinen einzigen Tag zur Schule gegangen.
Martin spürte die Abneigung des Lehrers. Er fühlte sich unwohl, schämte sich für seine ärmliche Kleidung, die geflickte Hose, den ausgeleierten Pullover mit den ausgefransten Ärmelbündchen. An seinen abgelaufenen Schuhen haftete der Matsch aus der Gasse. Doch er war fest entschlossen, seine Chance zu nutzen. Er würde fleißig lernen, mehr als die anderen, denn im Gegensatz zu ihnen lechzte er geradezu nach Bildung. Gerade als die Anspannung aus seinem Gesicht wich, als sich ein freundliches Lächeln darin ausbreiten wollte, gerade in diesem Moment schlug Simbach zu. Die Ohrfeige traf Martin so hart, dass sein Kopf zur Seite flog.
»Morgen erscheinst du mit sauberen Schuhen in der Schule, hast du verstanden?«, schrie Simbach.
Martin biss sich auf die Lippen, unterdrückte seine Tränen, während er stumm nickte.
»Alles hat seinen Preis«, hatte Schang einmal gesagt, und wenn die Schläge des Lehrers der Preis für das Wissen waren, dann war Martin bereit, ihn zu zahlen. Denn auch ohne dass Simbach daran interessiert gewesen wäre, war Martin ein gelehriger Schüler. Aufmerksam verfolgte er den Unterricht, ertrug die Schläge und hing begierig an den Lippen des Lehrers, und es gelang ihm, seine Fähigkeiten im Rechnen, Schreiben und Lesen rasch zu verbessern. Klara war stolz auf ihn, und Martin war jeden Tag aufs Neue dankbar, weil er spürte, dass ihm der Besuch der Schule etwas gab, das er bisher nicht gekannt hatte: Selbstvertrauen.
Als das Frühjahr kam, hatte Martin gelernt, seinen Namen und einfache Sätze zu schreiben. Er konnte Zahlen bis 100 addieren und leidlich subtrahieren. Er hatte sich angewöhnt, täglich seine Schuhe zu putzen, und Klara hatte seine Kleider noch einmal sorgfältig ausgebessert. Doch dann wurde bei Kroppens das Geld wieder knapp, und Naturalien, um Simbach damit zu bezahlen, besaßen sie nicht, und so entschied Gerald schon im Mai des Folgejahres, dass Martin ab sofort nicht mehr zur Schule gehen dürfe. Stattdessen nahm er ihn mit zur Arbeit auf den Feldern. Martin lernte Rüben zu einzeln, er jätete Unkraut und rechte Heu. Im Sommer band er mit braun gebranntem Buckel das Getreide zu Garben, und am nächsten Martinitag nahm Kroppen das Geld, das er verdient hatte, an sich, ohne Martin noch einmal zur Schule zu schicken.
Zwei Jahre später, im Sommer 1910, der außergewöhnlich kühl und regnerisch war, entschied er, Martin zum alten Gisbert, den sie den schälen Bähtes nannten, in die Lehre zu schicken. Bähtes war der Ziegenhirte des Dorfes, er besaß nur noch ein Auge, und obwohl Ziegenhirte kein Ausbildungsberuf war, bestand Kroppen darauf, dass Martin fortan ein Ziegenhirtenlehrling sei. Morgens um sechs Uhr traf Martin sich mit dem schälen Bähtes im Oberdorf, von dort zogen sie an den Häusern vorbei und sammelten die Ziegen ein, mit denen sie dann bis zum Abend draußen zwischen den Feldern umherzogen. Bähtes war nicht nur einäugig, sondern zu dieser Zeit auch schon ziemlich gebrechlich. Am Ende eines langen und entbehrungsreichen Lebens wollten seine Beine lieber hochgelegt werden, als tagein, tagaus über die holprigen Feldweg stolpern zu müssen. Dazu quälte ihn das Reißen im Rücken.
Am Anfang war Bähtes sehr schweigsam, erst allmählich, erst nachdem er sich an den Jungen gewöhnt hatte, wurde er zugänglicher, und weil er spürte, wie seine Zeit ablief, beeilte er sich, sein Wissen an seinen Ziegenhirtenlehrling weiterzugeben. Bald schon kannte Martin jede Ziege, wusste um ihre Eigenarten und Vorlieben. Er lernte, welche Wildkräuter die Tiere liebten und welche sie niemals fressen durften, weil sie giftig waren. Er lernte die exakte Uhrzeit am Stand der Sonne abzulesen, verstand sich schon bald darauf, das Wetter anhand der Form der Wolken und der Farbe des Himmels vorherzusagen. Bähtes war ein guter Lehrmeister, und Martin war sein aufmerksamer Lehrling.
Doch dann, an einem warmen Nachmittag im darauffolgenden Jahr, die beiden hatten begonnen, sich wirklich zu mögen, da geschah es. Gerade hatte Bähtes über die Zeit vor dem Krieg gegen die Franzosen gesprochen. Jetzt sahen sie schweigend auf das dunkle Wasser des Maares. Martin hing seinen Gedanken nach. Während ihm die tiefstehende Sonne ins Gesicht schien, verscheuchte er mit der Hand die Mücken auf seinen nackten Beinen, als Bähtes einen leisen Seufzer tat und starb. Der Hirtenstab glitt ihm in dem Moment aus der Hand, als sein Kopf nach vorne auf die Brust fiel. Der alte Ziegenhirte Gisbert war bei seiner Herde und neben seinem Lehrling friedlich eingeschlafen.
Von diesem Tag an war Martin Niemand sein Nachfolger. Gerald Kroppen sammelte am Martinitag den Jahreslohn bei den Besitzern der Ziegen ein. Fast alle zahlten mit Naturalien, nur wenige Münzen befanden sich am Ende in Kroppens Taschen, doch wieder behielt er alles Geld für sich, während er Speck und Würste und Honig seiner Gudula in die Arme drückte.
Für fast ein ganzes Jahr Arbeit bekam Martin keinen Pfennig Lohn. Auch durfte er nicht wieder zur Schule gehen, Kroppen war der Meinung, dass es nun an der Zeit sei, etwas von dem, was er in den vergangenen Jahren bekommen hätte, an seine Zieheltern zurückzugeben.
Nachdem er am Abend noch eine Weile bei dem verletzten Hund in der alten Scheune gesessen und ihm gut zugeredet hatte, erhob sich Martin am nächsten Morgen in aller Frühe von seinem Nachtlager. Schang würde das Tier wieder auf die Beine bringen, da war Martin sich jetzt ganz sicher. Auf Zehenspitzen verließ er das Tagelöhnerhaus. Der Himmel hatte sich am Horizont schon aufgehellt. Noch bevor alle anderen wach wurden, wollte Martin auf dem Weg zu Schang sein. Er hatte die alte Scheune fast erreicht, als er im Dämmerlicht eine Gestalt daraus hervortreten sah. Ohne zu zögern, kam die Gestalt näher, und dann sah Martin, dass es Anton war. Anton war zwei Jahre älter als Martin, er hatte den Verstand eines Kleinkindes, aber die Kraft eines Erwachsenen.
Als sie sich trafen, hielt Martin ihn am Arm fest. »Wo warst du?«, fragte er.
Anton sah ihn mit schrägem Blick an und antwortete nur: »Kaputt.« Dabei wies er mit der Hand zurück zur Scheune.
Martin sah die Blutspritzer in Antons Gesicht. Sah die blutverschmierte Hand, und es war ihm, als würde ihm der Boden unter den Füßen weggezogen. Als wäre der leibhaftige Teufel hinter ihm her, so schnell lief er los, erreichte die Scheune und fand dort den Hund, dessen Leben er gerettet, dem er den Namen Feldmann gegeben hatte und den er nun zu einem guten Hütehund ausbilden wollte, mit eingeschlagenem Schädel vor. Ein blutiger Steinbrocken, groß wie ein Ziegenjunges, lag neben dem Kadaver.
Sein Herz pochte wie ein Dampfhammer: Dieser Idiot hatte seinen Hund totgeschlagen! Zuerst wollte er auf die Knie fallen, sich schützend über den Kadaver werfen, doch dann verharrte er regungslos, er benötigte einen Moment, um das, was er sah, zu verarbeiten. Dann hob er Feldmann auf, trug ihn zur Scheune hinaus, der Körper war noch warm. Mit dem toten Hund in seinen Armen stolperte er über die staubigen Dorfstraßen, rannte hinüber zu Schang, dem Einzigen, dem er jetzt nahe sein wollte. Martin fand den alten Knecht im Stall, zwischen mächtigen Kuhleibern hockte er auf seinem Melkschemel und hantierte mit geübten Handgriffen an einem prallen Euter herum. Als er Martin sah, sprang er auf und hätte fast den Eimer umgestoßen, als der Junge, Feldmann noch in den Armen tragend, sich an ihn drückte. Ein Blick hatte Schang genügt, um die Situation zu erfassen, darum legte er sanft seine Hand auf Martins Rücken und sprach beruhigend auf den Jungen ein. Martins Tränen benetzten Schangs Arbeitsjacke, die nach Kuhstall roch und deren raue Fasern auf seinen Wangen kratzten.
So standen sie eine Weile, eine Kuh sah zu ihnen herüber und ließ ein warmes Muhen ertönen. Schließlich untersuchte Schang den Hund. Mehrmals fuhr er mit den Händen über das Hinterteil des Hundes, betastete seine Beine, bis er sich erhob und seine Diagnose kundtat: »An der Hüfte hat er nix gehabt, aber beide Beine gebrochen. Mit etwas Glück hätte er wieder gesund werden können.«
An diesem Tag hatte Martin kaum einen Blick für die Ziegen, er trieb sie hinaus zum Teufelsmaar und blieb entgegen seiner Gewohnheit den ganzen Tag dort. Seine Gedanken aber waren beim toten Feldmann. Und bei Anton. Voller Wut schmiedete er Rachepläne, der Idiot sollte büßen für das, was er getan hatte. Bilder von Anton, der mit eingeschlagenem Schädel in der Scheune lag, flammten vor seinem geistigen Auge auf. Martin dachte daran, Anton zu quälen oder der Strafe durch Kroppen zu überlassen. Doch das alles würde ihm nicht den brennenden Schmerz nehmen, den der Verlust Feldmanns in ihm bewirkte. Mit der Zeit wich seine Wut einer tiefen Traurigkeit, die bleischwer auf seinen schmalen Schultern lastete, als er sich am Abend erneut auf den Weg zu Schang machte.
Martin solle zu ihm kommen, wenn alle Arbeit getan sei, hatte der Alte gesagt. Die wohltuende Abendruhe hatte sich bereits über den Hof gesenkt, Schang saß auf der Bank vor dem Kuhstall, paffte dort in aller Gelassenheit seine Pfeife. Als er den Jungen erblickte, erhob er sich.
»Komm mit«, knurrte er, und der Junge folgte ihm zum Schuppen hinüber, in dem Schang den Kadaver zum Schutz vor den Fliegen mit einem alten Sack abgedeckt hatte. Behutsam hob er den toten Hund nun in den Sack, warf ihn sich auf die Schulter, drückte Martin eine Schaufel in die Hand und zog dann wortlos voran. Runter vom Hof, hinaus aus dem Dorf, Martin immer dicht an seiner Seite, bis sie hinter Gut Ving auf den Feldweg nach Kerpen abbogen. An der Wegkreuzung standen dichte Holunderbüsche, um sie herum hatten sich Brennnesseln ausgebreitet, hier blieb Schang stehen und nahm den Sack von seiner Schulter.
»Hier ist es«, sagte er, während er Martin die Schaufel aus der Hand nahm und zu graben begann. Bald hatte er ein tiefes Loch ausgehoben, Martin roch die frische Erde und legte auf ein Zeichen von Schang den Sack hinein.
»Warum hier?«, wollte Martin mit dünner Stimme wissen, »so weit draußen vorm Dorf.«
»Hier bist du alleine mit ihm«, antwortete Schang und begann das Loch wieder zuzuschütten. Zum Schluss klopfte er sorgfältig die Erde auf dem kleinen Hügel fest, dann sammelte er ein paar Steine in der Nähe auf, und legte sie darauf. Regungslos stand Martin daneben als er sich anschickte, dem Alten zu helfen, wehrte der ihn ab. »Das brauchst du nicht, du bist jetzt in Trauer.«
Nachdem alles gerichtet war, stellte Schang sich neben Martin, holte die Pfeife aus seiner Jackentasche und entzündete sie. Einem glutroten Feuerball gleich stand die Sonne tief am Horizont, während drüben bei der Brikettfabrik dunkler Rauch kerzengerade aus den Schornsteinen in den Abendhimmel stieg. Schang hatte seinen Arm um Martins Schulter gelegt, schweigend standen sie so, bis die Sonne untergegangen war.
2. KAPITEL
Der Krieg und der Birnbaum
Im mäßig warmen Sommer des Jahres 1914 war Martin Niemand ein guter Ziegenhirte geworden. Weder hatte sich ein Tier in seiner Obhut je verletzt noch nasses Gras gefressen. Die Klauen der Ziegen waren sauber geschnitten, und sie gaben ausreichend Milch und gutes Fleisch. Ihre Besitzer waren zufrieden, sie lobten Martin allenthalben, doch seinen Lohn behielt noch immer Gerald Kroppen für sich, während sich die Familie über die Naturalien hermachte. Martin stand bereits in seinem fünfzehnten Lebensjahr, doch irgendeinen materiellen oder finanziellen Besitz hatte er bislang noch nicht erlangen können.
In diesem Sommer hatte er das Gefühl der Liebe kennengelernt. Zwar hatte er schon gehört, wie andere Jungen in seinem Alter darüber gesprochen hatten, doch erst als er eines Tages Klara hinter dem Haus dabei beobachtet hatte, wie sie die Wäsche von der Leine nahm, und sie ihm plötzlich wunderschön vorgekommen war, da hatte er gemeint, so müsse es sich wohl anfühlen, wenn man verliebt ist.
Nach ein paar Tagen hatte Klara ihn beiseite genommen und ihm fest in die Augen gesehen. »Martin«, hatte sie mit sanfter Stimme gesagt, »schau mich nicht so an, ich bin deine Schwester, und außerdem wäre ich zu alt für dich. Du musst dich nach einer anderen umschauen, du Dummkopf.« Dann war sie ihm lächelnd durch das Haar gefahren und hatte ihn auf die Wange geküsst.
Martin hatte nur verlegen zu Boden geschaut, unfähig, etwas zu erwidern. Doch von den gleichaltrigen Mädchen im Dorf wollte ihm partout keine gefallen, und so hatte er sich darum bemüht, sich nicht weiter mit dem Verliebtsein zu beschäftigen.
Bei seinem Bemühen kam ihm die riesige Staubwolke zu Hilfe, die an einem sonnigen Tag im August am Horizont auftauchte. Es war ein später Nachmittag, als Martin bei der Herde stand, ringsum auf den Feldern waren die Bauern und ihre Knechte mit der Mahd des Getreides beschäftigt. Über ihm, hoch am wolkenlosen Himmel, segelte in unendlicher Gelassenheit eine Kornweihe, sie war auf der Jagd nach einer der unzähligen Mäuse, die sich jetzt zwischen den Stoppeln um die liegen gebliebenen Getreidekörner stritten. Die lauten Rufe der Bauern hallten zu ihm herüber, als er mit der Hand seine Augen vor der Sonne schützte, um dem Flug des Greifvogels zu folgen. Plötzlich nahm er etwas am Boden wahr. Drüben auf der Straße, die von Meller auf das Dorf zuführte, zog eine scheinbar endlos lange Kolonne heran. Martin erkannte Berittene, dahinter einige Fuhrwerke, gezogen von jeweils vier Pferden. Den Abschluss der Kolonne bildeten Männer, die in einer geordneten Formation voranschritten. Das mussten Soldaten sein, schoss es ihm durch den Kopf, eine wahre Streitmacht, und sofort war Martins Neugier geweckt. Eilig scheuchte er die Herde auf, über den Grasweg trieb er sie auf die befestigte Straße zu. Dieses Schauspiel musste er aus der Nähe betrachten, denn noch niemals in seinem Leben hatte er etwas Vergleichbares gesehen.
Als er bis auf wenige Meter herangekommen war, blieb er von Ehrfurcht ergriffen stehen. Regungslos bestaunte er die Soldaten, versuchte sie zu zählen, es gelang ihm nicht. Keiner schaute zu Martin herüber, dessen Blick wie gebannt an der wabernden Mixtur aus glänzendem Pferdefell, knarzenden Wagenrädern und üppigen Schnurrbärten in schweißnassen Soldatengesichtern klebte.
Es waren des Kaisers Soldaten auf ihrem Weg nach Westen. Es ging gegen die Franzosen, alte Rechnungen harrten darauf, beglichen zu werden. Doch davon, dass sein Land sich im Krieg befand, davon hatte der Ziegenhirte Martin Niemand bisher nicht die leiseste Ahnung gehabt. Er stand nur da, in seiner ganz und gar jämmerlichen Erscheinung, roch nach Ziege und seinem eigenen Schweiß und begaffte die Soldaten, bis auch der letzte drüben am Dorfrand zwischen den Häusern verschwunden war.