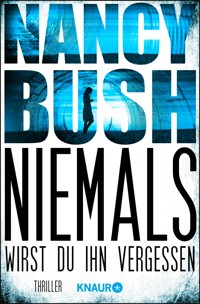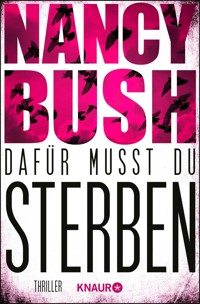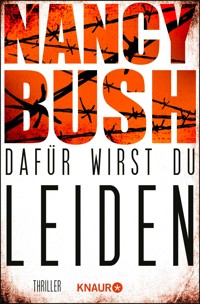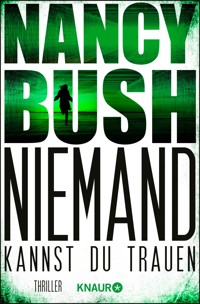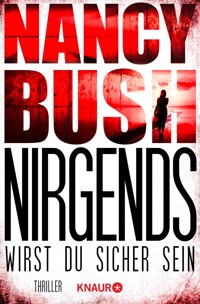
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Detectives-Rafferty-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ein packender Thriller in hochmodernen Cyber-Welten, psychiatrischen Kliniken und im Alltag einer außergewöhnlichen amerikanischen Familie. Um Haaresbreite entgeht Liv einem Massaker an ihrem Arbeitsplatz. Doch galt der Anschlag tatsächlich der Software-Firma, wie die Polizei vermutet? Liv befürchtet, dass sie das eigentliche Ziel war und dass das geheimnisvolle Päckchen aus dem Nachlass ihrer Mutter etwas damit zu tun hat. Aber Undercover-Detective Rafferty ist der Einzige, der ihr glaubt. Gemeinsam begeben sie sich auf eine beispiellose Jagd nach einem perfiden Killer ... Die schlafraubende Thrillertrilogie von New York Times-Bestsellerautorin Nancy Bush beinhaltet außerdem die Titel "Niemals wirst du ihn vergessen" (Erscheinungstermin eBook: 02.12.2015; Taschenbuch: 01.02.2016) und "Niemand kannst du trauen" (Erscheinungstermin eBook: 04.02.2016; Taschenbuch: 01.04.2016).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 572
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Nancy Bush
Nirgends wirst du sicher sein
Thriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Weil sie verspätet aus der Mittagspause zurückkehrt, entgeht Liv um Haaresbreite einem Massaker an ihrem Arbeitsplatz. Doch galt der Anschlag wirklich der Firma, die Gerüchten zufolge für das US-Militär arbeitet? Liv befürchtet, dass sie das eigentliche Opfer hätte sein sollen. Sie vermutet einen Zusammenhang mit dem mysteriösen Päckchen, das sie vor wenigen Tagen aus dem Nachlass ihrer Adoptivmutter erhalten hat. In Panik kidnappt Liv den nächstbesten Wagen samt Fahrer. Dabei handelt es sich ausgerechnet um den Undercover-Detective August Rafferty …
Inhaltsübersicht
Prolog
Kapitel eins
Kapitel zwei
Kapitel drei
Kapitel vier
Kapitel fünf
Kapitel sechs
Kapitel sieben
Kapitel acht
Kapitel neun
Kapitel zehn
Kapitel elf
Kapitel zwölf
Kapitel dreizehn
Kapitel vierzehn
Kapitel fünfzehn
Kapitel sechzehn
Kapitel siebzehn
Kapitel achtzehn
Kapitel neunzehn
Kapitel zwanzig
Kapitel einundzwanzig
Kapitel zweiundzwanzig
Kapitel dreiundzwanzig
Kapitel vierundzwanzig
Epilog
Spoiler-Alert
Prolog
Er stand draußen im Garten und starrte auf das Haus. Sie wussten nicht, dass er dort war. Sie wussten nicht, dass er in den Gärten vieler Häuser stand, beobachtete, nachdachte, Böses plante.
Durchs Küchenfenster konnte er ihre Silhouette vor der Spüle erkennen, ihre Figur erahnen, schlank, geschmeidig in einem schmalen Kleid, schemenhaft. Er lächelte. Mehr musste er nicht sehen. Er wusste, wie sie aussah, wie sie alle aussahen.
Ein gelbes Lichtquadrat fiel durch das kleine Fenster in der Seitentür auf das wuchernde Gras. Sie verließ die Spüle unter dem Küchenfenster und ging hinüber zur Seitentür, spähte durch das gelbe Quadrat hinaus in die Dunkelheit. Der Kitzel der Jagd trieb seinen Puls in die Höhe. Konnte sie ihn sehen? Ahnte sie etwas? Wusste sie gar, dass er da war?
Aber nein. Das war unmöglich. Sie wusste auch nichts von den anderen, obwohl die Zeitungen und Fernsehreporter über die verschwundenen Frauen schwadronierten, deren Leichname erst noch gefunden werden mussten. Sie wusste nichts von ihm. Wie dicht er bei ihr war … wie nah …
Seine Augen brannten, und er fragte sich, ob sie seine Begierde spüren konnte, die Begierde und die Wut, aber sie wandte sich ab und drehte ihm den Rücken zu, den Kopf schief gelegt. Die Kurve ihres weißen Nackens bot einen schönen Anblick.
Hörst du mich, du Schlampe? Hörst du mich?
Er spürte, wie er hart wurde. Ein grausames Lächeln stahl sich auf seine Lippen, als er in seine Hose griff und anfing, sich rhythmisch zu streicheln. Das war Teil des Rituals, Teil des Auftakts …
Spürst du mich?
Ich komme … deinetwegen … jetzt …
Livvie Dugan blickte in den Spiegel und verkündete: »Heute bin ich sechs Jahre alt.« Einer ihrer oberen Schneidezähne fehlte, und sie zog die Lippe zurück, um den kleinen Finger durch das Loch zu stecken, nur so, bloß um zu sehen, wie das ausschaute. Sie zog den Finger wieder heraus und steckte ihre Zunge durch die Lücke, dann kniff sie ein Auge zusammen und sagte: »Harr, Kameraden!«, genau wie richtige Piraten das taten.
Es war ein großartiger Tag gewesen. Mama hatte ihr eine riesige Geburtstagstorte mit rosa Rosen gebacken, und sie hatte alle sechs Kerzen darauf auf einmal ausgepustet! Ihr Bruder Hague, der erst zweieinhalb war und laut ihrem Dad so gut wie gar nichts konnte, hatte versucht, sie als Erster auszublasen, was Livvie so wütend machte, dass sie mit dem Fuß aufstampfte. Livvie wusste, dass Hague anders war, doch das bedeutete noch lange nicht, dass er ihre Kerzen auspusten durfte. Das kam gar nicht in Frage! Sie hatte ihn von seinem Hochstuhl geschubst, und er war zu Boden geplumpst und hatte angefangen zu schreien wie ein riesiges Baby, und genau das war er auch, dachte Livvie – ein dickes, fettes Riesenbaby. Aber Mama hatte ihn aufgehoben und ihn getröstet, und dann hatte sie Livvie diesen Blick zugeworfen – diesen Blick, der besagte, dass sie richtig sauer war, sich ihre Strafpredigt aber für später aufheben würde.
Anschließend hatte Mama Livvie vor die Torte gesetzt, und sie hatte tonnenweise Luft eingeatmet und mit aller Kraft wieder ausgestoßen. Die Kerzen hatten geflackert, dann waren sie ausgegangen. Alle auf einmal! Das war großartig, hatte Mama gesagt. Großartig. Aber sie war immer noch sauer gewesen wegen Hague und hatte nicht richtig gelächelt. Sie hatte Livvie und Hague je einen Pappteller mit einem Stück weiß-rosa Torte und eine kleine Tasse Milch hingestellt. Livvie hatte um Apfelsaft gebeten, aber Mama schien sie nicht zu hören, also hatte sie ihre Bitte wiederholt, lauter diesmal, und Mama hatte ihr den Apfelsaft geholt, wie ein Roboter, als wüsste sie nicht, was sie da eigentlich tat. Anschließend hatte sie Hague schlafen gelegt, der laut »Nein!« gebrüllt hatte, wie immer, wenn er ein Nickerchen machen sollte. Livvie fand, dass er es verdient hatte, ins Bett gesteckt zu werden. Noch besser wäre es, wenn er für immer dort bleiben müsste. Immerhin hatte er versucht, ihre Kerzen auszupusten!
Livvie hatte ihr Tortenstück aufgegessen und die Krümel mit dem Finger zerdrückt, bevor sie sie auch noch in den Mund steckte. Mama kam und kam nicht zurück, daher war Livvie aufgestanden und aus der Küche ins Wohnzimmer hinübergeschlendert, wo Mama auf der Couch hockte und ins Leere starrte.
»Was machst du da?«, fragte Livvie. Wie konnte Mama sie einfach in der Küche sitzen lassen und ins Wohnzimmer gehen? Dabei war noch nicht einmal der Fernseher an. Mama stierte das dunkle Rechteck an, als würde dort General Hospital, ihre Lieblingsserie, laufen.
»Warum schaust du nicht fern?«, fragte Livvie, verwirrt und verärgert zugleich. Schließlich war heute ihr Geburtstag! Mama antwortete nicht, also erklärte Livvie: »Ich will Zeichentrickfilme sehen.«
Mama stand von der Couch auf und steckte ein Video in den Rekorder. Sie hatten ein paar ihrer Lieblingsfilme auf Kassette, obwohl Mama bezweifelte, dass sich diese noch ganz abspielen ließ, weil Hague ein Stück von dem dunklen Band herausgezogen hatte. Livvie hätte ihn deswegen am liebsten umgebracht, aber Mama hatte die Kassette repariert und Hague in Schutz genommen, während Livvie gebrüllt hatte, Hague habe das Video ruiniert. Nun, das hatte er ja auch. Aber zum Glück funktionierte das Band noch ganz gut. Meistens.
Livvie machte es sich auf der Couch bequem, und obwohl Mama sie für gewöhnlich allein schauen ließ, setzte sie sich zu ihr und blieb für eine lange Zeit, was seltsam war. Dann wachte Hague auf, und Mama stand auf, um ihn zu holen. Livvie rechnete damit, dass sie zurückkehren und sie, Livvie, aus dem Wohnzimmer scheuchen würde, denn Mama mochte es gar nicht, wenn sie zu lange Zeichentrickfilme schaute, aber heute tat sie das nicht. Was vermutlich daran lag, dass heute Livvies Geburtstag war. Als das Band zu Ende war, spulte Livvie zurück und schaute es noch einmal an. Dann wurde ihr langweilig, deshalb griff sie nach dem neuen Spiel, das sie zum Geburtstag bekommen hatte, »Hippo Flipp«. Weil es aber keinen Spaß machte, allein zu spielen, schlenderte sie zurück in die Küche und fragte Mama, ob sie mit ihr spielte. Mama stand vor der Spüle und starrte gedankenverloren aus dem Fenster. Hague saß auf dem Fußboden neben ihren Füßen und stapelte Bauklötze aufeinander.
Mama sagte, sie habe jetzt keine Zeit für sie, ob sie nicht Lust habe, mit Hague zu spielen.
»Kommt gar nicht in Frage!«, schimpfte Livvie, dann zog sie sich schnell ins Wohnzimmer zurück. Sie spielte das Spiel allein, dann schaute sie sich wieder die Zeichentrickfilme an. Nach einer Weile holte Mama sie zum Abendessen, und Livvie schaufelte ein Fertiggericht mit Truthahnbraten in sich hinein. Mama wusste, dass sie das am liebsten mochte, und Hague, der ihr von seinem Hochstuhl aus zusah, rief begeistert: »Hm, hm, hmmm!«, weil er auch etwas davon haben wollte. Mama gab ihm ein paar Käsemakkaroni, die vom Mittagessen übrig geblieben waren, doch er warf sie auf den Fußboden und deutete auf Livvies Teller, was nicht anders zu erwarten gewesen war. Ausnahmsweise ignorierte Mama ihn. Als Mama nicht hinsah, zerquetschte Livvie ihr Essen, damit sie es ihm nicht geben konnte, dann fragte sie, ob sie noch etwas Torte bekommen könnte.
Als Mama ihr tatsächlich ein Stück brachte, war sie ziemlich überrascht. Hague, der auch etwas haben wollte, stimmte ein so lautes Gebrüll an, dass Livvie sich die Hände auf die Ohren drücken musste.
»Hör auf!«, schrie sie ihn an. »Mama, mach, dass er aufhört! Das ist mein Geburtstag! Er macht alles kaputt!«
»Er macht dir deinen Geburtstag nicht kaputt«, nahm Mama Hague in Schutz, wie immer, dann brachte sie auch ihm ein Stück.
Livvie war außer sich. »Er darf meine Torte nicht essen! Er ist noch viel zu klein! Außerdem hat er seine Käsemakkaroni liegen gelassen!«
»Ein bisschen kann er ruhig noch haben.«
»Aber das ist ein ganzes Stück! Das ist nicht fair!«
Mama reagierte nicht. Stattdessen kehrte sie zur Spüle zurück und starrte wieder aus dem Fenster. Sie stand einfach nur da, die Hände auf die Anrichte gestützt, als habe sie Mühe, sich auf den Beinen zu halten.
Wütend funkelte Livvie Hague an, der schmatzend sein Tortenstück verschlang. Livvie grub die Gabel in die weiß-rosa Masse, doch sie konnte nicht alles aufessen, weil Mama ihr ein sehr großes Stück abgeschnitten hatte. Ein riesiges Stück. Als sie keinen Bissen mehr hinunterbrachte, rutschte Livvie von ihrem Stuhl und verließ die Küche. Hague sagte etwas zu ihr. Er konnte noch nicht richtig sprechen, weil er noch zu klein war, und überhaupt konnte er gar nichts, trotzdem klangen seine Worte so, als hätte er »dich töten« gesagt.
Mama fuhr herum und starrte ihn an, und er entblößte seine kleinen weißen Zähne, um sie anzugrinsen.
Livvie kehrte ins Wohnzimmer zurück, legte das Video mit den Zeichentrickfilmen ein und stellte den Ton laut. Sehr laut. Mama stürmte herein und zischte: »Mach das leiser!« So sprach sie nur, wenn sie richtig, richtig wütend war. »Ich bringe jetzt Hague ins Bett, und das ist zu laut!«
»Tut mir leid«, murmelte Livvie, obwohl es ihr nicht wirklich leidtat.
Mama drehte die Lautstärke herunter und eilte aus dem Zimmer. Livvie hörte, wie sie Hague schlafen legte. Als er wieder anfing, »Nein!« zu brüllen, stellte sie den Ton etwas lauter. Nur ein kleines bisschen. Sie wartete und horchte, aber als Mama aus Hagues Zimmer kam, ging sie am Wohnzimmer vorbei direkt wieder in die Küche.
Hague heulte noch eine Zeitlang, dann beruhigte er sich endlich. Livvie spulte die Kassette zurück und schaute sich die Filme ein weiteres Mal an, doch nach einer Weile fing sie an, sich zu langweilen, stand auf und tappte durch den Flur in Richtung von Hagues Zimmer. Irgendwie war sie immer noch sauer auf ihn. Es war ihr Geburtstag! Ihrer! Nicht seiner.
»Er weiß es eben nicht besser«, sagte sie zu sich selbst, als sie vor seiner Tür stehen blieb.
Fast hätte sie geklopft. Irgendwie wollte sie, dass er wach wurde. Nein, sie wollte, dass Mama zu ihr kam und sich noch einmal mit ihr aufs Sofa setzte, aber das tat Mama nicht. Livvie zögerte noch eine Weile, dann kehrte sie ins Wohnzimmer zurück, zog geräuschlos die Tür hinter sich zu und fragte sich, ob Mama sie ebenfalls bald zu Bett schicken würde. Sie sprang bäuchlings auf die Couch und drückte ihr Gesicht in die Polster. Wenn sie ganz, ganz leise wäre, würde Mama sie vielleicht vergessen.
Doch dann schrie Mama auf. Livvie riss den Kopf hoch. Was hatte das zu bedeuten? Sie lief zur Wohnzimmertür und öffnete sie vorsichtig einen Spaltbreit.
»Mama?«, rief sie leise und spähte hinaus. Bis zur Küche war es nicht weit, nur ein kleines Stück durch den Flur und dann um die Ecke, doch auf einmal hatte sie schreckliche Angst. Mit hämmerndem Herzen schlich sie Richtung Küche. Sie konnte nur Mama sehen; sie saß am Tisch, ihre Beine zitterten. Mama hielt sich mit einer Hand das Gesicht. Unter ihrer Hand war die Haut gerötet. Mit großen Augen starrte sie zur offenen Seitentür. In ihren Augen standen Tränen.
»Was ist passiert?«, rief Livvie aufgeregt. »Mama, sag, was ist los? Warum steht die Seitentür offen? Ist da jemand?«
Mama sah sich im Zimmer um, sie wirkte verängstigt, dachte Livvie, aber als der Polizist sie später fragte, ob sie wirklich »verängstigt« oder nicht vielmehr »ausdruckslos« meinte, hatte Livvie kein Wort mehr gesagt. Sie wusste nicht, was »ausdruckslos« bedeutete.
»Die Seitentür war also offen«, hatte der Polizist wiederholt, als würde er Livvie nicht recht glauben, und Livvie hatte so getan, als würde sie ihn nicht mehr hören. Stattdessen zog sie sich zurück in eine Welt der Stille, zu der niemand außer ihr Zutritt hatte. An einen Ort, an den sie sich manchmal begab, wenn ihr alles um sie herum zu viel wurde, denn dort fühlte sie sich in Sicherheit.
Doch in jenem Augenblick rief sie: »Mama! Ist da draußen jemand? Wer ist da?« Mit böser Stimme antwortete Mama: »Geh zurück ins Wohnzimmer, Olivia!« Livvie fing an zu weinen. Sie hatte doch Geburtstag! Warum waren alle so gemein zu ihr?
Noch immer weinend, rannte sie ins Wohnzimmer und knallte die Tür zu, um auf Mama zu warten, die bestimmt gleich hereinkäme und sie in ihr Zimmer schickte. Doch nichts geschah. Trotzig reckte sie das Kinn vor und verschränkte die Arme vor der Brust. So blieb sie auf der Couch sitzen und starrte auf die Tür. Sie würde so lange dort sitzen bleiben und böse schauen, bis Mama käme.
Aber Mama kam nicht, und Livvie vergaß, warum sie eigentlich wütend war … und schlief ein. Als sie wieder aufwachte, war es schon sehr spät. Eigentlich müsste sie längst im Bett sein. Ein Spuckefaden lief ihr aus dem Mund aufs Sofakissen. Das erinnerte sie an ihre Zahnlücke, also ging sie ins Badezimmer und steckte die Zunge durchs Loch, kniff ein Auge zusammen und knurrte wieder: »Harr, Kameraden!«, dann ließ sie noch einmal die Ereignisse des Tages vor ihrem inneren Auge vorbeiziehen.
Sie fand, dass ein Pirat durchaus ein weiteres Stück Geburtstagstorte verdient hätte, diesmal vielleicht sogar mit Eiskrem.
Auf Zehenspitzen, damit Mama ja nichts merkte, schlich sie in Richtung Küche. Doch als sie um die Flurecke bog, bekam sie plötzlich eine Gänsehaut auf den Armen, und sie blieb wie angewurzelt stehen. Ihr Herzschlag beschleunigte sich, wie immer, wenn sie es mit der Angst zu tun bekam.
»Mama?«, wisperte sie.
Nichts.
Alles blieb still.
Mutig trat sie in die Küche, sah sich um – und fing an zu schreien. Sie schrie und schrie.
Denn Mama hing in der Luft, eine Drahtschlinge um den Hals, das Gesicht aufgequollen, die Zunge herausgestreckt, als würde sie eine lustige Grimasse schneiden.
Aber das tat sie nicht.
Livvie wusste, dass sie tot war.
Tot.
Genau das war sie.
Mama war tot.
Livvie schrie weiter und zog sich an ihren sicheren Ort zurück, und das war das Letzte, was sie für lange, lange Zeit erinnerte …
Kapitel eins
Liv tauchte aus dem Alptraum auf, schweißgebadet, einen erstickten Schrei auf den Lippen. Mit rasendem Herzen blinzelte sie in die schwache, frühmorgendliche Dämmerung, die sich unter ihrer Schlafzimmerjalousie hindurchstahl. Wie viel Uhr mochte es sein? Fünf? Halb sechs?
Sie schloss die Augen und zwang ihr wildpochendes Herz, sich zu beruhigen. Einzelne Bruchstücke ihres Traums zogen lebhaft vor ihrem inneren Auge vorbei, doch es gelang ihr nicht, diese zu einem kompletten Ganzen zusammenzusetzen. Egal. Sie hatte genügend Alpträume hinter sich, um zu wissen, dass dieser bestimmt nicht der letzte war, und obwohl die Träume nicht immer genau gleich abliefen, waren sie doch Resultat des tiefen Traumas, das selbst eine jahrelange Therapie nie ganz hatte auflösen können.
Dr. Yancy, Livs Therapeutin in Hathaway House, die genügend Mitgefühl und Kompetenz ausstrahlte, um Liv – damals noch ein Teenager – davon zu überzeugen, dass sie ihr wirklich helfen wollte, hatte einmal gesagt: »Ich glaube, es geht um etwas, was du gesehen hast.«
Sag bloß, Sherlock. Ich habe meine Mutter gesehen, die sich in der Küche erhängt hat!
Aber Dr. Yancy hatte bedächtig den Kopf geschüttelt, als Liv ihr das entgegenschleuderte. Liv war stets sehr schnell, wenn es darum ging, zu widersprechen oder sich zu verteidigen – und das war nur eines der vielen Probleme, die sie nach Hathaway House gebracht hatten.
Nach einem kurzen Moment hatte Dr. Yancy hinzugefügt: »Du hast noch etwas anderes gesehen. Etwas, woran du dich nicht erinnern kannst oder willst.«
Livs Puls schoss in die Höhe, und ihr wurde schlagartig heiß. Ein feiner Schweißfilm bildete sich auf ihrer Haut, als sie intuitiv die Wahrheit in den Worten der Psychologin spürte. Ihre Seele hatte sich fest davor verschlossen, zumindest behauptete das Dr. Yancy, als Liv darauf beharrte, sie könne sich an nichts anderes erinnern als an den Selbstmord ihrer Mutter.
Doch obwohl Liv Dr. Yancys Behauptung von sich gewiesen hatte, kam sie ihr nicht völlig abwegig vor, auch wenn sie das damals nicht zugeben mochte. Irgendetwas war da, das spürte sie. Genau wie sie spürte, dass sie verfolgt wurde. Einen Stalker hatte.
Jetzt, Jahre später, stellte sich ihr unweigerlich die Frage, ob ihr Aufenthalt in Hathaway House eher hilfreich oder eher kontraproduktiv gewesen war – eine Frage, die vermutlich unbeantwortet bleiben würde. Keiner der sogenannten Ärzte und Quacksalber in Hathaway House hatte sich je näher zu Dr. Yancys kühner Behauptung geäußert; sie alle hatten sich hinter ihren mitleidigen Blicken und gerunzelten Stirnen versteckt, ohne irgendetwas zu bewirken. Auch Dr. Yancy selbst hatte ihr nicht weitergeholfen. Liv wusste genug über die Anstaltspolitik, um zwischen den Zeilen der Gutachten lesen zu können, und hielt sämtliche Angestellten für einen Haufen Feiglinge, die so gut wie nichts von der Seele des Menschen verstanden, dafür aber sehr viel davon, wie sie ihre gut bezahlten Jobs behalten konnten.
Aber das stand nicht wirklich zur Debatte. Die Frage war vielmehr, ob Olivia Dugan von ihren schweißtreibenden Alpträumen und der quälenden Depression geheilt war oder nicht. Hatte Olivia Dugan gelernt, die sogenannten Trigger zu bekämpfen, die Auslöser, die ihr Herz zum Rasen, ihre Hände zum Zittern und ihre Gedanken zum Wirbeln brachten? Wie Flipperkugeln schossen sie durch ihren Kopf, prallten gegen die Wände ihres Schädels, ließen die falschen Neuronen feuern und brachten sie dazu, unüberlegte, unverantwortliche Entscheidungen zu treffen.
Nein. Sie hatte gelogen und alles getan, um aus Hathaway House entlassen zu werden, auch wenn sie weit von einer Heilung entfernt gewesen war, aber die Antwort war und blieb ein klares Nein. Sie wusste nicht, wie sie die Trigger bekämpfen, geschweige denn besiegen sollte, die die Alpträume und Depressionen auslösten. Obwohl sie sie genau kannte. Obwohl sie alles daransetzte, sich von besagten Schlüsselreizen fernzuhalten.
Erst gestern Abend war einer dieser Trigger ausgelöst worden. Als sie nach Hause gekommen war, hatte ein blinkendes rotes Licht sie empfangen. Der Anrufbeantworter. Ein Warnsignal. Die Stimme eines Fremden. Zögernd hatte sie zum Telefon gegriffen und die Nachricht abgehört.
Die Nachricht auf dem Anrufbeantworter …
Jetzt warf Liv die Bettdecke zurück und schauderte. Sie stieg aus dem Bett und tappte in die Küche, eine Strecke, die zehn Schritte über den abgetretenen Teppichboden in ihrem kleinen Apartment, bestehend aus Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche und Bad, bedeutete.
Die Nachricht auf dem Anrufbeantworter …
Irgendwelche Anwälte hatten ihre Festnetznummer herausgefunden und eine Nachricht für sie hinterlassen. Das war der Auslöser für ihren Alptraum gewesen. Sie hatte versucht, das blinkende Licht zu ignorieren, als sie die Schlüssel auf die Ablage warf, und sich wohl zum millionsten Mal gefragt, warum sie das Telefon und den Anrufbeantworter überhaupt behielt. Meistens gefiel ihr die Vorstellung, völlig netzunabhängig zu leben. Deshalb besaß sie nicht mal ein Handy. Wenn sie das zu einem Dinosaurier machte – sei’s drum. Sie hatte eben ein unbehagliches Gefühl, was die Technik anbetraf, wenn nicht sogar ein wenig Angst davor. Sie wollte nicht, dass jedermann sie auf dem Radar hatte. Dr. Yancy hatte behauptet, sie würde sich vor etwas verstecken, und Olivia nahm an, dass das stimmte.
Nun, Crenshaw & Crenshaw hatten ihre Telefonnummer herausgefunden, also hatte sie zurückgerufen und mit dem Anwalt – Tom Crenshaw – gesprochen, der sie bat, der Kanzlei ihre Adresse mitzuteilen. Sie hatte gezögert, sie ihm zu geben, doch er würde sie ja ohnehin herausbekommen; er fragte Liv bloß aus Höflichkeit danach.
Tom Crenshaw hatte behauptet, er wolle ihr etwas zusenden – ein Päckchen –, doch er hatte sich furchtbar zugeknöpft gegeben, als sie ihn nach dem Inhalt fragte. Erst nach einigem Hin und Her, und erst nachdem er sich überzeugt hatte, dass er tatsächlich mit der Olivia Margaux Dugan sprach, die er gesucht hatte, hatte er ihr mitgeteilt, dass seine Kanzlei ein Päckchen für sie habe, das man ihr im Auftrag ihrer Mutter zustellen solle.
Liv wollte ihren Ohren nicht trauen. Im Auftrag ihrer Mutter?
Sie hatte den Telefonhörer fallen lassen, war zum Bett getaumelt und in einen komaähnlichen Schlaf gefallen, aus dem sie gerade erst erwacht war.
Wieder fragte sie sich, ob das Ganze nicht ein Irrtum war. Ihre Mutter war tot. Und zwar seit Livs sechstem Geburtstag. Das Päckchen konnte nicht von ihrer Mutter sein.
Sie starrte auf den Telefonhörer, der an seiner Schnur an der Seite des Telefontischchens herabbaumelte. Bei dem Anblick schnürte sich ihr der Magen zu. Sie sah noch immer den sanft schwingenden Körper ihrer Mutter vor sich, die heraushängende Zunge – ein Bild, das mit der Zeit nicht blasser wurde.
Sie holte mehrmals tief Luft, dann kniff sie die Augen zusammen und öffnete sie wieder, anschließend nahm sie den Hörer hoch und legte ihn zurück auf die Gabel. Völlig veraltete Technologie. Ein schnurloses Telefon besaß sie nicht. Ihr Bruder Hague hatte wirkliche Probleme, was Paranoia anbetraf – weit schlimmere Probleme als Liv –, und ein Teil seiner Paranoia war definitiv auf ihre Art und Weise zu denken übergeschwappt. Da draußen gab es tatsächlich einen Schwarzen Mann. Vielleicht mehr als einen. Vorsicht war deshalb besser als Nachsicht.
Das unermüdlich blinkende Licht und das kleine Display am Anrufbeantworter zeigten an, dass ein weiterer Anruf eingegangen war. Mit Sicherheit hatte es der Anwalt noch einmal probiert. Liv dachte einen Moment lang über das Paradoxon nach, das ihr Leben war, über sich selbst, die vor sämtlichen technischen Kommunikationsmitteln davonlief und gleichzeitig ausgerechnet für eine Software-Firma arbeitete, die Kriegsspiele entwickelte, welche hauptsächlich von Kind gebliebenen Männern gekauft wurden. Zugegeben, sie war bei Zuma Software wenig mehr als eine kleine Buchhalterin – mit Zahlen hatte sie immer gut umgehen können. Dennoch entging ihr nicht die Ironie dieser Situation. Sie grinste schief, nahm all ihren Mut zusammen und drückte auf die Abspieltaste des Anrufbeantworters.
Die körperlose Stimme des Anwalts tönte aus dem Hörer: Ms. Dugan, hier spricht noch einmal Tom Crenshaw von der Kanzlei Crenshaw & Crenshaw. Bitte rufen Sie uns zurück, damit wir Ihnen das Päckchen von Deborah Dugan, adressiert an ihre Tochter Olivia Margaux Dugan, zuschicken können. Wie bereits besprochen, wurde dieses Päckchen in unsere Obhut gegeben mit dem Auftrag, es Ihnen an Ihrem fünfundzwanzigsten Geburtstag zukommen zu lassen. Da dieses Datum bereits verstrichen ist, sind wir verpflichtet zu gewährleisten, dass Ihnen dieses Päckchen sobald als möglichübergeben wird. Es folgte eine kurze Pause, als überlegte Tom Crenshaw, seinen Worten noch etwas hinzuzufügen, doch dann sagte er schlicht: Vielen Dank, hinterließ eine Rückrufnummer und die Öffnungszeiten der Kanzlei.
Liv drückte die Abspieltaste ein zweites Mal und hörte die Nachricht erneut ab. Es war zu früh am Morgen, um Tom Crenshaw zurückzurufen. Sie wusste nicht einmal, ob sie das überhaupt tun wollte. Ihr war warm, und sie hatte leichtes Kopfweh. Wie merkwürdig, nach all den Jahren etwas von ihrer Mutter zugestellt zu bekommen! Von ihrer Mutter. Fast zwanzig Jahre nach deren Tod.
Sie notierte sich die Nummer, die der Anwalt genannt hatte, und machte sich fertig für die Arbeit, dann fuhr sie mit ihrem Honda Accord geistesabwesend zu dem Gewerbegebiet, in dem Zuma Software ansässig war. Die Firma lag am Ende einer privaten Sackgasse, abgetrennt von den anderen Gebäuden durch eine lange, von Thujen gesäumte Auffahrt, was sie weit wichtiger erscheinen ließ, als sie es in Wirklichkeit war. Aber vielleicht war sie ja doch wichtiger, als Liv dachte. Der Besitzer von Zuma Software, ein gewisser Kurt Upjohn, trug die Nase auf alle Fälle ziemlich hoch.
Liv umrundete den vorderen Parkplatz und fuhr zur Westseite des Gebäudes, wo sich der inoffizielle Angestelltenparkplatz befand. Komplett aus Beton, mit einer Vorhalle aus Glas, entsprach Zuma Software neuesten Sicherheitsstandards, angefangen bei den Sicherheitstüren bis hin zu einem Wachmann, Paul de Fore, der Livs voreingenommener Meinung nach ein absoluter Trottel war. Ein kleiner Handlanger ihres Chefs. Ein typischer Radfahrer, der sich nach oben duckte und nach unten trat.
Liv parkte rückwärts ein und stieg aus. Nachdem sie den Honda mit der Fernbedienung verriegelt hatte, ging sie nach vorn zum Haupteingang des Gebäudes. Kurt Upjohn wollte nicht, dass seine Angestellten den Seiteneingang benutzten, da dieser automatisch schloss, sobald irgendwer das Gebäude verließ, und nur von innen wieder geöffnet werden konnte. Zwar konnte man die Tür von außen aufsperren, aber den Schlüssel hütete Upjohn wie seinen Augapfel. Livs Boss war äußerst vorsichtig, wenn es darum ging, dass jemand etwas über die neuesten Computerspiele herausfinden könnte, die die Nerds in dem Großraumbüro im ersten Stock entwickelten. Liv hatte nur einmal einen Blick in diese Welt voller leuchtender Bildschirme, Simulationen und ellenlanger Computercodes geworfen, als Aaron Dirkus, Kurts Sohn, sie förmlich mit nach oben geschleift hatte, und sie war zutiefst beeindruckt, um nicht zu sagen eingeschüchtert gewesen. Das Büro sah aus wie ein Kontrollraum aus einem Hightech-Abenteuerfilm.
Als sie jetzt durch die Eingangstür aus Mahagoni trat – eine Tür umgeben von Glas –, musterte Paul de Fore, der Wachmann, Liv von Kopf bis Fuß, als hätte er sie noch nie gesehen. Livs Finger schlossen sich fester um ihre Handtasche, eine automatische Reaktion, die sie nicht unterdrücken konnte, obwohl sie niemals ihre Pistole mit ins Büro bringen würde. So verrückt war sie nun auch nicht.
Jessica Maltona, die Rezeptionistin von Zuma Software, lächelte, als Liv eintrat, dann warf sie einen Seitenblick auf Paul, der immer noch neben der Eingangstür stand, die Arme verschränkt, und Liv beobachtete, die über den auf Hochglanz polierten Fußboden an ihren Arbeitsplatz auf der anderen Seite des großen Raums ging. Obwohl die beiden Frauen nicht gerade befreundet waren – so gut kannten sie sich einfach nicht, was hauptsächlich an Liv lag –, herrschte zwischen ihnen doch ein unausgesprochenes Einverständnis Paul betreffend, den keine von ihnen leiden konnte.
Im Vorbeigehen erwiderte sie Jessicas Lächeln. Du hast Recht, der Kerl ist wirklich ein Trottel. Als hätte sie ihren Gedanken laut ausgesprochen, nickte Jessica zustimmend.
Liv setzte sich an ihren Arbeitsplatz und stellte ihre Handtasche in ein abschließbares Fach. Den Schlüssel drehte sie herum, zog ihn ab und steckte ihn ein, dann nahm sie sich die Buchführung vor. Es war kein aufregender Job. Im Großen und Ganzen reine Routine. Doch Routinearbeit war genau das, was sie davon abhielt, zu viel nachzudenken, zu fantasieren und sich Sorgen zu machen. Nein, sie war nicht manisch-depressiv. Sie war auch nicht schizophren. Sie war einfach … angeschlagen – ein besseres Wort fiel ihr nicht ein. Von dem Moment an, in dem sie den Leichnam ihrer Mutter in der Küche entdeckt hatte, war sie nicht mehr dieselbe gewesen.
Eine Stunde später, an ihrem sicheren Schreibtisch bei Zuma Software, gute dreißig Meter von der Mahagonitür und den riesigen Fensterfronten entfernt, auf denen das dramatisch rote Neon-Logo der Firma prangte, griff sie zum Telefonhörer und wählte die Nummer der Kanzlei, bevor der allgegenwärtige Aufpasser in ihrem Gehirn sie davon abhalten konnte.
»Crenshaw & Crenshaw«, meldete sich eine gelangweilt klingende Stimme in jenem leicht versnobten Tonfall, der sich bei den gehobenen Kanzleien eingeschlichen zu haben schien.
»Hier spricht Olivia Margaux Dugan. Mr. Tom Crenshaw hat um meinen Rückruf gebeten.«
»Mr. Crenshaw ist noch nicht in der Kanzlei.« In der Stimme der Sekretärin schwang Tadel mit, als sollte Liv wissen, dass jemand, der so wichtig war wie Mr. Tom Crenshaw, sich niemals dazu herablassen würde, derart früh bei der Arbeit zu erscheinen. »Möchten Sie ihm eine Nachricht hinterlassen?«
»Geben Sie ihm bitte diese Adresse.« Sie teilte der Frau die Adresse von Zuma Software mit und sagte abschließend: »Wenn er mir das Paket im Auftrag von Deborah Dugan zustellen lassen möchte, kann er es an diese Adresse schicken.«
»Und er benötigt keine weiteren Angaben?«, fragte die Sekretärin, ein wenig verschnupft ob dieser Eigenmächtigkeit.
»Er weiß, worum es geht«, erwiderte Liv und legte auf.
Zwei Stunden später traf das Paket per Sonderkurier ein. Liv blickte von ihrem Computer auf, zuerst genervt wegen der Störung, dann verblüfft über die Geschwindigkeit und schließlich beklommen, als Paul de Fore auf sie zukam und ihr den braunen DIN-A4-Umschlag entgegenstreckte. Liv hatte gerade Zahlen in ein Computerprogramm eingegeben, das sie an den Chefbuchhalter und firmeninternen Rechnungsprüfer von Zuma Software weiterleiten wollte. Dieser würde über den Dateien brüten, als enthielten sie die Antworten auf die tiefsten Geheimnisse des Universums, bevor er sie schließlich Kurt Upjohn schickte.
Livs Kopf war voller Zahlen, doch Paul in ihre Richtung kommen zu sehen, riss sie mit Überschallgeschwindigkeit aus dieser Welt heraus und holte sie zurück in die Realität. Ihr wurde leicht schwindelig, als sei sie reisekrank.
Wortlos legte Paul den Umschlag auf ihren Schreibtisch. Er sagte ohnehin nie viel, was Liv gerade recht war.
Behutsam nahm sie das Päckchen zur Hand und betrachtete es. Absender war die Kanzlei Crenshaw & Crenshaw. Sie war beunruhigt gewesen, als Tom Crenshaw sie nach ihrem Geburtsdatum gefragt und sich danach erkundigt hatte, wo sie aufgewachsen war. Er hatte die Namen ihrer Eltern wissen wollen und ihr unzählige weitere Fragen gestellt. Im Gegenzug hatte auch sie wissen wollen, mit wem sie sprach. Wie hatte er ihre Telefonnummer herausgefunden? Was wollte er wirklich von ihr? Wie konnte er seine Befugnis nachweisen? Er hatte sich auf Crenshaw & Crenshaw berufen und darauf, dass es sich um eine alteingesessene, vertrauenswürdige Kanzlei handelte. Dann hatte er ihr von dem Päckchen erzählt, doch als er auf ihre Mutter, Deborah Dugan, zu sprechen kam, war ihr einfach der Hörer aus der Hand gefallen.
Und jetzt war besagtes Päckchen da. Das Päckchen von ihrer Mutter, neunzehn Jahre nach deren Tod. Ein großer, brauner Umschlag mit ihrem Namen auf einem in der Mitte prangenden Adressaufkleber. Vorsichtig legte Liv ihn auf den Schreibtisch zurück. Darin befanden sich zweifelsfrei Papiere. Aber welche Papiere? Ihr wollte partout nichts einfallen, was ihre Mutter ihr geschickt haben könnte –
»He!« Aaron Dirkus schnipste mit den Fingern vor ihrem Gesicht.
Liv setzte sich kerzengerade auf, als hätte er sie in den Hintern gekniffen.
»Aaron«, sagte sie gepresst zu Kurt Upjohns Sohn, ihrem einzigen »Freund« bei Zuma Software.
»Ich wollte dich nicht erschrecken«, fügte er hinzu, obwohl er seine Worte nicht ganz ernst zu meinen schien. Aaron hatte einen anderen Nachnamen als sein Vater, was auf eine nicht offiziell bekannte Streitigkeit zwischen Kurt und Aarons Mutter zurückzuführen war – Kurt hatte sie erst geheiratet, nachdem Aaron zur Welt gekommen war, und das hatte sie offenbar so sehr erbost, dass sie und Aaron ihren Mädchennamen behalten hatten. Später hatten sie und Kurt sich ohnehin scheiden lassen. Liv hatte nie nähere Details erfahren, aber die familiären Belange ihres Bosses interessierten sie auch nicht. Sie hatte Aaron keine Fragen gestellt, denn das hätte ihm eine Art Freibrief für eigene Fragen, sie selbst betreffend, gegeben. Sie wollte nicht, dass man Genaueres über sie wusste. Und das galt für alle.
»Du warst ja wie weggetreten. Komm, lass uns bei der Seitentür eine rauchen«, schlug Aaron vor.
»Ich muss noch einiges aufarbeiten«, redete sich Liv heraus, die keine Lust zum Rauchen hatte, schon gar nicht eine von Aarons Spezialzigaretten.
»Unsinn. Du arbeitest viel zu hart. Was uns andere Drückeberger ziemlich alt aussehen lässt.«
»Dein Vater ist der Boss. Du kommst damit vielleicht durch. Ich nicht.«
»Langsam fangen die Leute hier an, dich zu hassen, weißt du das? Also komm mit mir raus.«
Er akzeptierte kein Nein und hatte sie tatsächlich schon einmal von ihrem Stuhl hochgezerrt, damit sie endlich nachgab, deswegen stand sie zögernd auf. Ja, es stimmte, sie machte wirklich nicht genügend Pausen, obwohl ihr diese nach geltendem Arbeitsrecht zustanden, also folgte sie ihm zur Seitentür hinaus auf einen umfriedeten, teils überdachten Innenhof mit einem Tor, durch das man auf den Angestelltenparkplatz schauen konnte. Ihr blauer Accord stand dort, mit der Schnauze nach vorn, als wollte er jeden Moment davonrollen.
Für gewöhnlich schob Aaron einen großen Stein zwischen Tür und Rahmen, um diese einen Spaltbreit offen zu halten, doch heute zog er einen Schlüssel aus der Tasche und sperrte die Tür auf, so dass sie sie von außen öffnen konnten, bis er sie wieder zusperrte.
»Woher hast du den denn?«, fragte Liv verblüfft.
»Geklaut«, gab er zu. »Aber keine Sorge, ich werde die Tür wieder zuschließen, bevor wir heute Abend Feierabend machen. Ich hab einfach keinen Bock darauf, jedes Mal an diesem Arschloch de Fore vorbeizumarschieren, wenn ich etwas frische Luft schnappen möchte.« Mit einem schiefen Grinsen zog er einen Joint und ein Feuerzeug aus der Hosentasche.
Aaron liebte es, Marihuana zu rauchen. Liv hielt sich von sämtlichen Drogen fern; während ihrer jahrelangen Therapie in Hathaway House hatte sie mehr als genug davon für ein ganzes Leben nehmen müssen. Sie bevorzugte es, einen klaren Kopf zu bewahren, und abgesehen von einem gelegentlichen Drink – was allerdings eher selten vorkam –, rührte sie auch Alkohol nicht an.
»Du sagst nicht gerade viel«, stellte Aaron mit einem Seitenblick fest, während er den Rauch aus der Lunge blies. »Genau das mag ich an dir. Obwohl du dadurch ziemlich verschlossen wirkst.«
Unweigerlich musste Liv daran denken, wie sie als sechsjähriges Mädchen gewesen war, und verspürte einen Stich des Bedauerns darüber, dass dieser offene, unabhängige, eigenwillige, draufgängerische Teil ihrer selbst wohl für immer verloren war. Offenbar war die kleine Livvie zusammen mit ihrer Mutter gestorben.
Sie lehnte sich gegen das Tor zum Parkplatz und schaute zu ihrem Wagen hinüber. Gelegentlich hatte sie das Gebäude auf diesem Weg verlassen, wenn Aaron die Tür mit dem Stein offengehalten hatte. Wenn es darum ging, Paul de Fore zu umgehen, war auch sie nur allzu gern dazu bereit, gewisse Regeln zu brechen. Paul zählte definitiv zu der Sorte Mensch, die kaum einer ertragen konnte, zu jenen, die ihren Job viel zu ernst nahmen.
Etwas zu ernst zu nehmen war nicht gerade Aarons Problem.
»Erzähl mir etwas über dich«, sagte Aaron jetzt. Er hatte langes Haar und trug ein kariertes Hemd über einem T-Shirt, der typische lässige Leistungsverweigerer-Stil. Dabei spielte es keine Rolle, dass sein Dad der Boss war – alle Programmierer und Spieledesigner, die ein Stockwerk höher arbeiteten, trugen diesen Look. Slacker, Hacker, Computerfreak, Videospieldesigner … Es schien einen ganz bestimmten Dresscode unter ihnen zu geben, der sich bewusst von der typischen Geschäftskleidung unterschied.
Nur Liv und Jessica Maltona trugen offizielle Bürokleidung: Röcke oder Baumwollhosen, Blusen, Westen, Blazer, vernünftige Schuhe, geschmackvollen Schmuck, dezentes Make-up. Und obwohl es keine entsprechende Vorschrift gab, hatte Paul de Fore stets ein marineblaues Hemd und eine dazu passende Hose an, was an die Uniform eines Sicherheitsdienstes erinnerte.
»Nun, mein Sternzeichen ist Löwe«, kam sie Aarons Aufforderung nach. »Ich esse gern italienisch, liebe teuren Kaffee und lebe in einem Apartment mit einem hundertfünfzig Pfund schweren Kater zusammen.«
Aaron verschluckte sich am Rauch seines Joints und hustete heftig. Liv hatte noch nie etwas Persönliches preisgegeben, und jetzt hatte sie ihn völlig überrumpelt. Wenngleich sie selbst nicht wusste, warum sie das gesagt hatte. Sie hatte einfach einmal … nicht so ernst sein wollen.
»Cool. Wie heißt der Kater?«, fragte er.
»Tiny.«
Winzling? Er grinste, und Liv lächelte ebenfalls. Aaron, der sie noch nie so unbefangen erlebt hatte, starrte sie an, als hätte er sie gerade eben zum ersten Mal gesehen.
»Wer bist du?«, fragte er. »Du siehst viel zu gut aus für die mausgraue Buchhalterin, die du hier zum Besten gibst.«
Was sagt er da? Ich sehe gut aus? Liv hatte glattes braunes Haar und haselnussbraune Augen, Mund und Kinn standen zu dicht beisammen, zumindest hatte man ihr das einmal gesagt. »Ich sehe ziemlich durchschnittlich aus.«
»Wie wär’s, wenn du mal einen Blick in den Spiegel wirfst?«
Sie schüttelte den Kopf. Das war keine gute Idee. Wann immer sie in den Spiegel schaute, blickte ihr eine Frau mit angstvollen Augen entgegen, die so gut wie kein Privatleben hatte. Auch das Berufsleben war nicht weiter erwähnenswert.
Er winkte ab und nahm einen letzten tiefen Zug. »Du siehst gut aus, und du bist zu ernst. Du solltest das hier mal versuchen.« Er streckte ihr den abgebrannten Stummel seines Joints entgegen, doch Liv schüttelte den Kopf.
»Nein danke.«
»Dann trink halt mal ein, zwei Gläschen Wein oder ein paar Mojitos. Oder nimm Xanax. Manchmal wirken Psychopharmaka wahre Wunder. Mach dich doch einfach mal ein bisschen locker.« Er stieß das Tor auf und trat hinaus auf den Angestelltenparkplatz.
»Dein Vater wird stinksauer werden, wenn er mitbekommt, dass du die Sicherheitsvorschriften ignorierst«, warnte sie ihn.
»Ein Mann muss tun, was er tun muss. Du nimmst doch auch manchmal diesen Ausgang.«
Das stimmte. Obwohl sich Liv für gewöhnlich an die Regeln hielt, ließ es sich nicht leugnen, dass sich ein kleiner Teil von ihr ab und an gegen die Obrigkeiten auflehnte. Ein Teil, der so gut verborgen war, dass sie die meiste Zeit über so tat, als gäbe es ihn gar nicht. Aber manchmal reckte und streckte er sich und fuhr die Krallen aus wie ein aus dem Schlaf erwachendes wildes Tier, das gleich auf Beutefang gehen würde. Woran das lag, wusste sie nicht, wenngleich sie vermutete, dass es mit ihrer Zeit in Hathaway House zusammenhing, als andere Menschen komplett das Sagen über sie hatten. Oder aber an der Tatsache, dass die Polizei nach dem Tod ihrer Mutter einen unauslöschlichen Eindruck bei ihr hinterlassen hatte, und zwar keinen guten. Doch vielleicht hatte sie diese Seite ihrer Persönlichkeit bislang auch einfach nur ignoriert und war daher jedes Mal aufs Neue überrascht, wenn sich diese plötzlich in den Vordergrund drängte. Sie war nicht nur die stille, fleißige Angestellte, die alle in ihr sahen, auch wenn sie sich alle Mühe gab, genau so zu wirken – eine Art Tarnung, wie bei einem Chamäleon, das sich ebenfalls überall anpassen konnte.
Als sie nach der Arbeit nach Hause fuhr, hatte sie das geheimnisvolle Päckchen immer noch nicht geöffnet. In ihrem Apartment angekommen, ließ sie es auf die Küchenanrichte fallen und richtete sich ein rasches Abendessen her – ein kalorienreduziertes Fertiggericht aus der Mikrowelle, das nach gar nichts schmeckte. Ihre Essgewohnheiten hatten sich über die Jahre nicht weiterentwickelt.
Um zweiundzwanzig Uhr dreißig ging sie zu Bett und starrte im Dunkeln die Decke an. Sie hörte das tröstliche Summen des Kühlschranks und die blechernen Stimmen aus dem Fernseher ihrer Nachbarn, der gleich hinter ihrem Kopf zu stehen schien. Die Wand, die die Schlafzimmer der beiden Apartments voneinander trennte, war anscheinend dünn wie Papier.
Liv schlief ein und wurde um Mitternacht abrupt von einem schrillen Schrei aus dem Schlaf gerissen. Hinter der Wand war gedämpftes Stöhnen zu vernehmen. Offenbar war ihre Nachbarin Jo gerade zum Höhepunkt gekommen – was häufig genug vorkam.
Schlaf … So nannten es andere Leute, doch Liv war sich ziemlich sicher, dass sich ihr Schlaf von deren Schlaf unterschied. Ihr Schlaf wurde von immer wiederkehrenden Bildern gestört, die sich in einen Traum schlichen, obwohl sie gar nichts damit zu tun hatten; Bilder, die tief in ihrem Innern verborgen waren, Erinnerungen aus ihrer Kindheit, die einfach nicht weichen wollten. Grauenvolle Bilder. Bilder, derentwegen man sie nach Hathaway House geschickt hatte, eine Anstalt für psychisch labile Teenager, die dort therapiert wurden, weil sie Drogen genommen, Selbstmordversuche begangen oder sich verstümmelt hatten … Was auch immer – die Reihe ließe sich endlos fortsetzen. Sie hatte man dort eingewiesen, weil sie »verhaltensgestört« war, wie ihre böse Stiefmutter – ja, sie hatte tatsächlich eine – behauptete. Ebendiese böse Stiefmutter hatte ihren Vater davon überzeugt, professionelle Hilfe für seine durchgeknallte Tochter zu suchen. Bloß dass diese Hilfe nichts gebracht hatte, auch wenn Liv inzwischen wusste, dass ihre Probleme klein gewesen waren im Vergleich zu denen manch anderer Kids in Hathaway House.
Weil sie allerdings minderjährig war und ihr somit keine Wahl blieb, saß Liv ihre Zeit dort ab, bis man ihr endlich – sehr zum Missfallen der bösen Stiefmutter Lorinda – bescheinigte, dass sie sich »auf dem Weg der Besserung« befand. Zu jener Zeit hätte sie eigentlich ihren Abschluss an der Highschool machen müssen. Sie wurde in die Obhut ihrer Familie entlassen und erwarb per Fernunterricht ihr GED – das General Education Diploma, das einem Highschool-Abschluss in etwa gleichkam. Damals hatte sie gelernt, dass es das Beste war, nicht gleich jedem von den überwältigenden, verstörenden Bildern zu erzählen, die sie nach wie vor quälten: ihre Mutter, die schlaff von einem Haken an der Küchendecke baumelte. Bilder eines Selbstmords, der dafür sorgte, dass Deborah Dugans Kinder, Liv und ihr Bruder Hague, allein mit ihrem fassungslosen Vater zurückblieben, der erstaunlich schnell eine neue Frau fand.
Liv blinzelte in die Dunkelheit. Jetzt lief nebenan im Fernseher eine alte Sitcom, dann und wann ertönte dröhnendes Gelächter vom Band. Ha. Ha. Ha. Sie dachte an das Paar, das Tür an Tür mit ihr in Apartment 21B wohnte. Jung – etwa in ihrem eigenen Alter – und verliebt, schienen sie von Pizza und Cola light zu leben. Zumindest das Mädchen. Der junge Mann hatte eine Vorliebe für Bier. »Was immer gerade im Sonderangebot ist«, hatte er, einen Kasten Budweiser in den Händen, zu Liv gesagt, als sie die zwei eines Tages auf dem Balkongang vor ihrer Haustür traf. Sie versuchten, sich zu umarmen und zu küssen, und kicherten, während er gleichzeitig mit dem Schlüssel im Schloss herumstocherte. Die Tür ging auf, und sie stolperten hinein und knallten die Tür hinter sich zu.
Liv sperrte ihre eigene Haustür auf und wurde von dem Geruch der Einsamkeit und ungenutzt verstrichenen Gelegenheiten empfangen.
Das Paar nebenan hieß mit Nachnamen Martin, zumindest einer der beiden, und obwohl sie sich nie offiziell vorgestellt hatten, wusste Liv, dass die junge Frau, die beim Sex so gern schrie, Jo hieß. Sein Name fing mit einem T an … Travis oder Trevor oder so ähnlich. Eigentlich sollte sie wissen, wie er hieß, denn Jo schrie seinen Namen oft genug, wenn sie sich liebten, doch Liv, die sich vorkam wie ein akustischer Voyeur, pflegte sich stets das Kissen über den Kopf zu ziehen, sobald es nebenan zur Sache ging.
Das Schlimmste aber war, dass die Liebesspiele der zwei Liv an die beiden Male erinnerten, an denen sie selbst kurz davor gewesen war, mit einem Jungen zu schlafen, und natürlich an das eine Mal, bei dem es tatsächlich so weit gekommen war. Sie hatte es hinter sich gebracht und sich anschließend gefragt, was um alles auf der Welt die anderen so toll daran fanden. Wo waren die Glöckchen, Blumen, wo der Regenbogen, die Endorphine? Sie hatte sich danach hauptsächlich deprimiert gefühlt und darüber nachgedacht, ob ihr auch dieser Teil des normalen Lebens – Sex als wundervoller Ausdruck höchster Gefühle – wie so vieles andere verschlossen blieb.
Wie zynisch. Aber so war sie nun einmal. Zynisch und verängstigt. Ja, sie hatte Angst, ein Päckchen von einem Menschen zu öffnen, das ihr dieser so lange nach seinem Tod hatte zustellen lassen.
Am folgenden Morgen brachte Liv ihr allmorgendliches Ritual hinter sich – duschen, eine schwarze Hose und ein schwarzes, langärmeliges T-Shirt anziehen, ein Glas Orangensaft trinken und ein Toast mit Erdnussbutter essen –, während sie die ganze Zeit über das Päckchen im Auge behielt. Als sie fertig war, nahm sie ihre Handtasche und die Schlüssel und eilte zur Tür hinaus, doch dann machte sie auf dem Absatz kehrt und ging wieder zurück in ihre Wohnung, wo sie mit hämmerndem Herzen den Umschlag aufriss. Sie kämpfte die lähmende Angst nieder, die sie überkam, hielt die Luft an und leerte den Inhalt auf den Küchentresen.
Fotos und mehrere Bögen Papier kamen zum Vorschein.
Auf einem der Bilder entdeckte sie ihre Mutter, zusammen mit anderen Personen. Die Fotos in der Hand, taumelte Liv rückwärts zur Couch und ließ sich darauf sinken; die Papierbögen flatterten zu Boden. Liv erkannte eine Geburtsurkunde – ihre eigene. Sie atmete tief durch und versuchte, sich gegen den Panik-Tsunami zu wappnen, der sie zu überrollen drohte. Ihre Ohren dröhnten. Sie konnte nicht denken. Nichts sehen. Konnte sich kaum daran erinnern, wo sie war.
Ihr Blick wanderte nach innen, zurück an einen kühlen Sommerabend vor langer, langer Zeit. Eine frische Brise wehte durch die offene Seitentür in die Küche. Die Spitzen von den Schuhen ihrer Mutter schaukelten von einer Seite zur anderen … ihr Gesicht war dunkellila … ihre Zunge, die ihr weit aus dem Mund hing, blau und geschwollen.
Liv kniff die Augen zusammen, bemüht, das Bild durch Schwärze zu ersetzen, doch es leuchtete hell auf der Innenseite ihrer Lider, wie ein Negativ. Entsetzt riss sie die Augen wieder auf und sah für einen kurzen Moment ihre Mutter direkt vor sich stehen.
»Ich bin fertig«, sagte Mama, dann – puff! – löste sich die Erscheinung in Nichts auf.
Kapitel zwei
Während der Mittagspause verließ Liv das Büro und fuhr nach Hause, obwohl sie im Grunde gar keine Zeit dafür hatte, selbst wenn sie ganz aufs Essen verzichten würde. Sie hatte die Fotos aus dem Päckchen am Morgen auf dem Couchtisch liegen gelassen und war abrupt zur Arbeit gefahren, da sie die Bilder unmöglich länger hatte ansehen oder gar berühren können. Doch dass sie nun so offen dalagen, hatte ihre Fantasie den ganzen Vormittag über zu Höchstleistungen angespornt.
Jetzt hastete sie die Treppe vom Parkplatz in den ersten Stock des L-förmigen Gebäudes hinauf. Ihr Apartment war das vorletzte an dem langen Balkongang. Gerade als sie den Schlüssel ins Schloss steckte und die Tür aufdrückte, spürte sie, dass jemand hinter ihr stand.
Mit einem lauten Schrei sprang sie in ihre Wohnung und wirbelte herum, um dem Angreifer ins Gesicht zu blicken.
»Hoppla! Tut mir leid!«
Es war ihr Nachbar, Trevor oder Travis Martin. Erschrocken, die Hände in einer beschwichtigenden Geste erhoben, stand er vor ihr. Liv spürte, wie schlagartig sämtliche Energie aus ihr wich, und lehnte sich Halt suchend gegen die Wand. Ihre Beine zitterten. Fast wäre sie zu Boden gesunken.
Besorgt streckte er die Hand aus, um sie aufzufangen, und sagte: »Mein Gott, tut mir echt leid.«
Liv zuckte zurück. »Schon okay. Was … was machst du hier?«
»Komm.« Er legte den Arm um ihre Schultern und half ihr entgegen ihrer Proteste zur Couch. Ihre Beine funktionierten wie die eines Roboters, sie fühlten sich vollkommen losgelöst vom Rest ihres Körpers an.
»Was willst du?«, fragte sie erneut, bemüht, völlig angstfrei zu klingen.
Die Fotos lagen unübersehbar auf dem Couchtisch, außerdem ihre Geburtsurkunde und ein Brief ihrer Mutter. Sie starrte darauf, dann warf sie einen raschen Blick auf ihren Nachbarn, doch seine Augen ruhten nur auf ihr, er hatte die Bilder offenbar nicht wahrgenommen. »Ich wollte dich bloß für heute Abend zu uns einladen«, sagte er entschuldigend. »Es war nicht meine Absicht, dich so zu erschrecken.«
»Oh.« Sie wusste nicht, was sie sagen sollte, war zu sehr damit beschäftigt, ihren Puls auf ein normales Level herunterzubringen.
Sein Blick wanderte jetzt durchs Zimmer und landete auf den Fotos. Auf einem davon kam ein wütend aussehender Mann auf die Person zu gestapft, die das Foto machte, eine Hand ausgestreckt, als wollte er ihr die Kamera entreißen. Derselbe Mann war zusammen mit Livs Mutter auf mehreren Bildern zu sehen, doch er wandte sich stets mit finsterem Blick ab, als wolle er nicht, dass man ihn fotografierte.
»Wer ist das?«, fragte er.
»Keine Ahnung«, erwiderte Liv steif.
»Sieht voll angepisst aus. Ist das ein altes Foto?«
Die Farben waren verblasst, die Frauen in ihren schulterfreien Tops, den schwarzen Stretchhosen und mit den dauergewellten Haaren sahen aus, als kämen sie direkt aus Flashdance, was Bände über das Entstehungsdatum der Aufnahmen sprach. »Ja.«
»Hm.« Er wandte sich wieder Liv zu. »Also … Jo und ich … wir wollten dich auf ein paar Drinks und eine Pizza einladen. Wird bestimmt nicht spät werden. Passt dir das?«
»Danke, aber ich habe schon etwas vor.« Was nicht wirklich gelogen war. Sie hatte im Laufe des Vormittags tatsächlich beschlossen, zu ihrem Bruder zu fahren und diesem den Inhalt des Päckchens zu zeigen. Hague hatte zwar genügend mit sich selbst zu tun, doch seltsamerweise hatte er sich schon oft als ganz besonders einfühlsam erwiesen.
Er war noch ein Kleinkind gewesen, als ihre Mutter starb, aber vielleicht war tief in seiner Seele etwas begraben, was ihnen eine Erklärung bieten konnte.
»Vielleicht ein andermal? Ich muss wieder los, ich bin nur kurz in der Mittagspause hergefahren.«
»Komm einfach rüber, wenn es doch noch klappt«, schlug er vor.
»Das mache ich«, versprach sie und schob ihn zur Tür hinaus.
Das Apartment, in dem Livs Bruder Hague wohnte, lag im zweiten und damit obersten Stockwerk eines älteren Fabrikgebäudes am Ostufer des Willamette River. In den 1960ern hatte man es in Lofts umgewandelt, die inzwischen arg in die Jahre gekommen waren und dringend einer Renovierung bedurft hätten, doch sie boten nach Norden hin noch immer einen spektakulären Ausblick auf das Stadtzentrum von Portland, während die Fenster auf der Westseite auf den Fluss hinausgingen. Hagues Wohnung lag an der nordwestlichen Ecke und hätte eine Wahnsinnsaussicht auf die Skyline von Portland geboten, wenn er jemals die Jalousien geöffnet hätte.
Liv stellte ihren blauen Honda Accord anderthalb Blocks von dem ehemaligen Fabrikgebäude entfernt ab; einen näheren Parkplatz konnte sie jetzt, zur Feierabendzeit, nicht finden. Sie hastete zu seiner Wohnung, das Päckchen unter dem Mantel verborgen, da sie das Gefühl nicht abschütteln konnte, von unsichtbaren Augen verfolgt zu werden, auch wenn es mit Sicherheit keine gab. Für gewöhnlich gelang es ihr, ihre Neurosen und Psychosen in Schach zu halten, doch es gab Zeiten, in denen diese einfach übermächtig wurden und Liv ihnen völlig machtlos gegenüberstand.
Wie so oft wünschte sie sich inständig, die Geschehnisse der Vergangenheit ändern zu können, doch natürlich ging das nicht. Sie hatte ihre Mutter und große Teile ihres eigenen Lebens verloren – Tage, Wochen, Monate, Jahre –, und es gab keine Möglichkeit, diese zurückzubekommen. Sie konnte sich noch immer lebhaft an die bohrenden Fragen des Polizisten erinnern, die er ihr gestellt hatte, nachdem sie aus ihrer traumabedingten Ohnmacht erwacht war. Sie hatte in einem Krankenhaus mit grauen Wänden gelegen. Es roch unangenehm.
»Hast du etwas gesehen, als du in der Küche warst?«, fragte der Mann. Er trug keine Uniform.
»Ich habe Mama gesehen.« Sie musste sich zwingen, die Worte auszusprechen. Ihre Lippen zitterten unkontrollierbar.
»Sonst noch etwas? Egal, was.« Er warf der Frau, die bei ihm war, einen ungeduldigen Blick zu.
Livvie fing unkontrolliert an zu schluchzen.
»Sinnlos«, murmelte er.
»Sie ist doch noch ein Kind«, sagte die Frau angespannt.
Er wandte sich wieder Livvie zu. »Die Seitentür stand offen. Ist dir das aufgefallen?«
Sie nickte heftig.
»Bist du hinausgegangen? Hast nach draußen geschaut?«
»NEIN!«
»Beruhige dich«, sagte er. »War sonst noch jemand in der Nähe?«
»H-Hague lag in seinem Bett«, stammelte sie und zupfte an der Bettdecke. »Er – er hat angefangen zu weinen …«
»Ich meinte, ob irgendwelche Erwachsene in der Nähe waren!« Der Mann presste die Lippen zusammen, als müsste er sich eine fiese Bemerkung verkneifen.
Livvie spürte, wie ihr die Tränen übers Gesicht liefen. Die Frau trat zu ihr, tätschelte ihre Hand und sagte mit zornig funkelnden Augen: »Lassen Sie das arme Kind in Ruhe!«
»Vielleicht hat ihre Mutter sich umgebracht, weil sie etwas über die toten Frauen auf dem Feld hinter ihrem Haus wusste.«
»Pscht.« Der Mund der Frau bildete ebenfalls eine schmale Linie, aber Livvie war froh, dass sie da war, begriff, dass sie ihr zur Seite stand und nicht dem Mann.
»Es könnte aber auch sein, dass jemand annahm, sie würde etwas wissen, und dieser Jemand beschloss daher, das Problem auf seine Art und Weise zu lösen.«
Die Frau baute sich vor ihm auf und sagte mit leiser Stimme: »Dieses Mädchen hat seine Mutter gefunden! Es war Selbstmord, und das ist tragisch. Das Kind ist tief traumatisiert. Versuchen Sie bitte, daran zu denken.«
Er sah sie böse an, dann erwiderte er ebenso leise: »Ich versuche, einen Mörder zu finden. Vielleicht sollten Sie mal daran denken.«
Sehr viel später war Liv klargeworden, dass der Mann ein Polizist in Zivil von der Rock Springs Police gewesen war, eine kleine Einheit, die keinerlei Erfahrung mit dem Vernehmen von Kindern hatte. Wenngleich das keine Entschuldigung war. Zumal er nach der ersten Befragung keine Ruhe gegeben hatte. Sobald sie aus dem Krankenhaus entlassen wurde, hatte er sie zu Hause aufgesucht. Zu jener Zeit passte eine Nachbarin auf sie auf, aber Liv weigerte sich, in die Küche zu gehen. Sie saß im Wohnzimmer, als der Officer kam, um sie zu befragen. Dieses Mal war sie mit ihm allein … und sie brach in Panik aus.
Er versuchte es immer wieder, aber Liv hatte komplett das Vertrauen verloren.
»Jetzt versuch noch mal, dich an den Abend zu erinnern, an dem deine Mutter starb«, sagte er. Sein Lächeln glich einem Zähnefletschen. Sie spürte, dass er sich Mühe gab, freundlich zu sein, doch gerade das jagte ihr noch mehr Angst ein.
»Okay«, willigte sie zögernd ein.
»Denk nicht an deine Mom. Denk an die Küche.«
Die Panik wurde stärker. Sie sah den Tisch vor sich, das Spülbecken und das Fenster.
»Es war sehr dunkel. Von draußen kam Kälte herein«, sagte sie.
»Das ist richtig. Die Seitentür stand offen«, bestätigte der Officer nickend. »Weißt du, wer zur Tür hinausgegangen ist?«
»Mein Dad?«
»Du glaubst, dein Dad ist durch diese Tür gegangen?«
»Mama hat sich das Gesicht gehalten.«
»Dein Vater hat mir erzählt, dass sie sich gestritten haben. Weißt du, worum es bei diesem Streit ging?«
Livvie dachte angestrengt nach, doch dann schüttelte sie den Kopf.
»Haben sie schon früher mal gestritten?«
»Ja … Mama hat ihn einmal gehauen.«
»Deine Mama hat deinen Dad gehauen?«
»Ich glaube, er hat sie auch gehauen«, antworte Livvie. »Deshalb hat sie sich das Gesicht gehalten.« Als sie Mama vor sich sah, fing sie wieder an, zu zittern und zu schluchzen.
»Jetzt sei ein großes Mädchen und hör auf zu weinen. Ich brauche deine Hilfe. Deine Mama braucht deine Hilfe.«
»Mama ist tot. Mama ist tot!«
»Du kannst ihr helfen.«
»Du lügst! Mama ist tot!«, schrie Livvie und schlug die Hände über die Ohren. Der Polizist verließ das Wohnzimmer, sagte irgendetwas Böses zu der Nachbarin und knallte die Haustür zu.
Danach gab die Polizei auf und versuchte nicht weiter, Informationen über den fraglichen Abend aus ihr herauszulocken. Die Frau vom Jugendamt dagegen ließ nicht locker; sie fragte Livvie nach der Beziehung ihrer Eltern, was ihren Vater in Teufels Küche brachte und vermutlich einer der Gründe für ihr von da an eher frostiges Verhältnis war. Die Polizei verhörte Albert Dugan nach allen Regeln der Kunst, und er war außer sich vor Zorn darüber, dass Livvie derartige Märchen verbreitete. Dennoch räumte er ein, dass es in seiner Ehe mit Deborah eher stürmisch zugegangen war. Ja, er hatte sie geschlagen … einmal, vielleicht auch zweimal. Aber sie hatte ihn ebenfalls geschlagen. Er gab zu, dass er sie an jenem Abend kurz vor ihrem Tod geohrfeigt hatte und anschließend durch die Seitentür davongestapft war. Deborah habe ihn gebissen, und er habe ausgeholt, ohne weiter nachzudenken. Doch es täte ihm leid. So schrecklich leid.
Deshalb also hatte Mama »Ich bin fertig« gesagt, da war sich Liv ziemlich sicher.
Gar nicht sicher dagegen war sie sich bis zum heutigen Tag darüber, was wirklich zwischen ihren Eltern gelaufen war. Ihr Vater schwor, dass sie einander geliebt hatten. Nun, zumindest hätte er Deborah geliebt … doch dann habe sie sich das Leben genommen, und dafür müsse es einen tiefgehenden Grund geben, den er allerdings nicht verstehe. Er hatte nie daran geglaubt, dass seine Frau Selbstmord begangen hatte. Sprach nie darüber. Kaum ein Jahr nach Deborahs Tod heiratete er Lorinda, und die ganze Familie zog aus dem Haus mit den erdrückenden Erinnerungen fort und in ein anderes am entgegengesetzten Ende der Stadt. Albert, der beim Amt für Forstwirtschaft beschäftigt war, ließ sein altes Leben hinter sich und fing ein neues an. Liv verstand, dass ihn die Ereignisse jenes schicksalhaften Abends genauso verfolgten wie sie, wenngleich auf andere Weise, doch deswegen nicht minder qualvoll. Deborahs Tod hatte auch sein Leben nachhaltig verändert.
Genau wie das von Hague …
Liv riss sich von ihren Erinnerungen los, stieg in den ratternden Aufzug mit der Faltgittertür und sah den Fußboden unter sich verschwinden, während sie in den zweiten Stock hinauffuhr. Oben angekommen, trat sie hinaus auf den zerschrammten Holzfußboden im Flur, der nach Bohnerwachs, Staub und verkochtem Gemüse roch, und ging eilig zu Hagues Tür.
Nach dem Tod ihrer Mutter hatte der Polizist auch Hague Fragen gestellt, was aber kaum etwas brachte. Hague hatte etwas über »diesen Mann« gebrabbelt. Nicht nur die Ermittlungsbehörde, auch das Jugendamt hatte herausfinden wollen, was es damit auf sich hatte, doch keiner schien zu verstehen, wovon er sprach. Als alle weg und sie allein waren, hatte Liv ihn auch noch mal gefragt, und er hatte sich unter seiner Bettdecke versteckt und geflüstert: »Zombie-Mann. Tötet dich. Tötet dich!« Dann hatte er angefangen, gleichzeitig zu lachen und zu weinen. Er konnte gar nicht mehr aufhören zu schluchzen, was Liv eine Heidenangst einjagte.
Zitternd war sie in ihr eigenes Zimmer gerannt, um sich ebenfalls unter der Bettdecke zu verstecken. Später hatte Hague behauptet, Mama habe einen Freund gehabt. »Mamas Freund!«, hatte er gekreischt. »Mamas Freund!« Die Polizei war ratlos gewesen und führte besagten »Freund« seitdem als »Deborah Dugans geheimnisvollen Mann«.
Liv hatte vor den Ermittlern nie eine Bemerkung über Hagues »Zombie-Mann« und dieses »Tötet dich!« fallen gelassen. Ob er das wirklich an jenem Tag gesagt hatte … sie war sich da nie ganz sicher gewesen. Außerdem wusste sie damals noch nicht, dass diese Worte zu den ersten Anzeichen der Verhaltensstörung zählten, die Hague in eine tiefe Abwärtsspirale hineinziehen würde, welche bis zum heutigen Tag sein Leben beeinflusste.
»Hallo, Olivia.«
Della Larson, Hagues Lebensgefährtin oder wie immer man sie nennen wollte, öffnete die Tür. Sie warf den Kopf zurück, verschränkte die Arme vor der Brust und beäugte Liv misstrauisch. Das Loft hinter ihr sah aus wie ein finsteres Loch. Hague mochte weder Licht noch frische Luft, und er hasste jede noch so kleine Veränderung. Es sei denn, er entschied sich für eine hundertprozentige Kehrtwende, was gelegentlich vorkam.
Della war über zehn Jahre älter als Hague und seine Pflegerin-Begleiterin-Freundin und möglicherweise auch seine Geliebte. Sie hatte Hague den Großteil seines Erwachsenenlebens über begleitet, seit seiner Entlassung aus dem Grandview Hospital, der psychiatrischen Einrichtung für Jugendliche, in die man ihn kurzzeitig gesteckt hatte, während Liv in Hathaway House war. Obwohl Liv von den Dugans adoptiert worden war – eine Tatsache, die die just eingetroffene Geburtsurkunde eindeutig belegte – und somit nicht blutsverwandt mit ihrem Bruder, schienen psychische Erkrankungen die ganze Familie zu betreffen. Hague war ein Genie mit einem Intelligenzquotienten von hundertsechzig, aber das bedeutete noch lange nicht, dass er in dieser Welt lebensfähig war. Maladaptiv lautete das Wort, mit dem sein Verhalten häufig beschrieben wurde. Doch was normabweichende Verhaltensmuster anbetraf, war Liv ihrem Bruder meilenweit voraus, obwohl ihre Probleme – so die damalige Diagnose – von ihrem mentalen Trauma herrührten und nicht von einem Gehirn, das nicht so funktionierte, wie der Rest der »normalen« Menschen es erwartete. Wie schon der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer einst gesagt hatte: »Das Talent gleicht dem Schützen, der ein Ziel trifft, welches die Übrigen nicht erreichen können, das Genie dem, der eines trifft, bis zu welchem sie nicht einmal zu sehen vermögen.« Della hatte diese Worte häufiger zitiert, als Liv zählen konnte.
Hagues »Lebensgefährtin« hatte ihr weißblondes Haar zu einem straffen Knoten im Nacken frisiert und musterte Liv jetzt mit ihren eisblauen Augen, als hätte sie sie noch nie gesehen. Das nervte Liv, doch ihr war klar, dass dies bloß das Misstrauen spiegelte, das ihr eigener Bruder allem und jedem gegenüber hegte.
»Du hast nicht vorher angerufen«, bemerkt Della.
»Hi, Della«, sagte Liv. »Als ich es das letzte Mal probiert habe, war der Anschluss abgemeldet.«
»Er ist seit über einem Monat wieder angemeldet.«
»Auf wessen Namen?«
Della zögerte kurz. »Auf meinen.«
»Ganz gleich, was du über mich denken magst«, sagte Liv, »ich kann nicht hellsehen. Das überlasse ich Hague.«
Die Nase missbilligend gekraust, trat Della zur Seite und gestattete Liv, die dunkle Apartmenthöhle zu betreten. Es roch nach Bleichmittel und Zitrone, was eine Erleichterung war angesichts des Chaos, das dort herrschte. Hague hortete alle möglichen Dinge, aber alles musste blitzsauber sein, darauf bestand er, und Della fügte sich seinen Wünschen.
»Er ist in seinem Zimmer«, sagte Della und führte sie durchs Wohnzimmer und den kurzen Flur zu dem Eckzimmer, das nach Nordwesten hinausging. Dort klopfte sie an die Tür, und als Hague »Was?« blaffte, erwiderte sie mit ruhiger Stimme: »Ich will nicht stören. Deine Schwester ist hier.«