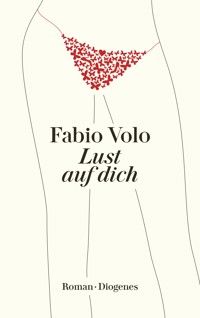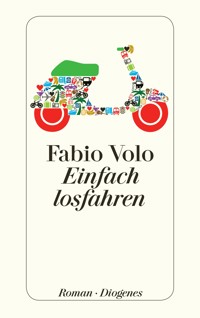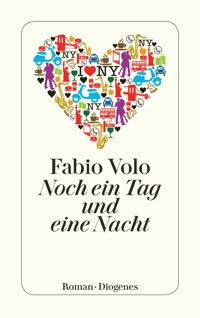
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wecker, Kaffee, Straßenbahn, Büro, Fitness, Pizza, Kino, Bett (wenn möglich nicht allein) … So sieht Giacomos Leben aus, ewiggleiche Tage unter dem fahlen Himmel einer italienischen Großstadt. Eines Morgens fällt Giacomo in der Straßenbahn eine junge Frau auf. Am nächsten Tag sitzt sie wieder da. Über Monate beobachtet Giacomo sie, ohne sie anzusprechen – das morgendliche Treffen wird für ihn zum geheimen Rendezvous. Als schließlich sie ihn anspricht, ist er für ein paar Sekunden auf Wolke sieben. Gleich darauf schlägt er aber hart auf dem Boden auf: Denn Michela geht fort. Für immer. Nach New York. Giacomo ist völlig durcheinander. Versucht, sich wieder einzukriegen, sich für andere Frauen zu interessieren. Doch schließlich packt er seinen kleinen Rucksack und reist Michela hinterher.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Fabio Volo
Noch ein Tagund eine Nacht
Roman
Aus dem Italienischen vonPeter Klöss
Titel der 2007 bei
Arnoldo Mondadori Editore, Mailand,
erschienenen Originalausgabe: ›Il giorno in più‹
Copyright © 2007 by Arnoldo Mondadori
Editore S.p.A., Mailand
Das Buch wurde für die deutsche Ausgabe
in Zusammenarbeit mit dem Autor
nochmals durchgesehen
Die Übersetzung wurde gefördert durch
ein Arbeitsstipendium
des Landes Nordrhein-Wesfalen
Umschlagillustration nach Motiven von
iStockphoto
Alle deutschen Rechte vorbehalten
Copyright © 2015
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 24090 0 (9. Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60371 2
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] Inhalt
Prolog [9]
Die Frau in der Straßenbahn [15]
Der »Scheinkauf« [33]
Silvia [38]
Ein abwesender Vater [50]
Exfreundinnen (kommen manchmal zurück) [62]
Frauen und Unglück [74]
Wo magst du sein? [85]
Waiting for Michela [99]
Das Tagebuch [112]
Romantisches Abendessen (Hamburger mit Pommes) [122]
Tags darauf [132]
Erste gemeinsame Dusche (und erste Nacht) [140]
Das Spiel [148]
Die Regeln [158]
Sich kennenlernen (-8) [164]
Brunch (-7) [179]
Sexy Manhattan (-6) [195]
Picknick (-5) [202]
Die Hochzeit (-4) [212]
Schnee und Kinder (-3) [219]
Das Bad (-2) [228]
[6] Game over (-1) [241]
Oma [253]
Mutter [260]
Gespräch mit Silvia [268]
Man selbst sein [282]
[7] Für sie
Erst wenn eine Liebe sich
nicht länger träumt, stirbt sie.
Pedro Salinas
When you were here before,
Couldn’t look you in the eye
You’re just like an angel,
Your skin makes me cry
You float like a feather
In a beautiful world
I wish I was special
You’re so very special
Radiohead, Creep
[9] Ich schlafe, und im Schlaf bin ich mir sicher, dass ich in einem Haus am Strand aufwache, in dem ich mit der Frau, die ich liebe, die Nacht verbracht und Augenblicke vollkommenen Glücks erlebt habe. Das Geräusch der Wellen hat erst das Wachsein begleitet, dann den Schlaf, du liegst in meinen Armen, und unsere Körper wärmen einander.
Doch als ich aufwache, befinde ich mich in einem Pariser Hotelzimmer, und obwohl mir rasch bewusst wird, dass es ein Traum war, höre ich immer noch das leise Klatschen der Meereswellen.
In Paris gibt’s doch gar kein Meer!
Eine unbestreitbare Wahrheit, und schon höre ich den Straßenlärm der Metropole anschwellen.
Es ist zwanzig nach sieben. Der Wecker ist auf acht gestellt, aber wie so oft in letzter Zeit bin ich aufgewacht, bevor der Wecker klingelte. Heute ist das allerdings weniger mysteriös als sonst. Als ich gestern Abend ankam, war ich müde von dem anstrengenden Tag und von der Reise, also bin ich schon gegen zehn ohne Abendessen ins Bett gegangen und sofort eingeschlafen. Wenn ich abends nichts esse, ist das, als würde ich fasten: Ich wache bereitwilliger auf, in Vorfreude aufs Frühstück.
Vermutlich ist der wahre Grund für dieses vorzeitige [10] Erwachen aber die Verabredung, die ich heute habe. Die wichtigste Verabredung meines Lebens. Ich weiß nicht, was genau passieren wird, es ist genauso geheimnisvoll und aufregend wie früher am Weihnachtsmorgen, wenn es draußen noch dunkel war und ich aus dem Bett sprang, um zu sehen, ob die Geschenke über Nacht gebracht worden waren. Aber jetzt bleibe ich im Bett liegen, verpackt und eingewickelt in Gedanken. Ich stehe nur auf, um die Vorhänge zu öffnen, dann schlüpfe ich gleich wieder unter die Decke. Ich liebe die Wärme nach dem Aufwachen und bleibe gern darin liegen. Sie hilft dabei, mich mit dem anzufreunden, was mich erwartet. Ich schaue aus dem Fenster und bewundere den Himmel und die Dächer von Paris. Ein paar Wolken ziehen schnell vorbei. Ich ordne meine Gedanken und betrachte mein Leben. Morgens bin ich mir sehr nah. Viel näher als abends. Wenn ich ins Bett gehe, denke ich auch oft nach, aber mit den Jahren habe ich festgestellt, dass ich morgens nachsichtiger mit mir bin. Gelassener. Wenn ich vor der Zeit aufwache, bleibe ich noch liegen und lausche auf all die kleinen Geräusche. Auch auf die in mir. Die im Haus, manchmal die der Nachbarn oder die von der Straße. Heute sind alle Geräusche neu. Türen, die geschlossen werden, Wasserhähne, die im Nebenzimmer laufen, fremde Sprachen auf dem Flur. Was ich zunächst für das Meer gehalten habe, ist in Wirklichkeit eine Kehrmaschine. Dieses Hotel wacht früh auf.
Der Wecker klingelt. Ich beschließe aufzustehen. Dusche und ziehe mich an. Es ist September. Der 16., um genau zu sein. Ich schaue aus dem Fenster, kann aber nicht erkennen, ob sich das Wetter ändert und es regnen wird. Wenn ich früher unbedingt wissen musste, wie das Wetter wird, habe [11] ich immer meine Oma gefragt. Sie lag nie daneben. Ihr Standardsatz lautete: »Mir tun die Beine weh, also regnet’s morgen.« Und prompt regnete es am nächsten Tag. Als Kind hatte ich eine kleine Madonnenstatue, die je nach Wetter die Farbe änderte, doch Omas Beine waren noch unfehlbarer als die Madonna.
Ich öffne das Fenster. Es ist nicht besonders kalt, aber ich nehme trotzdem einen Pulli mit.
Meine Mutter hat mir vor ein paar Monaten einen Trockner geschenkt. Seitdem wird bei mir zu Hause die Wäsche nicht mehr aufgehängt. Dafür laufen jetzt meine Kleider ein. Das T-Shirt, in dem ich geschlafen habe, reicht nur noch bis zum Nabel, und die Unterhose, die ich gerade angezogen habe, zwickt. Das Gerät trocknet und kürzt. Ich freue mich trotzdem darüber, weil jetzt meine frühere Methode ausgedient hat. Da warf ich die Kleidungsstücke noch in einem Haufen auf den Wäscheständer, wo sie im Verlauf einer Woche etappenweise trockneten – erst ein Ärmel, dann der Kragen und irgendwann der Rest. Schlimm ist, wenn man in solcherart getrockneten Klamotten schwitzt. Das stinkt dann wie nasser Hund.
Statt im Hotel zu frühstücken, suche ich lieber einen meiner Lieblingsorte auf, Le Pain Quotidien. Da ich in der Nähe des Centre Pompidou wohne, beschließe ich, einen Spaziergang zur Rue des Archives zu machen, in der sich das Lokal befindet. Le Pain Quotidien ist eine Kaffeehauskette, die es überall auf der Welt gibt. Jeder Laden ist gleich eingerichtet, alles ist aus Holz: Fußboden, Tische, Stühle, Schränke, Theke. Helles Holz, nordeuropäisch. Beim Essen kommt man sich vor wie ein Eichhörnchen im Wald. [12] Milchkaffee, Cappuccino, Filterkaffee, alles wird in Schalen serviert, wie bei meiner Oma.
Ich bestelle einen frischgepressten Orangensaft, einen Kaffee und ein Croissant. Wenn es etwas gibt, woran man merkt, dass man in Paris ist, dann am Geruch der Butter im Frühstückscroissant, der den ganzen Tag an den Händen haftet.
Der Laden ist schon voll. Außer Französisch wird an den Nebentischen Deutsch, Portugiesisch und Englisch gesprochen.
Ich ziehe den Pulli über. Es ist jetzt ein bisschen kühl.
Auf der anderen Straßenseite liegt das Starbucks mit den üblichen Sofas und Sesseln im Schaufenster. Wie oft habe ich mich an allen möglichen Orten in einen solchen Sessel gesetzt und ein Buch gelesen oder in den Computer getippt. Besonders, wenn der Flug nach Hause Verspätung hatte, ich das Hotelzimmer aber bis elf Uhr vormittags geräumt haben musste. Dann wurde das Café einen Tag lang mein Zuhause: Ich schlief sogar dort, in diesen Sesseln.
Meine Verabredung ist um elf im Jardin du Luxembourg. Es ist noch nicht mal zehn, und da ich gerade in der Nähe bin, beschließe ich, auf einen Sprung an einen anderen Lieblingsort zu gehen, die Place des Vosges. Jedes Mal, wenn ich diesen Platz erblicke, bin ich ganz ergriffen. Ich spaziere durchs Marais. Der September ist einer meiner Lieblingsmonate. Ich mag es, wenn ich auf einem Spaziergang die Sonne spüren will und die Straßenseite wechsele, weil meine im Schatten liegt. Viel schöner als im Sommer, wenn man es genau umgekehrt macht, der Sonne entflieht. In der Rue des Francs Bourgeois scheint die Sonne um diese Uhrzeit auf die rechte Straßenseite.
[13] Ich erreiche die Grünflächen auf der Place des Vosges und setze mich bei einem der vier Brunnen auf eine Bank unter einen Baum. Die Luft ist kühl. Ich lege die Arme rechts und links auf die Rückenlehne, schließe die Augen und recke das Gesicht in den Himmel, um mich von den warmen Sonnenstrahlen küssen zu lassen. Als ich das Knirschen von Schritten auf dem Kies höre, öffne ich die Augen wieder. Eine junge Frau. Sie setzt sich auf die Bank neben meiner, öffnet den Laptop und beginnt zu tippen. Menschen mit Computern im Park sieht man immer öfter, via Wi-Fi kann man online gehen, und deshalb kommen viele Leute bei schönem Wetter zum Arbeiten ins Freie.
Die Frauen in Paris sind anders. Ich habe nie herausgefunden, aus welchem Grund ich sie schöner finde. Es scheint, als wären sie von Natur aus der Vulgarität der Welt entzogen. Vielleicht, weil ihre Art, sich zu kleiden, immer auch etwas Persönliches offenbart. Ihre Kleider erzählen von ihnen, charakterisieren sie. Da eine Brosche, da ein Hut, ein Paar Handschuhe, ein Band, eine Kette, eine Farbe in Kombination mit einer anderen. Es gibt Kleider, die stehen nur schönen Frauen gut, und andere, die stehen nur Frauen mit schönem Wesen. Die Kleidung des Mädchens auf der Bank nebenan sagt viel über sie aus, vermittelt den Eindruck, dass sie in ihrer eigenen Welt lebt, dass sie sich darin wohl fühlt. Wenn man sie so anschaut, möchte man am liebsten Teil dieser Welt sein.
Es ist gut möglich, dass sie ihre Kleidung günstig auf dem Markt einkauft und dank der ihr eigenen Phantasie und einem Kombinationstalent etwas Originelles daraus macht. Frauen wie sie müssen nicht viel Geld ausgeben, um sich [14] gut zu kleiden, sie haben einfach das richtige Händchen, kaufen irgendwelche Fetzen, kombinieren sie und sind plötzlich feminin und sexy. Es sind Frauen, die nach Apfel duften.
In jeder Stadt, in der ich länger lebte, habe ich früher oder später »meinen Ort« gefunden. Einen Ort, den ich zum Nachdenken aufsuche, der mir vertraut ist, wo ich für mich sein kann. Oft ist es einfach der erste Ort, den ich finde, wenn ich in einer neuen Stadt bin. In Paris ist es die Place des Vosges. Als ich noch in Paris lebte, war ich oft hier, vor allem sonntags, weil dann unter den Arkaden Musiker spielten, fast immer klassische Musik.
Der Spaziergang hierher hat mir gutgetan. Er hat mir geholfen, etwas von der Spannung abzubauen, die mit jeder Minute, die meine Verabredung näher kommt, steigt. Trotzdem bin ich noch immer aufgeregt. Vielleicht auch ängstlich. Ich fühle mich orientierungslos, als hätte ich die Aufregung nicht unter Kontrolle. Eine Aufregung, die wächst und nahezu unbezähmbar wird. Kein Wunder: Wenn diese Verabredung läuft wie erhofft, wird sie mein Leben vollständig umkrempeln.
[15] Die Frau in der Straßenbahn
Wenn ich früher eine Frau sah, die mir gefiel, habe ich versucht, sie kennenzulernen – und vor allem, sie ins Bett zu kriegen. Nur ganz wenige, die mir gefielen, habe ich ausgelassen. Warum auch?
Die Frau in der Straßenbahn war eine der wenigen. Ich habe sie immer vor mir beschützt. Das war keine bewusste Entscheidung, es hat sich einfach so ergeben. Ich habe nie begriffen, ob es an ihr lag oder ob ich mich einfach verändert hatte. Gut zwei Monate lang sind wir uns jeden Morgen in der Bahn begegnet. Eine feste Verabredung.
Zusammen mit Alessandro betreibe ich eine Druckerei. Wir stellen Kataloge her, Bücher in kleinen Auflagen, Prospekte, Broschüren, Werbezettel, und vor den letzten Wahlen druckten wir auch Wahlkampfmaterial für beide Lager: Wir mussten nur die Farbe ändern, alles andere blieb sich mehr oder weniger gleich. Alle Politiker schwafeln von einer besseren Zukunft. Wahrscheinlich meinen sie das Paradies.
Vor ein paar Jahren habe ich als Angestellter angefangen, und irgendwann bin ich in die Firma eingestiegen. Es klingt vielleicht ein bisschen großspurig, aber alles, was ich anpacke, gelingt mir. Wenn ich mir etwas vornehme, dann schaffe ich es normalerweise auch. Das hat einen einfachen Grund: Was es mir in Liebesbeziehungen schwermacht, macht es [16] mir im Berufsleben leichter. Deshalb verdanke ich meinen Erfolg im Grunde genommen weniger einem Talent als einem Manko. Die Unfähigkeit, mit meiner labilen Gefühlswelt umzugehen, hat zwangsläufig dazu geführt, dass ich mich völlig in die Arbeit gestürzt habe. Emotional war ich schon immer eine Null. In der Arbeit fand ich eine Zuflucht. Dort war es von Vorteil, dass ich nie verliebt und abgelenkt war. Ich war immer der Meinung, mein Leben und meine Gefühle absolut unter Kontrolle zu haben, und so gedachte ich es auch weiter zu halten.
Auch im Ausland habe ich gearbeitet. Hauptsächlich als ich jung war. In London habe ich gelernt, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit zu fahren.
Die tägliche Begegnung mit der Frau in der Straßenbahn war das aufregendste Ereignis in meinem Alltag. Ansonsten lief es wie immer. Aber diese paar Minuten in der Bahn stachen heraus, waren klar wie ein Fenster zu einer anderen Welt. Eine Verabredung voller Farben.
Niemand, den ich kannte oder der auch nur im Telefonverzeichnis meines Handys stand, vermochte mich so aufzuwühlen wie die geheimnisvolle Unbekannte. Sie zog mich magisch an. Doch trotz meiner unbändigen Neugier sprach ich sie nie an.
Wenn ich in jenem Winter morgens in die Straßenbahn einstieg, saß sie immer schon da. Sie war wie eine Wolke. Sie musste um die fünfunddreißig sein. Wenn die Bahn kam, stellte ich mich auf Zehenspitzen und reckte den Hals, um zu sehen, ob sie drin saß. Wenn ich sie nicht entdeckte, wartete ich auf die nächste. Doch trotz dieser kleinen Vorsichtsmaßnahme kam es manchmal vor, dass ich ohne sie fuhr.
[17] Zu der Zeit begann ich vor dem Wecker aufzuwachen. Wenn ich sie nicht in der Straßenbahn sah, wollte ich nicht den Zweifel hegen müssen, dass sie vielleicht schon eine Bahn vorher gefahren war, und deshalb ging ich früher als üblich zur Haltestelle.
Oft träumte ich tagsüber mit offenen Augen von ihr, meist von uns beiden. Es ist schön, wenn es einen Menschen gibt, von dem man träumen kann. Selbst wenn es eine Unbekannte ist. Ich weiß nicht warum, aber wenn ich an sie dachte, kannten meine Gedanken keinen Punkt. Nur Kommas. Eine Lawine aus Worten und Bildern ohne Interpunktion.
Sie leistete mir Gesellschaft. Dabei bestand unsere Beziehung doch nur aus einem kaum angedeuteten Lächeln hier und da und kurzen, stummen Blicken.
Sie stieg zwei Haltestellen vor mir aus. Oft war ich versucht, ihr zu folgen, um etwas mehr über sie herauszufinden, aber ich hab’s nie getan. Ich habe nicht mal den Mut aufgebracht, mich neben sie zu setzen. Ich hielt den gebührenden Abstand ein, bemessen an freien Plätzen und einer guten Sicht. Tag für Tag trainierte sie meinen Blick, er wurde immer unauffälliger. Manchmal, wenn sie weit weg saß und ich ihr nicht den Kopf zuwenden wollte, schielte ich, bis mir irgendwann die Augen weh taten. Manchmal war die Bahn zu voll, und jemand stellte sich ausgerechnet zwischen uns, so dass ich sie nicht sehen konnte. Ich starrte sie nicht die ganze Fahrt über an, mir gefiel es, sie eine Weile zu beobachten, woanders hinzuschauen und den Blick dann wieder zu ihr wandern zu lassen. Zu wissen, dass sie da war, beruhigte mich. Der beste Sitzplatz war gleich neben der Tür. Wenn dieser Platz frei war, war das mein Glückstag, weil sie [18] auf mich zugehen musste, um auszusteigen, und dann lächelte sie mich zum Abschied immer an. Noch besser war es, wenn ich mich nicht setzte und an der Tür stehen blieb: Dann standen wir ein paar Sekunden lang nebeneinander, sie neben mir. Ich atmete sie ein. Sie war wie die frische Luft, wenn man morgens in den Bergen das Fenster aufmacht. Von ganz nah atmete ich sie ein, ohne sie zu berühren. Eines Tages vielleicht, sagte ich mir. Eine kurze Berührung gab es aber doch einmal. Eines Morgens, während sie darauf wartete, dass die Tür aufging, bremste die Straßenbahn scharf, und es warf sie in meine Richtung. Eine Sekunde lang hielt ich ihren Mantel in der Hand, nur ganz kurz. Am liebsten hätte ich die Hand nie mehr geöffnet, sie nie mehr losgelassen. Auch sie sah mich manchmal an, wenn sie so dasaß.
Häufig begegneten sich unsere Blicke, als wären wir heimliche Komplizen. Manchmal hatte ich Angst, sie schenkte mir ihre Blicke und ihr Lächeln nur aus Anstand.
Oft schrieb sie in ein orangefarbenes Heft mit Pappeinband.
Was schreibt sie da bloß? Ob sie schon mal über mich geschrieben hat?, fragte ich mich.
Ich sah ihr gern beim Schreiben zu. Vor allem weil sie dazu die Handschuhe auszog und weil sie dann völlig entrückt war. So sehr, dass es mich sogar ein bisschen eifersüchtig machte. Wenn sie schrieb, hob sie zwar die ganze Fahrt über den Blick nicht von ihrem Heft, aber mit anzusehen, wie sie so ganz in dem, was sie schrieb, aufging, machte sie noch faszinierender. Ich wäre gern in ihrer Welt vorgekommen.
Auch wenn sie las, ließ sie sich nicht ablenken. Sie setzte dazu eine Brille auf. Stand ihr gut. Ich fand es schön, wie sie [19] einen Finger unter die rechte Seite schob, ihn nach unten gleiten ließ und die Seite anhob. Eine natürliche Geste, doch mich schlug sie in Bann, denn ihre ganze Zartheit spiegelte sich darin.
An anderen Tagen wickelte sie eine Haarsträhne auf, ebenfalls mit dem rechten Finger.
Die Frau aus der Straßenbahn war schön. Mir gefiel ihr Gesicht, mir gefiel ihr Haar, das glatt, dunkel und voll war. Ihr Hals, ihre Handgelenke und ihre Hände. Am Ringfinger trug sie nur einen schmalen Trauring. Keine weiteren Ringe oder Armreife. Nur diesen schmalen Trauring. Am meisten hatten es mir aber ihre Augen angetan und was man darin sah, selbst wenn man ihrem Blick nur für einen kurzen Moment begegnete. Dunkel, tief, unausweichlich.
Kann man sich in einen Menschen verlieben, den man nicht kennt, den man nur Tag für Tag bei der Fahrt zur Arbeit in der Straßenbahn sieht?, fragte ich mich damals. Ich weiß es nicht. Ich weiß es noch immer nicht. Ich war nicht verliebt. Sie zog mich an. Was ich allerdings mit absoluter Gewissheit sagen kann, ist, dass ich mich irgendwie mit ihr verbunden fühlte und dass ich mir immer wieder dachte, dass das Schicksal ein Spiel mit mir spielte. Oder mit uns.
Einmal waren keine Sitzplätze mehr frei, und ich stellte mich genau vor sie. Allerdings mit dem Rücken zu ihr. Im Fenster sah ich ihren Blick. Sie schaute mich an. Wir trafen uns dort, auf jener Scheibe, die uns als durchsichtige Bilder zeigte. Und da, in der Begegnung unserer gespiegelten Gesichter, fand ich heraus, dass solche Blicke über Bande viel intimer sind als direkte. Als würde man beim Stehlen ertappt. Als machte diese Fläche auch einen heimlichen Wunsch [20] transparent. Als sie diesmal ausstieg und die Straßenbahn wieder anfuhr, drehte ich mich um und sah sie an. Sie tat dasselbe.
Zweimal wöchentlich hatte sie eine Sporttasche dabei, meist montags und donnerstags. Das sollte ich auch so machen, dachte ich. Also die Tasche mit ins Büro nehmen und nach der Arbeit direkt hingehen, obwohl das Fitnessstudio gleich bei mir um die Ecke ist. Dann würde ich bestimmt öfter trainieren. So aber ging ich nach Feierabend erst nach Hause, um die Tasche zu packen, und dann konnte ich mich nicht mehr aufraffen. Wenn ich nach einem anstrengenden Tag in die Wohnung komme, ist die Vorstellung, noch mal rauszugehen, alles andere als verlockend. Abgesehen davon, dass ich Hunger habe, wenn ich heimkomme, und mir immer erst mal etwas reinschieben muss. Dann sage ich mir jeweils: Ins Fitnessstudio gehe ich morgen.
Meine Beziehung zur Sporttasche ist eigenartig. Wenn ich sie abends packe, bekomme ich Lust, mich hineinzulegen und auf dem zusammengefalteten Bademantel zu schlafen. Außerdem müsste ich mir echt mal angewöhnen, sie gleich zu leeren, wenn ich nach Hause komme. Oft vergesse ich es, und es fällt mir erst wieder ein, wenn ich schon im Bett liege. Ich stelle mir das verschwitzte T-Shirt und den nassen Bademantel und die Badehose vor, die ich anhabe, wenn ich hinterher noch in die Sauna gehe. Dann muss ich wieder aufstehen und die Sachen aufhängen, weil ich sonst nicht ruhig schlafen kann. Ich möchte keine Champignonzucht vorfinden, wenn ich es erst am nächsten Tag mache.
Die Frau aus der Straßenbahn machte es richtig. Sie nahm die Tasche immer mit zur Arbeit.
An einem anderen Morgen stieg ich ein und sah sie zum [21] ersten Mal mit Pferdeschwanz. Einem hochgesteckten Pferdeschwanz, um genau zu sein: Das finde ich wahnsinnig feminin. Hals, Ohren, der Schwung der Kieferpartie, alles war wunderbar zu sehen. Ich weiß noch, dass ich dachte: Jetzt gehe ich zu ihr und schaue sie so lange an, bis sie aufsteht und wir uns schweigend in die Augen sehen. Uns alles sagen, was wir empfinden, ohne Worte, mit einem jener intensiven Blicke, die die Seele in Aufruhr bringen. Dann küssen wir uns. Wenn sich unsere Lippen voneinander lösen, drücke ich ihr kleine Küsse auf Augen, Nase, Wangen und Stirn und den letzten auf die Lippen. Alle Leute in der Bahn schauen uns zu, und plötzlich fangen sie an zu applaudieren. Eine Musik erklingt, die Straßenbahn hält an, wir steigen aus und gehen in die Stadt. Abspann, das Licht geht an, gerührt verlassen die Leute das Kino.
Pustekuchen. Ich hielt Distanz, wie immer. Keine Musik, kein Applaus, nur die beschlagenen Scheiben der Straßenbahn.
Ihretwegen habe ich eine Menge unsinnige Dinge getan. Eines Tages, nachdem sie ausgestiegen war, wartete ich ein paar Sekunden, dann stand ich auf. Ich ging dorthin, wo sie gestanden hatte, und legte meine Hand auf die Stelle, wo sie sich kurz zuvor festgehalten hatte. Ich spürte noch ihre Wärme. An dem Tag brauchte ich einfach mehr, es reichte mir nicht, sie nur anzuschauen. Mein Tastsinn machte die gleichen Rechte geltend wie der Blick. Aus diesem Grund suchte ich nach einer Spur von ihr. Ihre Wärme war in diesem Moment etwas Intimes, ich spürte das Verlangen, einen kleinen Ausschnitt der Welt zu berühren, die sie zuvor berührt hatte, ich wollte der Erste sein, der diese Stelle nach [22] ihr berührte. Aus dem gleichen Grund drückte ich auf den Halteknopf. Während ich ihre Wärme spürte, fragte ich mich: Was sind wir eigentlich? Freunde, Komplizen, Spielgefährten, platonisch Liebende, oder einfach nur Unbekannte?
Eines Morgens verlor sie beim Aussteigen in der Eile einen Handschuh, genau da, wo ich stand. Es saßen nur wenige Leute im Wagen, und die schliefen wie gewöhnlich. Keiner merkte was, keiner sah mich, als ich ihn aufhob. Ich hätte ihn ihr wiedergeben müssen, doch die Türen hatten sich schon geschlossen, und außerdem hielt mich irgendetwas zurück, ich weiß nicht, warum. Vielleicht weil das Schweigen, in dem ich mich wiegte, gebrochen worden wäre, wenn ich ihr hinterhergerufen hätte, vielleicht fehlte mir auch nur der Mut. Ich behielt den Handschuh. Er war aus kirschroter Wolle. Zum Glück, denn wäre er aus Leder gewesen, hätte er nicht ihren Geruch bewahrt. Den ganzen Tag schnüffelte ich daran. Wenn mich nur niemand dabei ertappte und dachte, ich sei ein Fetischist. Mir war klar, dass ich im Moment absurde Dinge tat, Dinge, die mir sonst nicht einmal im Traum eingefallen wären. Hätte mir ein Freund so was erzählt, hätte ich ihn für verrückt erklärt, ich glaube nicht, dass ich für so ein Verhalten Verständnis aufgebracht hätte. Aber ich konnte mich den Geschehnissen nicht entziehen. Die Frau aus der Straßenbahn war durch meine hochentwickelte Personenkontrolle geschlüpft. Als ich Silvia davon erzählte, lachte sie, aber für verrückt erklärte sie mich nicht.
Silvia ist meine beste Freundin. Sie weiß alles über mich. Über die Frau aus der Straßenbahn sprachen wir oft, wenn wir uns abends trafen. Silvia hatte nur etwas dagegen einzuwenden, dass ich den Handschuh in einer Plastiktüte [23] aufbewahrte wie die Leute vom CSI, damit ihr Geruch länger erhalten blieb.
Was tust du da?, fragte ich mich irgendwann, während ich den Handschuh beschnüffelte, und legte ihn weg. Aber dann ging er mir nicht aus dem Kopf, und wenn ich in seine Nähe kam, geriet ich wieder in Versuchung. Wie einer, der mit dem Rauchen aufhören will. Vielleicht hätte ich darauf schreiben sollen: »Schadet der Gesundheit!« Der geistigen.
Schließlich hörte ich auf. Nicht damit, ihn zu beschnüffeln, sondern mir albern vorzukommen. Ich wollte es tun, also tat ich es. Ich genoss dieses Verlangen. Punkt.
Am Tag, nachdem ich den Handschuh aufgehoben hatte, steckte ich ihn ein, um ihn zurückzugeben. Natürlich hatte ich mir diese Fahrt schon in allen Einzelheiten ausgemalt. Das Schicksal hatte mir einen wunderbaren, triftigen Vorwand gegeben, um das Schweigen zu brechen. Mit einem Handschuh wäre ich in ihr Leben getreten und hätte ihr ein Gefühl der Freude beschert: »Hey… ich bin der Typ, der deinen Handschuh gefunden hat.«
Als die Bahn kam, sah ich sie. Ich stieg ein und setzte mich. Ich versuchte, all meinen Mut zusammenzunehmen und zu ihr zu gehen, doch dann dachte ich, dass der Handschuh ja eigentlich das Einzige war, was ich von ihr besaß, und ich ihn vielleicht noch ein paar Tage behalten könnte. Gesagt, getan.
Auch auf dieser Fahrt hat sie mir ein Lächeln geschenkt, daran erinnere ich mich.
Einmal fehlte sie zwei Wochen. Ich wusste nicht, ob sie krank war oder in Urlaub, ich erinnere mich aber noch gut an meine Angst, sie könnte eine neue Arbeitsstelle haben [24] oder künftig lieber mit dem Auto fahren. Es ließ mir einfach keine Ruhe, es war schrecklich, so getrennt von ihr zu sein. Das Gefühl der Ohnmacht machte mich fertig: Ich konnte sie weder wiedersehen noch aufspüren, ich wusste nichts über sie.
Über diese tristen Morgenfahrten möchte ich nicht sprechen. Eines Tages saß sie plötzlich wieder da, in der Straßenbahn: Ich konnte meine Freude nicht verbergen. Ich war aufgeregt wie ein Baby, das versucht, nach den Schmetterlingen über seinem Bettchen zu greifen. Ich wusste nichts über sie, aber das war nicht wichtig. Es zählte nur, dass sie wieder da war. Ich wusste nicht, wie sie hieß, wo sie arbeitete, wie alt sie war, ob sie einen Freund hatte und mit wem sie zusammenlebte. Ich kannte nicht mal ihr Sternzeichen. Mich hat das Sternzeichen eines Menschen nie interessiert, aber bei ihr war das anders: Morgens an der Haltestelle nahm ich mir immer eine dieser Gratiszeitungen und schaute gleich auf der Seite mit dem Horoskop nach; ihres hätte ich auch gern gelesen, nur so, um herauszufinden, welches der geeignete Morgen war, sie anzusprechen. Ich wusste nur zwei Dinge über sie: dass sie, ohne es zu wissen, meine Tage aufregender machte und dass sie an derselben Straßenbahnlinie wie ich wohnte, und natürlich in meinen Gedanken.
Eines Morgens klappte sie wieder einmal das Heft, in dem sie geschrieben hatte, zu und stand auf. Sie ging zur Tür, um auszusteigen, und lächelte mich zum ersten Mal nicht an. Sie tat, als wäre ich nicht da. Ich, König Schuldbewusst, war zutiefst getroffen. In meinem Hirn ratterte es, vielleicht hatte jemand ihr erzählt, dass er gesehen hatte, wie ich den [25] Handschuh einsteckte, vielleicht hatte ich sie zu plump angeglotzt, und sie war langsam genervt, vielleicht meinte sie auch, dass ich sie an dem Tag, als wir uns berührt hatten, absichtlich angefasst, die günstige Gelegenheit ausgenutzt hätte.
An dieser kleinen Berührung muss sie mein ganzes Verlangen gespürthaben. Man weiß ja, wie die Frauen sind, sie spüren es sofort, wenn man sie begehrt. Vielleicht hat sie das erschreckt.
Gott sei Dank hatte ich sie nie angesprochen. Wie oft war ich versucht gewesen. Wie oft hatte ich in mir den Impuls gespürt, zu ihr zu gehen. Doch immer hatte ich mich zurückgehalten. Was gar nicht so leicht war, weil ich sie im wahrsten Sinne des Wortes anziehend fand. Wenn ich sie morgens manchmal anschaute, spürte ich, wie meine Seele hin und her wippte: Spitzen – Fersen – Spitzen – Fersen – Spitzen – Fersen: Ich gehe hin – ich gehe nicht hin – ich gehe hin – ich gehe nicht hin – ich gehe hin – ich gehe nicht hin.
Was ein Glück, dass ich nicht hingegangen war.
Während ich also dastand und nach einem Grund für ihr Verhalten suchte, drehte sie sich plötzlich zu mir um und brach das Schweigen: »Hast du Zeit für einen Kaffee, oder hast du’s eilig?«
»Wie bitte?«
»Hast du Lust, vor der Arbeit einen Kaffee zu trinken? Hast du Zeit?«
»Ja, ja… gern. Ich steige mit dir aus.«
Die Türen der Straßenbahn gingen auf, und wir stiegen gemeinsam aus.
»Da drüben ist eine Bar… ich heiße übrigens Michela.«
»Giacomo.«
[26] Im Gehen dachte ich, dass mir noch zwei Dinge an ihr gefielen: der Name und die Stimme.
Ich mag Frauen, die den ersten Schritt machen, obwohl sie mich damit ehrlich gesagt auch ein bisschen aus dem Konzept bringen, denn normalerweise bin ich derjenige, welcher die Initiative ergreift. Sie schüchtern mich ein, berauben mich der archaischen Rolle des Jägers.
Als wir die Bar betraten, hielt ich einer alten Dame die Tür auf. »Bitteschön, Signora, ziehen Sie sich warm an, es ist kalt.«
»Danke, vielen Dank, das ist aber sehr liebenswürdig.«
Wenn man glücklich ist, ist man viel freundlicher zu den Leuten.
Wir setzten uns und bestellten einen Espresso. Jetzt in der Bar, als wir uns gegenübersaßen, waren wir ein wenig verlegen. Ich mehr als sie.
»Ich habe dich gefragt, ob du einen Kaffee trinken möchtest, weil ich dich als meinen morgendlichen Reisegefährten empfinde, und da sich mein Leben in den nächsten Tagen ändern wird, habe ich all meinen Mut zusammengenommen und dich angesprochen.«
Mist, verdammter, sie heiratet. Ich bin der Kaffee zum Abschied von der Freiheit. Sie hat bestimmt mit ihren Freundinnen darüber diskutiert, und die werden ihr gesagt haben: Los, überwinde dich, lade ihn auf einen Kaffee ein, dachte ich panisch. »Gute Idee, das hätte ich auch längst getan, aber ich hatte Angst, dir lästig zu sein. Neulich, als ich deinen Mantel berührte, dachte ich schon, du wärst sauer.«
»Wann?«
»Du weißt schon… neulich, als die Bahn plötzlich scharf [27] gebremst hat und ich dich mit der Hand berührte, aber nicht absichtlich. Sagen wir, ich habe sie nicht weggenommen, im Gegenteil, mir gefiel die Vorstellung, dich zu berühren.«
»Hab ich gar nicht bemerkt.«
»Was heißt, dein Leben wird sich ändern? Heiratest du?«
»Nein, ich heirate nicht, ich ziehe nach New York. Ich habe einen neuen Job.«
»Du ziehst nach New York?«
»Ja, ich arbeite bei einer amerikanischen Firma und habe ein Gesuch um Versetzung nach New York gestellt. Sie haben es gutgeheißen.«
Während sie sprach, zog sie einen Brief hervor.
»Vor drei Wochen hatte ich ein Vorstellungsgespräch, und sie haben mich genommen. Vor ein paar Tagen kam die schriftliche Bestätigung. Weißt du, ich hätte nicht gedacht, dass sie mich in meinem Alter nehmen würden, ich bin sechsunddreißig, da stehen die Chancen eher schlecht. Aber ich hab’s geschafft.«
»Ach, dann fährst du also nicht mehr mit der Straßenbahn… das Kapitel Linie 30 ist abgeschlossen. Wird sie dir nicht fehlen?«
»Doch, ich glaube schon, dass sie mir fehlen wird, aber vielleicht auch nicht. Ich bin schon ganz aufgeregt bei der Vorstellung, dass in meinem Leben eine Wende bevorsteht, zumal ich schon immer mal dort leben wollte – es war nicht der erste Versuch.«
»Gehst du denn für immer hin?«
»Keine Ahnung, ich weiß nur, dass ich jetzt fahre, alles Weitere wird sich ergeben. Vielleicht halte ich es nach einem [28] Monat nicht mehr aus und komme zurück. Ich habe keine festen Pläne, ich tue, wonach mir jetzt gerade ist, der Rest wird sich dann schon ergeben.«
»Das ist ja ein Ding! Endlich lerne ich dich kennen, und dann reist du gleich ab? So ein Pech. Also ist das unser Abschiedskaffee?«
»Mehr oder weniger… entschuldige bitte, ich muss schnell auf die Toilette, ich bin gleich zurück.«
Ich war völlig fertig. Michela fehlte mir jetzt schon, ich sah schon die leere Straßenbahn vor mir.
Da saß ich nun in dieser Bar und hatte ihr fast nichts sagen können. Nicht mal, dass ihr Handschuh bei mir zu Hause rumlag. Ich hätte sie gern nach ihrer Telefonnummer gefragt, ihrer E-Mail-Adresse, aber mir fehlte der Mut. Sie hatte mich auf einen Kaffee eingeladen, bevor sie fuhr, als wollte sie mit mir eine Phase in ihrem Leben abschließen. Erst wenn man begreift, dass es bald zu spät ist, ist man zu allem bereit, um das Verpasste nachzuholen. Aber ich hatte schon immer diese Angst gehabt, ich könnte zu aufdringlich sein. Wenn ich als Junge bei fremden Leuten gefragt wurde, ob ich ein Glas Wasser möchte, habe ich immer »Nein, danke« gesagt, selbst wenn ich Durst hatte. Ich sagte schon nein, bevor mein Gegenüber ausgeredet hatte. Ich habe immer Angst gehabt, zur Last zu fallen, auf die Nerven zu gehen. Damit habe ich mich nur ins eigene Fleisch geschnitten. Selbst als Erwachsener noch. Wenn ich eine Putzfrau einstellte, tat ich anfangs etwas Absurdes. Am Tag, an dem sie kam, räumte ich auf, bevor ich aus dem Haus ging. Ich putzte ein bisschen vor. Damit die Unordnung nicht zu groß war, aus Rücksicht.
[29] Michela hatte ich nicht nach ihrer Telefonnummer gefragt, weil ich nicht aufdringlich sein, sie nicht in die Verlegenheit bringen wollte, sie mir aus Höflichkeit zu geben. Wenn, dann sollte sie sie mir geben, weil sie es wollte. Im Übrigen war dieser Kaffee zu nichts nütze. Ich gehörte zu ihrem alten Leben, dem Leben, vor dem sie nun floh. Wozu sollte ich sie nach der Adresse fragen? Wir waren nicht befreundet, und ihre Abreise war nun nicht gerade die beste Voraussetzung, um eine Beziehung anzufangen. Dieser Kaffee war nicht der Anfang von etwas, sondern allenfalls das Ende. Ich war nicht in der Lage, sie nach irgendwas zu fragen, doch während ich da saß, in meiner Enttäuschung schmorte und auf ihre Rückkehr wartete, fiel mein Blick auf den Brief der amerikanischen Firma, den sie mir gezeigt und auf dem Tisch liegen gelassen hatte. Dort stand eine Adresse. Ich überlegte, ob ich sie abschreiben sollte. Warum? Weil es irgendwie wirklich schade gewesen wäre, sie einfach so gehen zu lassen und immer noch nichts über sie zu wissen. Schreib dir die Adresse auf, sagte eine Stimme in mir. Oder lies sie wenigstens.
Nichts da, ich weiß, was sich gehört! Aber dann tat ich’s doch. In Windeseile. Ich las die Adresse und lernte sie gleich auswendig. Dann stand ich auf und ging zur Kasse, um zu bezahlen.
»Entschuldigen Sie, haben Sie vielleicht einen Zettel und einen Stift?« Das Mädchen an der Kasse gab mir das Gewünschte, doch als ich den Kugelschreiber aufsetzte, sah ich Michela von der Toilette kommen und sagte: »Ach, nicht wichtig, danke.« Ich ging zu unserem Tisch zurück, wir setzten uns wieder, und ich sah sie an: »Weißt du, ich dachte [30] gerade, wie schade, dass du fortgehst. Ich weiß, es hat keinen Sinn, ich kenne dich ja kaum, aber trotzdem.«
Die Worte waren einfach so aus mir herausgesprudelt, kaum dass sie sich wieder gesetzt hatte, ich hatte nicht mal Mut aufbringen müssen, um sie auszusprechen, ich hatte sie mir auch nicht vorher zurechtgelegt. Wie Michela hörte ich mir selbst zu, während ich sprach. Michela schaute mir direkt in die Augen, saß eine Weile reglos da und sah mich still an. Die Worte schienen sie berührt zu haben, anscheinend hatten sie ihr gefallen, denn ihr Gesicht öffnete sich zu einem wunderschönen Lächeln, das mir eine Gänsehaut über den Rücken jagte. Aber vielleicht war es auch nur wegen der Kälte: Ein Herr hatte die Bar betreten und die Tür offen gelassen.
»Also, wann fährst du?«
»Morgen Nachmittag, der Flug geht um vier.«
»Hast du schon gepackt?«
»Das meiste ja, den Rest mache ich heute Abend und morgen früh, bevor ich fahre. Meine Freundinnen und Kolleginnen haben mir zu Ehren eine kleine Feier organisiert. Ich hoffe, ich bin danach noch in der Verfassung, meine Koffer zu packen. Hättest du Lust mitzukommen? Nichts Großes, vielleicht fünfzehn Leute.«
»Das ist nett, aber es geht nicht, ich hab schon eine Verabredung… Dann fährst du also morgen nicht mehr mit der Straßenbahn?«
»Nein, heute war das letzte Mal.«
»Ach so!«
»Tja, danke für den Kaffee, ich muss jetzt los… du auch, glaube ich.«
[31] Wir verabschiedeten uns und küssten uns höflich auf die Wangen. Wie gut sie duftet, dachte ich.
»Dann also ciao, und gute Reise.«
»Danke. Ciao.«
Während ich davonging, wiederholte ich die Adresse wie ein Mantra. Als ich um die Ecke bog, lief ich Dante in die Arme. Dante war ein Schulkamerad vom Gymnasium, den ich Jahre nicht gesehen hatte. Er bestürmte mich sofort mit Fragen über mich und die anderen von damals. Dann fing er an, von sich zu erzählen. Er hatte sich vor kurzem getrennt, und er hatte einen Sohn. Haarklein erzählte er mir, was der Kleine schon alles konnte.
Während er mir in wenigen Minuten sein Leben erzählte, wiederholte ich wie ein buddhistischer Mönch die Adresse.
Dante nannte seine Telefonnummer und fragte mich: »Fällt dir was auf?«
»Was denn?«
»Meine Nummer… ist dir daran nichts aufgefallen?«
»Nein.«
»Sie ist ein Palindrom.«
»Ein was?«
»Ein Palindrom, meine Telefonnummer ist ein Palindrom. Du kannst sie auch andersherum lesen. Wie Adda, Anna, Otto. Weißt du, dadurch ist sie leichter zu merken. Man muss sich nur die ersten fünf Nummern merken. Und die sind übrigens auch leicht, die kannst du nicht vergessen.«
Ich gab ihm meine stinknormale Telefonnummer, und wir verabschiedeten uns.
Da ich das Handy schon mal in der Hand hatte, beschloss ich, Michelas Adresse dort festzuhalten. Ich tippte sie ein [32] und schickte sie Silvia. Ich hätte sie auch unter »Entwürfe« speichern können. Aber das fiel mir grad nicht ein, und deshalb schickte ich sie Silvia. Zwei Minuten später rief Silvia an.
»Was hast du mir denn da für eine Nachricht geschickt?«
»Die Frau aus der Straßenbahn. Ich habe heute mit ihr gesprochen. Wir haben zusammen einen Kaffee getrunken.«
»Dann hast du also endlich den Mut gehabt, sie einzuladen!«
»Ehrlich gesagt… heute hatte ich zwar den Mut, sie einzuladen, aber ich habe auch erfahren, dass sie von morgen an in New York leben wird. Was ich dir geschickt habe, ist ihre neue Büroadresse, ich hatte nichts anderes zum Aufschreiben. Notier’s dir irgendwo und gib mir dann den Zettel. Sehen wir uns heute Abend?«
»Heute ist du weißt schon welcher Tag, deshalb kann ich heute nicht. Morgen?«
»Morgen.«
Ich ging zur Arbeit. Im Gehen bekam ich eine Nachricht von Silvia.
Sie schickte mir die Adresse zurück, die ich ihr geschickt hatte. Silvia ist echt schlau. Wobei ich vielleicht oft auch einfach nur ein bisschen wirr bin.
Wie dem auch sei, auf der Arbeit wollte ich sie gleich irgendwo notieren… und so geschah es.
[33] Der »Scheinkauf«
An dem Abend, als Michela ihren Abschied feierte, war Silvia nicht da, um mich zu trösten. »Heute ist du weißt schon welcher Tag«, hatte sie gesagt. Das ist die Umschreibung des ersten Tags ihres Menstruationszyklus, und weil Silvia eine nach hinten geknickte Gebärmutter hat, muss sie da wegen der Schmerzen oft im Bett bleiben.
Meine Geschichte mit der faszinierenden Frau aus der Straßenbahn war also schon Vergangenheit. Ich hatte ihr zwar heimlich die Adresse ihres neuen Büros in New York abgeluchst, doch ich wusste schon, wie es weitergehen würde. Die Adresse würde mit jedem Tag weniger interessant, und diese Geschichte würde enden wie die meisten meiner Phantasien.
Vor diesem Kaffee war sie ganze Tage lang in meinen Gedanken gewesen, und ich hatte mir alles Mögliche ausgemalt. Die Vorstellung, die ich von ihr hatte, war in meinem Kopf gewachsen, sie entsprach vielleicht nicht der Wirklichkeit, gefallen hatte sie mir trotzdem. Bei unserem kurzen Treffen in der Bar hatte sie mich nicht enttäuscht und auch nicht meine Phantasien zerstört, im Gegenteil, der kurze Moment, als wir uns in die Augen geschaut hatten, hatte mich sehr aufgewühlt.
Michela gefiel mir. Jetzt noch mehr als vorher. Schade.
[34] Ich hätte nicht sagen können, warum ich die Einladung zu dem Fest nicht angenommen hatte. Wo ich doch gar nichts vorhatte. Kurz hatte ich sogar überlegt, umzukehren und ihr zu sagen, ich hätte es mir anders überlegt, ich würde doch zu ihrem Fest kommen, aber da war es schon zu spät. Und dann hatte mich plötzlich Dante in den Fängen.
An jenem Tag musste ich wie verrückt an sie denken. Daran, dass sie abreiste, daran, dass sie mich zu ihrer Feier eingeladen hatte, an den Ausdruck in ihrem Gesicht, als sie sich mit mir unterhielt, an den Klang ihrer Stimme.
Nach Feierabend ging ich ins Einkaufszentrum. Wenn ich mies drauf bin oder nachdenken muss, mache ich gewöhnlich entweder einen Spaziergang durch die Stadt, oder ich gehe in den Mega-Supermarkt, den größten weit und breit, und mache einen »Scheinkauf«. Ich packe mir den Wagen mit Sachen voll, die ich mag und gerne hätte. Das hebt die Stimmung. Mit meinem Wagen kurve ich durch den Supermarkt und fülle ihn: Bretter, Kreissägen, Angelruten, Fahrradreifen, Campingzelte, Haushaltsgeräte, Farbeimer, Lebensmittel, Radfahrerkleidung, Rollerblades. Wenn ich befriedigt bin, lasse ich den ganzen Krempel einfach stehen und gehe nach Hause. Ich verspüre eine kindliche Freude, wenn ich alles in den Wagen lege, was schön ist und glitzert und noch den Geruch des Neuen an sich hat. Ganz besonders bei Schreibwaren ist das so, bei Radiergummis, Heften, Bleistiften und Federmäppchen.
Solange ich mich nicht der Kasse nähere, empfinde ich die Dinge als mein, ich besitze sie. Ein tolles Gefühl. Ich liebe es. Es entspannt mich total. Und wenn ich alles stehen- und liegengelassen habe, breitet sich gleich noch mal ein [35] Glücksgefühl in mir aus, weil ich so viel Geld gespart habe, indem ich all diese Dinge nicht gekauft habe.
An diesem Abend habe ich Mofareifen, einen Tennisschläger, zwei Rollen Bälle sowie ein Mädchenfahrrad mit Stützrädern »scheingekauft«.
In der Kinderabteilung erblickte ich eine bildschöne Frau, die sich Spielzeug für ihren Sohn ansah, und um ein Gespräch anzufangen, fabulierte ich, ich sei auf der Suche nach einer Überraschung für meine Tochter. Sie riet mir zu dem Fahrrad.
Wäre ich bei Michela auch so forsch und locker gewesen wie bei dieser Jungmutter, dann wäre ich abends zu der Feier gegangen, anstatt sinnlos durch die Gänge eines Supermarkts zu kurven.
An jenem Abend nach dem »Scheinkauf« machte ich einen langen Spaziergang. Doppelte Dosis Lasterfrönen. Im Gehen stellte ich mir Michela auf ihrer Abschiedsfeier vor. Ich sah sie lachen, scherzen, sah sie unter Tränen ihre Freundinnen umarmen. Auf dieser Feier fehlte einer. Ein Depp, der gerade allein durch die Stadt lief.