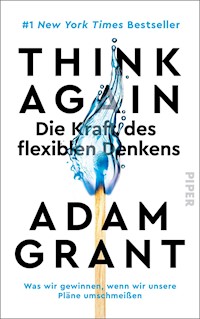9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
In vielen stark strukturierten Unternehmen wird Kreativität nicht sehr geschätzt. Dabei sind es gerade die originellen Nonkonformisten, die mit innovativen Veränderungen der Wirtschaft neue Impulse geben. Der führende amerikanische Organisationspsychologe Adam Grant zeigt in seinem Coaching-Ratgeber, wie man sein kreatives Potenzial besser ins Spiel bringt, Verbündete gewinnt und den richtigen Zeitpunkt zum Handeln wählt. »Dies ist eines der wichtigsten und faszinierendsten Bücher, die ich je gelesen habe – ein Buch voller überraschender und kraftvoller Ideen.« Sheryl Sandberg, Geschäftsführerin von Facebook »Adam Grant ist der herausragende Analyst unserer Arbeitswelt.« New York Times Anhand von prägnanten Beispielen aus Wirtschaft, Politik, Sport und Entertainment zeigt Adam Grant, dass es sich lohnt, alte Muster über Bord zu werfen, der eigenen Originalität freien Lauf zu lassen und für erfolgversprechende Ideen zu kämpfen. Und er liefert praktische Anleitungen, wie man sein kreatives Potenzial am besten einbringt, wie man etabliertes Gruppendenken überwindet, sich Gehör verschafft und eine Neuausrichtung in Gang setzt – zum Vorteil aller. Eine inspirierende Perspektive für alle, die ihre Visionen umsetzen und Großes leisten wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 495
Ähnliche
Adam Grant
NONKONFORMISTEN
Warum Originalität die Welt bewegt
Aus dem Amerikanischen von Bernhard Jendricke, Rita Seuß und Thomas Wollermann
Knaur e-books
Über dieses Buch
Mit pointierten Thesen stellt Adam Grant unsere Vorstellungen von Erfolg auf den Kopf. Seine bahnbrechende Erkenntnis, dass hilfsbereite Menschen langfristig deutlich mehr bewirken als die Ellenbogentypen, hatte in den Vorstandsetagen vieler Konzerne großes Aufsehen erregt und ein Umdenken eingeleitet. Nun geht er einen Schritt weiter: Wirtschaftsunternehmen sollten sich nicht ausschließlich auf die Typen von Leistungsträgern stützen, die die Firmenkultur verinnerlicht haben und einen guten Job machen, sondern gezielt kreative Nonkonformisten fördern. Denn ihre Originalität ist die entscheidende Kraft, um einen festgefahrenen Status quo zu überwinden und neue Wege zu beschreiten.
Inhaltsübersicht
Für Allison,
die mich stets herausfordert,
origineller zu sein.
Vorwort
von Sheryl Sandberg, Geschäftsführerin von Facebook und Begründerin von LeanIn.org
Für ein Buch über originelle Menschen ist Adam Grant der ideale Autor, denn er ist selbst einer.
Als herausragender Wissenschaftler widmet er sich mit ganzer Leidenschaft der Frage, was Menschen dazu motiviert, Mythen zu zertrümmern und Wahrheiten ans Licht zu bringen. Als Optimist (und ganz gewiss keiner von der blauäugigen Sorte) liefert er uns frische Einsichten und gibt uns Ratschläge, wie wir – zu Hause, am Arbeitsplatz und in unserem sozialen Umfeld – eine bessere Welt schaffen können. Als treuer Freund hat er mich ermuntert, an mich zu glauben, und mir geholfen, meine Ideen wirkungsvoll zu vertreten.
Adam hat mein Leben tiefgreifend beeinflusst. In diesem wunderbaren Buch wird er auch Ihnen neue Einsichten, Anregungen und Unterstützung vermitteln.
Ein Mythenzertrümmerer
Nach landläufiger Ansicht sind nur wenige Menschen von Natur aus kreativ, während sich die große Mehrheit nur selten durch originelle Ideen hervortut. Einige sind geborene Anführer, die meisten schwimmen mit dem Strom. Einige können etwas bewirken, die Mehrheit kann es nicht.
Alle diese vermeintlichen Gewissheiten stellt Adam in Frage. Er zeigt, dass jeder von uns seine Kreativität steigern kann, und demonstriert, wie wir wirklich originelle Ideen erkennen und wissen können, welche am ehesten Aussicht auf Erfolg haben. Er sagt uns, wann wir unserem Bauchgefühl vertrauen sollten und wann es besser ist, sich auf andere zu verlassen. Er legt uns dar, wie wir bessere Eltern werden können, die bei ihren Sprösslingen Originalität fördern, und bessere Manager, die Nonkonformisten ermuntern, statt konformes Denken zu unterstützen.
Dieses Buch hat mich gelehrt, dass bedeutende schöpferische Menschen nicht unbedingt profunde Fachkenntnisse haben müssen, sondern eher versuchen, eine möglichst umfassende Perspektive einzunehmen. Ich habe gesehen, dass in der Regel Erfolg nicht daraus resultiert, dass man allen anderen voraus ist, sondern dass man geduldig auf den richtigen Augenblick wartet. Und es war ein echter Schock für mich zu erfahren, dass es manchmal gut sein kann, eine Arbeit vor sich herzuschieben. Jeder, der schon einmal mit mir zusammengearbeitet hat, weiß, wie sehr ich es hasse, Aufgaben erst im allerletzten Moment zu erledigen, und dass ich immer der Ansicht war, es sei besser, sie sich möglichst schnell vom Hals zu schaffen. Mark Zuckerberg und viele andere werden sich freuen, wenn ich von dem unerbittlichen Druck befreit bin, alles möglichst frühzeitig fertigzustellen. Wie Adam darlegt, könnte dies mir und meinen Teams helfen, bessere Ergebnisse zu erzielen.
Ein Optimist, der weiß, was er sagt
Wir alle begegnen tagtäglich Dingen, die wir lieben, und Dingen, die sich ändern müssen. Das eine schenkt uns Lebensfreude, das andere beflügelt unseren Wunsch, die Welt zu verändern, und zwar möglichst zum Besseren. Aber eingefleischte Überzeugungen und Verhaltensweisen zu ändern ist eine schwierige Herausforderung. Wir nehmen die Welt hin, wie sie ist, weil uns echter Wandel unmöglich erscheint. Dennoch wagen wir zu fragen: Kann ein Einzelner etwas bewirken? Und in einem besonders kühnen Moment sogar: Könnte dieser Einzelne ich selbst sein?
Adams Antwort ist ein klares Ja. Und sein Buch beweist, dass jeder von uns Ideen voranbringen kann, die dazu beitragen, unsere Welt besser zu machen.
Ein Freund
Als ich Adam kennenlernte, war gerade sein erstes Buch Geben und Nehmen erschienen, das im Silicon Valley Furore machte. Ich habe es gelesen und sofort angefangen, allen und jedem davon zu erzählen. Adam ist nicht nur ein herausragender Wissenschaftler, sondern auch ein begnadeter Lehrer und Geschichtenerzähler, der komplizierte Sachverhalte einfach und verständlich darlegen kann.
Irgendwann hat mein Mann ihn eingeladen, für sein Team in seiner Firma einen Vortrag zu halten, und ihn zum Abendessen zu uns nach Hause mitgebracht. Adam ist als Mensch ebenso außergewöhnlich wie als Autor. Er besitzt ein enzyklopädisches Wissen, und seine Energie ist ansteckend. Ich habe lange mit ihm über die Bedeutung seiner Forschungen für die Gender-Debatte gesprochen, und so begann eine Zusammenarbeit, die bis heute anhält. Wir führen Untersuchungsprojekte durch und schreiben gemeinsam Beiträge zum Thema Frauen und Beruf. LeanIn.Org hat von seiner strengen Analyse und seinem Engagement für die Gleichberechtigung immens profitiert.
Einmal im Jahr bringt Facebook seine weltweit verstreuten Teams zusammen, und 2015 lud ich Adam als Eröffnungsredner ein. Alle waren hingerissen von seiner Klugheit und seinem Humor. Noch heute, Monate später, reden die Teams von den Erkenntnissen, die er ihnen vermittelt hat, und von seinen Ratschlägen, die sie befolgen.
Im Laufe der Zeit sind Adam und ich Freunde geworden. Als das Schicksal mir plötzlich und unerwartet meinen Mann nahm, war Adam zur Stelle und erwies sich als große Hilfe. In der schwersten Zeit meines Leben hat er die Probleme angepackt, wie er alles anpackt: indem er sein einzigartiges Verständnis der Psychologie mit beispielloser Großzügigkeit verband. Wenn ich dachte, ich wäre am Ende, flog er quer durch die Vereinigten Staaten, um mir darzulegen, was ich tun konnte, um mir auf die Beine zu helfen und Kraft zu geben. Wenn ich nicht wusste, wie ich eine besonders vertrackte Situation bewältigen sollte, half er mir bei der Suche nach Lösungen, die ich selbst nicht sehen konnte. Wenn ich jemanden brauchte, bei dem ich mich ausweinen konnte, war er stets zur Stelle.
Ein wirklicher Freund ist jemand, der in dir mehr Potenzial sieht als du selbst – jemand, der dir hilft, das Beste aus dir herauszuholen. Die Magie dieses Buches besteht darin, dass Adam für jeden, der es liest, zu dieser Art Freund wird. Er hält eine Fülle von Ratschlägen bereit, die uns helfen können, unsere Zweifel und Ängste zu überwinden, kein Blatt vor den Mund nehmen, für unsere Ideen zu werben und Verbündete auch dort zu suchen, wo es scheinbar keine gibt. Er gibt uns praktische Leitlinien an die Hand, die uns zeigen, wie wir mit unserer Angst umgehen können, die uns helfen, unsere Wut in produktive Bahnen zu lenken, in unseren Schwächen die Stärken zu erkennen, Hindernisse zu überwinden und anderen Menschen Hoffnung zu schenken.
Dies ist eines der wichtigsten und faszinierendsten Bücher, die ich je gelesen habe – ein Buch voller überraschender und kraftvoller Ideen. Es wird nicht nur unseren Blick auf die Welt verändern, sondern auch die Art und Weise, wie wir unser Leben führen. Und es kann uns dazu anregen, die Welt zu verändern, in der wir leben.
1 Schöpferische Zerstörung: Wie gefährlich es ist, gegen den Strom zu schwimmen
»Der vernünftige Mensch passt sich der Welt an;
der unvernünftige versucht hartnäckig,
die Welt sich anzupassen.
Darum hängt jeder Fortschritt
vom unvernünftigen Menschen ab.«
George Bernard Shaw[1]
An einem kühlen Abend im Herbst 2008 zogen vier Studenten aus, eine ganze Branche zu revolutionieren. Sie hatten einen Berg Schulden und ärgerten sich, dass es so teuer war, eine neue Brille zu kaufen, wenn die alte kaputt- oder verlorengegangen war. Einer hatte das ramponierte Gestell mit einer Büroklammer repariert und die Brille trotzig noch fünf Jahre lang weiter getragen. Er war nicht bereit, so viel Geld für neue Gläser auszugeben, obwohl sich seine Glasstärke zweimal änderte.[2]
Der Branchenführer Luxottica beherrschte mehr als 80 Prozent des Marktes. Um Brillen billiger zu machen, mussten die Studenten also einen Riesen vom Sockel stürzen. Sie hatten verfolgt, wie kurz zuvor die Firma Zappos mit dem Online-Verkauf von Schuhen den Schuhmarkt total umgekrempelt hatte, und spielten mit dem Gedanken, dasselbe mit Brillen zu versuchen.
Ihre Freunde reagierten ausgesprochen skeptisch. Kein Mensch würde jemals eine Brille übers Internet kaufen, sagten sie, denn eine Brille müsse man anprobieren. Zappos hatte dieses Konzept zwar mit Schuhen durchgezogen, aber es musste ja einen Grund dafür geben, dass dasselbe mit Brillen bisher noch nie versucht worden war. »Wenn es eine gute Idee wäre«, so der allgemeine Tenor, »hätte es längst jemand gemacht.«
Die Studenten hatten keine Ahnung vom Internethandel und der dafür notwendigen Technologie, und noch weniger verstanden sie von Einzelhandel, Mode oder Bekleidung. Doch obwohl manche die Idee für verrückt erklärten, schlugen die Freunde lukrative Jobangebote aus und gründeten ein eigenes Unternehmen. Sie wollten Brillen, die im Laden 500 Dollar kosteten, online für 95 Dollar verkaufen und für jede verkaufte Brille einem Entwicklungsland eine Brille spenden.
Das A und O ihres Geschäftsmodells war eine funktionierende Website, auf der potenzielle Kunden die Produkte anschauen und kaufen konnten. Nach langem Hin und Her hatten sie es endlich geschafft, eine solche Website einzurichten. Und erst um vier Uhr morgens, einen Tag vor dem Start des Internethandels im Februar 2010, konnten sie online gehen. Sie nannten ihre Firma Warby Parker, eine Kombination aus zwei Namen von Figuren des Schriftstellers Jack Kerouac. Von ihm holten sie sich die Inspiration, die Fesseln der sozialen Zwänge abzustreifen und sich in dieses Abenteuer zu stürzen. Sie bewunderten Kerouacs rebellischen Geist und wollten ihn in die Verkaufskultur herüberholen. Und das zahlte sich aus.
Die Studenten hatten sich zum Ziel gesetzt, eine Brille pro Tag zu verkaufen. Doch als das Männermagazin GQ sie zum »Netflix der Brillenmode« erklärte, erreichten sie ihre Zielvorgabe für das gesamte erste Geschäftsjahr in weniger als einem Monat und verkauften so viele Brillen, dass sie 20000 Kunden auf eine Warteliste setzen mussten. Erst nach neun Monaten hatten sie einen Lagerbestand aufgebaut, der die Nachfrage befriedigen konnte.
Als dann im Jahr 2015Fast Company seine Rangliste mit den fünfzig innovativsten Unternehmen aus aller Welt veröffentlichte, war Warby Parker nicht nur dabei, es belegte den ersten Platz. Die drei Sieger der Vorjahre waren die Kreativ-Giganten Google, Nike und Apple gewesen, alles Firmen mit mehr als 50000 Mitarbeitern. Das mutige kleine Start-up-Unternehmen, ein Newcomer, beschäftigte hingegen nur 500 Mitarbeiter. Innerhalb von fünf Jahren hatten die vier Freunde eine weltweit angesagte Marke etabliert und über eine Million Brillen für Bedürftige gespendet. Die Firma erwirtschaftete einen Jahresertrag von 100 Millionen Dollar und wurde mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet.
Im Jahr 2009 hatte mir einer der Gründer das Unternehmen vorgestellt und mich eingeladen, in Warby Parker zu investieren. Ich schlug das Angebot aus.
Es war eine der größten Fehlentscheidungen meines Lebens. Und ich wollte verstehen, worin mein Irrtum bestand.
Psychologen haben nachgewiesen, dass es zwei Wege zum Erfolg gibt: Konformismus und Originalität.[3] Konformisten folgen eingefahrenen Gleisen und halten am Status quo fest. Originelle Menschen beschreiten bevorzugt neue Wege. Sie folgen innovativen Ideen oder Werten, die dem Gewohnten widersprechen, letztlich aber Verbesserungen bewirken.
Freilich gibt es nichts komplett Neues, denn alle unsere Ideen sind beeinflusst von dem, was wir von der Welt um uns herum lernen. Wir übernehmen ständig irgendetwas, sei es bewusst oder unbewusst. Wir alle neigen zur Kleptomnesie, zum Ideenklau, geben wir doch oft Einfälle anderer als unsere eigenen aus: Wir glauben, sie seien neuartig, und haben vergessen, dass sie in Wirklichkeit von jemand anderem stammen.[4] Nach meiner Definition bedeutet Originalität die Einführung und Propagierung einer in einem bestimmten Bereich relativ ungewöhnlichen Idee, die das Potenzial besitzt, diesen Bereich zu verbessern.
Originalität beginnt mit Kreativität – mit der Schaffung eines Konzepts, das neuartig und nützlich zugleich ist. Aber das ist noch nicht alles. Originelle Menschen ergreifen die Initiative, um ihre Visionen zu realisieren. Die Gründer von Warby Parker besaßen die Originalität, sich eine unkonventionelle Art und Weise auszudenken, Brillen zu verkaufen, nämlich über das Internet, und sie ergriffen konkrete Maßnahmen, sie leichter zugänglich und erschwinglicher zu machen.
Großer Erfolg erfordert große Risikobereitschaft. Diese Überzeugung ist in unserer kulturellen Psyche so fest verankert, dass wir kaum jemals darüber nachdenken. Wir bewundern Astronauten wie Neil Armstrong und Sally Ride dafür, dass sie »das Zeug dazu« hatten: den Mut, den einzigen von Menschen bewohnten Planeten zu verlassen und sich in den Weltraum hinauszuwagen. Wir feiern Helden wie Mahatma Gandhi und Martin Luther King, die bereit waren, für ihre Überzeugungen auch mit dem Leben zu bezahlen. Steve Jobs und Bill Gates wurden zu Idolen, weil sie den Mut besaßen, alles auf eine Karte zu setzen – ihr Studium abzubrechen und sich in einer Garage zu verschanzen, um ihre technologischen Visionen Wirklichkeit werden zu lassen.
Wenn wir die originellen Individuen bewundern, die Kreativität vorantreiben und den Wandel in der Welt fördern, neigen wir zu der Annahme, dass sie eben einfach aus einem anderen Holz geschnitzt sind. Manche Leute haben das Glück, mit genetischen Mutationen geboren zu werden, die sie gegen Krankheiten wie Krebs, Fettleibigkeit oder HIV immun machen; in ähnlicher Weise, so glauben wir, seien Menschen, die etwas Großes geschaffen haben, biologisch immun gegen das Risiko. Wir glauben, sie seien so gepolt, dass sie das Risiko aus ganzem Herzen bejahen, auf soziale Anerkennung verzichten können und sich über den Preis des Nonkonformismus nicht so den Kopf zerbrechen wie wir anderen. Wir halten sie gleichsam für programmiert dafür, Bilderstürmer, Rebellen, Revolutionäre, Unruhestifter, Eigenbrötler und Unangepasste zu werden – gefeit gegen Angst, Ablehnung und Lächerlichkeit.
Der Ökonom Richard Cantillon (1680–1734), Ahnherr der Unternehmensforschung, definierte den Unternehmer als »Risikoträger«.[5] Die Geschichte des kometenhaften Aufstiegs von Warby Parker führt uns das Problem in aller Deutlichkeit vor Augen. Wie alle großen Schöpfer, Innovatoren und Weltveränderer waren auch sie bereit, den großen Sprung in die Ungewissheit zu wagen. Wer nicht nach den Sternen greift, wird das Glück nie zu fassen bekommen.
Stimmt doch, oder?
Sechs Monate bevor Warby Parker an den Start ging, saß einer der Gründer des Unternehmens in meinem Seminar an der Wharton School. Der großgewachsene junge Mann mit den schwarzen Locken wirkte aufgeschlossen, ruhig und dynamisch. Neil Blumenthal war in einer gemeinnützigen Organisation tätig und hatte den aufrichtigen Wunsch, einen positiven Beitrag für die Welt zu leisten. Als er mich für sein Unternehmen erwärmen wollte, reihte ich mich unter die vielen Zweifler ein und sagte, die Idee klinge zwar interessant, es sei aber schwer vorstellbar, dass die Leute Brillen online kaufen.
Wenn die Konsumenten skeptisch sind, ist es nahezu unmöglich, ein Unternehmen zum Laufen zu bringen, das wusste ich. Ich hatte kein gutes Gefühl, als ich erfuhr, dass Neil und seine Freunde sich tatsächlich auf den Start vorbereiteten.
Das Erste, was gegen sie sprach, sei, dass sie alle noch studierten, sagte ich zu Neil. Wenn sie wirklich von ihrer Idee überzeugt seien, sollten sie ihr Studium an den Nagel hängen und sich ganz auf die Umsetzung ihres Plans konzentrieren.
»Wir möchten uns absichern«, antwortete er. »Wir wissen nicht genau, ob es wirklich eine so gute Idee ist, und haben keine Ahnung, ob wir es schaffen. Deshalb arbeiten wir nur in unserer Freizeit daran, neben dem Studium. Wir sind vier Freunde, und wir sind der Meinung, dass Fairness im Umgang miteinander wichtiger ist als Erfolg. Jeff allerdings hat für den Sommer ein Stipendium bekommen, so dass er sich voll und ganz unserer Geschäftsidee widmen kann.«
Und was ist mit den anderen drei Gründern? »Wir machen alle ein Praktikum«, sagte Neil. »Ich im Bereich Consulting, Andy im Bereich Risikokapital und Dave im Gesundheitssektor.«
Aufgrund ihrer knapp bemessenen freien Zeit und ihrer zahlreichen anderen Verpflichtungen hatten sie immer noch keine Website eingerichtet; und sie hatten sechs Monate allein dafür gebraucht, sich auf einen Namen für ihre Firma zu einigen. Auch das sprach gegen sie.
Bevor ich sie jedoch endgültig abschrieb, hielt ich mir vor Augen, dass sie zum Jahresende alle ihr Studium abschließen würden und danach endlich Zeit hatten, sich voll und ganz ihrem Projekt zu widmen. »Na ja, nicht unbedingt«, sagte Neil. »Wir sind lieber vorsichtig. Für den Fall, dass es nicht klappt, habe ich eine Stelle angenommen, die ich gleich nach dem Studium antreten werde. Jeff auch. Und Dave wird im Sommer zwei Praktika machen und will dann vielleicht wieder bei seinem ehemaligen Arbeitgeber einsteigen.«
Ein dritter Punkt, der gegen sie sprach – und für mich einer zu viel.
Ich lehnte es ab, in Warby Parker zu investieren, weil Neil und seine Freunde mir so ähnlich waren. Ich bin Professor geworden, weil ich leidenschaftlich an der Entdeckung neuer Erkenntnisse interessiert bin, weil ich Wissen teilen und die nächsten Generationen von Studenten unterrichten wollte. Aber in Augenblicken, in denen ich mir gegenüber ganz ehrlich war, musste ich mir eingestehen, dass ich die Sicherheit schätzte, die mir eine solche Stelle bot. Im Alter zwischen zwanzig und dreißig hätte ich niemals den Mut aufgebracht, ein Unternehmen zu gründen. Und wenn doch, hätte ich mit Sicherheit gleichfalls mein Studium beendet und eine Stelle angetreten, um mich finanziell abzusichern.
Die Strategie, die die Gründer von Warby Parker verfolgten, widersprach meinen Vorstellungen von erfolgreichen Unternehmern. Neil und seinen Freunden fehlte es an Mut, sich kopfüber in ihr Projekt zu stürzen, und deshalb zweifelte ich an ihrer Überzeugung und ihrem Engagement. Es ist ihnen nicht ernst damit, erfolgreiche Unternehmer zu werden, dachte ich; sie investieren nicht ihr Herzblut. Meiner Ansicht nach waren sie zum Scheitern verurteilt, weil sie auf Nummer sicher gingen, statt alles auf eine Karte zu setzen. Aber in Wirklichkeit war genau das ausschlaggebend für ihren Erfolg.
In diesem Buch möchte ich den Mythos widerlegen, Originalität bedeute, Risiken auf sich zu nehmen. Ich möchte Sie davon überzeugen, dass außergewöhnliche Menschen uns in Wirklichkeit sehr viel ähnlicher sind, als wir glauben. In allen Bereichen, von Wirtschaftsunternehmen und Politik bis zu Wissenschaft und Kunst, sind die Menschen, die die Welt mit originellen Ideen voranbringen, nur selten Paradebeispiele an Selbstsicherheit und Engagement. Wenn sie Traditionen in Frage stellen und den Status quo anzweifeln, vermitteln sie vielleicht oberflächlich den Eindruck, wagemutig und selbstgewiss zu sein. Aber bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass auch sie sich mit Ängsten, Unsicherheit und Selbstzweifeln herumschlagen. Wir betrachten sie als Macher, aber sie werden oft von anderen beflügelt und manchmal sogar zum Handeln gezwungen. Und auch wenn es so aussieht, als wären sie geradezu süchtig nach Gefahr, gehen sie Risiken in Wirklichkeit lieber aus dem Weg.
In einer hochinteressanten Studie gingen die Managementforscher Joseph Raffiee und Jie Feng einer einfachen Frage nach: Wenn jemand ein Unternehmen aufbaut, ist es dann besser, wenn er seinen Brotberuf behält oder wenn er ihn aufgibt?[6] Zwischen 1994 und 2008 untersuchten sie eine landesweit repräsentative Gruppe von mehr als 5000 Amerikanern zwischen zwanzig und sechzig Jahren, die Unternehmer geworden waren. Für die Entscheidung dieser Gründer, ihren Brotberuf zu behalten oder an den Nagel zu hängen, spielten finanzielle Motive keine Rolle. Leute mit einem hohen Einkommen zeigten keine größere – oder geringere – Bereitschaft, ihre Stelle aufzugeben und sich ausschließlich ihrem Unternehmen zu widmen. Eine Umfrage ergab, dass diejenigen, die diesen Sprung wagten, risikofreudig waren und vor Selbstvertrauen nur so strotzten. Unternehmer, die sich absicherten und ihre Firma aufbauten, während sie weiter ihrem Brotberuf nachgingen, waren weniger risikobereit und weniger selbstsicher.
Wenn Sie so denken wie die meisten Menschen, werden Sie die Risikofreudigen klar im Vorteil sehen. Die Studie von Joseph Raffiee und Jie Feng jedoch ergab das genaue Gegenteil: Bei Unternehmern, die ihren Brotberuf behielten, lag die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns um 33 Prozent niedriger als bei denen, die ihren Job aufgaben.
Wenn Sie Risiken scheuen und die Umsetzbarkeit Ihrer Ideen nicht für von vornherein garantiert halten, ist die Wahrscheinlichkeit eines Erfolgs größer. Sind Sie ein hemmungsloser Zocker, steht Ihr Start-up auf sehr viel wackeligeren Beinen.
Etliche Gründer, die die jährlich erstellte Rangliste der innovativsten Unternehmen der Zeitschrift Fast Company anführen, behielten ihren Brotberuf nach dem Start ihres Unternehmens bei.[7] Phil Knight zum Beispiel, der Mitbegründer von Nike und als Student ein talentierter Läufer, begann im Jahr 1964, aus dem Kofferraum seines Autos Schuhe zu verkaufen, war aber noch bis 1969 als Wirtschaftsprüfer tätig. Nachdem Steve Wozniak den Apple I gebaut hatte, startete er mit Steve Jobs 1976 die Firma, blieb aber bis 1977 weiter in seinem Vollzeitjob als Ingenieur bei Hewlett-Packard. Und obwohl Larry Page und Sergey Brin 1996 einen Weg fanden, die Internetsuche zu optimieren, hängten sie ihre Dissertation in Stanford erst 1998 an den Nagel. »Wir hätten Google beinahe nicht gestartet«, sagt Page, denn »wir hatten Bedenken, unseren Promotionsstudiengang aufzugeben.« Voller Sorge, dass die Suchmaschine sie von ihrer wissenschaftlichen Forschung abhielt, versuchten sie, Google für weniger als zwei Millionen Dollar in bar und in Form von Aktien zu verkaufen. Zu ihrem Glück fand sich kein Käufer.
Die Tendenz, an seinem Brotberuf festzuhalten, ist nicht auf erfolgreiche Unternehmer beschränkt. Viele einflussreiche kreative Köpfe blieben auch dann als Firmenangestellte oder in einem Lehrberuf tätig, nachdem sie aus einem größeren Projekt bereits Gewinne erwirtschafteten. Ava DuVernay, die Regisseurin von Selma, drehte ihre ersten drei Filme, während sie noch als Journalistin arbeitete, und machte die Filmregie erst nach vier Jahren und etlichen Preisen zu ihrem ausschließlichen Beruf. Brian May arbeitete weiter an seiner Dissertation im Fach Astrophysik, als er anfing, in einer neuen Band Gitarre zu spielen; er gab die Fertigstellung seiner Doktorarbeit erst mehrere Jahre später auf, um ausschließlich als Gitarrist der Band Queen zu arbeiten. Wenig später schrieb er den Song We Will Rock You. Der Grammy-Gewinner John Legend brachte sein erstes Album im Jahr 2000 heraus, arbeitete aber bis 2002 weiter als Managementberater. Tagsüber erstellte er Finanzierungsmodelle und machte PowerPoint-Präsentationen, abends schrieb er Lieder und trat an den Wochenenden öffentlich auf. Der Thriller-Autor Stephen King blieb sieben Jahre lang weiter Lehrer, Hausmeister und Tankwart, nachdem er seine erste Geschichte geschrieben hatte. Erst ein Jahr nach Erscheinen seines ersten Romans Carrie gab er diese Jobs auf. Scott Adams, Schöpfer der Comicfigur Dilbert, arbeitete noch sieben Jahre, nachdem sein erster Comicstrip in einer Zeitung erschienen war, bei Pacific Bell. Warum gingen alle diese kreativen Köpfe auf Nummer sicher, statt alles auf eine Karte zu setzen?
Warum Risiken wie Aktienportfolios sind
Vor fünfzig Jahren entwickelte Clyde Coombs, Psychologe an der Universität Michigan, eine neuartige Risikotheorie. Bei einer riskanten Börseninvestition schützt man sich dadurch, dass man bei anderen Investitionen auf Nummer sicher geht. Coombs behauptete, dass Menschen, die in ihrem alltäglichen Leben erfolgreich sind, mit Risiken auf genau dieselbe Weise umgehen wie ein Investor mit Wertpapieren – indem sie das Risiko in einem Portfolio streuen. Wenn wir uns in einem Bereich für das Risiko entscheiden, agieren wir in einem anderen Bereich vorsichtiger. Wer vorhat, beim Black Jack zu zocken, hält sich auf dem Weg zum Spielkasino viel eher an die Geschwindigkeitsbegrenzung.
Risikoportfolios sind die Erklärung dafür, warum manche Menschen in einem Bereich ihres Lebens Originalität zeigen, in anderen Bereichen dagegen ziemlich konventionell bleiben.[8] Der Baseballfunktionär Branch Rickey ermöglichte es zwar Jackie Robinson, als erster Afroamerikaner in der Major League zu spielen, aber er ging sonntags nicht ins Baseballstadion, fluchte nicht und rührte keinen Tropfen Alkohol an. T. S. Eliots Gedicht Das wüste Land gilt als eines der bedeutendsten literarischen Werke des 20. Jahrhunderts. Doch nach der Veröffentlichung des Gedichts im Jahr 1922 behielt Eliot seinen Job bei einer Londoner Bank noch bis 1925, war also nicht bereit, ein finanzielles Risiko einzugehen. Der Romancier Aldous Huxley besuchte Eliot an seinem Arbeitsplatz und beschrieb ihn als einen »urtypischen Bankangestellten«. Auch als Eliot seinen Brotberuf endlich doch aufgab, wagte er nicht den Sprung in die Selbständigkeit. In den folgenden vierzig Jahren arbeitete er für einen Verlag, was Stabilität und Ordnung in sein Leben brachte. Seine phantasiereiche Lyrik schrieb er nebenbei. Wie Edwin Land, der Gründer von Polaroid, bemerkte, »kann wahrscheinlich niemand auf einem Gebiet originell sein, wenn er nicht auf allen anderen Gebieten psychische und soziale Stabilität besitzt, die auf einem festen Fundament ruht«.
Aber hält uns ein Brotberuf nicht davon ab, unser Bestes zu geben? Der gesunde Menschenverstand sagt, kreative Höchstleistungen gibt es nicht ohne einen maximalen Aufwand an Zeit und Energie, und ein Unternehmen floriert nur, wenn alle erdenklichen Anstrengungen unternommen werden. Dabei wird jedoch der entscheidende Vorteil eines ausgeglichenen Risikoportfolios übersehen: Das Gefühl von Sicherheit in einem Bereich gibt uns die Freiheit, in einem anderen Bereich originell zu sein. Finanzielle Rückendeckung befreit von dem Druck, unausgereifte Bücher zu veröffentlichen, minderwertige Kunst zu verkaufen oder fragwürdige Unternehmen zu gründen. Als Pierre Omidyar eBay aufbaute, war es zunächst nur ein Hobby; er arbeitete noch weitere neun Monate als Programmierer und quittierte diesen Job erst, als ihm sein Internet-Aktionshaus mehr Geld einbrachte als sein bisheriger Beruf. »Die besten Unternehmer gehen keine maximalen Risiken ein«, sagt Mitgründerin und Geschäftsführerin der Non-Profit-Organisation Endeavor, Linda Rottenberg, die jahrzehntelang viele der weltweit größten Unternehmer gecoacht hat.[9] »Sie machen sich ihr Risiko so risikolos wie möglich.«
Ein ausgewogenes Risikoportfolio bedeutet nicht, dass man stets den Mittelweg wählt und immer nur moderate Risiken eingeht. Erfolgreiche Kreative gehen vielmehr in einem Bereich Risiken ein, die sie mit extremer Vorsicht in einem anderen Bereich ausgleichen.[10] Mit 27 hatte Sara Blakely die neuartige Idee für Strumpfhosen ohne Fuß. Sie ging ein großes Risiko ein und investierte ihre gesamten Ersparnisse in Höhe von 5000 Dollar in ihr Projekt. Um ihr Risikoportfolio auszugleichen, behielt sie noch zwei Jahre lang ihre Stelle als Verkäuferin von Faxgeräten, arbeitete abends und an den Wochenenden am Prototyp ihrer Strumpfhose – und sparte Geld, indem sie ihren Patentantrag selbst stellte, statt einen Anwalt damit zu beauftragen. Als sie schließlich Spanx auf den Markt brachte, wurde sie schnell zur jüngsten Selfmade-Milliardärin der Welt. Hundert Jahre zuvor hatte Henry Ford sein Automobil-Imperium aufgebaut, während er als Chefingenieur bei Thomas Edison arbeitete. Das gab ihm die Sicherheit, die er brauchte, um seine innovativen Erfindungen für Automobile auszuprobieren. Er arbeitete zwei weitere Jahre für Edison, nachdem er einen Vergaser entwickelt hatte, und ein weiteres Jahr, nachdem er dafür ein Patent erhalten hatte.
Und was ist mit Bill Gates, von dem jeder weiß, dass er sein Studium in Harvard abbrach, um Microsoft zu gründen? Nachdem Gates im zweiten Studienjahr ein neues Softwareprogramm verkauft hatte, wartete er ein ganzes Jahr, bevor er die Universität verließ. Und selbst dann brach er das Studium nicht einfach ab: Er glich sein Risikoportfolio dadurch aus, dass er ein Freisemester beantragte und bewilligt bekam. Außerdem wurde er von seinen Eltern finanziell unterstützt. »Bill Gates war keineswegs einer der weltweit größten Hasardeure«, sagt der Unternehmer Rick Smith. »Man sollte ihn treffender als einen der weltweit größten Risikominimierer bezeichnen.«
Diese Art der Risikominimierung war auch für den Durchbruch von Warby Parker verantwortlich. Die beiden Mitgründer Neil Blumenthal und Dave Gilboa wurden gemeinsam Geschäftsführer des Unternehmens. Sie brachen mit der Regel, nur einen einzigen Geschäftsführer zu wählen, weil sie es für sicherer hielten, wenn zwei Leute am Ruder waren. In der Tat gibt es Belege dafür, dass der Markt auf eine Doppelspitze positiv reagiert und den Firmenwert steigen lässt.[11] Oberste Priorität der vier Start-up-Unternehmer war es von Anfang an, die Risiken zu minimieren. »Ich wollte nicht alles auf die Karte Warby Parker setzen«, sagte Dave. Nach der Gründung des Unternehmens erkundete er weitere Geschäftsmodelle und prüfte zu diesem Zweck wissenschaftliche Entdeckungen an Universitäten auf ihr kommerzielles Potenzial. Solche zusätzlichen Optionen verschafften den Gründern überhaupt erst den Mut, ihr Unternehmen auf die unbewiesene Annahme zu stützen, dass die Leute bereit seien, Brillen online zu kaufen. Statt diese Unsicherheit einfach nur hinzunehmen, arbeiteten sie aktiv daran, sie zu minimieren. »Wir diskutierten ständig darüber, wie wir die Risiken für das Unternehmen möglichst gering halten konnten«, sagt Neil. »Es war eine Aneinanderreihung von Ja- und Nein-Entscheidungen. Auf jeder Stufe überprüften und kontrollierten wir den nächsten Schritt.«
Im Rahmen ihrer Risikoabsicherung besuchten die vier Freunde gemeinsam ein Seminar für Unternehmensgründer und feilten monatelang an ihrem Geschäftsplan. Um den Kunden die Bedenken gegen einen Brillenkauf übers Internet zu nehmen, beschlossen sie, ihnen ein Rückgaberecht einzuräumen. Doch in Umfragen und Zielgruppenanalysen zeigten die Leute noch mehr Vorbehalte, einen solchen Kauf zu tätigen, als die Gründer erwartet hatten. »Viele wollten es auf keinen Fall. Das führte dazu, dass wir das ganze Geschäftsmodell in Frage stellten«, erinnert sich Neil. »Wir hatten starke Selbstzweifel. Und dann haben wir noch einmal ganz von vorne angefangen.«
Nach langwierigen Diskussionen fanden sie schließlich eine Lösung: Die Kunden sollten die Produkte zu Hause anprobieren können. Sie konnten die Brillengestelle ohne jede Kaufverpflichtung ordern und sie zurückschicken, wenn sie ihnen nicht gefielen. Das war letztlich sogar billiger als die Gewährung eines Rückgaberechts. Wenn ein Kunde das Gestell mit den Gläsern kaufte und dann zurückgab, bedeutete das aufgrund der individuell geschliffenen Gläser für Warby Parker einen erheblichen Verlust. Wenn die Kunden aber nur die Brillengestelle probierten und zurückgaben, konnte die Firma sie weiterverkaufen. An diesem Punkt war Dave optimistisch und entschlossen: »Als wir so weit waren, an den Start zu gehen, und ich die Entscheidung zu treffen hatte, ob ich mich ausschließlich damit beschäftigen sollte, erschien es mir nicht mehr riskant. Ich hatte nicht mehr das Gefühl, ins Bodenlose zu springen.« Das Konzept, die Modelle zu Hause anprobieren zu können, wurde so populär, dass Warby Parker 48 Stunden nach dem Start das Angebot zeitweilig aussetzen musste.
Eine wachsende Zahl von Beispielen zeigt, dass Unternehmer keineswegs risikofreudiger sind als andere Menschen – eine Erkenntnis, der viele Wirtschaftswissenschaftler, Soziologen und Psychologen in seltener Eintracht zustimmen. In einer repräsentativen Studie mit mehr als achthundert Amerikanern wurden Unternehmer und Angestellte gebeten zu wählen, welches der drei nachfolgenden Geschäftsmodelle sie am ehesten starten würden:
eines, das 5 Millionen Dollar Gewinn bei einer Erfolgschance von 20 Prozent versprach,
eines, das 2 Millionen Dollar Gewinn bei einer Erfolgschance von 50 Prozent versprach,
oder eines, das 1,25 Millionen Dollar Gewinn bei einer Erfolgschance von 80 Prozent versprach.
Die Unternehmer entschieden sich signifikant öfter für die letzte, die sicherste Option. Und zwar unabhängig von Einkommen, Reichtum, Alter, Geschlecht, unternehmerischer Erfahrung, Familienstand, Bildung, Größe der Familie und Erwartungen darüber, wie gut andere Geschäftsmodelle funktionieren würden. »Wir haben festgestellt, dass Unternehmer signifikant risikoscheuer sind als die allgemeine Bevölkerung«, schreiben die Autoren der Studie.[12]
Hier handelt es sich zwar nur um eine Umfrage, aber auch wenn man reale Business-Entscheidungen betrachtet, wird klar, dass Unternehmer große Risiken scheuen. Wirtschaftswissenschaftler sagen, dass erfolgreiche Unternehmer als Teenager fast dreimal so oft wie ihre Altersgenossen Regeln gebrochen und unerlaubte Dinge getan haben. Sieht man sich ein solches Verhalten aber genauer an, so zeigt sich, dass Heranwachsende, die später produktive Firmen gegründet haben, nur relativ kleine Risiken auf sich nahmen.[13] Psychologische Untersuchungen an amerikanischen und schwedischen Zwillingen ergaben dasselbe Bild.
Alle drei Studien kamen zu dem Ergebnis, dass spätere erfolgreiche Unternehmer als Teenager eine größere Tendenz gezeigt hatten, sich ihren Eltern zu widersetzen, länger als erlaubt auszugehen, die Schule zu schwänzen, in Läden zu klauen, Glücksspiele zu spielen, Alkohol zu trinken und Marihuana zu rauchen. Doch sie scheuten das Risiko, betrunken Auto zu fahren, harte Drogen zu konsumieren oder wertvolle Sachen zu stehlen. Und zwar unabhängig vom sozialen und wirtschaftlichen Status ihrer Eltern oder dem Familieneinkommen.
Originelle Köpfe variieren allerdings in ihrer Einstellung zum Risiko. Einige sind echte Zocker, andere pingelige Pfennigfuchser. Um seine Originalität zu entwickeln, muss man etwas Neues ausprobieren, was zwangsläufig eine gewisse Risikobereitschaft einschließt. Aber die erfolgreichsten Entwickler neuer Ideen sind keine Draufgänger, die unbedacht losstürmen, sondern Leute, die sich vorsichtig bis an den Rand einer Klippe vortasten, die Fallgeschwindigkeit berechnen, ihren Fallschirm dreimal checken und unten sogar noch ein Sicherheitsnetz gespannt haben – für alle Fälle. Wie Malcolm Gladwell im New Yorker schrieb: »Viele Unternehmer gehen große Risiken ein – aber das sind im Allgemeinen gescheiterte Unternehmer, nicht solche mit einer Erfolgsgeschichte.«[14]
Auch Gleichgültigkeit gegenüber sozialer Anerkennung ist kein Unterscheidungsmerkmal für Menschen, die originelle Wege einschlagen. Einer umfassenden Auswertung von sechzig Studien mit über 15000 Unternehmern zufolge wurden Menschen, denen die Anerkennung durch andere eher gleichgültig ist, nicht mit größerer Wahrscheinlichkeit Unternehmer, und ihre Firmen waren auch nicht unbedingt erfolgreicher.[15] Dasselbe Muster zeigt sich in der Politik: Bei einer Bewertung amerikanischer Präsidenten durch Hunderte von Historikern, Psychologen und Politikwissenschaftlern kam heraus, dass diejenigen, die den Willen des Volkes und die Vorgaben ihrer Vorgänger erfüllten, als eher unbedeutend beurteilt wurden. Die größten US-Präsidenten waren diejenigen, die den Status quo in Frage stellten und einen Wandel beförderten, der die Geschicke des Landes verbesserte. Ihr Handeln hatte jedoch überhaupt nichts damit zu tun, ob sie öffentliche Zustimmung und soziale Harmonie erstrebten.[16]
Abraham Lincoln gilt im Allgemeinen als der bedeutendste US-Präsident. Bei der Bewertung, wie wichtig es den Präsidenten war, andere zufriedenzustellen und Konflikte zu vermeiden, bekam Lincoln die höchste Punktzahl. Er empfing vier Stunden täglich die Bürger mit ihren Anliegen in seinem Amtssitz und begnadigte Deserteure während des Bürgerkriegs. Bevor er die Proklamation zur Aufhebung der Sklaverei unterzeichnete, rang er sechs Monate lang mit seiner Entscheidung. Er zweifelte, ob er die verfassungsmäßige Befugnis dafür hatte, und befürchtete, die Unterstützung der sklavenhaltenden Grenzstaaten einzubüßen, den Krieg zu verlieren und das Land zu zerstören.[17]
Originalität ist kein fest umrissener Charakterzug, sondern eine freie Entscheidung. Lincoln wurde nicht als originelle Persönlichkeit geboren. Es war ihm nicht in die Wiege gelegt, dass er einmal große Konflikte auf sich nehmen würde. Dies war vielmehr ein bewusster Willensakt. Wie der große Denker W. E. B. DuBois schrieb: »Er war einer von euch und wurde trotzdem Abraham Lincoln.«
Was muss man tun, um seine Originalität zu entwickeln? Man könnte damit anfangen, dass man versucht, origineller zu denken – also die Welt ringsherum mit anderen Augen zu sehen.
Defizite erkennen
Vor einiger Zeit wollte der Wirtschaftswissenschaftler Michael Housman im Rahmen eines Forschungsprojekts herausfinden, warum manche Kundenbetreuer es länger in ihrem Job aushalten als andere. Er verfügte über die Daten von mehr als 30000 Mitarbeitern, die für Banken, Fluggesellschaften und Mobilfunkbetreiber am Telefon saßen. Aus ihrer Beschäftigungsbiographie erhoffte er sich Aufschlüsse über ihr Engagement am Arbeitsplatz. Er vermutete, dass Menschen, die in der Vergangenheit häufig ihren Arbeitsplatz gewechselt haben, früher aufhören würden, aber das war nicht der Fall. Mitarbeiter, die in den zurückliegenden fünf Jahren fünf verschiedene Jobs gehabt hatten, gaben ihre Stelle nicht mit größerer Wahrscheinlichkeit auf als diejenigen, die seit fünf Jahren ein und denselben Job ausübten.
Auf der Suche nach weiteren Anhaltspunkten fiel Housman auf, dass sein Team Informationen darüber gesammelt hatte, welchen Internetbrowser Mitarbeiter benutzten, als sie sich einloggten, um sich für die Stelle zu bewerben. Aus einer Laune heraus untersuchte er, ob diese Wahl etwas mit einer frühen Kündigung zu tun haben könnte.[18] Er rechnete nicht damit, hier einen Zusammenhang zu entdecken, denn er beurteilte die Wahl des Browsers als reine Geschmackssache. Doch die Ergebnisse waren verblüffend: Mitarbeiter, die Firefox oder Chrome als Browser benutzten, hielten 15 Prozent länger an ihrem Job fest als diejenigen, die den Internet Explorer oder Safari benutzten.
Überzeugt, dass dies reiner Zufall war, führte Housman dieselbe Analyse bezüglich der Fehlzeiten durch. Das Muster war genau dasselbe: Die Benutzer von Firefox und Chrome fehlten 19 Prozentpunkte seltener als die des Internet Explorers und von Safari. Dann betrachtete er die Arbeitsleistung. Sein Team hatte fast drei Millionen Datensätze zu Verkäufen, Kundenzufriedenheit und durchschnittlicher Dauer der Anrufe zusammengetragen. Die Benutzer von Firefox und Chrome hatten signifikant höhere Verkäufe, und ihre Telefonate waren kürzer. Außerdem waren ihre Kunden zufriedener. Nach 90 Tagen in ihrem Job zeigten die Nutzer von Firefox und Chrome ein Niveau der Kundenzufriedenheit, das die Nutzer des Internet Explorers und von Safari erst nach 120 Tagen erreichten.
Nicht der Browser an sich ist jedoch der Grund dafür, dass sie in der Firma bleiben, zuverlässig zur Arbeit erscheinen und erfolgreich tätig sind. Die Vorliebe für einen bestimmten Browser ist vielmehr ein Signal für ihre Gewohnheiten allgemein. Warum sind die Nutzer von Firefox und Chrome in jeder Hinsicht engagierter und leistungsstärker?
Die naheliegende Antwort lautet, dass sie technisch mehr Durchblick haben; daher fragte ich Housman, ob er das nicht untersuchen könne. Alle Mitarbeiter hatten einen Test am Computer absolvieren müssen, mit dem ihre Kenntnis von Tastaturkürzeln, Softwareprogrammen und Hardware sowie die Geschwindigkeit beim Tippen geprüft wurde. Die Gruppe, die Firefox und Chrome benutzte, hatte keine signifikant besseren Computerkenntnisse, und sie konnte auch nicht schneller und korrekter tippen. Der Browser-Effekt musste also andere Gründe haben. Technisches Know-how und Fähigkeiten im Umgang mit Computern waren jedenfalls nicht die Ursache für größeren Erfolg im Beruf.
Entscheidend war die Art und Weise, wie die Leute sich den Browser beschafft hatten. Bei einem neu gekauften PC ist der Internet Explorer vorinstalliert, bei einem Apple Mac gilt das Gleiche für Safari. Fast zwei Drittel der Kundenbetreuer benutzten den vorinstallierten Browser, ohne zu fragen, ob es nicht einen besseren gibt.
Um einen anderen Browser wie Firefox oder Chrome herunterzuladen, braucht man eine gewisse Findigkeit. Statt das Vorgegebene ungefragt hinzunehmen, muss man die Initiative ergreifen und aktiv nach einer besseren Option suchen. Und dieser Akt der Initiative, so geringfügig er auch sein mag, gibt Aufschluss darüber, wie jemand seinen Job ausfüllt.
Die Kundenbetreuer, die den jeweils voreingestellten Browser übernahmen, zeigten an ihrem Arbeitsplatz ein ähnliches Verhalten: Sie hielten sich bei ihren telefonischen Verkaufsgesprächen strikt ans Drehbuch und folgten im Umgang mit Kundenbeschwerden standardisierten Vorgehensweisen. Sie betrachteten die Beschreibung ihres Jobs als unverrückbar, und wenn sie mit ihrer Arbeit unzufrieden waren, meldeten sie sich öfter krank und gaben schließlich den Job ganz auf.
Die Mitarbeiter, die die Initiative ergriffen, um Firefox oder Chrome zu installieren, gingen ganz anders an ihren Job heran. Sie suchten nach neuen Wegen, den Kunden etwas zu verkaufen und auf Beschwerden zu reagieren. Wenn sie mit einer Situation konfrontiert waren, die ihnen nicht behagte, veränderten sie sie. Und nachdem sie aktiv geworden waren und ihre Arbeitsbedingungen verbessert hatten, gab es für sie keinen Grund mehr zu kündigen. Sie schufen sich den Job, den sie wollten. Doch sie bildeten die Ausnahme, nicht die Regel.
Wir leben in einer Internet-Explorer-Welt. So wie fast zwei Drittel der Mitarbeiter in der Kundenbetreuung den auf ihrem Computer vorinstallierten Browser benutzen, akzeptieren viele von uns in ihrem eigenen Leben das, was ihnen vorgegeben ist. In einer Reihe von provokativen Studien ging der Sozialpsychologe John Jost der Frage nach, wie Menschen auf unerwünschte Lebensbedingungen reagieren. Im Unterschied zu Amerikanern, die europäische Vorfahren hatten, waren Afroamerikaner mit ihren wirtschaftlichen Lebensumständen zwar weniger zufrieden, betrachteten aber wirtschaftliche Ungleichheit eher als legitim und gerecht. Im Vergleich zu Menschen im obersten Einkommenssegment tendierten 17 Prozent mehr Menschen im untersten Einkommenssegment dazu, wirtschaftliche Ungleichheit als unabdingbar hinzunehmen. Und auf die Frage, ob sie Gesetze befürworten würden, die Bürgerrechte und das Recht der Presse zur Kritik an der Regierung einschränkten, falls solche Gesetze zur Lösung der Probleme des Landes notwendig seien, waren im untersten Einkommenssegment doppelt so viele wie im obersten bereit, das Recht auf Meinungsfreiheit zu opfern. Jost und seine Kollegen fanden heraus, dass sozial benachteiligte Gruppen den Status quo durchweg stärker unterstützten als sozial begünstigte. Ihr Fazit: »Menschen, die unter einem bestimmten Zustand am meisten leiden, sind paradoxerweise am wenigsten geneigt, diesen Zustand in Frage zu stellen, zu kritisieren, abzulehnen oder zu verändern.«
Dieses eigenartige Phänomen erklärt Josts Team mit einer Theorie der Systemrechtfertigung.[19] Sie besagt im Kern, dass Menschen grundsätzlich dazu tendieren, den Status quo zu rechtfertigen, auch wenn er unmittelbar gegen ihre persönlichen Interessen und die Interessen ihrer demographischen Gruppe gerichtet ist. Die Wissenschaftler untersuchten das Verhalten demokratischer und republikanischer Wähler vor den US-Präsidentschaftswahlen 2000. Als George W. Bush in den Umfragen zulegte, bewerteten die Republikaner ihn als wünschenswerteren Kandidaten, ebenso aber auch Demokraten, die bereits anfingen, nach einer Rechtfertigung für den antizipierten Status quo zu suchen. Dasselbe geschah, als Al Gores Erfolgsaussichten stiegen: Republikaner und Demokraten beurteilten ihn jetzt sehr viel wohlwollender. Ungeachtet ihrer politischen Weltanschauung bringen die Menschen einem Kandidaten verstärkt Sympathie entgegen, wenn er die Wahlen zu gewinnen scheint. Sinken seine Erfolgsaussichten, nimmt auch die Sympathie ab.
Die Rechtfertigung des gegebenen Systems dient der eigenen Beruhigung. Es ist ein emotionales Betäubungsmittel: Wenn die Welt nun einmal so ist, wie sie ist, brauchen wir nicht unzufrieden mit ihr zu sein. Aber die stillschweigende Hinnahme des Gegebenen beraubt uns auch der moralischen Empörung, gegen Ungerechtigkeit aufzubegehren, und des schöpferischen Willens, andere Möglichkeiten der Ordnung unserer Welt in Erwägung zu ziehen.
Originelle Menschen zeichnen sich dadurch aus, dass sie den Impuls, das Gegebene zu akzeptieren, zurückweisen und bessere Optionen erkunden. Nachdem ich mehr als zehn Jahre lang untersucht habe, wie man hier weiterkommen könnte, scheint mir heute, dass es weniger schwer ist, als ich dachte.
Am Anfang steht die Neugier – das Nachdenken über die Frage, warum etwas überhaupt so ist, wie es ist. Wir sind dann eher geneigt, Vorgegebenes in Frage zu stellen, wenn wir ein Vujà-dé-Erlebnis haben, das Gegenteil von Déjà vu, wie wir es nennen, wenn uns etwas Neues begegnet, das uns bekannt vorkommt. Beim Vujà dé ist es genau umgekehrt: Wir erleben etwas Bekanntes, sehen es aber mit neuen Augen und können auf diese Weise neue Einsichten in alte Probleme gewinnen.[20]
Ohne ein Vujà-dé-Erlebnis würde es Warby Parker gar nicht geben. Als die Unternehmensgründer an jenem ersten Abend im Computerraum zusammensaßen und ihre Geschäftsidee ausheckten, hatten sie zusammen sechzig Jahre lang Brillen getragen – ein Produkt, das seit jeher überteuert verkauft wurde. Aber bis zu diesem Augenblick hatten sie den Status quo als selbstverständlich hingenommen und den hohen Preis für Brillen nie in Frage gestellt. »Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen«, sagte Dave. »Ich hatte immer gedacht, es ist ein medizinisches Hilfsmittel, und wenn ein Arzt mir eine Brille verschreibt, wird der Preis dafür schon gerechtfertigt sein.«
Als er dann eines Tages in einem Apple Store in der Schlange stand, um ein iPhone zu kaufen, fing er an, die beiden Produkte zu vergleichen. Brillen zählten seit fast tausend Jahren zu den Grundbedürfnissen des Menschen und hatten sich seit der Zeit seines Großvaters kaum verändert. Jetzt fragte sich Dave Gilboa zum ersten Mal, warum Brillen so extrem teuer waren. Warum kostete ein so grundeinfaches Produkt mehr als ein technisch hochkompliziertes Smartphone?
Diese Frage hätte sich jeder andere auch stellen können, und er wäre zu derselben Antwort gelangt wie die Gründer von Warby Parker. Neugierig geworden, fingen sie an, in der Optikerbranche zu recherchieren. Sie fanden heraus, dass der Markt von Luxottica beherrscht wurde, einem europäischen Unternehmen, das im Jahr zuvor mehr als 7 Milliarden Dollar eingestrichen hatte. »Als ich erfuhr, dass derselben Firma Lenscrafters und Pearle Vision, Ray-Ban und Oakley gehörte und dass die Firma auch eine Lizenz für Brillen und Sonnenbrillen von Chanel und Prada besaß, wurde mir plötzlich klar, warum Brillen so teuer sind«, sagt Dave. »Nichts an dem Warenwert rechtfertigt diesen Preis.« Luxottica nutzte sein Marktmonopol und verkaufte die Brillen für das Zwanzigfache des Warenwerts. Der vorgegebene Preis war nicht gerechtfertigt; er war vielmehr die Entscheidung einer Gruppe von Leuten in einem bestimmten Unternehmen. Und das bedeutete, dass eine andere Gruppe von Leuten eine andere Entscheidung treffen konnte. »Wir konnten es anders machen«, das wurde Dave plötzlich klar. »Es war die Erkenntnis, dass wir unser Schicksal selbst in die Hand nehmen, dass wir unsere eigenen Preise gestalten konnten.«
Wenn wir erst einmal angefangen haben, in Frage zu stellen, was uns an dem, wie die Welt eingerichtet ist, nicht gefällt, erkennen wir rasch, dass es für diese Missstände meist gesellschaftliche Gründe gibt: Regeln und Systeme werden von Menschen geschaffen. Und wenn wir uns das vor Augen halten, können wir den Mut aufbringen zu überlegen, wie wir sie verändern können. Vor Einführung des Frauenwahlrechts in Amerika betrachteten viele Frauen »ihren benachteiligten Status als etwas ganz Natürliches«, meint die Historikerin Jean Baker.[21] Als die Bewegung für das Frauenwahlrecht stärker wurde, »fing eine wachsende Zahl von Frauen an zu erkennen, dass Traditionen, religiöse Vorschriften und gesetzliche Bestimmungen von Menschen geschaffen und damit veränderbar waren«.
In Beruf und Privatleben fehlt uns diese Möglichkeit zur Kontrolle nur allzu oft. Vor ein paar Jahren wurde die renommierte Yale-Professorin Amy Wrzesniewski von Google gebeten, Mitarbeitern des Unternehmens im Vertrieb und in der Verwaltung, die nicht die Freiheit und den Status der Ingenieure besaßen und auch nicht an den glanzvollen Projekten beteiligt waren, Möglichkeiten aufzuzeigen, ihre Jobsituation zu verbessern.[22] Ich schloss mich ihr und ihrem Mitarbeiter Justin Berg auf einer Reise nach Kalifornien, New York, Dublin und London an, wo wir gemeinsam nach Lösungen suchten.
Viele Mitarbeiter waren Google so treu ergeben, dass sie ihren Job als etwas Unumstößliches akzeptierten. Sie empfanden ihren Aufgabenbereich und die Möglichkeiten zur Interaktion derart fest umrissen, dass sie gar nicht auf die Idee kamen, daran etwas zu verändern.
Um dieses Denkschema zu durchbrechen, entwickelten wir zusammen mit Jennifer Kurkoski und Brian Welle von Google, zwei führenden Köpfen im Bereich People Analytics, der sich mit der Auswertung von Mitarbeiterdaten zum Zweck fundierter Entscheidungen befasst, einen Workshop für Hunderte von Angestellten. Wir machten sie mit der Vorstellung vertraut, dass Jobs keine in Stein gemeißelten Gebilde sind, sondern aus flexiblen Bausteinen bestehen. Und wir stellten ihnen Leute vor, die sich ihren Job selbst gestaltet und sich ihre Aufgaben und Interaktionen so zurechtgelegt hatten, dass sie ihren Interessen, Fähigkeiten und Wertvorstellungen besser entsprachen. Ein künstlerisch veranlagter Mitarbeiter im Verkauf zum Beispiel entwarf aus freien Stücken ein neues Logo; ein kommunikationsfreudiger Finanzanalyst kommunizierte mit seinen Kunden per Videochat statt per E-Mail. Von da an sahen sie ihren Job mit ganz neuen Augen: ein Vujà-dé-Erlebnis. Sie begannen, ihre Rolle am Arbeitsplatz neu zu konzipieren und eine bessere, aber immer noch realistische Sicht ihres Jobs zu gewinnen.
Manager und enge Mitarbeiter bewerteten die Zufriedenheit und die Leistung der einzelnen Angestellten vor und nach dem Workshop. Der ganze Workshop dauerte nur 90 Minuten; wir waren daher unsicher, ob das ausreichte, um einen Effekt zu erzielen. Doch sechs Wochen später zeigten diese Google-Mitarbeiter – sie waren rein zufällig ausgewählt worden – ein größeres Maß an Zufriedenheit und Leistung. Sie hatten sich Gedanken darüber gemacht, wie sie ihren Job umgestalten konnten, und angefangen, ihre Ideen in die Praxis umzusetzen. Google-Mitarbeiter einer Kontrollgruppe, die nicht diesen Workshop besucht hatten, zeigten keine Veränderung ihrer Zufriedenheit oder ihrer Leistung. Als wir die Mitarbeiter dann zusätzlich auch noch aufforderten, ihre Fähigkeiten gleichfalls als formbar zu betrachten, zeigte sich ein Zugewinn, der auch sechs Monate nach dem Workshop noch nachweisbar war. Statt lediglich ihre bisherigen Talente zu nutzen, ergriffen sie jetzt die Initiative, neue Fähigkeiten zu entwickeln, und gestalteten sich ihren Job origineller und individueller. Das Ergebnis war, dass sie 70 Prozent häufiger als ihre Kollegen befördert wurden oder in eine attraktivere Funktion wechseln konnten. Dadurch, dass sie aufhörten, ihren Arbeitsbereich und ihre Fähigkeiten als vorgegeben und unveränderlich zu betrachten, wurden sie zufriedener und erfolgreicher – und qualifizierten sich zudem für Aufgaben, für die sie besser geeignet waren. Sie hatten erkannt, dass sie sich viele ihrer Grenzen selbst gesetzt hatten.
Die zwei Seiten des Ehrgeizes
Der Druck, sich vorgegebenen Regeln anzupassen, beginnt weitaus früher, als wir denken. Wenn man sich die Frage stellt, welche Menschen dazu bestimmt sind, in der Welt Spuren zu hinterlassen, fallen einem als Erstes Wunderkinder ein.[23] Diese kleinen Genies können mit zwei Jahren lesen, mit vier Bach spielen, mit sechs jede Rechenaufgabe lösen und mit acht sieben Sprachen fließend sprechen. Sie lassen ihre Mitschüler vor Neid erblassen, und ihre Eltern freuen sich wie über einen Lottogewinn. Doch ihre Karriere endet oft nicht mit einem Knall, sondern mit einem Wimmern.
Wunderkinder verändern die Welt nur selten. Psychologische Studien der berühmtesten und einflussreichsten Persönlichkeiten der Weltgeschichte zeigen, dass viele von ihnen als Kinder nicht außergewöhnlich begabt waren. Und die lebenslange Beobachtung einer großen Gruppe von Wunderkindern hat ergeben, dass sie ihre weniger frühreifen Altersgenossen aus finanziell ähnlich gutgestellten Familien keineswegs in den Schatten stellen.
Das scheint unmittelbar einzuleuchten. Wir gehen davon aus, dass ein Bücherwurm Defizite in praktischer Intelligenz aufweist und dass einem derart begabten Kind die sozialen, emotionalen und praktischen Fertigkeiten fehlen, die es zu einem funktionierenden Mitglied der Gesellschaft machen. Untersuchungen zeigen jedoch, dass diese Erklärung zu kurz greift. Weniger als ein Viertel der begabten Kinder hat soziale und emotionale Probleme. Sie sind mehrheitlich gut angepasst und können auf einer Cocktailparty ebenso glänzen wie bei einem Rechtschreibwettbewerb.
Wunderkinder sind zwar oft talentiert und ehrgeizig, aber da sie nicht lernen, sich zu schöpferischen Persönlichkeiten zu entwickeln, bringen sie die Welt nicht voran. Auch wenn sie in der Carnegie Hall auftreten, Wettbewerbe wie »Jugend forscht« gewinnen oder Schachmeister werden – die tragische Wahrheit lautet: Übung macht zwar den Meister, schafft aber nichts Neues. Die Begabten lernen, wunderbare Melodien von Mozart und Symphonien von Beethoven zu spielen, aber sie komponieren keine eigenen Stücke. Sie konzentrieren all ihre Energie darauf, sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse anderer anzueignen, statt Neues zu generieren. Sie passen sich vorgegebenen Spielregeln an, statt die Regeln ihres eigenen Spiels aufzustellen. Dabei erstreben sie das Lob ihrer Eltern und die Bewunderung ihrer Lehrer.
Die Forschung hat gezeigt, dass diejenigen Kinder am kreativsten sind, die keine Chance haben, zu den Lieblingsschülern ihrer Lehrer zu avancieren. In einer Studie erstellten Grundschullehrer Listen mit den Schülern, die ihnen am liebsten waren, und mit denen, die sie am wenigsten mochten. Die von den Lehrern am wenigsten geschätzten Schüler waren Nonkonformisten, die ihre eigenen Spielregeln aufstellten. Lehrer neigen dazu, besonders kreative Schüler zu diskriminieren und als Unruhestifter zu brandmarken und auszugrenzen.[24] Deshalb lernen viele Kinder schnell, sich geltenden Regeln anzupassen und ihre originellen Ideen für sich zu behalten. Um es mit dem Autor William Deresiewicz zu sagen: Sie werden die brillantesten Schafe der Herde.[25]
Als Erwachsene sind Wunderkinder in der Regel Experten ihres Fachs und Führungskräfte in ihrem Unternehmen. Doch »nur ein Bruchteil der begabten Kinder entwickelt sich letztlich zu revolutionär schöpferischen Erwachsenen«, klagt die Psychologin Ellen Winner. »Diejenigen, die es schaffen, müssen einen schmerzlichen Übergang vollziehen«: von einem Kind, »das in einem vorgegebenen Bereich schnell und mühelos lernt«, zu einem Erwachsenen, der »letztlich einen Bereich umgestaltet«.
Die meisten Wunderkinder vollziehen diesen Sprung nicht. Sie wenden ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten in ganz gewöhnlicher Weise an und erledigen ihren Job, ohne das Vorgegebene in Frage zu stellen und ohne Ärger zu machen. Ihr Risikoportfolio ist unausgeglichen: In jedem Bereich, den sie betreten, gehen sie auf Nummer sicher und folgen konventionellen Wegen zum Erfolg. Sie werden Ärzte, die ihre Patienten heilen, ohne sich für eine Veränderung des maroden Systems einzusetzen, das vielen Kranken eine bezahlbare Gesundheitsversorgung verweigert. Sie werden Anwälte, die ihre Mandanten gegen veraltete Gesetze verteidigen, ohne zu versuchen, die Gesetze selbst zu verändern. Sie werden Lehrer, die Algebra unterrichten, ohne sich zu fragen, ob das für ihre Schüler überhaupt ein sinnvoller Lehrstoff ist. Wir brauchen sie, damit alles glattläuft, aber sie tragen dazu bei, dass wir aus der Tretmühle nicht herauskommen.
Wunderkinder werden durch Leistungsmotivation eingeschränkt. Der Wunsch, erfolgreich zu sein, ist für viele große Leistungen der Menschheitsgeschichte verantwortlich. Wenn wir unbedingt glänzen wollen, wächst uns die Kraft zu, härter, länger und besser zu arbeiten. Da jedoch eine beträchtliche Zahl von kreativen Leistungen durch die Kultur vereinnahmt wird, ist es zunehmend ein paar wenigen Spezialisten vorbehalten, wirklich Originäres zu leisten.[26]
Eine hohe Leistungsmotivation kann Originalität verdrängen: Je mehr es auf die erfolgreiche Bewältigung von Aufgaben ankommt, desto mehr fürchtet man zu versagen. Statt einzigartige Leistungen anzustreben, konzentrieren sich alle unsere Wünsche auf den sicheren Erfolg. Die Psychologen Todd Lubart und Robert Sternberg formulieren es so: »Hat man in seinem Streben nach Erfolg eine bestimmte Stufe erreicht, schwindet nachweislich die Kreativität.«[27]
Das Streben nach Erfolg und die damit einhergehende Angst zu scheitern haben im Laufe der Geschichte bedeutende schöpferische Persönlichkeiten gebremst, auch wenn sie dennoch einen Wandel bewirkt haben. Zu sehr auf Stabilität und auf Leistungen bedacht, die den Konventionen entsprechen, strebten sie nicht unbedingt nach Originalität. Statt selbstsicher und mit Volldampf loszulegen, mussten sie erst gedrängt, überredet oder gezwungen werden, sich klar zu positionieren. Obwohl sie ganz offenkundig über das Charisma von Führungspersönlichkeiten verfügten, wurden sie im übertragenen – und manchmal auch im wörtlichen – Sinn von Gefolgsleuten und Kollegen erst emporgehoben.[28] Wären sie nicht zu originellen Taten gedrängt worden, würde es Amerika vielleicht gar nicht geben, die Bürgerrechtsbewegung wäre immer noch ein Traum, die Sixtinische Kapelle besäße keine Fresken, wir würden heute noch glauben, dass sich die Sonne um die Erde dreht, und der Computer hätte niemals eine solche Verbreitung gefunden.
Uns heute erscheint die Unabhängigkeitserklärung als eine historisch zwingende Notwendigkeit, aber einige der damals maßgeblichen Revolutionäre zauderten so sehr, dass fast nichts daraus geworden wäre. »Die Männer, die in der Amerikanischen Revolution die Führungsrolle innehatten, waren alles andere als Bilderbuchrevolutionäre«, schreibt der Historiker und Pulitzer-Preisträger Jack Rakove. »Sie wurden zu Revolutionären wider Willen.«[29] In den Jahren bis zum Unabhängigkeitskrieg fürchtete John Adams die Vergeltung der Briten und zögerte, seinen Beruf als erfolgreicher junger Anwalt aufzugeben. Erst nach seiner Wahl zum Delegierten des Ersten Kontinentalkongresses stürzte er sich in das Abenteuer der Politik. George Washington wiederum widmete sich der Verwaltung seines Guts und dem Weizenanbau, der Fischerei und der Pferdezucht, bevor Adams ihn zum Oberbefehlshaber der Armee berief. »Ich habe alles in meiner Macht Stehende versucht, um das zu vermeiden«, schrieb Washington.
Fast zweihundert Jahre später schreckte Martin Luther King davor zurück, sich an die Spitze der Bürgerrechtsbewegung zu stellen.[30] Sein damaliger Traum war es, als Pastor tätig zu sein und Universitätspräsident zu werden. 1955, nachdem Rosa Parks festgenommen und zu einer Geldstrafe verurteilt worden war, weil sie sich geweigert hatte, ihren Sitzplatz in einem öffentlichen Bus für einen Weißen freizumachen, kam eine Gruppe von Bürgerrechtsaktivisten zusammen, um zu diskutieren, wie man darauf reagieren könnte. Sie gründeten die Montgomery Improvement Association und organisierten einen Busboykott, und einer der Teilnehmer schlug King als Vorsitzenden vor. »Es ging so schnell, dass ich gar keine Zeit hatte, darüber nachzudenken. Sonst hätte ich die Nominierung wahrscheinlich abgelehnt«, sagte King. Erst drei Wochen zuvor waren King und seine Frau übereingekommen, »dass ich keine schwierigen Aufgaben in der Gemeinschaft übernehmen sollte. Ich hatte gerade erst meine Doktorarbeit abgeschlossen und musste mich intensiver meiner Kirchentätigkeit widmen.« Er wurde einstimmig zum Wortführer des Boykotts gewählt. Wie er selbst schildert, bekam er große Angst, als er an jenem Abend eine Rede vor der Gemeinde halten sollte. Diese Angst überwand er jedoch so schnell, dass er 1963 mit seiner Donnerstimme das Land unter der elektrisierenden Vision der Freiheit einte. Doch das konnte nur geschehen, weil ein Kollege King als Abschlussredner beim Marsch auf Washington vorschlug und wichtige Mitglieder der Bewegung dafür gewann, sich für King einzusetzen.
Michelangelo zeigte kein Interesse, als der Papst ihn mit dem Deckenfresko der Sixtinischen Kapelle beauftragte. Er sah sich als Bildhauer, nicht als Maler, und fühlte sich von der Aufgabe so überfordert, dass er sich nach Florenz absetzte.[31] Erst zwei Jahre später begann er auf Drängen des Papstes mit der Arbeit an dem Projekt. Und die Astronomie stagnierte jahrzehntelang, weil Nikolaus Kopernikus die Veröffentlichung seiner Entdeckung, dass sich die Erde um die Sonne dreht, ablehnte.[32] Aus Angst vor Ächtung und Spott schwieg er 22 Jahre lang und machte seine Entdeckung nur engen Freunden zugänglich. Als ein einflussreicher Kardinal von diesen Forschungen erfuhr, versuchte er Kopernikus in einem Brief zur Veröffentlichung seiner astronomischen Arbeiten zu bewegen. Doch selbst dann zögerte Kopernikus noch mehrere Jahre. Erst ein junger Mathematiker konnte ihn davon überzeugen, sein Hauptwerk in Druck zu geben.
Als fast ein halbes Jahrtausend später, 1977, ein reicher Investor Steve Jobs und Steve Wozniak 250000 Dollar zur Finanzierung von Apple anbot, stellte er eine Bedingung: Wozniak sollte bei Hewlett-Packard aufhören. Wozniak lehnte ab. »Ich hatte vor, für immer und ewig bei dieser Firma zu bleiben«, sagt er. »Meine psychische Blockade war, dass ich keine eigene Firma gründen wollte, ich hatte einfach Angst.« Wozniak besann sich erst dann eines Besseren, als Steve Jobs, mehrere Freunde und seine Eltern ihm Mut zusprachen.
Es lässt sich nur erahnen, wie viele Wozniaks, Michelangelos und Kings ihre originellen Ideen nur deshalb nicht weiterverfolgten, veröffentlichten oder propagierten, weil sie das Rampenlicht scheuten. Auch wenn wir keine Ambitionen haben, ein eigenes Unternehmen zu gründen, ein Meisterwerk zu schaffen, das abendländische Denken zu revolutionieren oder eine Bürgerrechtsbewegung zu gründen, fehlt es uns nicht an Ideen zur Verbesserung unserer Arbeitsplätze, Schulen und Gemeinschaften. Bedauerlicherweise zögern viele, ihre Ideen umzusetzen. Wie der Ökonom Joseph Schumpeter einmal sagte, ist Originalität ein Akt der schöpferischen Zerstörung.[33] Um ein neues System zu propagieren, müssen wir oft alte Gepflogenheiten über den Haufen werfen, und davor schrecken wir zurück, weil wir nicht als Unruhestifter gelten möchten. Von fast tausend Wissenschaftlern bei der amerikanischen Nahrungs- und Arzneimittelbehörde FDA hatten mehr als 40 Prozent Angst vor Sanktionen, wenn sie öffentlich Sicherheitsbedenken äußerten.[34] Von den mehr als 40000 Mitarbeitern eines Technologieunternehmens war die Hälfte überzeugt, es sei nicht ungefährlich, am Arbeitsplatz unpopuläre Ansichten zu artikulieren. 85 Prozent der Mitarbeiter in den Bereichen Consulting, Finanzdienstleistung, Medien, Arzneimittel und Werbung räumten ein, dass sie lieber schwere Bedenken verschwiegen, als sie ihrem Chef mitzuteilen, um ihr Image, ihre Beziehungen und ihre berufliche Karriere nicht zu gefährden.