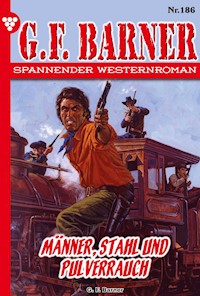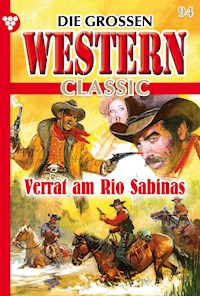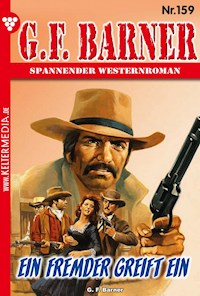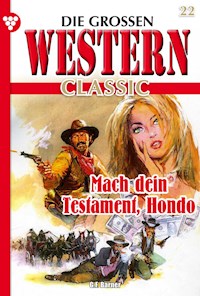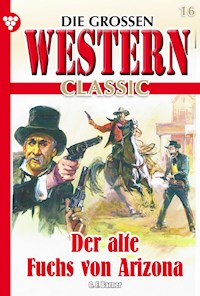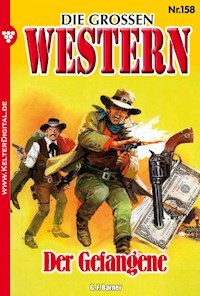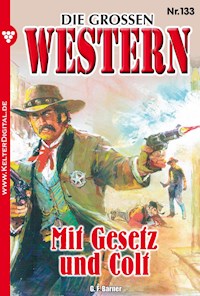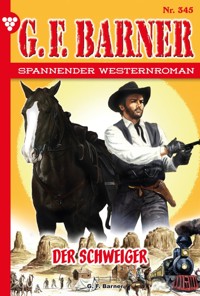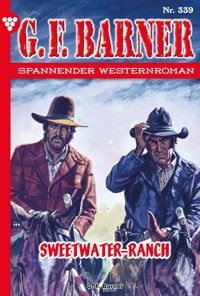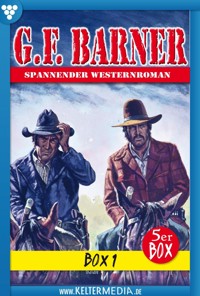
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: G.F. Barner Box
- Sprache: Deutsch
Begleiten Sie die Helden bei ihrem rauen Kampf gegen Outlaws und Revolverhelden oder auf staubigen Rindertrails. G. F. Barner ist legendär wie kaum ein anderer. Seine Vita zeichnet einen imposanten Erfolgsweg, wie er nur selten beschritten wurde. Als Western-Autor wurde er eine Institution. G. F. Barner wurde als Naturtalent entdeckt und dann als Schriftsteller berühmt. Seine Leser schwärmen von Romanen wie "Torlans letzter Ritt", "Sturm über Montana" und ganz besonders "Revolver-Jane". Der Western war für ihn ein Lebenselixier, und doch besitzt er auch in anderen Genres bemerkenswerte Popularität. E-Book 1: Männer der Grenze E-Book 2: Scout auf einer Geisterfährte E-Book 3: Teufels-Canyon E-Book 4: John Quinton E-Book 5: Fahr zur Hölle, Stewart
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 751
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Männer der Grenze
Scout auf einer Geisterfährte
Teufels-Canyon
John Quinton
Fahr zur Hölle, Stewart
G.F. Barner – Box 3 –
E-Book 11-15
G.F. Barner
Männer der Grenze
Roman von Barner, G.F.
Noch sieben Meilen bis Alpine.
Viele Jahre war er fort.
Wie gewonnen, so zerronnen. Geld gehabt, geritten, irgendwo in den Bergen gejagt, wenn die Lust zu jagen gekommen ist. Dann in eine Stadt, in einen Saloon, trinken und spielen. Gewonnen – zerronnen.
Mit seinem Partner Sid Lanson eine gute Arbeit oben in Neu Mexiko, aber der weite Weg, viele Städte, viele Saloons und der in Alpine. Eine Kugel im Oberarm, Fieber, kein Geld mehr und eine neue Dummheit machen.
Es ist eine Kette von Dummheiten. Dieses Sich-beweisen-Müssen, daß man ein Mann ist…, damit hat es angefangen. Wenn kein Halt mehr ist, wenn man nicht weiß, wohin man gehört, dann reitet man ziellos und ruhelos umher.
Die Schatten sind da, der Himmel über ihm ist in allen Farben gemalt. Ein Bild für einen Maler. Und wer es nie gesehen hat, der glaubt es nicht.
Dies ist der heiße Süden, dies ist Süd-Texas.
Angus Haley reitet in die Schatten hinein. Er reitet wie immer, wie einer der Männer, die ihre besten Jahre im Sattel verbringen. Vorgebeugt, locker, ganz gelockert und ganz träge, aber wachsam. Über einen Hang, der sich gegen den hellen Streifen im Westen abzeichnet und weiter, wieder in den Schatten hinein.
Eine Stunde, anderthalb, er sieht nun die Lichter und hält wieder an.
Da ist sie, die Stadt Alpine, in der man ihn verhaften will.
Es ist seltsam, in den Ort zu reiten, in dem man gesucht wird. Die Leute werden sicher nicht mehr reden, die Leute werden über andere Dinge sprechen – oder vielleicht doch nicht, wenn sie es schon gehört haben.
Angus Haley, Sohn des alten Markus John Haley, der viele Rinder, viel Geld und viel Einfluß hat, der im Kirchenvorstand sitzt und den Gouverneur so gut kennt, daß er manchmal auf der Haley-Ranch zu Besuch ist. Angus Haley mit Banditen, Viehdieben am Rio Grande. Angus Haley unter jenen Leuten, die man Bravados nennt – oder Bandidos, Banditen der Grenze!
Eine feine Nachricht muß das für den alten Markus John Haley sein, eine wirklich feine Nachricht. Nun gut, dann ist der Bruch wenigstens ganz und vollkommen, nichts mehr zu kitten, gar nichts.
Der Hof mit den Frachtwagen liegt links der Stadt. Und das Pferd geht weiter, kommt über den Weg, der von Alpine nach Marfa führt.
Einen Augenblick lang hält er wieder. Dort, südwestlich, zehn, zwölf Meilen entfernt, da liegt die Ranch, die Haley-Ranch, sehr feiner Name für die Leute, die dieses Land kennen.
Zwölf Meilen, mehr nicht.
Und das Pferd geht weiter auf die Lichter zu.
Einen Bogen nach links, jetzt den Hügel hinab und da – da ist schon der Frachthof, dicht hinter dem Alpine Bach liegt er mit seinen beiden Schuppen.
Das Pferd trottet langsam, das Pferd geht im Schritt. Schon sieht er den Corral, die Laternen im Hof, da stehen Pferde an der Tränke und saufen. Er reitet absichtlich weit genug vorbei und läßt das Pferd im Schritt gehen. Es ist eine seltsame Marotte von ihm gewesen, sein jeweiliges Pferd mit einem Eisen zu brennen. Immer ein großes H auf dem Fell. Haley – Haley-Pferd!
Er hört einen Mann lachen und steigt hinter den Baumwollbäumen leise ab. Dann bindet er sein Pferd an und geht los.
Auf der Straße knattert ein Wagen in die Stadt, ehe er am Zaun ist. Es ist einer der üblichen Zäune in diesem Gebiet. Man nimmt Strauchwerk, flicht es zu einem hohen Zaun zusammen und schmiert alles voll Lehm. Von weitem sieht es aus wie eine Mauer, aber der Zaun hat den Vorteil, daß er den Wind durchläßt, wenn die größte Hitze über Südtexas ist.
Jetzt steht er am Zaun, sieht den schmalen Durchlaß, und tritt an die Ecke. Er kann nun in den Hof blicken, er sieht den langen, flachen Bau, in dem die Fahrer schlafen. Spencer wird zu Hause sein. Er trinkt nicht, er raucht nur. Seltsam für einen Frachtwagenmann, daß er nicht auch trinkt, der alte Joe Spencer.
Joe Spencer verrät niemanden, Joe kann schweigen, Joe ist ein Freund seines Vaters. Einmal hat der alte Haley ihm Geld zu seinem Geschäft geliehen. Das ist fünfundzwanzig Jahre her, weiß der Himmel, was für eine Zeit das damals war. Joe Spencer hat Angus getroffen, damals, als Angus weggeritten ist.
»Bleib hier, Junge, arbeite bei mir, der Alte überlegt es sich noch. Bleib hier, er wird einsehen, daß du einfach schießen mußtest, bleib, Junge!«
Zwei Männer sitzen auf der Bank vor dem Hause, der eine lacht wieder, Licht fällt aus dem Anbau, jemand kommt von der Straße herein, und sagt knapp:
»Ist Joe im Bau?«
»In seinem Office.«
Der Mann wendet sich um, geht auf das erste Haus zu, macht die Tür auf, tritt in den Gang und läßt einen breiten Lichtstrahl in die Dunkelheit fallen.
Angus steht ganz still, er sieht den Schatten des Mannes verschwinden, den er zuerst nicht erkannt hat. Auf einmal schlägt sein Herz stärker, Schweiß bricht ihm aus. Er beißt die Zähne zusammen und sagt zwischen den Zähnen leise und sehr gepreßt:
»Mark – Mark!«
Mark Haley, sein älterer Bruder. Er ist schon verschwunden, die Tür ist zugeklappt. Hier, auf diesem Hof, da sieht er ihn nun wieder und nicht mal deutlich. Sechs – siebeneinhalb Jahre, denkt der Mann hinter der Ecke und geht wie ein Krebs rückwärts. Mark, mein Bruder, er ist hier, ich muß ihn sehen, ich muß!
Die Beine gehen von allein. Er duckt sich unter den Fenstern her und steht bald am Haus. Er kann nun auf das Fenster sehen, ein Fenster nur, alle Häuser haben Fenster, doch hinter diesem Fenster, das aufsteht, wenn es auch eingehakt ist, sagt der alte Joe Spencer heiser:
»Mark, ich habe erst morgen zwei Wagen frei.«
»Dann sieh zu, daß du sie noch am Abend losschickst. Es ist sehr eilig, wir brauchen den Draht, Mörtel und zwanzig Säcke Zement. Hör zu, er will einen großen Corral bauen. Und was er will…«
»Und was willst du?«
»Er hat recht, es ist besser so, Joe.«
»Du wirst ihm immer recht geben, wie?«
Einen Moment ist es still. Der Mann draußen vor dem Fenster gleitet weg, taucht zurück und schiebt sich dann wieder hoch. Jetzt kann er in das Fenster sehen. Der Lichtschein der Hängelampe fällt auf seinen Bruder.
Angus sieht ihn und lächelt.
Mark, der große Mark mit dem festen Kinn, dem hellen Haar des Vaters und den scharfen harten Augen. Zwei Jahre älter als Angus, der Erbe der Haley-Ranch. Er hat ihm dieses Erbe niemals geneidet, der Angus, niemals jene vorausbestimmte Führungsrolle auf der Haley-Ranch.
Mark steht da und kratzt sich am Kopf. Das macht er also immer noch, wenn er verlegen ist. Dann sagt Mark knapp:
»Ich gebe ihm nicht immer recht, Joe, das weißt du. Nur bin ich nicht wie Angus, ich gebe nach, wenn es sein muß. Hast du etwas von ihm gehört?«
»Du weißt also, daß er mit Viehdieben gesehen worden ist?«
»Ja«, sagt Mark, und seine Stimme klingt sehr dunkel. »Ein Ranger hat es heute früh auf der Ranch erzählt.«
»Und?«
»Du kannst dir denken, wie Vater es aufgenommen hat.«
»Und du?«
»Ich weiß nicht, ein Mensch kann sich in sieben Jahren ändern, aber ich weiß es nicht, was fragst du mich, wenn ich selbst keine Antwort darauf weiß. Also gut, lassen wir das, in jeder Familie gibt es meist einen dunklen Fleck, warum nicht bei den Haleys?«
Der Mann draußen steht still und ballt die Fäuste.
Ein dunkler Fleck!
In fast jeder Familie!
Angus senkt den Kopf und denkt, daß so viel bitterer Geschmack auf einmal gar nicht in einen Mund passen kann.
Der alte Joe Spencer hüstelt.
»Ist gut, du bekommst die Sachen übermorgen früh auf die Ranch, Mark.«
»Danke, Joe, ich wußte es doch. Also, gute Nacht.«
»Gute Nacht, Markus.«
Angus hebt den Kopf und sieht, daß sein Bruder stehenbleibt, als der alte Joe Spencer Markus zu ihm sagt.
»Hast du was, Joe?«
»Nichts, was soll ein alter Mann schon haben? Vielleicht etwas bessere Augen, wie? Du bist derselbe Narr wie dein Vater, Mark, fürchte ich. Du kennst deinen eigenen Bruder zu wenig, wie? Hat er von sich aus eine Schießerei angefangen – damals? Warum hat er schießen müssen?«
»Damals – damals! Er hat nie geschrieben, niemals in all den Jahren.«
»Weil er so stur wie dein Alter sein kann. Und weil man ihn weggejagt hat – ungerecht, wie? Ach, geh schon, geh doch schon, es hat keinen Sinn mit dir. Dein Bruder schießt sich für dich mit jemandem, der ihm überlegen war und du Narr sagst, daß er ein schwarzes Schaf sei. Mach die Tür von außen zu, Junge.«
»Aber – Joe, ich meine doch nur…«
»Wenn er das hören könnte, dann wärest du für ihn gestorben, du Narr. Der wird nie schlecht, der muß sich nur die Hörner abstoßen, aber warte nur nicht darauf, daß er dann zu euch kommt, das macht er niemals. Ihr müßt kommen, das weiß ich. Und es wäre gut, wenn ihr das letzte Stück auf den Knien rutschen würdet. Geh raus, ich will jetzt meine Ruhe haben!«
Mark Haley macht die Tür auf. Dann geht er hinaus, er geht mit gesenktem Kopf. Und der Alte steht auf, stopft sich seine Pfeife und zieht die Lampe ganz nach unten. Es wird dunkel vor Angus Haleys Füßen, ganz dunkel. Joe steckt sich auf die Art vieler Männer seine Pfeife über dem Zylinder der Lampe an. Er saugt heftig, schiebt die Lampe dann brummelnd hoch und sieht zum Fenster.
Dann wird er steif, seine Augen weiten sich.
Ein Mann steht vor dem Fenster und hat die Hand erhoben, um zu klopfen.
»Angus«, sagt der Alte, nimmt seine Pfeife aus dem Mund und starrt das Fenster an. »Angus – Junge!«
Einen Schritt macht er auf das Fenster zu, dann hält er jäh an, dreht sich um, geht hastig zur Tür und schließt ab. Erst dann öffnet er das Fenster.
»Angus – Junge, komm herein!«
»Ja!«
Mehr sagt er nicht, er steigt durch das Fenster, geht leise in eine Ecke und stellt sich neben einen Schrank.
»Mach das Fenster besser zu, Joe!«
Das Fenster ist geschlossen, der Vorhang ist vorgezogen.
»Du – du hast schon lange da draußen…«
»Ja!«
Es bleibt still danach, es bleibt so still, daß man den Tabak in der Pfeife knistern horen kann.
»Angus, Mark meint es nicht so, er hört ja nichts anderes von deinem Vater. Dann verliert man leicht…«
»Schon gut. Joe, kann ich etwas bleiben, nur eine Stunde oder eine halbe? Erinnerst du dich noch an den Mann, mit dem ich damals gekommen bin? Wir waren erst am Nachmittag gekommen und keine sechs Stunden in der Stadt, hast du ihn damals gesehen?«
»Ja, Junge, und?«
»Ich suche ihn.«
»Du, warum? Du suchst ihn? Ja, seid ihr denn nicht zusammen weggeritten?«
»Nein, er ist von hier aus allein weiter und hat mich im Stich gelassen. Er heißt Lanson, das wirst du wissen, Sidney Lanson. Joe, ich bin schwer verletzt worden, als Wagner geschossen hat. Und Lanson ist weggeritten. Wie geht es Wagner?«
»Ach, er kann schon wieder gehen. Bei so einem Bullen siegt doch immer die Natur. Wo hat er dich erwischt?«
»Am linken Oberarm, Joe. Joe, ich muß Lanson finden.«
»Mußt du? Warum das? Schuldet er dir Geld?«
»Nein, er schuldet mir einige andere Dinge. Ich – ich habe Wagner nicht angeschossen. Lanson ist es gewesen.«
Der alte Spencer erstarrt und hebt den Blick seiner grauen, hellen Augen. Er sieht Angus durchdringend an, dann nickt er langsam.
»Also, darum«, sagt er dann gepreßt. »Du wagst dich her, um etwas über diesen Lanson zu erfahren, aber – ich weiß nichts, Junge, damit du es gleich hörst. Lanson hat geschossen und Wagner getroffen. Wie ist das passiert?«
Angus erklärt ihm, daß bei der Schießerei damals Lanson geschossen hat und dann sofort verschwand. Die Leute dachten, er sei es gewesen.
»Du kannst mir glauben, oder mich für einen Lügner halten. Aber ich würde wohl kaum herkommen, wenn ich…«
»Das brauchst du mir doch nicht zu sagen, Angus. Warte, ich frage meine Leute, vielleicht haben sie etwas gesehen. Was hat Lanson damals getragen, ich weiß das nicht mehr.«
Angus beschreibt ihm die Kleidung und noch einmal genau das Aussehen von Syd Lanson. Der Alte nickt, geht zur Tür und deutet auf die Tür neben dem Schrank.
»Geh in mein Schlafzimmer, da hinein kommt niemand. Angus – die Leute reden da über einige Sachen. Einer der Ranger glaubt, daß er dich am Rio Grande mit Viehdieben gesehen hat. Ist das…«
»Ja«, sagt Angus kurz. »Aber – ich bin nur mit denen geritten. An dem Vieh habe ich nichts verdient. Du brauchst es niemandem zu sagen, ich werde es woanders abstreiten. Es war ein Fehler, ich habe eine ganze Menge Fehler begangen, wie?«
»Wenn du sie einsehen kannst, Junge, sind sie keine schlimmen Fehler mehr. Du brauchst nicht darüber zu reden, ich glaube ohnehin, daß du kein Vieh stehlen würdest.«
»Bist du sicher? Ich würde es nicht tun, Joe.«
»Ich bin sicher, geh in mein Schlafzimmer und sei leise.«
Er verschwindet, die Tür klappt zu. Angus wartet, hört Stimmen, dann Schritte im Gang und sieht die Tür zum Schlafzimmer aufgehen.
»Komm heraus«, sagt der alte Joe leise. »Sie wissen nichts – fast nichts. Du kennst doch Enrique, den Tuchhändler aus der oberen Straße?«
»Ja.«
»Er hat vor mehreren Tagen, gut zwei Wochen ist es her, Samuel erzählt, du müßtest dich wohl in der Gegend von Coyame herumtreiben, denn er hätte deinen Freund dort gesehen. Hilft dir das weiter?«
»Coyame«, sagt Angus bestürzt. »So weit in Mexiko drin? Vor zwei Wochen? Wann will er ihn dort gesehen haben?«
»Das weiß ich nicht, Junge. Ich kann hingehen und ihn fragen, aber ich habe vorhin zu Samuel gesagt, ich würde mich hinlegen und schlafen. Vielleicht fällt es auf, wenn ich, jetzt noch losgehe. Aber natürlich kann ich – wenn du kein Risiko dabei siehst?«
»Kein Risiko, es wird besser sein, ich rede mit Enrique selbst. Er wird nichts von meinem Besuch sagen.«
»Bist du sicher? Er hat eine böse Zunge und…«
»Und handelt mit einigen Dingen, über die ich etwas in den vier Wochen drüben in Mexiko gehört habe. Keine Sorge, Joe, er wird den Mund halten.«
Der alte Joe hat seine Schreibtischschublade aufgezogen und greift in den Kasten, der in der Lade steht.
»Laß sein«, sagt Angus heiser, als das Rascheln von Geldscheinen zu hören ist. »Ich brauche nichts, ich habe genug.«
»Junge, ein Mann braucht immer Geld, wenn er jemanden sucht. Nimm das hier – gib es mir irgendwann wieder, wann immer du es übrig hast. Die Sache kommt noch in Ordnung, ich habe so ein Gefühl. Also, nun nimm schon.«
»Nein, Joe. Ich nehme es nicht. Ich habe genug, ich sagte es doch schon.«
»Bestimmt, hast du reichlich Geld?«
»Ja, du kannst mir schon glauben.«
Ich nehme nichts, ich habe noch nie geborgt. Lanson schuldet mir hundertzehn Dollar und einige Cents. Die hat der Narr nach und nach verspielt. Man soll eben nie Geld verborgen, soll man nicht, wie?
»Brauchst du sonst etwas – Patronen, irgend etwas?«
»Ich habe alles!«
»Dein verrückter Stolz, man braucht immer etwas. Also gut, willst du schon gehen?«
»Ich weiß ja, was ich wissen wollte. Joe – kein Wort von meinem Besuch, verstanden?«
»Natürlich nicht. Und – du sollst nicht denken, daß Mark das ganz ernst gemeint hat. Ich glaube, er ist in der Stadt, um Jane Harfield zu sehen. Die beiden treffen sich manchmal hier. Mark ist in Ordnung, Junge.«
»Das habe ich gehört.«
»Angus, du irrst dich sicher, dein Bruder wird zu dir halten.«
»Ja, ich glaube an Wunder. Gute Nacht und vielen Dank, Joe.«
Er blickt aus dem Fenster, sieht niemanden und steigt hinaus. Der alte Joe blickt ihm nach, er sieht Angus Haley rechts unter den Bäumen verschwinden.
Dann kommt Angus noch einmal kurz zum Vorschein. Sein Pferd geht nun über den Hang hinweg, kommt nahe an das Bachbett heran – und ist fort.
»Der Junge«, sagt der alte Joe heiser. »Das wird noch was mit ihm und dem Alten.«
Angus reitet in diesem Augenblick nahe am Bach entlang, um die Stadt zu umrunden, denn er muß auf die andere Seite.
Und am Bach.
Einer dieser jungen Burschen und eines dieser jungen Mädel.
Am Bach ist es still und friedlich. Hierher kommt niemand. Vielleicht sitzen sie darum hinter den Büschen, reden leise miteinander und sehen sich manchmal an.
»Da kommt einer«, sagt das Mädchen wispernd. »Wenn das mein Bruder ist, dann gibt es Ärger.«
Sie verstecken sich beide hinter dem Busch und sind nun ganz still.
Der Junge sieht zwischen den Zweigen durch. In manchen Familien hier ist es so, daß die Brüder über ihre Schwestern wachen. Er hat ein wenig Angst. Der Mann taucht am Hang auf. Er ist genau über ihnen, der Mond scheint auf sein Gesicht.
Und der Junge bekommt ganz große Augen.
Der Mann reitet sehr nahe vorbei, keine zehn Schritt.
Auf einmal erinnert sich der Junge, schluckt heftig und duckt sich noch tiefer. Einen Augenblick denkt er, daß er sich irrt, doch dann ist er sicher, daß er Angus Haley gesehen hat.
Wenn der Mann ihn sieht, der wird schießen, der schießt einfach und fragt dann erst. Der Junge hat auf einmal Angst davor, zu sterben und schluckt schwer.
Dann ist der Reiter weg, verschwindet links, kommt hinter den Büschen wieder heraus und jagt durch den Bach, dessen Wasser hochspritzt.
Er reitet um die Stadt, denkt der Junge. Er will in die Stadt. Ich muß sofort zum Sheriff.
*
Angus reitet durch eine Gasse und sieht sich sichernd um. Da ist der Stall, dessen Dach weit überhängt. Neben dem Stall ein großer Weißbeerenbusch. Unter dem Dach und am Busch wird das Pferd nicht zu sehen sein.
Gleich darauf steht der Wallach unter dem Dach, und der Mann geht los.
Er hat den Hut ins Gesicht gezogen, taucht in die Gasse ein und hört ein Kind im Hause weinen. Licht geht an. Er zuckt zusammen, als der Lichtschein in die Gasse fällt und hastet weiter die Gasse hoch. Keine zwanzig Schritt mehr, die Tuchhandlung liegt genau an der Ecke zur Hauptstraße, der Hof ist hinten. Dann kommt jemand in die Gasse, der Mann pfeift laut, hat die Hände in den Taschen, und kommt genau auf Angus zu.
Angus Haley geht ruhig weiter. In diesem Moment weiß er, daß es kein Mann sein darf, der ihn genau kennt, denn dann ist es vorbei.
Er pfeift, dieser Mann, er kommt näher.
Und er pfeift immer lustig weiter, als er längst an Angus vorbei ist und an dem Haus, in dem das Kinderweinen anhält, die Tür aufmacht.
Er hat ihn nicht erkannt, das war sein Glück. Angus Haley atmet auf.
Der Mann ist fort. Angus zieht sich am Zaun hoch. Mit einem Satz steht er im Hof, dreht sich dem Haus zu und sieht Licht.
Enrique handelt mit gestickten Decken aus Mexiko, mit gewebten Teppichen und guten Tuchen. Die Tuche sind zum größten Teil geschmuggelt. Sie sind drüben in Mexiko um die Hälfte billiger als hier, weil die Arbeitskräfte ungleich geringer bezahlt werden. Man schmuggelt von hier aus Gewehre nach drüben, wenn man die richtigen Abnehmer hat. Und die hat man immer in Mexiko und seinen zahlreichen »Armeen«, die jeweils ein »General« führt. Der »General« ist ein ganz gewöhnlicher Bandit, der sich diesen Titel selbst verliehen hat. Entweder kämpft er für sich selbst, oder für den jeweiligen Provinzgouverneur, wenn der ihn bezahlen kann. Oder er kämpft für den einen Provinzonkel gegen den anderen. Sachen gibt es, die kein Mensch richtig auseinanderhalten kann. Es kommt vor, daß die »Truppen« eines Generals heute die eine Stadt oder das Dorf von Feinden befreien und morgen wiederkommen, weil der, der sie zu der »Befreiungsaktion« angeworben hat, sie einfach nicht bezahlen kann, oder zu wenig bezahlt.
Dann kommen die »Befreier« wieder und holen sich alles, was nicht niet- und nagelfest ist.
Und wer sie kennt und sie beliefert, denn schießen müssen sie, wenn es auch nur in die Luft ist, der verdient eine schöne Stange Geld dabei.
Einer dieser freundlichen Zeitgenossen ist Enrique. Als Angus kurze Zeit mit den Viehdieben ritt, hat er von Enrique gehört. Und darum weiß Angus einige Dinge über den braven, dicklichen und ewig grinsenden Enrique, der so harmlos ist – so schrecklich harmlos, kaum zu glauben, wie harmlos ein Mensch sein kann, wie?
Dieser dicke Enrique sitzt behäbig – er hat gerade seinen Store geschlossen – in seiner Küche und hat ein Huhn von seiner Haushälterin gebraten bekommen. Enriques Haushälterin ist in der Nachbarschaft und redet – alle Frauen reden viel.
Enriques Finger sind voller Fett. Ein schönes Huhn, ein feines Huhn. Enrique ist so in sein Huhn vertieft, daß er nichts hört und nichts sieht.
Daraufhin hebt er den Kopf. Und dann bleiben seine Zähne im Fleisch stecken.
Ein Mann steht plötzlich in der Tür und sieht auf ihn herab. Enrique ist nicht groß, Enrique ist klein und rund, sehr rund. Vor Schreck weiten sich seine Augen.
»Iß weiter«, sagt Angus Haley ruhig. »Ich hoffe, es schmeckt dir, Enrique?«
»Ja, jawohl, es schmeckt«, sagt Enrique, dem gerade keine andere Antwort einfallen will. »Was – was willst du, Angus? Ich bin nur ein kleiner armer…«
»Du bist ganz arm, du bist sogar so arm, daß du die sechzig Gewehre und zwanzig Kisten mit Munition an Gomez vor drei Wochen umsonst geliefert hast«, sagt Haley ganz ruhig. »Oder hast du sie bei den Behörden hier registriert, mit einer Ausfuhrgenehmigung… Ist dir was, Enrique?«
»Ni – ni – nichts«, stottert Enrique und hat auf einmal gar keinen Hunger mehr. »Wer – wer ist Gomez, Angus?«
»Ich weiß nicht, ich bin so vergeßlich, Enrique. Stimmt es, du bist auch vergeßlich, wie? Du siehst niemanden, du weißt von nichts, du kennst auch keinen wieder, na?«
»Ja, ja, ich bin schrecklich vergeßlich«, beeilt sich Enrique zu versichern. »Neulich habe ich doch sogar vergessen, meinem Bruder zum Namenstag zu gratulieren. Du brauchst eine Kleinigkeit, Freund Angus?«
»So kann man es nennen, Enrique. Nein, nein, nicht dein Geld, wenn du das denkst. Ich bin doch kein Erpresser, wie? Enrique, du bist in Coyame gewesen, nicht wahr? Und dort hast du meinen Freund gesehen, stimmt es?«
»Deinen Freund, ja«, sagt Enrique erleichtert, der schon an spätere Prozentbeteiligung von Angus gedacht hat. »Aber – du warst nicht dort, dich habe ich nicht gesehen, schade – sehr schade. Ich hätte dir sonst gern eine große Flasche Tequila spendiert, ich bin nicht so, das weißt du doch, was?«
»Ich weiß vieles und noch mehr«, gibt Angus zu. »Wo hast du Lanson gesehen, genau den Platz, das Haus, die Bodega, jede Kleinigkeit ist wichtig, Enrique. He, kann hier keiner kommen?«
»Meine Haushälterin ist fortgegangen – und vorn ist zu.«
»Dann ist hinten auch geschlossen, damit du es weißt. Also, wo hast du ihn gesehen?«
In den kleinen, von dicken Fettpolstern umgebenen Augen Enriques taucht jähe Neugierde und Wachsamkeit auf.
»Äh, vielleicht erinnere ich mich nicht richtig, kann sein, es wird schwer…«
»Hör gut zu, dir wird jede Kleinigkeit einfallen, sonst binde ich dich hier fest, nehme einen Stein, wickle einen Zettel darum mit einer feinen Geschichte und werfe ihn durch das Fenster des Sheriffs. He, was passiert dann? Also, wo bist du ihm begegnet?«
Enrique wird noch kleiner, er schrumpft förmlich zusammen und sagt leise:
»In Coyame. Ich habe ihn sofort erkannt. Er war in der Bodega von Micaela – Rufo Micaela, weißt du?«
»War er allein?«
»Allein? No, er hat mit zwei, drei Mexikanern zusammen an der Theke gestanden und getrunken. Wahrscheinlich hat er mich nicht erkannt. Was willst du von ihm, habt ihr euch getrennt?«
»Das geht dich nichts an, Enrique. Beantworte nur meine Fragen. Hast du einen der Mexikaner gekannt?«
»Äh – ich glaube, der eine, ja, der heißt Rodriguez – Alfonso Rodriguez. Er ist bei einem Ranchero beschäftigt.«
»Bei wem?«
»Ich weiß nicht, ich weiß nur, daß er Vaquero bei einem Ranchero ist. Er soll ein guter Reiter sein und Pferde zureiten. Mehr weiß ich nicht über ihn, wirklich nicht. Aber – wenn du nach Coyame gehst, Rufo kennt Rodriguez bestimmt. Ich weiß bestimmt nichts, Angus, du mußt mir glauben. Angus, ich hätte ihn ja anreden können, aber ich habe gedacht: Misch dich in nichts ein; du weißt nichts, du tust so, als ob du ihn nicht kennst. Das ist ein wilder Bursche, redest du ihn an – vielleicht nimmt er seine Revolver und geht auf dich los? Es ist immer besser, nicht neugierig zu sein.«
»Da hast du recht, mein Freund. Also, Rufo kennt ihn mit Sicherheit?«
»Ich möchte das sagen, aber beschwören kann ich es nicht. So was schwöre ich nicht, verstehst du? Geh hin, frage dort. Warum seid ihr denn auseinander, he?«
»Jetzt bist du neugierig, wie? Also gut, du hast mich nicht gesehen, du hast mich auch nicht erkannt, ich bin nicht bei dir gewesen, verstanden?«
»Ich schwöre, ich habe dich nie gesehen!«
»Gut dann – iß weiter!«
Er geht rückwärts bis in den Gang und macht die Haustür leise auf.
Coyame, denkt er, als er hinten im Hof am Schuppen stehenbleibt und den Schlüssel im Schloß der Hintertür des Hauses rasseln hört. Coyame hat nur einige Häuser, kein großes Nest, wie? Und dorthin ist Lanson gegangen? Warum, weshalb ausgerechnet nach Coyame? Arbeitet er für eine Ranch dort unten oder – die Mexikaner brauchen keine Scharfschützen wie Lanson, wenn sie nicht dunkle Geschäfte… ich habe ihn nie richtig gekannt.
Er ist immer ein Rauhbein gewesen, bereit, keinem Krach auszuweichen, aber immerhin als Partner nicht übel.
Er stößt sich vom Schuppen ab und klettert dann wieder über den Zaun.
In der Gasse ist niemand. Er geht schnell, um hinauszukommen. Weit hinter ihm, auf der Mainstreet schreit jemand etwas. Stimmengewirr ist dort. Er hastet aus der Gasse, er rennt beinahe, weil ihn nun niemand mehr sehen soll. Es würde ein törichter Zufall sein, sollte ihm jetzt noch einer begegnen, den er kennt und der ihn auch sofort erkennen würde. Angus kommt gut aus der Gasse und geht dann zu seinem Pferd.
Er streckt die Hand aus, will die Zügel lösen und hört auf einmal hinter sich ein Knacken, als wenn jemand auf einen Ast tritt und der trockene Ast bricht.
Und da sagt auch schon die Stimme von Hank Turgill – und niemand als er kennt besser die Härte, die Turgill besitzt.
»Angus, steh ganz still. Ich schieße!«
Dies ist es.
Der Mann ist hinter ihm.
Er ist um die Ecke des Stalles gekommen.
Jetzt ist er da, Hank Turgill. Der Sheriff von Alpine.
Seine Worte sind wie immer kurz, scharf und schnappend.
Angus wendet langsam den Kopf.
Turgill hält den Revolver in der Hand.
Und er ist der Mann, der ihn auch gebraucht.
Angus ist verloren.
*
Er wacht auf und blinzelt. Die Schmerzen in seinem Kopf sind da, kleine, ziehende Stiche, die sich von seinem Hinterkopf ausbreiten und über seinen Nacken abwärts laufen.
Dann hört er die Stimmen und liegt ganz still. Sein Blick fängt nacheinander einige Dinge ein. Zuerst sieht er die Decke, einen dicken Balken und dann das Gitter. Der Blick gleitet am Gitter herab, erfaßt den Gang, die Wand, die Lampe an der Wand und die schwere Eisentür.
Plötzlich erinnert er sich, wenn die Gedanken auch quälend langsam von ihm geformt werden.
Turgill, sein Befehl, sich umzudrehen. Die Schritte hinter ihm und jenes Wissen, daß ein Mann wie Turgill kaum einen Fehler macht, sozusagen nie.
Er hat noch an den Tag gedacht, an dem Hank Turgill die Ranch der Haleys verlassen hat. Auf dieser Ranch hat Turgill mit dreizehn Jahren einmal angefangen, dort hat sein Weg begonnen.
Aber nichts und niemand wird Hank Turgill abhalten, einen Haley einzusperren. Auch wenn in diesem Fall Angus Haley der Sohn des Mannes ist, dem Hank Turgill sein Amt und viele andere Dinge verdankt.
Hank Turgill ist unbestechlich und kennt nur eine Sache:
Das Gesetz.
Dies alles, denkt Angus Haley, habe ich gewußt. Und noch einige Dinge mehr. Ich habe gewußt, daß er mich niederschlagen würde, weil er weiß, daß ich zu gefährlich bin. Manchmal weiß man um die Dinge und nimmt sie hin wie Zahnschmerzen, oder einen kratzenden Hals. Hat der Bursche zugeschlagen, wie?
Er kann nicht verstehen, was drüben geredet wird, er kann nicht mal hören, zu wem die Stimmen da passen. Eine könnte Turgills sein, könnte.
Er wendet den Kopf, sieht durch seine nach links in eine andere Zelle.
Erst in diesem Augenblick zuckt er zusammen.
Nichts in diesem Jail von Alpine hat auf die Anwesenheit eines anderen Menschen schließen lassen.
Aber hier ist noch ein Mensch.
Und dieser Mensch ist seltsam ruhig.
Der Mann sitzt mit angezogenen Knien auf der Pritsche, hat die Hände um seine Knie geschlungen und sieht ihn an.
Es ist ein völlig ruhiger, forschender Blick. Der Mann bewegt sich überhaupt nicht, nicht einmal die Augen scheinen sich zu bewegen. Er sitzt da wie eine Puppe, die man in das Jail gebracht und auf eine Pritsche in der anderen Zelle gesetzt hat.
Der Mann ist nicht alt, er mag sechsundzwanzig, höchstens achtundzwanzig Jahre alt sein und trägt einen vielleicht zwei, drei Tage alten Stoppelbart. Sein Gesicht ist oval, ein fester und doch nicht zu harter Mund, braune dunkle Augen, starke Augenbrauen und eine gerade Nase. Er trägt ein altes Hemd, das auseinanderzufallen scheint, denn es ist mehrfach geflickt und seine ehedem graue Farbe, die man noch unter den Achselhöhlen und unter dem Kragenansatz erkennen kann, ist aus geblichen. Der Mann trägt eine Leinenhose, wie man sie bei jedem
Rancharbeiter findet, keine Stiefel, sondern derbe Schnürschuhe und hat den Hosenlatz vorn weit übereinandergeknöpft. Die Hose ist ihm also viel zu groß.
Er sieht ihn an, wie einen Mann, den er studieren will. Und er ist seltsam blaß, das fällt Angus Haley innerhalb von einer Minute auf. Entweder ist dieser Mann sehr lange krank gewesen oder er sitzt schon einige Zeit im Jail.
Dann plötzlich krümmt sich der Mann zusammen.
Er macht es auf eine seltsam schnelle, hastige Weise. Sein Oberkörper knickt ein, er preßt blitzschnell beide Hände an den Mund und krampft sich völlig zusammen.
Er hustet, die Hände fest vor den Mund gepreßt, in denen – weiß Gott woher – ein schmutziges Tuch aufgetaucht ist. Tränen sind plötzlich in seinen Augen, die grade noch groß, braun und seltsam leuchtend auf Angus geblickt haben.
Es dauert vielleicht eine halbe Minute, ehe sein Hustenanfall vorbei ist. Dann nimmt er das Tuch, wischt sich über den Mund und steckt es hastig ein, als wenn niemand etwas von dem Tuch sehen darf.
»Entschuldige«, sagt er dann leise mit einer angenehmen leisen Stimme, die Angus durch ihre Sanftheit erschrickt. »Hast du dich erschrocken, Angus?«
»Ja«, sagt Angus langsam. »Du hast sehr ruhig gesessen.«
»Ich habe dich beobachtet, schon eine halbe Stunde lang«, erwidert der Mann sanft. »So lange bist du hier drin. Es hat einigen Lärm bei deiner Einlieferung gegeben, Angus, aber Turgill ist nicht der Mann, der sich nicht Zuschauer und Neugierige vom Leib halten kann. Jetzt ist alles ruhig, sie sind fort. Hast du Schmerzen?«
»Ja«, sagt Angus leise. »Ziemliche. Er hat mich niedergeschlagen. Vielleicht hat er gewußt, daß ich ihn sonst überlistet hätte, weißt du. Wer bist du – was machst du hier?«
Der Mann sieht ihn an und lächelt. Dieses Lächeln kommt Angus irgendwie unwirklich vor. Er hat schrecklich viele Leute getroffen, der Angus Haley, aber niemand hat jemals so seltsam gelächelt wie dieser Mann.
»Du kannst Rual zu mir sagen, Angus.«
»Und sonst nichts, Rual?«
»Nein, sonst nichts«, murmelt der Mann und zuckt bedauernd die Schultern. »Sie nennen mich alle Rual, einige sagen auch, ich sei ›der Lächler‹, aber ich bin für dich Rual. Du hast nie von mir gehört, nicht wahr?«
»Nein, nie.«
»Das dachte ich schon, du bist sehr lange nicht zu Hause gewesen, siebeneinhalb Jahre, nicht wahr? Angus, ich glaube, jemand kommt jetzt, wir reden nachher weiter.«
Angus hört nichts, aber der Mann, der sich Rual nennt, blickt auf die Tür und sinkt nach hinten auf seine Pritsche. Er hat eine geschickte Art, sich hinzulegen, es ist mehr ein Rollen, mit dem er auf die Pritsche sinkt. Und einen Augenblick lang hat Angus das bestimmte Gefühl, daß dieser Mann dies Rollen schon viele hundert Tage geübt und ausgeführt haben muß.
Dann geht tatsächlich die Tür auf.
Angus Haley liegt still, er sieht auf die Tür und die beiden Männer. Aber hinter den beiden Männern, die durch die Tür treten, sieht er noch mehr.
Im Office ist noch ein Mann, neben dem Mann aber steht ein Mädchen. Einen Moment erinnert er sich an das Gesicht des Mädchens. Sie ist blond, trägt das Haar zu einem Knoten und erinnert an… Dann weiß er es, denn er hat Mark vor sich, Mark ist schon am Gitter. Und das Mädchen ist Jane Harfield, es gibt keinen Irrtum mehr. Sein Bruder hat Jane mitgenommen. Vielleicht hat Jane auch ihren Kopf durchgesetzt und ihn, den wilden Bravado, der immerhin der Bruder Mark Haleys ist, sehen wollen. Angus erinnert sich, daß Jane schon als Mädel eigenwillig war. Sie ist das einzige Kind der Harfields – es gibt viele eigenwillige und verzogene Einzelkinder.
Turgill hat die Arme verschränkt und lehnt sich an die Wand.
»Fünf Minuten«, sagt er, als wenn er es schon einmal gesagt hat. »Du hast gehört, nicht mehr, Mark.«
Mark sieht sich eine Sekunde scharf um. In seinem strengen, jetzt kühlen und völlig beherrschten Gesicht zuckt es kurz.
»Ich rede so lange ich will, verstanden? Und wenn ich aus El Paso den besten Anwalt holen muß, Hank, er wird ihn bekommen. Hallo, Angus!«
»Hallo«, sagt Angus kühl, knapp und sicher. »Was willst du, Mark.«
»Dir sagen, daß ich dir einen Anwalt besorge, er wird morgen hier sein. Diese Anklage ist lächerlich, denn Wagner hat zuerst geschossen, wie? Es gibt Zeugen dafür, daß er zuerst gefeuert hat. Der Anwalt wird dich herausholen.«
Angus verzieht keine Miene, aber er erkennt in dieser Minute, daß Mark sich entschieden hat. Es muß ihm unheimlich schwer geworden sein, für sich eine Entscheidung zu treffen, aber – er hat sie gefällt.
»Ich brauche keinen Anwalt, Mark.«
»Hör auf, jetzt rede ich. Du hörst auf, mit dem Kopf gegen die Wand zu laufen. Alles, was du brauchst, wirst du bekommen, Angus. Gewiß hat dein Partner mit der Schießerei angefangen, aber Wagner hat dich verwundet. Ich glaube, darin liegt nicht viel, vielleicht sogar ein Freispruch.«
»Du wirst jemanden fragen müssen, wenn du den Anwalt bezahlst«, sagt Angus trocken. »Zudem – ich habe gesagt, daß ich keinen Anwalt will. Kommt einer, dann redet er für die Katz. Du hast es nicht nötig, auch noch mit dem alten Mann Streit zu bekommen. Ich will das nicht.«
»Er hat damit nichts zu tun, ich bezahle es von meinem Geld.«
»Von deinem? Wie ich den alten Mann kenne, besitzt du gerade dein Pferd und das, was du am Leib trägst. Du hast keine Summe, die groß genug ist, um einen Anwalt zu bezahlen. Also, woher kommt das Geld?«
Einen Augenblick preßt Mark fest die Kiefer aufeinander. Er schweigt, doch da sagt das Mädchen es ist nun an der Tür:
»Von mir, Angus.«
Einen Moment lang ist Angus schockiert. Er sieht seinen Bruder an, dessen Gesicht jetzt wie eine Maske wirkt.
»Danke«, sagt er dann kühl. »Jane, ich bin es gewohnt, mir selbst zu helfen. Kein Haley würde jemals Geld annehmen, das er sich nicht selbst verdient hat. Es tut mir leid, ich brauche kein Geld, ich brauche auch keine Hilfe. Noch kann ich mir selbst helfen. Und dann gibt es eine Kleinigkeit, die hier niemand weiß. Ich habe Wagner nicht angeschossen.«
Das Mädchen ist bei seinen Worten bleich geworden. Angus weiß genau, daß er sie getroffen hat. Sie hat, vielleicht aus einer Laune heraus oder um Mark zu helfen, das Geld geben wollen. Sie fühlt sich in ihrem Stolz gekränkt.
Mark aber sieht ihn groß und durchbohrend an.
Hank Turgill tritt einen Schritt vor und blickt genauso bestürzt zu ihm hin wie Mark.
»Du hast…«, will Mark beginnen, aber da legt ihm Turgill die Hand auf den Arm und sagt hart:
»Sei still, ich frage. Angus, du behauptest, daß du Wagner nicht getroffen hast? Wer dann, kannst du mir das auch sagen?«
»Ich könnte es«, erwidert Angus. »Aber ich bin gewohnt, meine Dinge selbst zu ordnen. Ich sage dir nur, daß ich es nicht gewesen bin, der Wagner getroffen hat. Das muß dir genügen.«
»Das kann jeder behaupten«, antwortet Turgill schnappend. »Solange du keinen Beweis erbringst, Angus, muß ich dich hierbehalten. Wer ist es gewesen, wenn nicht du?«
Angus lehnt sich zurück, verschränkt die Arme unter dem Kopf und sieht zur Decke.
»Rede«, sagt Mark beschwörend. »Wenn es irgend etwas gibt, das dich entlasten kann, dann mußt du reden. Dieser Lanson ist weggelaufen, er kann also nicht geschossen haben.
Dort ist nur noch ein Mann gewesen, der gefeuert hat – du. Und du sagst, du bist es nicht gewesen, der Wagner getroffen hat. Angus, wer sonst?«
Angus wendet den Kopf und lächelt düster.
»Ich habe noch nie jemanden verraten«, sagt er. »Was immer meine Gründe zu schweigen sind, sie sind da. Stellt sich der Schütze, dann gut, wenn nicht, werde ich ihn herbringen und zwingen, auszusagen. Es ist meine Sache.«
»Donnerwetter«, knurrt Turgill bissig wie ein an der Kette liegender Hofhund. »Das erinnert mich verteufelt an die Reden eines Mannes, Angus. Wenn zwischen zwei Leuten Ähnlichkeit besteht, dann zwischen dir und jemandem, der nicht gerade erfreut ist, dich zum Sohn zu haben. Du bist genauso stur und verbohrt wie der Alte. Dies ist nicht deine Sache. Einen Mann zu suchen, der – und das geht doch wohl aus deinen Worten klar genug hervor – der auf Wagner absichtlich gefeuert hat, das ist Sache des Gesetzes. Wer ist der Mann?«
»Du fragst den Mond«, gibt Angus zurück und sieht das Zusammenzucken seines Bruders. »Ich sage dir, es ist meine Sache. Er stellt sich nicht freiwillig, fürchte ich, also werde ich ihn herbringen müssen. Es würde besser sein, du ließest mich heraus, mein Freund.«
»Das kann ich nicht, niemand weiß so gut wie du, daß ich das nicht kann. Wenn es stimmt, daß du anderthalb Jahre Marshal in drei Städten gewesen bist, dann mußt du das genau wissen, Angus. Ich habe hier eine Anklage gegen dich. Und solange die besteht, bleibst du im Jail. Es sei denn, daß dein Bruder einen Rechtsverdreher ausfindig macht, der dich mit tausend Tricks herausholt. Aber du willst keine Hilfe, wie?«
»Ich sage dir Narr nur, du sollst mich herauslassen. Tust du es nicht, dann kann ich dir nicht helfen.«
»Ist das eine Drohung?« fragt Turgill scharf. »Dieses Jail ist sicher – und befreien wird dich kein Mensch. Der erste Mann, der das versucht, findet sich beim Arzt wieder, wenn er noch dorthin kommt.«
»Hör mal, Hank«, mischt sich Mark ein. »Ich glaube ihm jedes Wort. Dieser Bursche ist so stur wie sein Vater. Er gleicht ihm sehr, das muß ich immer wieder erkennen. Laß ihm eine Chance, Mark. Ich werde einen Anwalt besorgen, ob es dir paßt oder nicht, Angus.«
»Er wird mit mir so wenig reden können wie mit einem Marsbewohner«, gibt Angus kühl zurück. »Vielleicht ist es besser, wenn ihr jetzt geht, ihr verschwendet nur eure Zeit. Vielen Dank, Jane, aber behalte dein Geld. Es gehört den Harfields und nicht einem Haley. Laßt mich in Ruhe.«
»Bruder…«, sagt Mark heiser.
»Das kannst du dir sparen«, unterbricht Angus. »Wenn dich jemand von der Ranch gejagt hätte, würde ich gleich mitgegangen sein. Und das ist nichts als die Wahrheit. In meinen Augen hast du versagt. Komm jetzt nicht und sage, daß du mir helfen willst, dazu ist es zu spät. Habe ich mich in eine Sache gebracht, dann bringe ich mich auch wieder heraus, ohne Hilfe von dir oder einem anderen Haley. Das ist alles.«
Mark tritt dicht an das Gitter und flucht leise. Turgill sagt grimmig:
»Immer, wenn er den Mund aufmacht, dann erinnert er mich an den alten Markus John Haley. Du kannst genausogut mit einem Stein reden, Mark, mehr Erfolg hast du hier auch nicht. Kommt raus, er kann über seinen Dickschädel lange genug nachdenken. Angus, du bist ein sturer Hund.«
Angus gibt keine Antwort. Er hört sie hinausgehen, der Schlüssel rasselt im Schloß.
Er liegt still, die Arme unter dem Nacken verschränkt, und den Blick auf die Decke gerichtet.
Mark will ihm helfen, aber auf eine Art, die unannehmbar ist. Mark mag ein guter und aufrechter Mann sein, jedoch ist er in Wahrheit seinem Vater nicht gewachsen, vielleicht ist das niemand hier, das dürfte der Wahrheit sehr nahe kommen.
Es würde mir, denkt Angus, verteufelt wenig ausmachen, zu Old Mark zu gehen und ihn um Geld zu bitten, sollte ich an Marks Stelle sein.
Aber Mark kneift, er will dem Streit zwar nicht ausweichen, aber er läßt ihn auf sich zukommen, denn der alte Markus John Haley wird mit tödlicher Sicherheit davon erfahren, daß sein ältester Sohn Geld von seiner zukünftigen Frau angenommen hat. Dann wird er wild werden und Mark zur Rede stellen. Genau das ist Marks Art, er wehrt sich aus der Verteidigung heraus, er läßt seinen Gegner kommen – in diesem Fall seinen eigenen Vater. Das ist schon damals so gewesen, als er Jim Marton herausgefordert hat. Und würde Marton nicht unfair mit dem Revolver geschlagen haben – sicher hätte Mark ihn verprügelt. Dieser Revolver hat Angus damals erregt, daß er eingegriffen hat, dabei war nicht mal sicher, ob er nicht eine Kugel erwischen würde, er hat aus seinem Impuls heraus gehandelt, dem Bruder zu helfen, und ein Unrecht zu bekämpfen. Und darum ist er heute ein Mann ohne Heimat.
In seine Gedanken hinein kommt auf einmal die sanfte, leise Stimme des Mannes, den er beinahe vergessen hat.
»Jeder Mann in diesem Land«, sagt der seltsame Rual träge, »kennt euch Haleys. Du bist wohl nicht allzu erfreut, daß sie jetzt etwas von dir wollen, wie? Ich weiß, damals hat dich dein Vater weggejagt.«
»Ja«, sagt Angus einsilbig. »Ich komme hier heraus, ich weiß nicht wie, aber – ich glaube, ich habe noch Freunde.«
»Und was wirst du dann tun, Angus?«
»Einen Mann herbringen«, sagt Angus knapp. »Wahrscheinlich werden sie mich dann wegen des Ausbruches einlochen, aber mich einen schießwütigen Narren nennen zu lassen, der andere anschießt, das dulde ich nicht. Ich gehöre nicht mehr zu der Haley-Sippe, daran wird man sich gewöhnen müssen.«
»Du bist sehr schnell, sagt man«, murmelt Rual leise. »Es gibt, so sagt man, niemanden hier, der so schießen kann wie du, Angus. Du suchst einen Mann, wie?«
»Ja – und ich werde ihn finden.«
»Die letzte Spur ist drüben.«
»Drüben«, sagt Rual und hebt heftig den Kopf an. Er weiß natürlich, daß Mexiko gemeint ist. »In welcher Ecke?«
»Ungefähr Coyame, Rual.«
Rual schweigt mindestens drei Minuten. Dann aber sagt er vorsichtig:
»Wenn du hinauskönntest, ohne daß du irgend etwas tun mußt, würdest du gehen?«
»Dumme Frage«, erwidert Angus trocken. »Natürlich würde ich die erste Gelegenheit benutzen, um verschwinden zu können. Ich muß den Mann haben. Verstehe mich richtig, ich will niemals wieder auf die Haley-Ranch, dort bekommen mich keine zehn Pferde hin. Aber ich will beweisen, daß ich nichts mit dem Schuß auf Wagner zu tun habe, das ist der einzige Grund, weshalb ich verschwinden will. Wie kommst du auf den Gedanken, daß ich hier herauskommen könnte?«
»Manchmal«, sagt Rual sanft. »Manchmal schickt der Himmel einen Mann, den man brauchen kann. Ich muß auch in die Gegend, Angus, in die du willst, aber ich bin nicht sehr gesund. Einem Mann, der mich begleitet, würde ich – fünfhundert Dollar zahlen.«
»Fünf…«
Angus Haley liegt jäh auf der Seite und starrt den lächelnden Rual groß an.
»Dann ist es nicht ungefährlich, dich zu begleiten, wie?«
»Du sagst es, es kann sehr gefährlich sein. Und ich bin ein schlechter Mann mit dem Revolver und dem Gewehr. Wie gesagt – fünfhundert Dollar bei Antritt der – na, sagen wir – Reise.«
»Hast du das Geld denn?«
»Es liegt im Office im Schrank, sogar noch etwas mehr. Wenn du mich bis dreißig Meilen nach Mexiko begleitest, dann bekommst du diese fünfhundert Dollar sofort.«
Angus sieht ihn aufmerksam und verwundert an. Dieser sanfte, ruhige Mann, der diese abgetragenen Sachen trägt, hat derart viel Geld? Das ist doch beinahe nicht möglich.
»Hör mal, hast du auch kein Fieber, Rual?«
»Ich glaube nicht«, sagt Rual lächelnd. »Ich bin nicht sehr gesund, aber ich weiß genau, was ich sage. Ich kann hier zu jeder Zeit raus, aber draußen bin ich wahrscheinlich weniger sicher als hier drinnen. Jemand möchte mich haben. Und hat er mich, dann bringt er mich mit Sicherheit um.«
Er spricht davon so ruhig, als wenn er sich über das Wetter unterhält. Dabei aber hat Angus das bestimmte Gefühl, daß Rual sich seiner Worte vollkommen sicher ist.
»Moment«, sagt er etwas rauher. »Um was geht es hier? Hast du etwas verbrochen, Mann, daß man dich umbringen will?«
Rual antwortet: »Jemand will etwas haben, das nur ich weiß und besitze. Er würde dafür nicht nur einen, sondern mehrere Morde begehen. Stelle keine Fragen nach dem, was es ist. Ich biete dir fünfhundert Dollar in gutem Geld. Dafür hast du nicht mehr zu tun, als jeden Mann von mir fernzuhalten, der mich umbringen will. Es können mehrere Männer sein, die Möglichkeit ist wahrscheinlicher als die, daß du es nur mit einem Gegner zu tun bekommst. Ich werde dich vielleicht zehn Tage brauchen, nicht mehr. Fünfhundert Dollar, Angus!«
»Das heißt, ich müßte jemanden erschießen – oder anschießen?« fragt Angus heiser. »Ich soll dich schützen. Und die Leute, vor denen ich dich schützen soll – sind das ehrliche Leute?«
Rual sieht ihn ganz offen an, dann sagt er spröde:
»Es sind Banditen, Mörder und Schurken. Du könntest für jeden, der von dir erschossen wird, sogar eine Prämie bekommen. Ich lüge nicht, es ist die Wahrheit. Wenn du den ersten dieser Schurken siehst, dann wirst du wissen, daß ich nicht gelogen habe. Glaubst du aber, daß ich gelogen habe, dann kannst du mich allein lassen. Ist das ein faires Angebot, mein Freund?«
Angus nickt, schweigt aber, und überlegt dafür. Endlich sagt er leise:
»Du hast also etwas, was anderen einen Mord wert ist. Hast du keine Angst, daß ich neugierig werden kann und dich vielleicht auch – na?«
Rual lächelt seltsam dünn.
»Du würdest mich nicht umbringen«, sagt er sanft. »Ich bin ganz sicher, daß du das niemals versuchen würdest, auch wenn du die Geschichte ganz kennst. Ich kenne Menschen, mein Freund, ich glaube, ich kenne dich. In dir steckt mehr von einem Haley, als du wahrhaben willst. Du bist nicht der Mann, der irgend jemanden aus niederen Beweggründen erschießt. Und hier geht es nur um derartige Gründe. Also, was ist, würdest du mit mir kommen?«
»Ja«, sagt Angus Haley trocken. »Aber wie kommst du heraus? Bringst du dabei jemanden um?«
»Das ist ein Risiko«, murmelt Rual. »Aber ich denke nicht, daß jemand sterben muß. Obwohl ich, um an mein Ziel zu kommen, auch jemanden umbringen würde. Nein, ich glaube, ich komme so frei. Wenn eine Stunde vergangen ist – ruhig, jemand kommt!«
Er muß enorm scharfe Ohren haben, denn Angus hört wieder nichts.
Er wird erst aufmerksam, als die Tür aufgeht und jemand hereinkommt, dem gleich zwei Männer folgen. Einer ist Turgill, der andere ist groß, blond, trägt einen Schnurrbart und hat den Hut schief auf dem Kopf.
Neben Angus hustet Rual tief und heiser. Der erste Mann bleibt stehen, wirft einen Blick auf Rual und sagt:
»Hank, hast du den Doc für ihn geholt? Er ist krank, ich möchte fast sagen, er ist ernstlich krank.«
»Ich habe ihn geholt«, erwidert Turgill knapp. »Der Doc gibt ihm kaum noch eine Chance. Er sagt, wenn er noch lange zu leben hat, dann ein halbes Jahr. Sie werden ihn bald holen kommen.«
»Na, Rual?« fragt der Mann mit dem schiefen Hut träge, als Ruals Husten verstummt. »Wohin hast du eigentlich gewollt, mein Freund? Willst du es noch immer nicht sagen?«
»Ich bringe niemanden um, ich kann nicht gut schießen, Captain, das weiß man doch. Mit der Sache habe ich nichts zu tun, ich schwöre es.«
»Aber du mußt wissen, warum sich zwei Mann gegenseitig umbringen«, sagt Captain Kirby Norman scharf. »Versuche nicht, mir zu erzählen, daß sie sich, um ihre Revolver auszuprobieren, gegenseitig erschossen haben. Es gibt einen sehr guten Grund dafür – und du weißt ihn. Wir bekommen es schon noch heraus.«
»Hoffentlich«, sagt Rual sehr freundlich. »Hoffentlich, Captain.«
»Mich trickst du nicht, Mann. He, Angus – komm hoch!«
»He, Kirby«, sagt Angus trocken. »Ich liege aber ganz gut. Feines Lokal hier!«
»Du bist ein Narr, Mann. Wer ist der Kerl, der auf Wagner geschossen hat? Sage seinen Namen, ich schaffe ihn dir her. Aber…«
»Eine kleine Gegenleistung, wie?«
»Ja«, sagt Kirby augenzwinkernd, und mit einem Versuch zu grinsen. »Das ist Niemann, einer meiner Leute. – He, Niemann, tritt mal vor und mach die Augen auf. Ist das der Mann, den du an der Furt gesehen haben willst?«
Niemann, ein blonder Mann mit großen Händen und breiten Schultern, tritt vor, starrt den liegenden Angus an und hebt langsam und zweifelnd die Schultern.
»Ich – ich weiß nicht genau, Captain.«
»Was heißt das, du weißt nicht genau? Ist er es oder ist er es nicht?«
»Auf dem Pferd hat es so ausgesehen, als wenn er das ist, aber jetzt – ich bin nicht mehr sicher.«
»Da haben wir es«, sagt Norman heiser. »Erst bringst du die Geschichte auf, dann bist du nicht mehr sicher. Verschwinde, ich brauche dich nicht mehr. Angus, er will dich angeblich bei einigen Viehdieben gesehen haben. Wo bist du vorgestern um diese Zeit gewesen?«
»Ich denke, das geht nur mich etwas an, Kirby, wie?«
»Na schön, wenn du es nicht sagen willst – deine Sache. Angus, jetzt hör mir mal genau zu: Ich brauche einen Mann wie dich an der Grenze. Du kannst Scout werden, aber auch bei uns eintreten. Das ist ein Angebot, hörst du?«
»Ich höre und sage nur nein!«
»Du bist ja verrückt, Mensch! Wir beide kennen uns lange genug, aber in dieser Gegend muß ein Mann groß geworden sein, um sich auszukennen. Angus, drüben leben mindestens zweihundert Banditen. Sie kommen über die Grenze, wann immer es ihnen einfällt. Sie berauben Postkutschen, fallen über Farmen und Ranches her, stellen dort die schlimmsten Dinge an und die Frauen…«
»Ich weiß es«, erwidert Angus hart. »Laß dir nur gesagt sein, daß du den Mann, den ich suche, niemals bekommen wirst. Das muß ich allein tun.«
»Mensch, du kommst hier niemals heraus, so lange eine Anklage gegen dich läuft, Angus. Erst wenn deine Unschuld bewiesen ist, läßt man dich frei. Siehst du das nicht ein, dann kann ich dir nicht helfen. Sage mir, wo ich den Burschen finde, den du haben willst, dann hole ich ihn.«
Er kann es nicht, denkt Angus bitter. Dies ist eine Chance für mich, aber unmöglich für ihn weit nach Mexiko hineinzureiten und Lanson herauszuholen. Weiß der Teufel, mit wem Syd drüben reitet. Ich bringe Kirby höchstens den Tod, schicke ich ihn auf die Suche.«
»Ich sage dir, es ist meine Sache.«
»Verdammter, sturer Narr, der du bist. Ich brauche dich, dies ist ein ehrenvoller Posten, Angus, den nur ausgesuchte Männer erhalten. Siehst du nicht deine Chance?«
»Kirby, du redest umsonst.«
»Du müßtest in der Hölle im heißesten Keller sitzen«, sagt Kirby Norman wütend. »Ich komme wieder, jeden Tag, komme ich wieder und frage dich erneut. Denke darüber nach, Angus, es lohnt sich. So ein sturer Bulle, wie du einer bist, den findet man nie wieder. Hast du schlechte Träume in der Nacht, dann gönne ich sie dir.«
Er geht hinaus, die Tür fällt wieder zu, und Rual sagt nach einiger Zeit:
»Jetzt sind sie weg, Angus. Ein prächtiges Angebot, das du dir überlegen solltest. Vielleicht ist es sogar ganz gut, wenn du mit mir kommst, du lernst dann einige Dinge kennen, die in diesen siebeneinhalb Jahren deiner Abwesenheit geschehen sind. Am Ende wirst du vielleicht überzeugt sein, daß du dem Captain helfen mußt. Er ist ein guter Mann, aber nicht sehr klug.«
»Na, ich weiß nicht…«
»Für mich ist er es nicht«, sagt Rual trocken. »Du hast nun gehört, daß ich krank bin, sogar sehr krank. Und darauf baue ich meinen Plan. Der Doc hat Turgill gesagt, daß er mir, wenn ich einen Hustenanfall bekomme, Wasser bringen soll. Ich werde einen Anfall bekommen, Turgill kommt herein und…«
Er öffnet seine Hose und greift in eine der Nähte hinein. Stoff knirscht, als Rual reißt. Und dann zieht er eine dünne, lange und gedrehte Schnur aus dem rechten Hosenbein.
»Die haben sie nicht gefunden, als sie mich durchsucht haben«, sagt er leise und lächelt. »Ich habe sie in die Naht der Hose eingenäht. Für sie hat es sich nicht wie eine Naht angefühlt. Mit dieser Schnur werde ich Turgill überraschen.«
Angus fragt heiser: »Mann, was willst du mit dem kleinen Ende Schnur denn anfangen?«
Rual lächelt. Er nimmt die Schnur in beide Hände. Und dann sieht Angus seine auf einem grell funkelnden und gar nicht mehr sanften Augen. Dieser Mann erscheint nicht mehr so schwächlich, so krank und so matt. Er wirkt jetzt hart wie Federstahl.
»Dies«, sagt er – und die Schnur pfeift blitzschnell durch die Luft. »Wir werden in einer Stunde frei sein, ich sage es dir, mein Freund. Für den Augenblick habe ich Kraft genug. In einer Stunde bist du draußen.«
In einer Stunde bist du draußen! In einer Stunde.
*
Im ersten Augenblick glaubt Angus, genau wie es jeder andere glauben würde, daß der Mann beinahe stirbt.
Es ist ein furchtbarer und niederschmetternder Anblick, denn Rual windet sich am Boden. Sein Husten kommt stoßartig, hohl, dann wieder pfeifend, schrill und hoch aus seiner Brust.
Er ist rot angelaufen, sein Körper zuckt, der Mann windet sich in schwerster Atemnot am Boden.
Und jetzt sieht Angus das, was er vorher nicht gesehen hat.
Er sieht Blut und er fragt sich einen Augenblick, ob Rual sich darüber klar ist, daß er dabei sterben kann. Mit einem Schlag erkennt Angus Haley die Krankheit, die Rual hat.
Der arme Kerl – und in diesem Augenblick beginnt er ihn zu bedauern – hat es an der Lunge. Und dagegen gibt es noch kein Mittel. Ruals Husten schallt durch das Jail, er wird auch im Office zu hören sein.
Und er ist dort zu hören.
Während Angus noch denkt, daß Rual mit seinem Leben spielt, um den verzweifelten Versuch der Flucht zu unternehmen, hebt drüben Sheriff Hank Turgill den Kopf.
Turgill hört das Husten und steht auf. Einen Augenblick steht der Sheriff ganz still. Und dann sagt er heiser:
»Viereinhalb Jahre hat er schon gesessen. Ich möchte wissen, warum er geflohen ist, denn er und die beiden anderen Männer hatten nur noch ein halbes Jahr vor sich, aber sie sind ausgebrochen und geflohen. Er wird sterben, ob er gewußt hat, daß es zu Ende geht?«
In dieser Sekunde glaubt Turgill, daß er die Beweggründe des Mannes kennt, den sie den »Lächler« nennen und der bis jetzt fast jeden Mann ausgetrickst hat. Er war nie ein kräftiger Mann, auch als er noch nicht im Jail gesessen hat. Schießen konnte er auch nie. Im Gegenteil, er hat die Gewalt als abscheuliches und brutales Mittel immer abgelehnt. Vielleicht war er immer nur der Kopf der Bande. Und wenn man von einem Kopf in jenem Rudel von Bravados redet, das der »Lächler« einmal befehligt hat, dann müßte man sagen, er ist ›der Kopf« gewesen. Sie haben ihn nie erwischen können. Ganze anderthalb Jahre lang ist er mal hier und mal da aufgetaucht. Und immer hat er völlig ohne Blutvergießen gearbeitet. Das ist bis zu jenem Tag zwischen El Paso und Van Horn gutgegangen. An diesem Tag hat die Transportgesellschaft von Süd-Texas der Kutsche einen Scharfschützen mitgegeben. Und dieser Mann hat einen Mensch getroffen, um dann selbst getroffen zu werden.
Ob diese Tat, die Verwundung eines Scharfschützen, der für den »Lächler«, das Ende seiner Laufbahn war, niemand weiß es. Man weiß nur, daß man ihn erwischt hat. Und es sah so aus, als wenn er sich hätte fangen lassen. Ihn und zwei Mann hat man erwischt und ins Jail gesteckt.
Und dann sind sie ausgebrochen, ein halbes Jahr vor der Freilassung.
Warum, denkt Hank Turgill, warum nur?
Er glaubt die Antwort zu wissen. Vielleicht hat der »Lächler« davon erfahren, daß sein Lebenslicht in einem halben Jahr erlöschen wird. Und darum ist er ausgebrochen, darum?
Einmal noch die Freiheit in vollen Zügen atmen, wie?
Ich muß etwas tun, denkt Turgill, der arme Mann hört nicht auf zu husten. Wieder so ein Anfall. Immer gegen Mitternacht. Vorgestern, gestern… heute… immer gegen Mitternacht.
Er geht zur Tür, schließt auf und sieht hinein. Er ist ein vorsichtiger und umsichtiger Mann, denn immerhin ist Angus Haley im Jail. Und Angus hat gedroht, daß er ausbrechen will.
Turgill sieht zuerst auf die Zelle von Angus, aber Angus kauert nur auf der Pritsche und starrt zu dem »Lächler« hin.
Die Tür, denkt Turgill! Geschlossen!
Die Tür ist zu, aber der Lächler zuckt im Krampf am Boden. Vielleicht will Turgill gar nicht so rauh sein, vielleicht sagt er es nur, weil ihm die Qual dieses Mannes, dessen Lebensflamme schon klein geworden ist, irgendwie erschüttert.
»Mensch, Rual«, sagt er leise. »Du kannst einen wirklich den allerletzten Nerv kosten, Mann. Daß sie dich ausgerechnet bei mir eingeliefert haben. Was ich wohl mit dir anfangen soll, was? Na gut, warte, ich hole Wasser.«
Er dreht sich um, er verdammt die Tatsache, daß der »Lächler« von der Pritsche gefallen ist und nicht mehr die Kraft hat, bis an das Gitter zu kriechen. Der Krampf hat den Lungenschwindsüchtigen wieder auf der Pritsche überrascht. Und im Krampf ist er herabgefallen.
Turgill dreht sich um, holt einen Becher mit Wasser, den er extra für diesen Mann angeschafft hat und den er dann wegwerfen wird, sobald der Mann aus dem Jail ist.
Dann schließt er die Zellentür auf und sieht den zuckenden Körper des Mannes.
»Na gut, ich helfe dir ja schon«, sagt er mürrisch. »Da, komm her, komm hoch.«
Er stellt den Becher hin, hebt den Mann unter den Armen hoch und versucht, ihn auf die Pritsche zu legen.
Der Körper Ruals krampft sich zusammen, die Beine und die Hände zucken und dann stößt der eine Fuß gegen den Becher.
Drüben sitzt Angus Haley und starrt auf den Fuß, der den Becher trifft und umstürzen läßt.
Am Boden eine Lache – und in Angus Haleys Kopf jäh der Gedanke: Das ist es, so will er es machen. Mein Gott, ist er schlau, ist der schlau. Er hat es mir nicht sagen wollen, er hat gesagt, daß es seine Sache ist und ich etwas lernen kann, wenn ich will.
Der »Lächler« hustet und ist fast blau angelaufen, als Turgill ihn auf die Pritsche legt.
»Der Becher, Himmel, was bist du für ein Narr?« sagt Turgill schimpfend. »Jetzt muß ich wahrhaft noch einmal Wasser holen.«
Turgill starrt auch auf die Lache am Boden. Nun muß er noch mal Wasser holen. Er bückt sich, der »Lächler« aber hustet.
Und dann fahren die Hände des »Lächlers« so blitzartig unter die Decke auf der Pritsche, daß es wie ein Zucken erscheint. Im nächsten Augenblick kommen die Hände hervor und mit ihnen die Schnur.
Er hustet immer noch, aber er macht plötzlich einen Sprung und hat beide Arme hochgerissen.
Die Schnur, denkt Angus Haley entsetzt – die Schnur, mein Gott.
Die Schnur pfeift einmal, und Turgill hebt erschrocken den Kopf.
Dann keucht er und greift mit den Händen hoch.
Der Revolver, denkt Turgill. Ich muß den Revolver zu fassen kriegen. Er wirft sich nach vorn, er fällt zu Boden, und will an seine Hüfte greifen, den Dienstrevolver nehmen, aber er kriegt keine Luft!
Diesen mageren, schwächlichen Kerl muß er doch abschütteln können, er muß ihn abschütteln.
Der »Lächler« hat die Enden der Schnur übereinandergerissen und die Hand gedreht. Seine linke Hand hält die Schnur, und die rechte Hand schnellt nach unten.
In dieser Sekunde sind all jene verlorenen Kräfte noch einmal entflammt. Er ist schnell, er ist zäh wie eine Katze, und so flink. Er kauert auf dem Mann und weiß, daß er schnell sein muß, denn lange kann er ihn nicht halten. Er muß immer noch husten, doch die rechte Hand kommt jetzt und reißt den Dienstrevolver des Sheriffs mit einem Ruck aus dem Halfter.
Nebenan aber sitzt ein Mann auf der Pritsche und sieht ängstlich zu.
Es ist Angus, als wenn ihm eine Faust die Kehle zupreßt und sein Körper erstarrt ist. Dieser kleine, schwächliche Mann mit dem sanften Lächeln und den höflichen Reden…
Der Revolver…