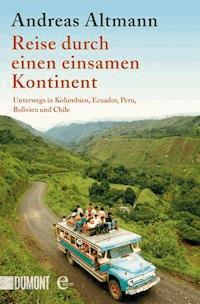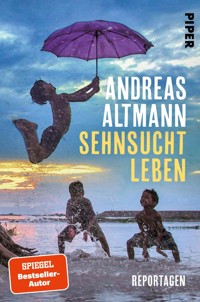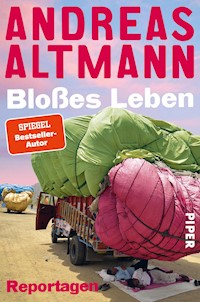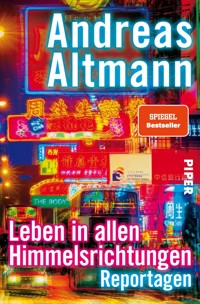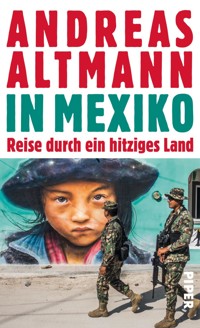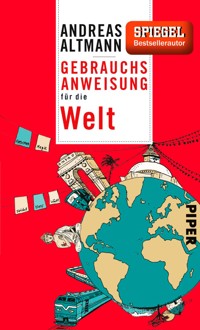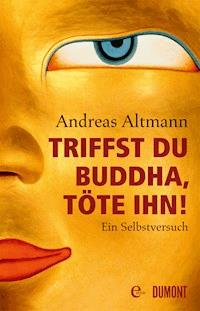9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von Bettlern und Businessmen, Heiligen und Huren Die Grundregel jedes guten Reporters lautet: Nichts schon wissen, alles vor Ort erfahren. Andreas Altmann hat sich daran gehalten. Er hat sich in Bombay in den Zug gesetzt und ist einfach drauflos gefahren. Mit dem festen Vorsatz, Indien mit allen Sinnen in sich aufzunehmen. Altmann sucht den Menschen und er findet ihn, in Slums, Bordellmeilen, Hindu-Heiligtümern und in der drangvollen Enge der Indian Railways. «Altmann reist nicht stellvertretend für Abenteuerarme. Er berichtet, um zu verführen, will ‹den Leser mit Sehnsucht vergiften›. Schon passiert.» (Hamburger Morgenpost) «Geradezu glücklich dürften Daheimgebliebene sein, wenn sie die Geschichten des Reisejournalisten Andreas Altmann lesen.» (NDR)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Andreas Altmann
Notbremse nicht zu früh ziehen!
Mit dem Zug durch Indien
Über dieses Buch
Von Bettlern und Businessmen, Heiligen und Huren
Die Grundregel jedes guten Reporters lautet: Nichts schon wissen, alles vor Ort erfahren. Andreas Altmann hat sich daran gehalten. Er hat sich in Bombay in den Zug gesetzt und ist einfach drauflosgefahren. Mit dem festen Vorsatz, Indien mit allen Sinnen in sich aufzunehmen. Altmann sucht den Menschen und er findet ihn, in Slums, Bordellmeilen, Hindu-Heiligtümern und in der drangvollen Enge der Indian Railways.
«Altmann reist nicht stellvertretend für Abenteuerarme. Er berichtet, um zu verführen, will ‹den Leser mit Sehnsucht vergiften›. Schon passiert.» (Hamburger Morgenpost)
«Geradezu glücklich dürften Daheimgebliebene sein, wenn sie die Geschichten des Reisejournalisten Andreas Altmann lesen.» (NDR)
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Oktober 2009
Copyright © 2003 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung any.way, Andreas Pufal
Foto Bildagentur Schapowalow/Allantide
Autorenfoto von Karin Lange
Karte von Peter Palm, Berlin
ISBN 978-3-644-40391-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für die «ACH», die umtriebige Tausendfüßlerin.
Für Josef W., der mir bisweilen das Leben rettete.
Bert Brecht «Alles übergab ich dem Staunen, selbst das Vertrauteste.»
Al Pacino «Ich verlasse mich nur noch auf meinen Enthusiasmus.»
Paul Morand «Wenn ich tot bin, macht aus meiner Haut einen Koffer.»
In zehntausend Meter Höhe, mitten im Himmel über der saudi-arabischen Wüste, erzählt mir Mister Chatterjee eine Geschichte. Wir sitzen im Flugzeug nach Bombay, und minutenlang hat der elegante Mensch neben mir mit geschlossenen Augen dagesessen und gelächelt. Ich will auch lächeln. Eine lange Reise liegt vor mir, Leichtigkeit wäre hochwillkommen. Um mich zu wappnen gegen die schwerwiegenden Gedanken, die Indien in jedem provoziert.
Sobald Mister Chatterjee die Augen öffnet, muss er Auskunft geben. Woher kam der selige Ausdruck auf seinem Gesicht? Sanft dreht der Inder den Kopf und erzählt, an was er gerade dachte: Ein chinesischer Bauer hatte gehörigen Stress. Er war arm und lebte mit drei anderen armen Schluckern in einem Raum. Der Bauer war arglos und ruhig, die drei zänkisch und laut. Draußen vor der Tür streunten Hunde, Hühner und Schweine, auch sie zankten und lärmten. Viel zu selten war dem Bauern eine stille halbe Stunde zum Meditieren vergönnt. So machte sich Lu auf den Weg zu seinem Zen-Meister, um einen Ausweg zu finden.
Der Meister hörte die Klagen und sagte: «Das scheint ein eher einfaches Problem, ich denke, ich kann dir helfen: Geh zurück in dein Dorf und lade die Hunde, Hühner und Schweine in dein Zimmer ein. Verbringe eine Woche mit ihnen, dann komme wieder.»
Lu war perplex, aber er tat, wie ihm vom Meister vorgeschlagen. Nach einer Woche kam er in einem jämmerlichen Zustand zurück, die Kleider zerrissen, sein Körper stinkend, rot und schlaflos die Augen. Unter Tränen berichtete er: «Die Erfahrung war schlimmer als die Hölle. Ich weiß nicht, ob ich das verdient habe.» Der Meister antwortete gelassen: «Alles wird sich nun regeln. Geh zurück in dein Dorf und lebe wie zuvor, ohne Tiere. Nach sieben Tagen berichte, was passiert ist.»
Ein weiteres Mal tat der Bauer, was der Meister vorschlug. Aber als er nach einer Woche erneut wiederkam, leuchtete sein Gesicht. Mit strahlenden Augen erzählte er dem Mönch: «Nie zuvor in meinem Leben war es so friedlich. Nur meine drei Freunde und ich, und keine Tiere im Raum. Kein Grunzen, kein Gackern, kein Schnattern, kein Dreck, kein Gestank. Wir alle schliefen ausgezeichnet, und die Tage über war ich zufrieden und voller Freude.»
Dafür umarme ich Chatterjee. Die Story wird mich nähren. Damit ich nicht als nörgelnder Empörer über das Land reise. Damit ich nicht die Freuden aus den Augen verliere, die Indien nur denen schenkt, die es lieben.
Mumbai ist der neue Name für die größte Stadt Indiens. Anflug über die Slums. Ich sehe ein Kind nach oben winken. Was denkt der Junge wohl? Dass Götter herabschweben und ihn abholen? Mich holt Shiva ab. Ich habe ihn nicht bestellt, aber er ist der Schnellste, der am Ausgang auf mich zuspringt und zu seinem Taxi entführt. Shiva muss eine Wiedergeburt des berühmtesten indischen Gottes sein. Beide haben denselben Namen und eine ähnliche Lust, auf sich aufmerksam zu machen. Mit Vollgas fährt Shiva auf Adheri los, einen Vorort. Vielleicht ist die Höchstgeschwindigkeit nur Ausdruck seiner Enttäuschung, weil ich nicht in die Stadt will, nur zum nächsten Bahnhof. Sofort fällt mir wieder ein, dass jeder Fremde stolz ist, der dieses Land bei lebendigem Leib übersteht. Unversehrt von allen öffentlichen und privaten Vehikeln, die auf ihn zuschießen. Überleben als Ausdruck von Glück und Zeichen von Achtsamkeit. Jedes Jahr sterben knapp eine Million Menschen im Straßenverkehr, weltweit. Indien liefert unverdrossen seinen Anteil an Leichen.
Vom ersten Tag an will ich mit der Eisenbahn reisen. Die produziert auch ein paar hundert Tote und ein paar tausend Verletzte. Aber sie gilt als romantisch, als Hort seltsamster Überraschungen und Garant jener ewigen Wahrheit, dass immer der auf der Strecke bleibt, der Indien aufräumen und renovieren will. Jeder Zugpassagier muss wissen, auf was er sich einlässt. Sich beschweren? Sich bemitleiden? Nichts wäre komischer. Ich will es machen wie Lu.
Ich bin zu früh. Am Zeitungskiosk in Adheri kaufe ich «Trains at a glance», einen Fahrplan. Der witzige Teil steht hinten. Hier entdeckt der Leser eine «Charter», Hinweise auf die Rechte und Pflichten aller Reisenden. Am lustigsten die Informationen über «Entschädigungen». Indian Railways unterscheidet zwischen «Zugunglücken» und «unglücklichen Vorfällen». Das wären terroristische Aktionen, Schießereien («shootouts») und Krawalle. Wer sie als Krüppel überlebt, bekommt umgerechnet 8000 Euro, wer nur leicht verletzt wird, kann mit zehn Euro rechnen. Ich beschließe, unverkrüppelt und unverwundet davonzukommen.
Alle fünf Minuten fährt ein Zug ein, Frauen und Männer auf dem Weg zu ihrem Arbeitsplatz in Mumbai. Ich versuche zweimal einzudringen, vergeblich, alle Türen sind bereits von der hiesigen Bevölkerungsexplosion verstopft. Beim dritten Anlauf habe ich Glück. Ich sehe einen Waggon vorbeirauschen, an dessen Ende «Handicapped-Compartment» steht. Das ist feines Indien-Englisch und soll auf kein behindertes Abteil verweisen, sondern auf ein Coupé, das für Versehrte reserviert ist. Unverzüglich humple ich drauflos, der Rucksack verstärkt die Mühsal. Die anwesenden Krücken-Besitzer lächeln scheu und machen Platz. Ich weiß nicht, ob sie scheu lächeln, weil sie das Spiel durchschauen, oder aus Überraschung darüber, dass auch Weiße hinken und leiden. Aus Dankbarkeit erfinde ich die Geschichte von meiner Ex-Frau, die versuchte, mich mit ihrem BMW zu überrollen. Deshalb das steife Bein. Storys von wahnsinnig gewordenen Verwandten kommen in Indien gut an. Keine andere Institution ist in diesem Land für mehr Glück und Desaster verantwortlich als die Familie.
In Indien lüge ich nicht, hier phantasiere ich, mache es nicht anders als seine Einwohner. Die Wirklichkeit interessiert sie nur am Rande, sie wollen Märchen, Gleichnisse, Parabeln, die viel wahrer sind als die nackten Tatsachen. Wie das Märchen vom Bauern Lu, seinem Unglück und seiner Wiederauferstehung. Zudem ist mein Beitrag der Auslöser für einen freundlichen Gedankenaustausch. Jetzt erzählen die anderen, was zu ihrer Verletzung führte. Am dramatischsten klingt die Geschichte des jungen Manoj. Er arbeitete als Maurer. Bis er samt Bambusgerüst umfiel. Nach hinten, im 45-Grad-Winkel, fünfzehn Meter lang. Immerhin auf einen Haufen Sand. Seitdem wackeln die Hüften.
Eine knappe Stunde dauert die Fahrt, irgendwann Stille, irgendwann fragt Mister Dasgupta, der seinen rechten Arm im letzten Krieg gegen Pakistan verlor: «Sind Sie Deutscher?» Da ich mich vor solchen Fragen grundsätzlich drücke, antworte ich: «Sehe ich aus wie einer?» Und Dasgupta, wunderbar kryptisch: «Ja und nein, manchmal nicht.»
Mumbai, der Moloch. Am nächsten Morgen wandere ich zur Victoria Station, vor hundertfünfzehn Jahren eröffnet und nach der damaligen Königin von Großbritannien und Kaiserin von Indien benannt. Sie hat der Welt einen ergreifenden Satz hinterlassen: «Lie back, close your eyes and think of England.» Ein verzweifelter Rat an die Damen der Inselwelt, den Geschlechtsverkehr einigermaßen unbeschadet hinter sich zu bringen. Noch heute leidet der Subkontinent an dem Exportartikel «Eros – made in England», der über dreihundert Kolonialjahre lang hierher exportiert wurde. Fairerweise muss erwähnt werden, dass die Königin es sich später noch einmal überlegte und von einem sinnlicheren Leben träumte. So ließ sie regelmäßig indische Fakire nach London schaffen, Yogameister, die ihr vorturnen mussten. Irgendwo wird sie geahnt haben, dass zwischen körperlicher Gewandtheit und sinnlicher Genussfähigkeit ein Zusammenhang besteht. Alles vergeblich, nichts schlug an.
Die Erinnerung an den «spinster», die unerlöste Witwe im Buckingham-Palast, ist wichtig. Auf dieser Zugreise werde ich erfahren, dass noch immer ein eherner Keuschheitsgürtel das Land umschließt.
Sicherheitskontrollen, Notieren der Personalien, Bodycheck, dann darf ich zum «Chief Public Relation Manager» des Bahnhofs. Der Boss ist ein herzlicher Boss. Ich bettle um Drucksachen, um Informationen zur Geschichte der Indian Railways. «No problem», alles geht seinen indischen Weg. Der Boss klingelt, und ein Kalfaktor wird beauftragt, zwei Bücher zu bringen. Als sie kommen, zücke ich die Geldscheine. «No problem», aber dazu müsse ich rüber ins große Zimmer, dort werde eine ordentliche Rechnung geschrieben. Im großen Zimmer liegen Halden von Papier, und zwischen den Halden machen sich sogleich sechs «paper pusher» (ein Beruf mit Erbfolge) auf die Suche nach einem Quittungsblock. Zuerst frenetisch, dann rasch erlahmend, dann freudig. Denn kein Block findet sich, aber ein Stempel, auf dem «Complimentary» steht. Siebenmal saust der Stempel in die Bücher, lächelnd werden sie mir als «Freiexemplar» überreicht. Eine Meisterleistung: Das Angenehme (sich nicht mehr strecken und bücken müssen) und das Großzügige (ein Geschenk an einen Fremden) miteinander verbinden, die Inder machen es vor.
Roald Amundsen hinterließ Aufzeichnungen, in denen er von minutenlangen, frostkalten Duschen sprach, die ihn auf die Fahrt zum Südpol vorbereiten sollten. Wer sich für die Entdeckung der indischen Eisenbahn rüsten will, dem sei eine Spritztour von hier nach Thane empfohlen. Sie wird ihn stählen. Die knapp 34 Kilometer waren die ersten Eisenbahnschienen, die in Indien, ja Asien, verlegt wurden. Nachdem sich das englische Parlament und die Geldgeber darauf geeinigt hatten, dass mit einem Eisenbahnnetz in Indien besser Krieg zu führen und schneller Waren an die Häfen zu transportieren, sprich effizienter Land und Leute leer zu rauben wären, setzte sich am 16. April 1853 um 15.25 Uhr in Bombay der erste Zug in Bewegung. Die Presse berichtete, die «Eingeborenen» seien wieder einmal überwältigt gewesen vom Genie des Weißen Mannes. Da sie keine Pferde und Ochsen entdeckten, die die vierzehn Waggons mit den vierhundert geladenen Gästen zogen, vermuteten sie, dass «the wonderful white man» wieder gezaubert und Dämonen und andere wunderliche Kräfte eingesetzt hatte. So brachten sie Kokosnüsse und «besänftigende Opfergaben», um den überirdischen «ag-gadi», den Feuerwagen, die wild speiende Dampflok, zu begütigen.
Fußnote: Die Inder haben die Neuerung umgehend akzeptiert. Anders in China, da führte sie ein Vierteljahrhundert später zu Aufständen. Die ersten Gleise mussten wieder herausgerissen werden. Nicht zu stillen war der Zorn abergläubischer Alter.
«150 glorreiche Jahre» nachdem Neugierige entlang der Strecke niederknieten und den Eisenbahn-Gott anbeteten, kaufe ich ein Rückfahrticket nach Thane und betrete um 8.35 Uhr eine «EMU», eine Electric Multiple Unit. Jene spartanisch möblierten Vorortzüge, die zweitausendmal pro Tag in die Bahnhöfe Mumbais einlaufen, um eine Arbeitnehmer-Armee von zwei Millionen morgens anzuliefern und abends wieder heimzukarren.
Verdächtig zivilisiert fängt es an. Ich kann sitzen, ungehindert den Kopf drehen und atmen. Mein Blick fällt auf ein Werbeposter, man sieht eine fröhliche Familie an einem geräumigen Tisch hocken und frische Kuhmilch trinken. Bettler ziehen ein, einer schreit «Allah», einer quetscht das Akkordeon, der kleine Nago hat genügend Platz für seine Flicflacs. Ich wundere mich, dass immer mehr Leute einsteigen, obwohl der Zug noch immer stadtauswärts fährt. Sie wollen doch rein nach Mumbai und nicht zurück in den Vorort? Bis ich kapiere: Sie steigen bereits vor der Endstation ein, um auf der Rückfahrt in den Moloch schon an Bord zu sein. Als wir in Thane ankommen, verlässt kaum jemand seinen Platz
Die vierunddreißig Kilometer zurück beginnt Indien. Wer jetzt aussteigen will, wird von den Neuzugängen zurückgewirbelt. Die Logik, dass mehr Platz vorhanden ist, wenn zuerst Passagiere den Zug verlassen, diese Logik klingt hierzulande völlig unlogisch. Bald stehen Männer zwischen den Knien jener, die sitzen. Ausschließlich Männer, denn jeder Zug besitzt ein «Ladies’ carriage», in das nur Frauen dürfen. Das ist weise, denn so mancher würde im Schutze des Gewühls nach verbotener Nähe suchen. Bald stehen drei Männer zwischen einem Paar (sitzender) Männerknie.
Mein Kopf ist nun fest zwischen zwei Gürtelschlaufen verankert. Hinter den Gürtelschlaufen stecken zwei blitzsaubere Hemden, sicher Bankangestellten-Hemden. Wir drei kommen gut miteinander aus, das Duo rührt sich nicht und ich kann immerhin mit den Augen rollen. Sie rollen nach links und werden belohnt. Auf zärtliche Weise. Ich sehe zwei Männerhände, die verliebt miteinander spielen. Direkt unterm Fenster. Sie haben Recht, keiner kann sie entdecken, so dunkel ist es, so umstellt sind sie von Hosen und Beinen. Schon anrührend diese Sehnsucht nach erotischer Heimlichkeit, zweimal heimlich. Sinnlich und homosexuell sinnlich. Alles Gründe, nichts davon an die Öffentlichkeit dringen zu lassen.
Pablo Neruda fällt mir ein, der Präsident Allende auf dessen Wahlreisen begleitete und seinen Freund um die Gnade des Zehn-Minuten-Schlafs beneidete. Zu jeder Zeit, an allen Orten. Inder sind ähnlich begabt. Ein paar liegen mit offenen Mündern auf fremden Schultern, andere sitzen wie Tote mit hängenden Köpfen da. Wer nicht schläft und aussteigen muss, leitet das Manöver drei Stationen davor ein. Irgendwo las ich einen Bericht über vier Kartenspieler in indischen Vorortzügen. Schon möglich, da die Nachricht aus dem Jahr 1993 stammte. Da gab es zweihundert Millionen Inder weniger, damals war noch Platz für vier Arme zum Ausstrecken. Nach einer halben Stunde bade ich in Schweiß, Salztränen laufen in meine Augen, die Gürtelschlaufen schmerzen. Ich würde gern wissen, warum ich mir den Beruf des armen Reporterschweins ausgesucht habe. Warum ich nicht, sagen wir, ein Genie wie Somerset Maugham geworden bin. Dann würde ich in feinsten Hotels logieren und jeden Morgen auf schattiger Terrasse der Sekretärin den nächsten Welterfolg diktieren. Ohne eine einzige Zeile leben zu müssen, ohne am ganzen Leib zu dampfen, ohne je von einem anderen Leben zu träumen. Ich wäre Genie, sonst nichts. Tagsüber würde ich die Welt neu erfinden und abends mich zum Dinner umziehen. Vor dem Zubettgehen würde ich einen letzten Blick auf das Diktierte werfen und schon wieder wissen, dass ich teuflisch begabt bin.
Aber eine Freude kommt, die versöhnt. Irgendwann läutet ein Handy, keine zwei Hintern von mir entfernt. Ich rolle die Augen nach rechts und sehe einen Langen, der sich mit beiden Händen an einen von der Decke baumelnden Haltegriff klammert. Er muss der Angerufene sein, denn er macht Anstalten, die Arme nach unten, Richtung Jackentasche, zu bewegen. Aber das geht nicht. So viel Platz ist nicht. Man sieht sein fieberhaft arbeitendes Hirn: Wie komme ich an das Telefon? Es läutet weiter, und wir stellen uns alle die Frage: «Wer klingelt hier an?» Die Gattin? Sicher nicht, sie weiß seit vielen Jahren, dass ihr Mann um diese Zeit unmöglich sein Handy erreichen kann. Wer dann? Nun kommt der Augenblick, in dem Genies eingreifen und folgendes diktieren würden: «… Das war der Tag, an dem Mister Singh einen Anruf bekam, der nicht für ihn bestimmt war. Undenkbar, jetzt zu antworten. Als Singh endlich ausstieg, wählte er die Nummer, die noch auf dem Display zu sehen war. Ein Mister Kiru meldete sich. Singh erkannte die Stimme und wusste, dass von nun an sein Leben einen anderen Lauf nehmen würde …»
Als der Zug in der Victoria Station hält, schwappen wir wie Springfluten auf den Bahnsteig. Die meisten mit heiteren Gesichtern. Kein Ärger über das Zugemutete, eher Freude, dass sie es wieder heil überstanden haben. Die Seligsten werden mit lauten Schlägen an die Außenwände vom Personal geweckt. Sie haben verschlafen. Es muss schnell gehen, Minuten später setzt sich der EMU wieder in Bewegung.
Eine Stunde später, kurz vor 11.30 Uhr, treten hier Männer auf, die einen Beruf ausüben, der einzig in Mumbai existiert: Die Dabbawalla, die Blechdosen-Männer. Sie sind fast alle Analphabeten und bekamen von dem amerikanischen Wirtschaftsmagazin Forbes ein «6 Sigma»-Prädikat, das wäre eine «99,999999»-prozentige Zuverlässigkeit, soll heißen: Bei sechs Millionen Erledigungen begehen sie einen Fehler.
Was erledigen die kleinen Männer? Sie schwirren vormittags durch die Hochhäuser der Vorstädte, klopfen an und bekommen vier ineinander verschachtelte Blechschalen, warm und voll mit Reis, Linsen, Chapati-Brot, Soße und Salat: Das Mittagessen, zubereitet von Ehefrauen für ihre in der Großstadt arbeitenden Männer. Mit dem Fahrrad pesen die Dabbawalla damit zum nächsten Bahnhof, laden ein. Am Zielort Mumbai übernehmen die Kollegen die Bleche, hieven sie via Lattenroste auf ihre Köpfe, balancieren damit ins Freie, verteilen die Dosen – jede hat einen farbigen Code auf dem Deckel – wieder auf Fahrräder. Bis zu vierzig Stück pro Mann. Jetzt lostreten und ab ins Business-Viertel. Der Code – den können sie lesen – zeigt an, in welchen Wolkenkratzer, in welchen Stock, vor welche Tür das Mittagessen soll. Natürlich könnten die Angestellten auch in der Kantine essen. Aber 175 000 von ihnen jagt die uralte Angst, die Mahlzeit würde – nicht auszudenken – «unrein» zubereitet von einem «Unberührbaren». Fünftausend drahtige Männer leben seit über einem halben Jahrhundert von dieser Phobie. So erfolgreich, dass sie in letzter Zeit von Großbetrieben eingeladen wurden, um über ihr System zu reden. Um zu erklären, wie sie mit einfachsten Mitteln eine solche «performance rate» schaffen.
Auch klar: Die Ehemänner und Söhne könnten ihr Mittagessen morgens selbst mitbringen. Aber das gilt als unschick. Zudem hat ja kein zusätzliches Reiskorn mehr Platz in den voll gestopften Waggons. Ein Super-GAU würde losbrechen, sollten die Bleche aufgehen und die würzigen Saucen an den strengen Bügelfalten der Herren hinunterlaufen.
An diesem Vormittag bin ich der 5001. Dabbawalla. Raghunat nimmt mich mit, ich darf neben seinem Fahrrad herlaufen und nach einer Viertelstunde vor dem Air-India-Gebäude in die Knie gehen, eine halbe Minute Atem holen, dann die ersten Bleche auf unsere vier Arme verteilen und vor bestimmte Eingänge auf verschiedenen Stockwerken abstellen. Bis hinauf in den elften, ohne den Lift zu benutzen. Warum nicht? Der Alte traut den Aufzügen nicht. Dann weiter zur Citibank und zum Indian Express, der großen Tageszeitung. Raghunat denkt nie nach, er weiß längst alle Türen auswendig. Als wir fertig sind, gibt es eine lustige Überraschung, mein Boss will ein Bakschisch. Ich dachte, er wird mir auf die Schulter klopfen und dreimal danke sagen. Ein Pförtner kommt hinzu und erklärt mir Raghunats cleveren Gedankengang: Er hätte mir doch eine Gelegenheit verschafft, eine neue Erfahrung zu machen? Wäre das nicht ein halbes Hundert Rupien wert?
Abends schlendere ich in die Falkland Road, bekannter unter «Fuckland Road», hier stehen die verfügbaren Mädchen. Belebte Straße, das ganz normale indische Chaos, Dreck, Krach, die entspannten Restaurantbesitzer vor ihrer Kasse, ein Kino mit Postern voller coltschwingender Schurken, querstehende Kühe, links und rechts parken Kutschen, Hochzeitsgäste können sie mieten. Alle fünfzig Meter steht ein Bordell, vor dem viele junge Frauen lächeln und locken, viele nicht lächeln, nur stumm ihre Leiber neben dem Trottoir aufstellen. Bisweilen späht eine Gruppe potenzieller Kunden von der anderen Straßenseite herüber. Und wartet. Sie sind geil und mutlos, selten geht einer los und verhandelt.
Mister Sahni spricht mich an. Sehr glücklich scheint er hier nicht. Er kämpft mit sich. Eine Hure kaufen oder nur davon träumen? Plötzlich sagt der ältere Herr, am «Bandra Point», einem Abschnitt am Strand der Stadt, könne ich meine Freundin mitbringen und «kiss and hug». Mehr nicht, «not to sleep», soll heißen: Küssen und umarmen wäre möglich, ohne dass der Volkszorn ausbricht. Eigenartig, warum Sahni das erwähnt. Vielleicht will er sich Mut machen, will den Eindruck verbreiten, er würde noch teilhaben.
Fest steht, zum Liebesspiel kommt niemand in die Falkland Road. Sex in Indien ist «quick business», quicker noch, wenn dafür bezahlt werden muss. Möglicherweise geniert sich Sahni für sein Alter, für die Tatsache, dass es ihn noch immer nach der Nähe einer nackten Frau verlangt. Ich bin eiskalt und sage ihm, dass auch Hundertjährige ein Recht auf Wärme haben. Der Alte zieht dankbar einen «estimate slip» aus der Brieftasche. So poetisch nennt er seine Visitenkarte. Wir verabschieden uns. Als ich zurückblicke, steht Sahni noch immer auf der anderen Seite, zögert noch immer.
Ich ziehe weiter und laufe Pankaj in die Arme. Er nimmt mich bei der Hand und stellt sich als «messenger», als Bote, vor. Seine frohe Botschaft: «Ich kenne private Mädchen, junge Mädchen, wilde Mädchen, Schulmädchen, Mumbai-Mädchen, Delhi-Mädchen.» Schon das Wort «private girls» verwirrt. Wir ziehen los. Nach einem Dutzend Nebenstraßen sind wir am Ziel: Eine dunkle Mauer, ein dunkles Eisentor, drei dunkle Gestalten. Sie lassen die Muskeln spielen, wenn nötig. Hinter der Tür ein schummriges «Wartezimmer», auf der weißen Plastikcouch soll ich Platz nehmen. Ich bin mir im selben Augenblick nicht mehr sicher, ob es eine gute Idee ist, sich hier niederzulassen. Denn ich schleppe mein gesamtes Bargeld und den Mac mit mir herum. Mein Hotel ist zu lausig, um Wertgegenstände dort zu lassen.
Die Überlegung kommt zu spät. Eine Seitentür öffnet sich abrupt, und acht Mädchen marschieren auf. Kaum stehen sie in einer Reihe, reißt ein vierter Muskelprotz an einem Hebel, und ein gemeines Flutlicht bestrahlt die Halbnackten im Bikini. Ein paar von ihnen schaffen tatsächlich ein Lächeln. Um die Tortur abzukürzen, sage ich gleich, dass ich mich entschieden habe. Der Hebel schnellt zurück, Mangal und ich werden in das «Vorzimmer» geführt, ein winziges Kabuff, die Enge soll sicher zur gegenseitigen Erhitzung beitragen. Das Mädchen zeigt mit dem Finger auf eine andere Tür und flüstert: «I and you love.» Das Kabuff fungiert somit als zweites Wartezimmer, wenn das Bett noch besetzt ist.
Das ist der Augenblick, in dem ich zu lügen anfangen muss. Denn nun wäre Zahltag, für dreißig Minuten zehn Euro, für zwei Stunden vierzig. Spezialpreise für den Weißen Mann. Lügen müssen, weil bezahlter Sex in Indien eine Zumutung ist. Ich bin hierher gekommen, um das Prozedere zu erfahren, nicht den angebotenen Service. Lieber das Keuschheitsgelübde ablegen, als sich foltern zu lassen von einem Gemisch aus erotischer Unbegabung, jahrhundertelang genährten Schuldgefühlen und einer trotzigen Wut auf den Kunden, der an allem Schuld hat.
Ich frage noch scheinheilig nach der Polizei, ob deren Auftritt nicht zu befürchten sei. Um die Schweigegelder für den illegalen Betrieb zu kassieren. Aber nicht doch, der Hebel-Mann grinst, er selber wäre Polizist. So verspreche ich dem Freizeit-Zuhälter, dass ich schnell einen Bankautomaten suchen wolle, um die nötigen Scheine runterzuladen. Um elf sei ich zurück.
Ich gehe nochmals zur Falkland Road. Diesmal werde ich belohnt. Eine Frau mit einem wunderschönen Gesicht steht da. Und einem Dekolleté, das einen atemberaubenden Busen offenbart. Wir reden. Ich will nicht glauben, dass ein solcher Mensch nicht eine wohlriechendere Umgebung finden könnte, um ein paar Rupien zu verdienen. Aber «Stella» antwortet ausweichend. Plötzlich irritiert mich ihr selbstsicheres Auftreten, zu selbstsicher für eine indische Frau in Anwesenheit eines Fremden. Ich frage, ohne zu überlegen: «Sind Sie ein Mann?» Und Stella, jetzt eindeutig und keineswegs verstimmt: «Nein, ich war ein Mann.» Der Satz bringt die Erinnerung an eine vor langer Zeit gelesene Reportage zurück: Die Falkland Road ist auch das Zentrum der «Hijras», jener Wesen, die als Männer auf die Welt kommen und nichts anderes wollen, als eine Frau zu werden. So ist der Wunderbusen ein Wunderwerk der Technik. (Dass ein Mann die schönsten Brüste hat, nichts soll einen wundern in diesem Land.) Für den entscheidenden Eingriff – «the cutting» – muss Stella noch sparen. Deshalb wartet sie hier auf Freier. Beim Abschied fragt sie weich: «What is your darling name?» Wie romantisch: Einen besonderen Namen haben, wenn man zu seinem Darling geht.
Auf dem Heimweg lese ich in der Zeitung, «Richard Gere is in town». Der Amerikaner rennt vor jedes Mikrofon in Mumbai und erzählt den Indern, dass eine «Zeitbombe tickt»: Aids. 3,9 Millionen Einwohner sind schätzungsweise infiziert. Viele Millionen mehr jedoch erkranken an Gastritis oder Malaria oder Ignoranz. Viele Millionen sterben daran. Über eine halbe Milliarde kann in diesem Land nicht lesen und schreiben. Oder sie lesen und schreiben wie Siebenjährige. Hier tickt die Bombe. Aber mancher hat eben eine Begabung für die fotogenen Probleme. Ein skelettöser Aidskranker ist fotogen, ein Analphabet nur ein stumm dasitzendes Männchen, nicht der Rede, nicht des Blicks wert.
Der kapitale Humbug, der im Zusammenhang mit dieser Krankheit oft verlautbart wird, kann auch Anlass zu Heiterkeitsausbrüchen sein. Ein indischer Minister wurde unsterblich, nachdem er seine Landsleute wissen ließ: «Aids wird nicht nach Indien kommen, denn Inder haben keinen Sex.» Zu seiner Verteidigung könnte man anmerken, dass der Satz nicht die ganze Wahrheit spricht, nur fast die ganze, die schon.
Gere verkündet unheimliche Sätze. Ich zitiere ihn noch einmal, weil ich jeden beneide, der solche Gedanken ohne Anflug von Ironie verbreitet: «Ja, schon möglich, dass die guten Taten in meinen Vorleben für mein gutes jetziges Leben verantwortlich sind.» Hat der heilige Richard Recht, dann war ich während der letzten Jahrhunderte ein schlechter Mensch. Gere darf derlei Weisheiten vom edlen Sofa seiner Luxussuite loslassen, ich steige aus einem klapprigen Bus und wetze auf mein desolates Zimmer, Hose runter, mein virulenter Magen verfolgt nur ein Ziel: loslassen dürfen.
Am nächsten Morgen gehe ich zu dem Hotel, wo der Schauspieler predigt. Die letzten hundert Meter dorthin sind anstrengend. Wie die «Gürtel der Armut» in Mexico City umlagern die Habenichtse die Hochburg der Alleshaber. Direkt vor dem Eingang stehen zweiundvierzig Männer und starren konzentriert auf die Doppeltür. Die Chauffeure starren, sie wollen den Wink ihres Herrn nicht versäumen. Sollte er irgendwann herauskommen und winken. Auffällig, dass acht von zehn Stinkreichen dem Türöffner nicht in die Augen sehen. Von einem Gruß, einem Lächeln nicht zu reden.
Früher galt ein Grandhotel als Brutstätte von Geheimnis, Verführung, ja Weltwissen und eleganten Snobismus. Heute genügen zehn Minuten Aufenthalt in der Nähe der Rezeption, um sich von dieser Illusion zu verabschieden. Proleten und Parvenüs, Männer und Frauen mit dumpfen Geschmacksnerven fläzen in den Sesseln, mit Leggins und Nike, Trainingshose und Hawaiihemd, weißen Tennissocken und splitternackten Waden, denen man drei Dutzend Enthaarungstuben spendieren möchte. Wie ich höre, ist Mister Gere bereits abgeflogen. First class.
Hinterher tue ich das, was ich bereits vor der Reise beschlossen habe: Regelmäßig nach ein paar Tagen Streunen und Wandern einen Ort aufzusuchen, der still ist, der Geist ausstrahlt. Wo nichts Ohren und Augen massakriert, kein ätzender Geruch die Nasenflügel entzündet, keiner hinter mir her winselt und Gerechtigkeit fordert. Wo ich Indien verdaue, wo ich mit Hilfe von Sprache versuche, mit dem Land fertig zu werden. Aus Erfahrung weiß jeder Schreiber, dass der Herzmuskel ruhiger schlägt, sobald sich das träge Fleisch zum Schreiben überredet hat, sobald man seine Gedanken als Buchstaben und Worte vor sich auftauchen sieht. Erst beim Wörterfinden erkenne ich den Sinn dessen, was mir widerfahren ist, übersetze ich die stummen Bilder in meinem Kopf in Sprache. Nur Reisen, wie unerträglich. Käme nicht immer wieder der Augenblick, in dem ich mein zweites Leben beginnen darf, würde ich umkehren und nie mehr aufbrechen. Andere rufen nach Gott, mich behütet das Alphabet.
Der Wachtposten am Polizei-Hauptquartier weiß die richtige Adresse. Zehn Minuten später sitze ich in der State Central Library. Ich muss stürmisch lügen, um dasitzen und den mitgebrachten Computer benutzen zu dürfen. Denn Vorschrift ist: Nur Bücher ausleihen und Bücher lesen. Dass zehn Steckdosen zur Verfügung stehen, dass ich niemandem – auch in Indien raufen keine Massen um Lektüre – den Platz wegnehme, das alles soll nicht gelten. Wer so penetrant nein sagt, der muss in die Irre geführt werden. So fordere ich ein großes Buch an («The fight for freedom») und tippe – ausreichend dahinter versteckt – mein Tagebuch.
Nachmittags bekomme ich Besuch, ein Mann setzt sich an meinen Tisch. Höchst aufmerksam liest er, mit bewegten Lippen, schreibt Sätze raus. Ich bin umso neugieriger, da der Mensch in nichts einem Intellektuellen ähnelt, eher einem Handwerker oder Arbeiter. Ich frage und Mister Vadivel reicht mir unverzüglich das mit einem Umschlag versehene Buch «Guide to good writing», verlegt bei Random House, New York. Der Sechsundvierzigjährige ist Vertreter, Männerhosen-Vertreter, aber in seiner Freizeit will er Schriftsteller werden. Angefangen hat die Sehnsucht, als er in einer Zeitung ein Gedicht von W.H. Auden las. Der englische Dichter hatte in dem Sonett den Tod seines Liebhabers beweint. Obwohl die Zeilen keinen Trost spendeten, nur Trauer hinterließen, hatte Vadivel die seltsame Empfindung, dass die Schönheit der Verse ihm ein erstaunliches Wohlgefühl bereiteten. Das wollte er wieder finden, ja selber lernen, das Schöne herzustellen. Um ihm Mut zu machen, erzähle ich ihm ein paar Daten aus dem Leben von Charles Bukowski, auch ein «latebloomer», der erst Leichenwäscher, Tankwart, Müllkutscher, Birnenpflücker, Eisenbahn-Bremser, Zuhälter und Briefsortierer werden musste, um als Weltberühmter zu enden.