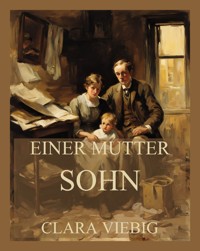Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In diesem Erzählband hat Herausgeber Peter Kämmereit Novellen zusammengestellt, die sich der Stadt Trier und dem Moselraum widmen. Hier vereinigt sich Ernstes und Heiteres, Tragisches und Besinnliches. Das Buch enthält zwei Wiederentdeckungen, die bisher noch in keinem Novellenband veröffentlicht wurden und lässt Viebigs novellistisches Schaffen wieder zu Ehren kommen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2018 – E-Book-Ausgabe Rhein-Mosel-Verlag Brandenburg 17 D-56856 Zell/Mosel Tel. 06542/5151 Fax 06542/61158 www.rhein-mosel-verlag.de Alle Rechte vorbehalten ISBN 978-3-89801-863-0 Ausstattung: Stefanie Thur Titelbild: Clarkson William Stanfield »Trier, Hauptmarkt, Steipe und Brunnen« Korrektorat: Melanie Oster-Daum, Peter Kämmereit
Clara Viebig
Novellen aus Trier und dem Moselland
Mit einem Vorwort des Herausgebers Peter Kämmereit
RHEIN-MOSEL-VERLAG
Clara Viebig: Wie ich schreibe
»Ich arbeite schwer und bin nicht leicht zufrieden mit dem, was ich schreibe. Jeder Schaffende wird immer wieder und wieder feilen und bessern, bis er schließlich die endgültige, allein mögliche Form gefunden hat. Ich arbeite nicht mit dem Auge, sondern mit dem Ohr. Auf jeden Tonfall kommt es mir an. Das Musikalische des Stils bestimmt meine Arbeitsmethode.
Erst wenn ich durch stetes Bessern, Weglassen, Zusetzen, Verschieben die Form gefunden zu haben glaube, die die letzte, die beste ist, dann gehe ich ans Diktieren der Reinschrift. Und auch beim Diktieren hilft mir das Ohr zu weiteren, letzten Verbesserungen, nicht zu den allerletzten.«
Aus Uhu. Das Ullstein Magazin, Berlin 1925
Vorwort des Herausgebers
»Was, Sie kennen den Markusberg nicht?«, war die verwunderte Reaktion eines Kursteilnehmers an der Universität Trier während einer Veranstaltungsreihe zu Clara Viebig. So erfuhr ich erstmalig, dass diese herrliche Novelle in Trier, dem Geburtsort der Dichterin spielt. Obwohl diese Novelle 1898, also noch ganz am Anfang ihrer schriftstellerischen Karriere, in der Zeitschrift »Die Wage« erschien, zeugt sie bereits von großem Können. Viebig war dennoch mit dem Text nicht ganz zufrieden gewesen. Davon zeugt ihre handschriftliche Überarbeitung, der auch die Druckfassung dieses Novellenbandes entspricht. Wir erhalten so eine Kostprobe ihrer Arbeitsweise, von der sie auf Seite 5 dieses Buches berichtet.
An den erwähnten Literaturkurs wurde ich noch einmal während eines Klinikaufenthalts in Trier täglich erinnert, denn von meinem Fenster aus konnte ich den Ort der Handlung, die Kapelle am jenseitigen Moselufer, sehen. Dem mit der Örtlichkeit nicht vertrauten Leser bleibt nämlich Trier als Ort der Handlung verborgen.
Die Novelle »Vom heiligen Markus« fand in keinem ihrer Novellenbände Aufnahme, was möglicherweise mit der kritischen Haltung zu erklären ist, die die katholische Kirche zu Viebigs als unmoralisch angesehene Dichtkunst einnahm.
Zwei Episoden mögen dies noch unterstreichen: Als eine ältere Bewohnerin aus dem oberhalb von Bad Bertrich gelegenen Hontheim gebeten wurde, doch einmal im Clara-Viebig-Pavillon zu einer Lesung zu kommen, wies diese einen solchen Gedanken mit den Worten »gehen Sie mir nur mit der Viebig weg« schroff ab, hatte aber noch nie etwas von Viebig gelesen. Und eine Fabrikinhaberin aus Dreis erzählte mir, dass sie als junges Mädchen ein Viebig-Buch heimlich aus dem Bücherschrank des Vaters nehmen musste, weil der ihr die für unmoralisch angesehene Lektüre nicht erlaubt hatte.
Wohl ist Viebigs Werk dann später in höchsten katholischen Kreisen akzeptiert worden, denn in einem Interview, das der Kölner Erzbischof Frings einer Zeitung gab, äußerte er »ich las Viebig«.
Mit einer anderen Erzählung aus dem Jahre 1930, »Das Karusellpferd«, verknüpft Viebig die Mosel mit Berlin, der Stadt, in der sie bis zu ihrem Tod fast 70 Jahre gewohnt hatte. Eine heitere Erzählung, in der frühe Kindheitsfreuden wieder zum Erwachen kommen. Auch dieses Fundstück ist in keinem ihrer Novellenbände enthalten, damit auch eine Wiederentdeckung.
Von der Frömmigkeit der Eifeler zeugt die Novelle »Margrets Wallfahrt« und Heimatverbundenheit ist wohl die eigentliche Botschaft der Novelle »Der Pündericher Jusep«. In der Novelle »Josepha Sewenich« sind Liebe und Ablehnung die herrschenden Gefühle, die schließlich in die Katastrophe führen. In den geschichtlichen Fokus der Rheinlandbesetzung durch Frankreich in den 1920er Jahren rückt Viebigs Novelle »Heinrich Feiten«: Tiefer Hass für ungesühntes Verbrechen vermögen es hier dennoch nicht, Rache an den Besatzern zu üben.
Trotz des von ihr beklagten Verlustes ihrer geliebten Heimat hat Viebig, gegen den damaligen Zeitgeist, in ihren Novellen stets das zutiefst Menschliche in den Vordergrund gestellt und damit nie Hassgefühle gegen das Nachbarland bedient. Wohl deshalb konnten Viebigs Werke auch in Frankreich erscheinen.
»Ech wallfaohren aach«, hatte in der Novelle »Die Heimat« der Lippi mit fester Stimme geäußert, als ihm die Krankenschwester im Landarmenhaus von Trier den Blick vom Fenster zur Mariensäule auf dem Markusberg wies. Pflege- und betreuungsbedürftig hatte die Eifelgemeinde Bad Bertrich ihn hier gut versorgt gedacht, er aber verzehrte sich voller Sehnsucht nach seiner Eifelheimat und machte sich noch einmal dorthin auf den Weg.
Häufig hat Viebig Kranke, Behinderte und Benachteiligte in den Fokus ihres Schaffens gerückt. So auch ein schwerst missgebildetes Kind in der Novelle »Das Miseräbelchen«. Die alleinstehende Mutter muss es, während sie ihrer Arbeit nachgeht, im Haus verwahren. Aber Nachbarskinder kümmern sich liebevoll um das Kind und verschönern seine Tage.
In der Novelle »Brummelstein« hat die Tochter der so genannten, geistig verarmten Frau in ihrem jungen Leben nie Mutterliebe erfahren können. Erst als sie fern der Heimat von deren Tod erfährt, erkennt sie den Verlust und begreift nun, dass die Mutter auch ihrer Obhut bedurft hätte.
Den Abschluss dieser der Stadt Trier und dem Moselraum gewidmeten Zusammenstellung des Schaffens der Dichterin bildet die Wiedergabe des ersten Kapitels des Romans »Unter dem Freiheitsbaum«, das die Lebensumstände für die Einwohner Triers während der Besatzungszeit in Folge der französischen Revolution schildert.
So vereinigt sich Ernstes und Heiteres, Tragisches und Besinnliches in diesem Erzählband, der Viebigs novellistisches Schaffen wieder zu Ehren kommen lässt.
Peter Kämmereit, Juni 2018
Die drei Brauten
Ich soll etwas von mir selber erzählen, gleichsam in den Spiegel schauen, und, wie ich mich darin sehe, ehrlich beichten – es fällt mir schwer. Denn so ein einfaches Frauenleben, das am liebsten zwischen den Wänden des eigenen engumhegten Heimes dahinfließt, was kann das wohl an reichen Bildern zeigen?! Es wirft nicht Glanz noch Schimmer ins Spiegelglas; es gleicht der Flut in einer friedvollen Bucht, an der der müde Mann gerne sitzt und ruht und lachende Kinder spielen.
Und das was meine Augen nachdenklich gemacht hat und meinen Mund, trotzdem er ganz herzlich lacht, ernst, das was ich innerlich erlebt, das steht ja alles in meinen Büchern; denn welcher Autor spänne nicht eigenen Faden auf seinem Webstuhl und knüpfte diesen an fremde Fäden an und schlänge ineinander und durcheinander, bis daß er selbst nicht mehr weiß, wo Eigenes aufhört und Fremdes anfängt.
Also von mir möchte ich nicht reden, wohl aber von dem, was meinem Herzen teuer ist: von meiner Heimat. Vielmehr: von meinen Heimaten. Mir geht’s, wie es Onkel Bräsig ging – ich habe »drei Brauten«. Und wie ein Mann um die Liebste wirbt, so werbe ich um die drei; aber welche von ihnen meine Madame Nüßlern ist, die Heißgeliebteste und Ewiggeliebte, das verrate ich nicht. –
Ich sehe in den Spiegel – – – da fließt klar und leise die liebe Mosel! Wie ein blaues Band schlingt sie sich grünen Bergen eng um die Füße, im schwärzlichen Schiefergestein wachsen Reben, Stock bei Stock, dicht gesetzt, wie im Plattland die Kartoffeln. Weiße Städtchen hüben und drüben, in denen der Frühling früher und goldner einzieht als anderswo, in denen großdoldiger lila Flieder in Bündeln über bunte Gnadenbilder hängt und tiefbrauner Goldlack und rote Federnelken – alles Farbe, alles Duft.
Und hinter den lachenden Rebenhügeln tauchen die runden Eifelkuppen auf, steil führen die Pfade hinan. Die Ebereschen, die den Chausseerand säumen, lassen weiße Mooszipfel im rauen Regenwind flattern, ernste Maare ruhen schweigend im vulkanischen Bett, endlose Wälder schlagen die dunklen Wogen um einsame Dörfer, verlorene Heiden träumen im blendenden Sonnenglanz. Jungfräuliches Land noch, das im Dornröschenschlaf des erlösenden Kusses harrt – weltenfern, weltenweit das rührige Leben. Nur Kirchenglocken dröhnen durch die Stille, und der herbe Eifelwind trägt diesen einzigen Klang hierhin und dorthin, allüberall hin.
Die Glocke mit der mächtigsten Stimme hängt zu Trier; da ruft sie vom Dom, eine beredte Zeugin der uralt-eingesessenen, siegreichen Kirche. Und doch ist’s nur ein Katzensprung von da zur Porta Nigra; Christentum und Heidentum treten sich in Trier fast auf die Füße. Ich habe mir just den schönsten Winkel der ganzen schönen Rheinlande zum Geborenwerden ausgesucht. In Trier, unweit der »Poort«, wie das Römertor im Volksmund heißt, stand meine Wiege; sie schaukelte im Takt mit den frommen Kirchenglocken, ich schlummerte süß bei deren Schall, und doch war ich ein Ketzerkind.
Meine Amme, die schwarze Anna, war eine echte Tochter der Eifel. Als sie in meiner Mutter Wochenstube, hinauf in den ersten Stock, geführt wurde, traute sie sich dort nicht von der Türe fort; es war nicht ländliche Schüchternheit, wie man anzunehmen geneigt war. Die schwarze Anna hatte noch niemals ein Haus mit mehreren Etagen betreten; nun, da die Dielen unter ihren Nagelschuhen knarrten, fürchtete sie, durchzubrechen, und zitterte für ihr Leben. Auch von der Reinlichkeit hatte sie merkwürdige Begriffe; es dauerte eine ganze Weile bis man ihr abgewöhnte, auf einen Zipfel der Windel zu spucken und hiermit ihrem Pflegling das Gesichtchen zu waschen.
Mit der trefflichen Milch dieser schwarzen Anna habe ich schon die Liebe zu meiner ersten Braut eingesogen. Tief, tief bis ins Innerste erfüllt die mich, zäh ist sie mir im Herzen eingewurzelt, wie eine starke Tanne im Eifelforst, fest ist sie, wie der festeste Stein der heimatlichen Felsen. Und wenn ich so ganz still für mich sitze, dann glaube ich oft die Glocken des uralten, heiligen Römertrier zu hören, wie sie voll und sonor über die uralte und doch jugendschöne Mosel schwingen und in den Eifelbergen verhallen. Ich höre sie, wo ich auch bin; ihr Klang kommt mir nicht aus den Ohren. Immer wieder rufen sie mich, Jahr um Jahr; ich glaube, sie läuten mir auch bis zum Ende. –
Da ich anfing die Schule zu besuchen, wurde mein Vater als Oberregierungsrat nach Düsseldorf versetzt. Das war eine Veränderung! Von der sanftgleitenden Mosel zum breitflutenden Rhein, aus der Stille des kleinen Trier, wo das Gras zwischen den Pflastersteinen wächst, in das heitere Leben der eleganten Gartenstadt!
Und doch war es noch nicht das schnellwachsende, großstädtische Düsseldorf der letzten anderthalb Jahrzehnte; man kannte noch jeden, der in der Straße wohnte. Man lief Stelzen und sprang Seilchen vor der Haustür, man kletterte über Gartenmauern und prüfte des Nachbars Birnen; man machte im Abenddunkel »Schellemännkes« und lauschte klopfenden Herzens, glühend vor Aufregung hinter dem nächsten Hausvorsprung auf das Schelten der Magd, die , wütend über das Reißen an der Klingel, öffnete, und, fand sich niemand draußen, noch wütender zukrachte.
Noch flutete der Rinnstein neben dem Trottoir, der hochgeschossene Backfisch hat verschiedentlich nähere Bekanntschaft mit ihm gemacht, wenn er, entrückten Blickes in die Luft starrend, sich ein märchenhaftes Glück der Zukunft zurechtphantasierte.
Und all die Feste! St. Martins-Abend – »Lustig, lustig, trallerala, heut ist Martins Abend da!« – die ganze Stadt roch nach Puffertkuchen und wimmelte von Kürbissen und bunten Laternen. Keine Eltern so arm, dass sie ihrem Kind nicht ein buntes Papierballönchen gekauft hätten, in dem das Kerzchen flackerte. Und die Weckmänner auf St. Nikola, Korinthenaugen hatten sie und eine Tonpfeife im breiten Maul! Die Bratäpfel und Kastanien, die in der Herdröhre zischten und knackten, wenn der erste Schnee fiel! Das Suchen nach Sauerampfer und Veilchen auf den Hammer Wiesen! Das Rheinbaden in der primitiven Bretterbude an heißen Sommertagen! Und nicht zu vergessen: das Grundwasser, wenn der Rhein hoch ging!
Was den Ältern höchsten Ärger schaffte, war uns Kindern höchste Wonne. Eine dunkle Flut schwamm im Keller, wir mitten auf dem Weltmeer in einer Bütte, Holzscheite die Ruder; Robinson war nichts gegen uns. Und wenn gar der Rhein unterm Zolltor durchlief, die Straßen der Altstadt überflutete, dem alten Jan Willem auf dem Markt die Füße wusch, die Bewohner der anliegenden Häuser in die oberen Etagen jagte, wenn kreuzende Kähne die Flüchtlinge durch Eimer an der Stange mit Speise und Trank versorgten, dann kannte unser Jubel keine Grenzen.
Und noch lacht mir das Herz, wenn ich der Freuden gedenke, die, zwölf Jahre hindurch, die zweite Braut mir bot. Es ist mein Wunsch, dies heitere Bild Düsseldorfer Lebens in einem nächsten Roman festzuhalten.
Mein lieber Vater starb; ich war eben erwachsen, das Bisherige trat zurück. Meine Eltern stammen beide aus der Provinz Posen, daher, wo man sich, wie man in dem von der Natur so bevorzugten Rheinland denkt, Hasen und Füchse Gutenacht sagen. Da kam ich nun hin.
Eisenbahn gab es nicht bis zum Gut der Verwandten, der Wagen wartete auf der kleinen Station; endlos gings durch Sand und Korn und Rübenfelder, und weiter durch Rübenfelder, Korn und Sand. Rebhühner schwirrten auf, wenige Dörfer zeigten sich, die Räder holperten in ausgefahrenen Landweggeleisen, und der Himmel stülpte sich über das flache Land, wie eine Glasglocke über den Teller.
Hier soll ich bleiben?! Fast wars ein Angstruf.
Und doch, wie schön ist auch dieses flache Land! Inseln gleich liegen die Gutshöfe im Meer der Felder, abgeschlossenen Reiche für sich, jeder Gutsherr ein König.
Weit schweift der Blick über die nährende Erde: hier wächst unser Brot. Goldenen Ähren wiegt der Sommerwind, der Kiefernwald blaut in der Ferne; am Horizont der Ebene sieht man die Sonne aufsteigen und versinken, rosige Wolken schwimmen im verklärten Glanz.
Meine dritte Braut ist keine Schönheit auf den ersten Blick, man muß sie näher kennen lernen. Und das habe ich getan. Polnisch und deutsch hat sie zu mir gesprochen. Die, freilich nur unoffiziell geschwungene Peitsche mit den verknoteten Lederriemchen, die so empfindlich die gebückten Rücken der Polaki trifft, habe ich ebenso gut kennen gelernt, wie das gütig-patriarchalische Regiment, das noch auf dem, weit über hundert Jahre der Familie gehörenden, deutschen Stammgut geführt wird.
Die Kosiniery in Schlapphut und rotem Hemd traf ich im Feld und auch die deutschen Schnitter; fröhliche und verdrossene, aufrührerische und zufriedene, stupide und intelligente Arbeiter sind an mir vorübergezogen. Die Zeit ist mir nie lang geworden. Man bangt vor dem Gewitter und ersehnt tränkenden Regen für das verdorrte Land, man gramt sich wegen der Disteln im Acker und jauchzt jedem glücklich eingebrachten Fuder zu. Die Erntekrone wird dem Herrn vors Haus gebracht, »Nun danket alle Gott!« erklingt es von unmelodischen Stimmen; gleich darauf quiekt die Fiedel und parpt die Harmonika, der Knecht schwingt die Magd auf der Tenne im Erntetanz, derweil die Alten trinken.
Ich aber schlich mich von dannen, hinter die Scheuer und weiter über die Äcker bis in den blauen Kiefernwald. Da blieb ich stehen im Heidekraut. Harziger Duft umschwebte mich wie eine Wolke, und in der Wolke kam ein Gruß jener anderen Kiefern, jener rotstämmigen, knorrigen Gesellen, die auf Eifelheiden wachsen. Natur ist immer verwandt, und Bauer ist Bauer, und Mensch ist Mensch. –
In West und Ost und am Niederrhein wohnen so meine drei Brauten. Einer jeden von ihnen gehört mein Herz, einer jeden danke ich viel Glück, allen zusammen aber mein Höchstes – meine Kunst.
Drei Brauten – und wenn ich’s recht bedenke, bin ich Bräsigen doch noch über, ich habe eigentlich vier. Die vierte Braut ist Berlin. Aber nein, was sage ich denn?! Keine Braut! Mit Berlin bin ich – verheiratet!
abgedruckt in:
»Das literarische Echo«, 3. Jg. 1900/01, Sp. 313-316
Vom heiligen Markus
veröffentlicht in »Die Wage« Heft 40, 1898
Der Weg war sehr steil von der Mosel herauf zum Markusberg. Mancher Schweißtropfen fiel auf den roten Sandstein, und Seufzer, die wie unterdrücktes Fluchen klangen, mischten sich mit dem Gebetgemurmel und dem Geprassel der abwärts rollenden Steinchen unter nägelbeschlagenen Schuhen. Die Luft war still. Die Hitze so stechend, wie sie nur die Frühlingssonne im ersten Feuereifer ausbrütet.
Schneider Pitter Schommer aus der Nagelgasse hatte seinen Rock über den Stecken gehängt. Das Weiß der sonntäglichen Hemdärmel wetteiferte mit dem Blütenschnee der Obstbäume, die unten im Tal zurückblieben.
»Dunnerkiel«, murrte er, wischte sich mit dem Handrücken unter der Nase her und verbesserte sich dann rasch: »Gelowt seist du!« Er drehte sich nach seiner Frau um: »Mo, esu komm doch!«
»Wart’ ebbes, Pittchen!« Sie war ganz außer Atem und stand keuchend still. Sie trug ein kleines Mädchen auf dem Arm; an jeder Seite hatte sie noch eines an den Rockfalten hängen. »Ech sein et net gewohnt dat Bergklettre un dann die Hitz! – Un die Kinner!«
»Dän heiligen Markus wird dafür auch en Einsicht han, ech sein sicher.« Der Mann schlug gläubig das Kreuz. Und dann: »Verfluchte Karnallje, wirste gleich giehn!«
Das eine kleine Mädchen hatte den Rock der Mutter fahren lassen, saß nun im Sonntagsstaat am Boden und heulte. Kein Zerren half, kein Schütteln. Es wollte nicht weiter, es war müde, es wollte getragen sein.
»Jeß, die Mädercher!« Der Schneider fuhr sich unwirsch durch die Haare. Er mußte die Last aufladen.
»Gegrüßt seist du – heiliger Markus, bitt’ für uns!«
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Oben bimmelte das Glöckchen der Kapelle, hell und durchdringend schrillte es in die Weite. Klänge von Tanzmusik, abgerissene, melodielose flatterten dazwischen.
»Hörste? Muhsik!« Das junge Weib hielt mit Beten inne und hob die Hand, um die der Rosenkranz geschlungen war. Sie wies hinauf.
Um die weißen Mauern des Kirchleins wehten Zelttücher, ein Knäuel von Menschen drängte sich dort.
»Laß’ die Muhsik,« brummte er verdrießlich. Er war schon ältlich, seine Beine steckten wie Stelzen in den faltigen Hosen. Von der Anstrengung glühte sein mageres Gesicht blaurot. Über die Stirn liefen ihm Tropfen wie Regen, rieselten an der langen Nase nieder und näßten die pomadisierten Zöpfchen des heulenden Kindes.
Endlich waren sie oben. Stöhnend und unsanft ließ er die Last nieder: »Ech sein gestraft mit all die Mädercher!«
»Heiliger Markus, bitt für uns!« Peter Schommer setzte hoch aufatmend den Fuß über die Schwelle der Kapelle. Drinnen lagen viele auf den Knien; in der kühlen Dämmerung roch es betäubend nach Weihrauch, nach Schweiß, nach Menschen. Die Kinder glotzten blödneugierig. Frau Schommer warf sich mit gleichgültig stumpfem Gesicht nieder.
Er aber betete heiß und lang, den Hut vor’m Gesicht, die fahlen Haare, dunkel vom Schweiß, an die Wangen geklebt. Seine Lippen bewegten sich murmelnd unaufhörlich, er hatte ein dringendes Anliegen beim heiligen Markus.
Mädchen, lauter Mädchen! Drei lebendige Töchter kreischten in seiner Werkstatt, und zwei hatte er schon auf dem Kirchhof. Fünf Mädchen! Er hatte keinen Mut mehr, noch einmal Vater zu werden – wenn’s wieder eine Tochter wäre! Der Angstschweiß konnte ihm zu Zeiten ausbrechen und die Lust verging ihm. Noch ein Mädchen – nein, dann lieber nicht! Und er hatte doch glühende Sehnsucht nach einem Sohn; es war eine fixe Idee, sein brennendster Wunsch, den Namen Schommer weiterzupflanzen. Wenn Pittchen eins getrunken hatte, malte er sich diesen Sohn aus im ganzen Glanz seiner Jugendschöne; er sah ihn leibhaftig in der Nagelgasse den Kreisel drehn – »ganz der Vater«, sagten die Leute – er schneiderte ihm schon die ersten Höschen. Und dann weinte er vor Glück und Rührung. Die Bekannten foppten ihn. Einer, der’s gut mit ihm meinte, riet ihm einen Bittgang zum heiligen Markus: jetzt, wo der Heilige seine Oktave hatte, war der besonders geneigt und wundertätig. –
Die heiße Maisonne rutschte schon nach Westen, als Schommers die Kapelle verließen. Über dem Rand der Berge schwamm die gold’ne Kugel in einem Strahlenmeer.
Peter Schommer fühlte sich wunderbar gestärkt, wie eine selige Zuversicht war’s über ihn gekommen. Er zwinkerte mit den wasserblauen Augen, zog die Hosen stramm und drückte die Brust heraus – er fühlte eine Kraft für zehn. Er nahm die Kinder an die Hand und ging mit ihnen an die Verkaufsbuden.
Staub, Gedränge, bewunderndes Betrachten, Feilschen, Anpreisen, halbtrunkene Gesichter, roter Abendsonnenschein auf geweihten Rosenkränzen und Jahrmarktsherrlichkeiten.
Die Zelttücher wehten, der Leierkasten quietschte, die Kinder bliesen auf Zuckerpfeifchen und die Erwachsenen lärmten. Töne der Lust, Gedudel, Gekreisch.
Das Bimmeln hatte aufgehört; um die weißen Mauern des Kirchleins drückten sich Liebespaare und verschwanden abwärts in den Büschen.
Verdrossen schlenderte Kettchen Schommer hinter Mann und Kindern drein. Ihr kornblumenblaues Kleid schleifte über den Boden, die sich drängende Menge trampelte darauf. Die verschlafenen braunen Augen der Frau wanderten langsam nach rechts und links. Sie neigte zur Fülle.
»No, Kettche!« Schommer war besonders liebenswürdig; er winkte ihr, und sie ließen sich vor der Wirtschaft auf einer Holzbank nieder. »He, Wirtschaft! En Liter Viez!«
Der Raum war eng; Tisch bei Tisch, Bank an Bank, man saß sich fast auf dem Schoß. Etliche von Besatzungstruppen waren auch da, das Käppi im Genick, lachend, spuckend, Späße treibend, zogen sie manche Blicke auf sich.
Schommer trank hastig; er bestellte noch einmal zu trinken. Er rief seine beiden Ältesten heran, die mit ihren Pfeifchen um die Tische strolchten, und ließ sie kosten; sie schluckten gierig mit zugekniff’nen Augen, bis ihnen der Atem ausging. Er wurde zärtlich gegen seine Frau, dann schimpfte er, dann wurde er wieder zärtlich und zuletzt ganz weich. Ohne Hut, rittlings auf der Bank, die Arme über die Lehne hängend, saß er schlaff da, sehr bleich und stierte immer auf einen Fleck.
Die junge Frau, das kleinste Mädchen auf dem Schoß, sah gedankenlos in’s Blaue. Sie gähnte, aber jetzt hielt sie mitten im Gähnen inne – einer der Franzosen rückte neben sie.
Es war ein schmucker junger Mensch; ein Gesicht, rund wie ein Apfel mit einem bläulichen Flaum unter der keck aufgestülpten Nase; Augen klein, lebhaft, schwarz wie Vogelkirschen.
Er sah sie dreist an; ihr verdroß’nes Gesicht hellte sich auf, sie zeigte geschmeichelt die weißen Zähne. Das war einmal ein Schöner. Sie sah ihn sich ordentlich an, mit großen, dummen, erstaunten Augen.
Er kitzelte das kleine Mädchen unter’m Kinn und kniff es in’s Hälschen. Weit legte er sich dabei über, so daß sie sein ganzes Gewicht auf ihrem Schoß spürte. Er sagte: »Sehr schöne Kind – ganz wie Madame.« Dann schob er ihr sein Glas hin. Sie trank, schon wieder durstig.
Drinnen im Wirtshaus dudelte die Tanzmusik. Alles hatte sich hineingedrängt; man hörte das Scharren der Füße auf sandigen Dielen, das Stampfen im Takt. Ein heißer, sichtbarer, luftdurchschwängerter Dunst drang aus Fenster und Tür.
Er drehte sich an dem blauen Flaum unter der keck gestülpten Nase. Und dann machte er ihr einen Diener.
Sie wußte selbst nicht recht, ob sie sollte; Lust zu tanzen hatte sie schon.
Er sah nach ihrem Mann und faßte sich an die Mütze: »Pardon!« Mit zwei Fingern tippte er dem vor sich sitzenden auf die Schulter.
Schommer hob den Kopf. Freundlich grinsend, mit glasigen Augen starrte er den Franzosen an und sagte kein Wort.
»Merci, merci!« Der Soldat schnallte das Seitengewehr ab, dann zog er die Frau dem Tanzlokal zu.
Die Musikanten drinnen taten ihr Bestes. Der Mai-Viez war feurig gewesen, das Blut stieg ihr zu Kopf. Entschlossen trat sie an einen Karren, der neben der Wirtshaustür auf dem Dunghaufen stand – das Jüngste lag da ganz friedlich.
Mit langsamen Bewegungen, aber mit Augen, die wie Zündhölzchen aufflammten, ging sie in den Tanzsaal.
Das Kleine schlief sanft im Karren auf dem Dung. Schommer, die Arme über die Banklehne hängend, den Kopf an’s Holz gepreßt, glaubte sich daheim in seinem Bett und schnarchte. Das hagere Gesicht mit den gelben Backenknochen sah ungemein friedlich aus; ein Grunzen der Befriedigung stahl sich über die wie in einem Schmunzeln geschlossenen Lippen des Schläfers. Der Abendwind spielte in seinen fahlen Haaren, aber weckte ihn nicht. Er hatte einen schönen Traum.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Als Frau Kettchen Schommer mit dem Franzosen wieder aus der Wirtshaustür trat, sah sie sich um: »Wo sind uns Kinner?« Aber sie sah jetzt: ja, das kleinste schlief im Karren, aber die größeren Mädchen waren weg. Die müßte man jetzt suchen gehen.
Oben auf der Bergspitze war noch Licht, aber von der Mosel herauf krochen Riesenschatten. Sie reckten sich und dehnten sich und begruben das Rot der Felsen in ihrem stumpfen Schwarzgrau. Die Berglehne lag schon ganz im Dämmerschein. Noch schimmerten die weißen Mauern des Kapellchens, aber gleich dahinter fingen die dichten Büsche an. Blühender Flieder in üppigen Dolden hing dem heiligen Markus auf’s Dach. Kreuzdorn und junges Buchenlaub wölbten sich in Lauben. Ein Pfädchen verlor sich im grünenden Dunkel. Tief drinnen saß ein Vogel und sang. Er lockte, er hielt lange auf einem Ton, dann schlug er übermütige, nicht endenwollende Triller.
»Jesses, dän schenen Vogel«, sagte die Frau und legte den Kopf tiefatmend hinten über. »Anschela – Grittche – wo seid ihr? Grittche – An-sche-la-a-a!«
Der hübsche Bursche legte ihr die Hand auf den Mund. Er sah spähend nach den Bänken vor’m Wirtshaus zurück. Der Mann war auch nicht zu sehen. Und er lachte: »Nix Mann!«
Sie kicherte.
Seine Augen, schwarz wie Vogelkirschen, funkelten, seine Nase schien sich noch kecker aufzustülpen; er faßte die hübsche Frau um die Taille und drängte sie um die Ecke des Kapellchens, wo’s dunkel wurde.
Man hörte noch einmal rufen: »Anschela – Grittche!« Der Abendwind nahm den Ruf auf und trug ihn weit in die Runde. –
Die Büsche lagen unendlich friedlich im versöhnenden Zauberschein des ersten Maiabends.
Die Nachtigall sang ihr Liebeslied, wie sie es immer gesungen hatte um diese Zeit.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Der Markus, das war noch ein Heiliger! Peter Schommer versprach ihm zur nächsten Oktave eine Kerze, dick wie ein Kinderarm.
Der Winter war vorbei und die ersten Frühlingswehen hatten sich eingestellt – drinnen in der Werkstatt stand wieder die Wiege, aber kein Mädchen war’s dies Mal, der ersehnte Stammhalter schrie die Wände an.
Stolz stand Schommers mittags im Sonnenschein in der Haustür, schaute mit breitem Lächeln die Nagelgasse auf und ab und dann auf das Wickelkind in seinem Arm.
Die Äugelein funkelten schwarz wie Vogelkirschen in dem apfelrunden Gesichtchen über dem keck aufgestülpten Näschen.
Tränen gerührter Dankbarkeit in den wasserblauen Augen schmunzelte Peter Schommer: ganz der Vater! Gelobt sei der heilige Markus!
Das Miseräbelchen
veröffentlicht in »Kinder der Eifel«, 1897
Du lieber Gott, was für ein armseliges Kind war der Christoph Nepomuk! Er hatte einen Buckel auf dem Rücken und einen Buckel auf der Brust, die dünnen schlotternden Beinchen trugen den Körper kaum, und zwischen den hohen Schultern saß der dicke Kopf mit dem zwergenhaft alten Gesicht. Die Wangen so abgezehrt, so gelb, kein Hauch von Farbe auf ihnen! Um den Mund zogen sich tiefe Falten, ach, und die großen schwarzen Augen blickten nicht kinderfroh und unbewußt in die Welt; in ihrer traurigen Tiefe brannte ein unnatürlich glänzendes Licht, ängstlich flackernd wie die Totenkerzen am Allerseelentag.
Was nützte es dem Christoph Nepomuk, daß er zwei schöne Heilige zu Paten hatte?! –
Drunten im Tal lag die Stadt mit den vielen Kirchen und Türmen, und nicht weit von dem alten römischen Stadttor war der heilige Christophorus an die Mauer gemalt, riesengroß und prächtig, blau und rot; auf seinen Schultern saß das Christuskind, das hob segnend die Rechte. Und der zweite Pate, der heilige Nepomuk, der stand weit draußen im Böhmerland auf der Moldaubrücke, trug einen goldenen Sternenkranz ums Haupt, und die Schiffer beteten zu ihm.
Des Christoph Nepomuks Vater war auch ein Schiffer gewesen, aber nur ein Knecht, und sein Schiff war nicht flott gesegelt. Tagaus, tagein hatte er keuchend, den Riemen um die Brust, den Steinkahn die Mosel hinauf gezogen, die Erde mit Schweißtropfen netzend, die Lebenskraft tauschend für armseligsten Lohn. So war es gegangen, Jahr für Jahr, bis ihn einst die Kameraden nach Hause brachten, bewußtlos und röchelnd. Der Riemen hatte ihm was in der Brust zerquetscht. Da half kein Doktor und keine geweihte Kerze mehr; nach zwölf Stunden war er tot, die Witwe saß allein, blutarm und blutjung, und hatte ein zweijähriges Kind auf dem Schoß, das war ein unglücklicher Krüppel.
»En Miseräbelchen«, sagten die Leute. – Seitdem waren nun acht Jahre vergangen, acht Jahre voller Hunger und Not. Das blühende Weib war verwandelt; die frische Farbe, die jugendliche Rundung waren geschwunden; die sehnigen braunen Arme, der gekrümmte Rücken trugen schwere Lasten. Im Tragkorb schleppte die Ursel im Frühjahr den Dünger, den Schiefer auf die Weinberge, die so steil vom Fluß aufstiegen, daß sie aussehen wie senkrechte Mauern, an denen der Fuß mühsam einen Halt sucht. War sie nicht im Taglohn der Weinbauern, so suchte sie Beeren im Wald; Erdbeeren, Blaubeeren und in den Spalten der sonnigen roten Felsen würzige Himbeeren. Im Winter saß sie Abende und Nächte und band Besen, große und kleine, und am frühen Morgen ging sie den weiten Weg zur Stadt, irrte durch die Straßen und rief von Haus zu Haus: »Kaaft Besen, kaaft Besen!«
Das war ein schweres Brot, sie war oft müde und verdrossen, und wenn die Leute zu ihr sprachen: »Jao, wann dir nor dat Könd, dat Miseräbelchen net hätt, duh könnt dir Eich besser helfen« – so sagte sie nicht nein.
Kam sie dann nach Hause und sah das Miseräbelchen sie mit den schmerzlichen Augen an, so riß sie es wohl heftig an sich und küßte es; und am Sonntag kaufte sie von den mühselig abgedarbten Pfennigen ein dünnes Licht, das zündete sie in der kleinen Bergkapelle unter dem Muttergottesbild an, lag davor auf den Knien und betete: »Heil’ge Moddergott’s, bitt for ons! Heil’ge Moddergott’s, laoß hän baal en Engelche gänn!« Und damit meinte sie das Miseräbelchen.
Aber das tat ihr nicht den Gefallen. Es wurde kein Engel, trotz aller geweihten Kerzen; es wurde wohl alle Jahr elender und schwächer, aber es starb doch nicht.
Strich der Lenzwind über die Berge und küsste der warme Strahl der Sonne das erste Grün wach, dann kam des Miseräbelchens gute Zeit. Dann kroch es hervor aus seiner dunklen Höhle und hockte auf der Schwelle der Hütte, streckte die wachsgelben, durchsichtigen Hände der Sonne entgegen und wärmte sie; sie waren so eiskalt. Die jämmerliche kleine Gestalt saß Tag für Tag vor der niederen Tür, elend, verkommen, und ringsum lachte die Welt, so heiter, so lenzesfrisch wie am ersten Schöpfungsmorgen.
Unten im Tal schlängelte sich der Fluss in sanftem Bogen und spiegelte den Himmel in seinem klaren Blau; von den Bergen stürzten Kaskaden von Blüten, wie milchiger Schaum schimmerten die Obstbäume mit ihrem Blütenschnee. Und jenseits des Wassers lag die alte Stadt mit den grauen Schieferdächern, überglänzt von Sonnenschein. Die Glocken des ernsten Domes riefen die Gläubigen zur Maiandacht. Überall Frieden, Schönheit, Versöhnung. Selbst die armseligen Hütten des Dörfchens, die wie Schwalbennester an der Felswand kleben, lagen eingebettet in riesigen Blütensträußen; auf ihre Dächer hingen Goldregen und Flieder in duftenden Dolden, das nackte Elend mit üppiger Fülle verdeckend. Der Frühling erbarmte sich über die Höhlen der Armut; sie störten nicht mehr die Schönheitsharmonie, sie passten zu Amselruf und Nachtigallensang.
Aber unter den Blüten saß das Miseräbelchen, ein Missklang in der Schöpfung, ein Hohn auf die jubelnde Natur.
Des Kindes Blicke schweiften mit unbewusstem Staunen über Berg und Tal, den Fluss hinauf und hinunter; dann richtete es sich auf und kroch mühsam die Mauer entlang, an dem Stückchen Zaun vorbei, bis zur benachbarten Hüttentür. Da lag ein flacher Stein, auf den sank es nieder, und dann rief’s: »Toni! Josepha!« Die Stimme klang dünn und schwach, aber sie wurde doch gehört.
Aus der Tür sprangen zwei Kinder, ein sonnverbrannter Bube und ein flachshaariges Dirnchen, Bruder und Schwester, des Miseräbelchens treue Gefährten. Sie fassten den kleinen Krüppel in die Mitte; sie schleppten ihn ein Stück weiter, bis hinüber zu dem grünen Rasenfleck, auf dem die Kuckucksblumen blühten, Himmelschlüssel und Wiesenschaum, Hahnenfuß und Sonnenröschen.
Dort saßen die drei nieder. Die Josepha pflückte von den gelben Blumen, steckte die Stiele ineinander und machte eine lange Kette, die hing sie dem Miseräbelchen um den Hals. »Nau biste e su schien, Miseräbelchen«, sagte sie, »nau spille mer Prozession!«
Das waren glückliche Stunden für den Christoph Nepomuk. Er saß im warmen Sonnenschein auf dem weichen Rasen und spielte »heiliger Christophorus«. Der Toni und die Josepha zogen an ihm vorbei, langsamen Schritts, statt des Lichtes eine gelbe Blume in der Hand; sie plapperten und kreuzten sich, knicksten und beteten: »Heiliger Christophorus, bitt’ for ons! Heiliger Christophorus, laoß dat Miseräbelchen baal en Engelche gänn!«
Und das Miseräbelchen nickte seelenvergnügt mit dem Kopf; es war zu schön. Und als die Sonne sank, packten es die Kinder wieder und schleiften es zu seiner Tür zurück; sie meinten es sehr gut, aber sie rissen ihm beinah die Arme aus.
Noch einen Freund hatte der arme Krüppel, den liebte er fast mehr als den Toni und die Josepha. Das war der Peter, ein großer schwarzer Kater. Der hatte sich einst bei strömendem Regen in die Hütte geflüchtet, hatte dort Mäuse und freundliche Aufnahme gefunden und war geblieben. Damals war er ein junges Kätzchen, halberstarrt vor Kälte, halbtot vor Hunger und so elend, daß er dem Miseräbelchen glich; nun war er ein mächtiges Tier mit scharfen Krallen und bösen Augen. Eine Schönheit war der Peter noch immer nicht, die Knochen standen ihm verdächtig heraus, aber er war doch des Miseräbelchens größter Schatz, sein Freund, sein Gespiele, sein Reichtum, sein ganzes Glück. Dem Toni und der Josepha wurde es oft langweilig, still bei dem Krüppel zu sitzen; sie sprangen davon, mit den andern Kindern durch die Berge zu streifen oder in wilden Spielen auf der Gasse zu tollen. Wie Schwalbengezwitscher klang das Rufen und Lachen der Kinder von ferne; das Miseräbelchen saß allein auf der Schwelle und hielt seinen Peter im Arm, der schnurrte und rieb den dicken schwarzen Kopf an der abgezehrten faltigen Wange des Kindes. Beide starrten hinaus in die Luft. Der Kater sah mit den gläsernen grünen Augen unverwandt nach dem Vogelnest auf dem Baum, und das Kind blickte zum Himmel auf – ohne Wunsch, ohne Klage.