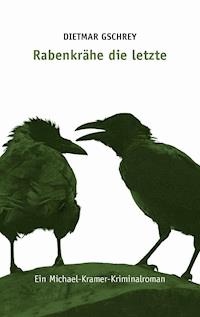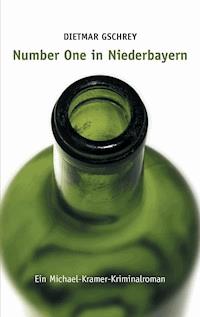
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Serie: Michael Kramer Kriminalromane
- Sprache: Deutsch
Jagdszenen in Niederbayern: Michael Kramer, ein pensionierter Lehrer, wird von einem ehemaligen, jetzt sehr vermögenden Schulfreund innerhalb kurzer Zeit in den Un-Ruhestand versetzt. Es geht um das mysteriöse Verschwinden eines Fuhrunternehmers. Anreize für die Metamorphose in eine männliche Miss Marple werden reichlich und großzügig angeboten. Begleitet wird der "Frauenversteher" Kramer von interessanten und raffinierten Frauen, für die er eine außerordentliche Schwäche, aber auch Stärke entwickelt. Er ist beim Lösen des seit Jahren ungeklärten Falles bereit, bis an die Grenzen zu gehen, bis hin nach Görlitz, an die deutsch-polnische Grenze und später grenzüberschreitend nach Griechenland. Auch wenn die Ermittlungsarbeiten ihm körperlich und seelisch viel abverlangen, er hat ein großes Faible für kulinarische Köstlichkeiten aller Art! Halbwelt, Rotlichtmilieu, Schwulenszene, Rechtslastige, frustrierte Wessi-Aufmischer - sein bisher beschauliches Beamten-Dasein erlebt das krasse Kontrastprogramm. Abrupt kommen ihm dabei immer wieder die leisen Töne dazwischen, dann entwickelt er sich nicht nur seinen Mit-Ermittlern gegenüber zum Seelentröster. Fäden laufen zusammen, Spuren, die schon verwischt waren, bekommen wieder Kontur. Spannung baut sich auf in unerwarteten Momenten. Heimatverbunden, authentisch, so webt sich ein rustikaler Flickenteppich zusammen, bei dem neben dem Kettfaden der Schussfaden durchaus wörtlich zu nehmen ist!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 562
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
»Selig die Zärtlichen«
Jesus in den Seligpreisungen (Mathäus 5,5)
Für Christa †
Herzlichen Dank für die selbstlose Unterstützung, ohne die der vorliegende Roman wohl nie fertig geworden wäre:
Monika Bumo, Uta Conrad, Rudi Eppinger, Erika und Georg Wessling, Daniel Jesch, Christine Metzger, Ingrid und Franz Jesch, Barbara Feuerstein-Weber, Christof Wessling, Josefine Bumo, Maria Hundsberger und vielen anderen.
Zu Autor und Buch
Der Autor ist Jahrgang 1941, in München geboren und hat wie der »Held« im vorliegenden Erstlingswerk seine Kindheit und frühe Jugend in Niederbayern verbracht. Danach absolvierte er in München eine technische Ausbildung, arbeitete als Facharbeiter und holte über den zweiten Bildungsweg das Abitur nach. Anschließend studierte er in München und Göttingen und arbeitete über 20 Jahre als Lehrer für Deutsch, Geschichte und Sozialkunde an einem Gymnasium der Stadt München sowie in der politischen Bildung für Heranwachsende. Die letzte Dekade seiner beruflichen Laufbahn leitete er das städtische Münchner Institut für die Fortbildung von Lehrkräften und Erzieherinnen/Erzieher.
Mit dem vorliegenden Kriminalroman erfüllte sich der Autor ein Versprechen für die ersten Jahre seiner Pensionszeit. Dabei hat er eine Erzähltechnik wieder aufgegriffen, die er bereits als Kind zusammen mit seinen Mitschülerinnen und Mitschülern auf dem langen Weg von der Schule nach Hause gepflegt hatte: ausgehend von realen Verhältnissen eine fantasievolle Geschichte zu entwerfen und dabei über die Schauplätze und die beteiligten Figuren frei zu verfügen. Das Ergebnis taugt also nicht als Reise- und Kulturführer für Niederbayern. Auch sind etwaige Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen ungewollt und rein zufällig. Allerdings dürfte dem Leserkreis des Kriminalromans trotz aller in diesem Buch enthaltenen Fantasiewelt die tiefe Verbundenheit des Autors mit Niederbayern, seinem »bayerischen Arkadien«, nicht verborgen bleiben.
Inhaltsverzeichnis
Der Kontrakt
Die Ermittlung
Nachlese
Niederbayerische Rupfhauben
Der Kontrakt
An dem Tag, an dem ich zum ersten Mal versuchte, die Erlebnisse während meiner Ermittlung als Gedächtnisstütze für eine spätere Bearbeitung stichwortartig zu Papier zu bringen, saß ich an einem nagelneuen Schreibtisch in einem ebenso nagelneuen Büro. Später sollte mich dann die Dramatik der Entwicklung daran hindern, regelmäßig Notizen zu machen, sodass ich gezwungen war, im Nachhinein viele Einzelheiten mühsam in Rücksprache mit Beteiligten zu rekonstruieren. Da mir dies aber von dem begleitenden Polizeipsychologen dringend ans Herz gelegt wurde, nahm ich diese Mühe – zunehmend zwanghaft – auf mich.
Meine ersten Notizen machte ich also an einem neuen Schreibtisch und dabei feixte ich über mich. Seit ich älter bin, bemühe ich mich nämlich um ein eher freundschaftliches Verhältnis zu mir. Um ein Verhältnis, das geprägt ist von Nachsicht. Die konnte ich auch gut gebrauchen, denn ich saß an einem nagelneuen Schreibtisch in einer Art nagelneuem Detektivbüro im tiefen Niederbayern mit Blick über das Dorf meiner Jugend und die Gegenhänge des Sulzbachtals. Genauer gesagt saß ich, und so stand es auch auf dem Messingschild außen an der Wand des einstöckigen Hauses, in einem »Büro für Ermittlungen im Auftrag der AW – Michael Kramer«. Blöd war nur, dass Michael Kramer, also ich, ein frisch pensionierter Beamter und Exlehrer war, der die Zeit seines ganz und gar unspektakulären bisherigen Erwachsenenlebens in der etwa 130 km entfernten Landeshauptstadt verbracht hatte. Und der mit Ermittlungen, auch und schon gar nicht im Zusammenhang mit einem verschwundenen Fuhrunternehmer, nichts, aber auch gar nichts am Hut hatte. Ich wollte eigentlich längere Zeit meine Seele baumeln lassen und wachen Sinnes darauf warten, was sich nach dem Abschluss des aktiven Beamtenlebens einstellen würde.
Was meine Nachsicht mit mir aber besonders herausforderte, war der Umstand, dass der Hundesohn von Alfons Schild und Büro etc. samt Einrichtung offensichtlich organisiert hatte, bevor er mich gestern abends, besser nachts, mit seinem verrückten Angebot überfiel. Die Einrichtung des Büros konnte sich übrigens, wie nicht anders zu erwarten, sehen lassen und trug deutlich die Handschrift des Architekten, der mich schon am Abend vorher verblüfft hatte: hellbrauner Schreibtisch aus exotischem Holz in L-Form, moderne Telefonanlage, Handy, PC, Aktenschränke, hypermoderner und wahrscheinlich sündteuerer ockerfarbener Schreibtischlederstuhl und ein ebensolcher Besuchersessel. An der Wand wieder eines jener farbenfrohen und raffiniert-naiv wirkenden Gemälde der Malerin, die auch in der Mühlenresidenz meines Schulfreundes dominiert hatten. Auf dem Parket natürlich Teppiche. Zwei zurückhaltende moderne Exemplare in gedecktem Grau und Grün und tatsächlich ein alter Afghane in jenem tiefen, fast schwarzen Rotton. Ich hatte Alfons vor gut zwei Jahren auf unserem letzen Klassentreffen davon erzählt, dass ich seit Langem von so einem Teppich träumen würde. Hundesohn, stinkreicher!
Es gab in diesem Büro übrigens auch ein komplett und geschmackvoll eingerichtetes »Empfangszimmer« mit zweitem Arbeitsplatz und für mich eine wunderschöne Zweieinhalb-Zimmer-Wohneinheit mit Luxusbad und Hochterrasse. Das Haus, irgendwie postmoderner Landhausstil, wie so viele in dieser Hangsiedlung, war wie fast alle Häuser hier schätzungsweise nicht älter als fünf Jahre. Der gepflegte Garten im Stil eines niederbayerischen Bauerngartens mit seinem Akzent auf Duft- und Heilkräuter tat an diesem Julinachmittag meiner gekränkten und zugleich amüsierten Beamtenseele gut. Durch das offene Fenster duftete es abwechselnd schwer nach Lavendel, Salbei und anderen Kräutern und dann wieder nach Rosen. Auch hier konnte ich, wie rund um die Mühlenresidenz, unter den über den Garten verstreuten Blumeninseln die seltenen alten dunkelroten Rosenarten ausmachen, von denen Alfons geschwärmt hatte. Und die, wie er sagte, der Hauptgrund waren, warum er sich »einen eigenen Gärtner hielt«.
Der Garten hier zog sich schätzungsweise doppelt so breit wie das Haus lang war dreißig bis vierzig Meter den Hang hinab. Der obere Stock des Hauses war der fehlenden Einrichtung nach unbewohnt, der Besitzer des Anwesens also mein Schulfreund Alfons. »Ein reines Abschreibungsobjekt«, wie er mit seiner penetranten und unechten Bescheidenheit wie nebenbei bemerkte. In Wirklichkeit war alles Teil seines Reiches und Teil eines ungemeinen Stolzes über Erfolg, Reichtum und Einfluss, der ihn jedes Mal, wenn er wie zufällig darauf zu sprechen kann, regelrecht übermannte. Aber ich muss versuchen, zukünftig Ordnung in meine Geschichte zu bekommen, die damals meinem keine fünf Tage alten Pensionistenleben eine völlig unerwartete Wendung und mir ungeahnte und darunter schöne, aber auch absolut hässliche und meine Existenz bedrohende Erfahrungen bescheren sollte.
Die Einladung überraschte mich exakt am Tag meiner Pensionierung zusammen mit den besten Wünschen für den Ruhestand. Wir hatten zusammen acht Jahre die Dorfschule besucht. Ich, der dickliche Junge Michael Kramer, der »Michi« gerufen wurde und als Flüchtlingskind galt, obwohl meine Mutter aus dem Dorf stammte. Sie war nach dem »Heldentod« meines Vaters in Stalingrad und der Zerstörung unserer Wohnung in der Hauptstadt durch alliierte Bomber mit ihrem kleinen Sohn bei entfernten Verwandten auf einem kleinen Hof eines entlegenen Weilers untergekommen, der zu ihrer ehemaligen Heimatgemeinde gehörte. Wir galten als arm und waren es wohl auch, obwohl ich mich beim besten Willen an keinen Mangel erinnern kann. Er, Alfons Weinberger, kleiner als ich, vierschrötig, muskulös, zäh und verwegen, gerufen »Fonsi«, war Sohn des Besitzers einer Mühle. Die Mühle überragte in einer zwei Kilometer bachabwärts liegenden und zur Gemeinde zählenden Ortschaft etwa zehn Anwesen, deren Besitzer zu unserer Schulzeit fast alle noch Landwirtschaft betrieben. Seine Familie galt als reich und war es wohl auch für die Verhältnisse unmittelbar nach Kriegsende.
Wir hatten die ganze Schulzeit hindurch ein eigenartiges Verhältnis zueinander. Mir fiel es leicht anzuerkennen, dass Alfons der Mutigere, der körperlich Geschicktere, bald der Erfolgreichere bei den Mädchen und immer der Reichere war. Auch dass die Mühle, die er später erben sollte, irgendwann in der fernen Vorkriegszeit meinem eigenen Großvater gehört hatte, nahm ich ohne Groll zur Kenntnis. Ich bewunderte ihn und seine Art, ohne so sein zu wollen wie er. Wenn es etwas Derartiges zwischen Kindern und Jugendlichen gibt, dann war mein Verhältnis zu Alfons geprägt von eben jener Nachsicht, die ich lange Zeit mir gegenüber eher vermissen ließ. Ich war immer darum bemüht, ihn nicht zu verletzen. Denn ich war alle acht Jahre hindurch unangefochten Klassenbester und Alfons wollte alle acht Jahre hindurch vergeblich Klassenbester werden. Und da ich instinktiv um seine Unterlegenheit auf diesem Felde wusste und zugleich seinen brennenden Ehrgeiz erlebte, wollte ich verhindern, ihn ganz zu verlieren. Denn obwohl wir viel zusammen waren, standen sein Ehrgeiz und damit seine tief empfundenen Niederlagen immer zwischen uns.
Ich erinnerte mich bei der Lektüre der ockerfarbenen Einladung auf, wie er schrieb, seine »bescheidene Mühlenresidenz«, plötzlich ganz plastisch an eine dieser Situationen, die so charakteristisch waren für unsere Beziehung während der Schulzeit. Wir sollten, wahrscheinlich in der siebten Klasse, einen Fantasieaufsatz schreiben, der uns als Jungen in der Steinzeit möglichst realistische Abenteuer erleben ließ. Während ich für meine Arbeit (wieder einmal) die bestmögliche Bewertung bekam, erhielt Alfons (wieder einmal) wegen mangelnden Realismus nur »befriedigend«.
Wie spannungsreich und auch belastend unser Verhältnis sein konnte, zeigt die nachfolgende Reaktion meines Schulfreundes. Seit Wochen diskutierten die Buben der Klasse heftig darüber, ob es möglich sei, mit einem Fahrrad den für uns grausam steilen Hang einer nahen Kiesgrube hinunterzufahren. Nach der Schule stürzte Alfons aus dem Gebäude, griff sich sein von uns so bewundertes gelbes und glänzendes »Jugendrad« (das Einzige im Dorf mit Gangschaltung!) und nahm demonstrativ und mit versteinertem Gesicht Kurs auf die Kiesgrube. Fast die ganze Klasse lief ihm hinterher, wobei ich in Panik als einziger voller böser Vorahnung den Weg hinunter zum Boden der Kiesgrube nahm. Am Rand der Kiesgrube angekommen, schwang sich Alfons ohne Zögern auf sein Rad und stürzte sich den mindestens zehn Meter hohen bedrohlichen Hang hinab. Ich sah noch aus einiger Entfernung mit stockendem Atem, wie er regelrecht hinunterfiel, wie nach dreiviertel der Strecke sein Vorderrad im Kies versank, Alfons sich überschlug und samt Fahrrad etwa zwei Meter vor dem Grund der Kiesgrube auf dem Hang aufschlug. Und dann rutschten Rad und Alfons gemeinsam die letzten Meter des Hanges hinab, gefolgt von einer ganzen Ladung Kies. Als ich bei ihm ankam, setzte er sich gerade sichtlich benommen auf. Ich sah, dass er heftig aus der Nase blutete und mit seinen Füßen im Kies steckte. Er tat mir unendlich leid und ich machte Anstalten, ihm zu helfen. Aber er schrie so laut er konnte, ich möge verschwinden, wobei ihm Tränen über das Gesicht liefen und sich mit dem Blut aus der Nase vermischten. Dann kämpfte er sich, immer noch schluchzend, mühsam aus dem Kies, befreite auch sein sichtlich lädiertes Fahrrad, kam beim dritten Versuch in den Sattel und radelte davon. Die Klasse applaudierte vom Rand der Kiesgrube aus, ich aber war am Heulen.
Nach der Schulzeit verloren wir uns aus den Augen. Mich verschlug es, wie gesagt, in die ferne Hauptstadt. Auf Umwegen landete ich schließlich bei einem Studium und später als Lehrer im Dienst der Landeshauptstadt. Alfons lernte das Müllerhandwerk, machte zusätzlich eine kaufmännische Ausbildung, erbte die väterliche Mühle und heiratete (wie ich später erfuhr) die Erbin zweier weiterer niederbayerischer Mühlen. Beim zwanzigjährigen, dreißigjährigen, vierzigjährigen und fünfzigjährigen Klassentreffen sahen wir uns wieder. Organisiert wurden diese übrigens vor allem von Alfons. Unser Verhältnis war immer noch seltsam zwiespältig. Ich beschloss, die überraschende und verwirrende Einladung anzunehmen. Überraschend und verwirrend auch noch deswegen, weil er mich darin aufforderte, »wenigstens einen vernünftigen Anzug« einzupacken und unter Umständen mit »einem mindestens mehrwöchigen Aufenthalt« zu rechnen.
Die Ankunft in der Alfonschen Mühlenresidenz am Tag der Einladung wurde zu einem unerwarteten Erlebnis. Wie immer hatte mir zuvor die Fahrt von der Hauptstadt zum Dorf meiner Kindheit und Jugend, die Fahrt also von Oberbayern nach Niederbayern, gut getan. Spätestens mit dem Erreichen des Rottales und damit der ehemaligen Kreisstadt Eggenfelden und dem Mittelzentrum Pfarrkirchen stellten sich nahezu irreale Heimatgefühle ein. Es war, als würde ich die Brille wechseln. Die Hügel z.B. des oberbayerischen Inntales um Mühldorf und Altötting, die Dörfer und Gehöfte, die Wälder, Wiesen und die Juli-Getreidefelder dort waren so verschieden nicht. Aber es war nicht Niederbayern! Ich ließ das irreale Gefühl zu, ich beobachtete es, lächelte ihm zu und machte ihm Mut. Wie gesagt, Nachsicht war angesagt.
Und dann die Ankunft an der »Mühlenresidenz«. Ich musste Jahrzehnte nicht mehr an diesem Ort gewesen sein. Ich hatte – wohl aus den Tagen unserer Schulzeit – einen relativ seelenlosen betongrauen mehrstöckigen hohen Bau in Erinnerung mit einer Art Durchfahrt für Fuhrwerke und bald Lastwagen. Der etwa hundert Meter entfernte Sulzbach, der sich in der Regel mit zwei bis vier Meter Breite bis heute offensichtlich weitgehend unreguliert durch das weite Tal schlängelt, war kurz vor einer Brücke zirka zwei Meter hoch angestaut. Über diese Brücke führte die Zubringerstraße aus der Ortschaft zu der etwas abseits gelegenen Mühle. Neben dieser Straße verlief ein von Büschen gesäumter natürlich wirkender Kanal in Bachgröße und verschwand unter der Mühle. Es gab wohl schon bald nach Ende unserer Schulzeit kein Wasserrad mehr, sondern Turbinen zur zusätzlichen Stromerzeugung. Hinter der Mühle, die ziemlich nah an der hier relativ steil aufsteigenden Süd-Ost-Flanke des Tales lag, stand damals mit ihr verbunden ein eher bescheidenes Wohnhaus mit einem bald asphaltierten Wendeplatz davor. Hier konnten die Fahrzeuge umdrehen, die in einer in der wohnhausnahen Seite der Mühle ausgesparten Durchfahrt mit Laderampen und dicken Füllrohren vorher abgefertigt worden waren. Auf diese Weise konnten sie über die einzige Zufahrt, die Zubringerstraße, die Mühle in Richtung Ortschaft wieder verlassen. Nach dem Wendeplatz erstreckte sich früher eine Art Aue mit Buschbestand und Wiesenflächen. Der Sulzbach führte mehrfach im Jahr Hochwasser, das durch solche Flächen davon abgehalten wurde, größere Schäden zu verursachen. Zu Hochwasserzeiten stand die Mühle früher übrigens öfters wie auf einer Insel und Alfons konnte dann wegen »Höherer Gewalt« nicht in die Schule gehen. Wir haben ihn damals gebührend beneidet.
Die moderne »Mühlenresidenz« hatte schon von der Ferne mit der alten Mühle fast nichts mehr gemein. Bereits auf der Straße zwischen Dorf und Mühlen-Ortschaft war ich an großen Hinweisschildern vorbeigefahren, die auf die »Kunstmühle und Futtermittelvertrieb Alfons Weinberger« verwiesen und Entfernungsangaben enthielten. Auf diesen in Ocker gehaltenen Schildern sah ich auch das Logo des Betriebes wieder, das ich von der ebenfalls ockerfarbenen Einladung her kannte: zwei schwarze Buchstaben, miteinander verschmolzen, ein großes A (für Alfons), dessen rechter Schenkel zugleich den linken Schenkel eines großen W (für Weinberger) bildet. Als ich mit meinem alten japanischen Mittelklassewagen auf die Zubringerstraße einbog, musste ich anhalten, um die offensichtliche Veränderung aufnehmen und irgendwie verdauen zu können. Vor mir lag jenseits des Baches ein völlig umgestaltetes Gelände. Ich machte eine ganze Reihe von Gebäuden aus. Alle hatten rote Dächer und einen ockerfarbenen Anstrich. Und alle trugen ein großes schwarzes Firmenlogo. Das alte mehrstöckige Mühlengebäude war offensichtlich von Grund auf renoviert, hatte ein rotes Walmdach bekommen und war eindeutig zum Wohnhaus, offensichtlich zur besagten Mühlenresidenz, umfunktioniert. Das Gebäude lag jetzt am Ende eines weiten Gartens. Dieser war umgeben von dem typischen Holzzaun alter Bauerngärten und erstreckte sich bis zu den Büschen und Bäumen des Sulzbachufers. Verwirrend war, dass an der Mühlenresidenz deutlich ein großes Wasserrad auszumachen war, das von mir aus gesehen links im letzten Drittel der gartenseitigen Wand des vierstöckigen Gebäudes eingelassen war und sich drehte. Es musste aber ein Wohnhaus sein, denn die sichtbaren Seiten wiesen viele und große Fenster- und Glasflächen auf, es gab Balkone und ebenerdig eine überdachte Terrasse, die neben dem Wasserrad auf den Garten führte. Das alte Wohnhaus war verschwunden und hatte einer langen Zeile von Betriebsgebäuden Platz gemacht. Der alte Wendeplatz war jetzt so lang wie die Gebäudezeile geworden. Ich zählte neun Lastwagen, bis auf zwei alle mit Anhängern, alle in Ocker und mit großem schwarzem Logo an den Seiten. Sie nahmen nicht einmal ein Drittel des gesamten Hofes ein. Den Abschluss des Platzes bildet offensichtlich eine neu gebaute Mühle, die der renovierten alten nicht unähnlich war. Hinter dieser neuen Mühle, die eine ähnliche Durchfahrt aufwies wie die vorherige sie einst hatte, verlief eine Straße, die im Bogen über eine relativ neu wirkende Brücke zur Ortschaft zurückführte. Ganz offensichtlich war Alfons im letzten Jahrzehnt wirtschaftlich wesentlich erfolgreicher gewesen, als ich angenommen hatte.
Aus der Nähe zeigte sich dann, dass die Durchfahrt der alten Mühle zugebaut worden war und die Zubringerstraße rechts an dem renovierten Gebäude vorbei zum Betriebsgelände weiter lief. Vier Stufen führten zu einem einige Meter mit roten Schindeln überdachten großen Podest vor einer sehr breiten, zweiflügligen und wie die Fensterläden unlackierten Eichentür mit alten, schweren Beschlägen. Davor ein Parkplatz für gut zwanzig Autos, dezent umrahmt mit einer halbhohen Hecke. Ich hatte mein wenig gepflegtes Auto in der hintersten Ecke abgestellt, weit weg von den beiden glänzenden Mercedes-Limousinen mit örtlichem Kennzeichen. Der weiße Kies knirschte beim Gehen wie in alten englischen Filmen. Insgesamt eine beeindruckende Kulisse, die wohl auch beeindrucken sollte. Fast zu viel des Guten und wahrscheinlich nicht ganz im Sinne des Architekten war dann die goldene Inschrift zwischen Überdachung und Haustürrahmen: »Mühlenresidenz A. Weinberger«!
Auf mein Klingeln öffnete ein junger und leger gekleideter Mann von etwa dreißig Jahren, für mich unschwer als Sohn des Hauses zu erkennen. Er erfasste offensichtlich meine Empfindungen, die durch die goldenen Lettern ausgelöst worden waren. Sympathisch lächelnd bemerkte er fast entschuldigend: »Das musste sein! War ein Herzenswunsch meines Vaters!« Er wirkte auf mich gesetzt und seiner selbst sicher. Ich beglückwünschte ihn im Stillen, dass er von seinem Vater durchaus den männlichen Charme, aber offensichtlich nicht den Zwang, sich ständig selbst beweisen zu müssen, geerbt zu haben schien. Er war mir auf Anhieb sympathisch. Wir standen in einer hellen, relativ hohen und breiten Vorhalle, vor uns große Eichen-Schiebetüren, rechts offensichtlich Toiletten und eine Tür mit Aufschrift »Garderobe«, eine weitere mit der Aufschrift »Privat«, linker Hand ein relativ schmaler Treppenaufgang. Verständlich, denn daneben folgte ein breiter gläserner Aufzug, daneben wiederum ein etwas kleinerer Aufzug mit der Aufschrift »Küche«. An der Wand vergrößerte und gerasterte Ansichten der alten Mühle im bräunlichen Farbton der ersten Fotos aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts. Ich erkannte als Vorlage für eines der Bilder ein altes Foto, dass sich auch unter dem Nachlass meines Großvaters befunden hatte und auf dem er zusammen mit einem schweren Bauernpferd vor der hölzernen Mühle zu sehen war. Der voraussichtlich zukünftige Erbe all dieses Reichtums staunte zunächst, als ich ihn als Erstes auf meinen Großvater hinwies. Bei dem anschließenden Gespräch stellten wir fest, dass wir dieselben Vornamen hatten, nur dass er dem Zeitgeist geschuldet »Mike« gerufen wurde. Er informierte mich, dass die Einladung in einer knappen Stunde hier hinter den vor uns liegenden Schiebetüren beginnen würde, nannte mir als meine Zimmernummer die 3/3 im dritten Stock (Mike: »Wie in einem Hotel!«) und wollte sich offensichtlich verabschieden. Er merkte aber, dass ich zögerte und hob erwartungsvoll die von Alfons geerbten buschigen Augenbrauen. »Ich habe eine Frage zur Etikette«, sagte ich. »Ich habe die Einladung eher als ironisch verstanden und wollte meinem Schulfreund mit gleicher Münze heimzahlen. Ich habe ein weißes Partyjackett, eine schwarze Hose und eine Fliege mitgebracht! Jetzt kommen mir allerdings Zweifel...« Der Unternehmernachwuchs grinste über das ganze Gesicht: »Keine Sorge, der Papa liebt alles, was vornehm aussieht! Ich bin sicher, er freut sich darüber.«
Danach trennten wir uns und ich schwebte mit dem chromglänzenden Aufzug in den dritten Stock. Das Gästezimmer 3/3 war geräumig, hatte ein großes Fenster über mehr als die Hälfte der Zimmerbreite mit herrlichem Blick auf den Sulzbach, die Mühlenortschaft und den Nordwesthang des Tales. Es gab auch einen kleinen, in die Fassade eingelassenen Balkon mit Tisch und zwei Stühlen. Über die Brüstung gelehnt konnte ich die beeindruckende Pracht des Weinbergerschen Bauerngartens betrachten, der an einen Klostergarten erinnerte. Die Einrichtung des Zimmers wurde dominiert von einem mächtigen abgelaugten alten Bauernschrank, dazu kontrastierten hypermoderne Chrommöbel. An der weißen Wand hingen zwei moderne Gemälde, auf denen mit etwas Fantasie Mühlenmotive zu erkennen waren. Sie waren von einer fast expressionistischen Farbigkeit und fügten sich hervorragend in die Einrichtung. Das Gästezimmer hatte auch ein modernes Bad samt Sitzwanne mit Whirlpool. Ich ließ dies alles auf mich wirken und freute mich über die gelungene Kombination von Alt und Neu. Dann begann ich mich für die Einladung schick zu machen. Ich nahm mir vor, auf alle Fälle das, was immer da kommen mochte, zu genießen. Und ich hatte vor allem einen gehörigen Hunger!
Meinen Hunger sollte ich allerdings zunächst völlig vergessen. Ich fuhr pünktlich und immer noch leicht verunsichert durch mein für mich ungewohntes Outfit mit dem Schnurrelift nach unten. Kaum aus dem Lift, bot mir schon im Vorraum eine relativ groß gewachsene, ausgesprochen attraktiv wirkende junge Frau mit roten Haaren, blassem Gesicht und auffallend großen Augen auf einem Tablett Getränke an. Sie trug ein graues Kostüm mit kleinem AW-Logo auf der Jacke und eine weiße Bluse. Ein Namensschild verriet, dass die an der Sprache als eindeutig niederbayerische Schönheit identifizierbare junge Frau Monika hieß. Ich entschied mich für Prosecco mit Orangensaft. Unauffällig suchte ich das Glas nach dem AW-Logo ab. Ich fand es, dezent eingeritzt am Fuß des Glases! Die Flügel der Schiebetüre waren in der Wand verschwunden. Nach ein paar Schritten öffnete sich mir der Blick in den Raum, aus dem vorher schon leise Musik und Stimmengewirr zu hören gewesen waren. Ich beschloss spontan, niemals mehr über das Gewese mit der »Mühlenresidenz« zu feixen: Ich stand am Eingang einer Wohnhalle, die sich ohne Probleme mit den Sälen einer Fürstenresidenz messen konnte! Rechts von mir diskutierte bzw. kommentierte etwa in der Hälfte der Raumtiefe eine Gruppe von Menschen mit Gläsern in den Händen vor einem großen Bildschirm, der in die Wand eingelassen war, offensichtlich einen Urlaubsfilm über Griechenland.
Der Raum umfasste zwei Stockwerke, ich schätzte seine Höhe auf etwa sieben bis acht Meter. Vom Grundriss her nutzte er von der Tür bis zur rückwärtigen Wand fast zwei Drittel des quadratischen Mühlengebäudes, während er in seiner Querausdehnung die ganze Breite der Exmühle einnahm. Alle gemauerten Wände waren weiß, die weiße Decke wurde von schweren dunklen Eichenbalken getragen. Beleuchtet wurde er durch einen breiten Glasstreifen in der gegenüberliegenden Wand, zahlreichen Fenstern und einigen großen Kunstlichtquadraten. Am spektakulärsten aber war die Wand links von mir, zumindest in Teilen. Sie war von mir aus gesehen etwa zwei Drittel der Tiefe des Raumes gemauert. Diese Wand entlang führte am Fußboden ein breites Podest, das kurz vor der Wand aus einem etwa einen Meter breiten Glasstreifen bestand.
Der Clou aber war das letzte Drittel dieser Wand. Es bestand nur aus dickem Glas und ragte wie eine riesige Vitrine fast drei Meter in den Raum hinein. Draußen vor dieser Glaswand drehte sich das Wasserrad, das mir aus der Ferne Rätsel aufgegeben hatte. Die Achse des fünf bis sechs Meter hohen traditionellen Wasserrades, das, wie ich bald erfahren sollte, dem Original aus der Zeit meines Großvaters nachgebaut worden war, lag genau auf der Höhe des Fußbodens der Wohnhalle. Um aber das Rad in seiner vollen Größe sehen und den Ablauf des Wassers kurz verfolgen zu können, war parallel zur Glaswand eine Vertiefung in den Wohnhallen-Boden von ca. vier Meter Breite und knapp drei Meter Tiefe angelegt worden. Die »Grube« (so Alfons später) war oben mit einem modernen bronzefarbenen Geländer mit ockerfarbener Lederauflage für die Betrachter gesichert und von der hinteren linken Ecke der Wohnhalle aus über eine Treppe aus demselben Material zu begehen. Das Wasserrad drehte sich auf einer sich nach oben hin verjüngenden Auflage, die sich dunkel vor der Glaswand abzeichnete. Das Wasser schoss offensichtlich unter dem Glasstreifen des Podestes vor der gemauerten Wand in der Wohnhalle hindurch, trat unter dem kurzen Schenkel der Glaswand ins Freie und stürzte auf das Wasserrad. Unter dem Wasserrad bildete sich ein schäumender und schwappender Abfluss von ca. 80 cm Tiefe. Das Wasser verschwand nach dem Ende des Gebäudes in einem großen Rohr, wurde neben dem Bauerngarten als Fischweiher gestaut und kehrte dann in den Sulzbach zurück.
Die letzten Angaben erhielt ich allerdings erst später in einer Art Lehrvideo zur Mühlenresidenz. Von meiner Position am Türstock der Schiebetür aus fielen als Einrichtung neben einer großzügigen Sitzgruppe in Ocker mehrere besonders große antike Schränke und Kommoden aus einem zu Beginn des 19. Jahrhunderts aufgelassenen bayerischen Kloster auf. Dazu eine riesige gedeckte Tafel mit, den Tischbeinen nach zu schließen, modernem hellem Holztisch, etwa fünfzehn dazu passenden modernen Stühlen, dezent graugrüner Tischwäsche und ganz schlichtem modernem Geschirr in Weiß. Ich fing gerade an, mich für den großen modernen Bronzeleuchter in der Mitte des Raumes (Mühlenmotiv dezent angedeutet) und die leuchtenden, raffiniert-naiven großen Bilder an den Wänden, die alle von derselben Künstlerin oder demselben Künstler stammen mussten, zu interessieren, als der Sohn des Hauses mich entdeckte. Also ging ich, vorbei an riesigen Pflanzen, mit dem Glas in der Hand zu der Gruppe von etwa zehn Personen, in deren Mittelpunkt mein Schulfreund Alfons stand.
»Da kommt unser Stargast!«, rief Alfons mir mit seiner sonoren und durch Gesang geschulten Stimme entgegen. Musik war übrigens das zweite Fach in unserer gemeinsamen Schulzeit gewesen, in dem ich ihm ebenso wenig wie in Sport das Wasser reichen konnte. Die Damen und Herren waren festlich gewandet, Vater und Sohn Weinberger trugen, welch ein Zufall, wie ich weiße Partyjacketts, schwarze Hosen und dazu eine Fliege. Der Rest meiner Befangenheit begann sich zu verflüchtigen, bevor ich auch nur einen Satz gesagt hatte. Ich fand kurz Zeit, Mike zuzuzwinkern, was der mit einem breiten Lächeln quittierte. Nachdem Alfons sich erkundigt hatte, ob alles in bester Ordnung sei, was ich zu dem Zeitpunkt nur bestätigen konnte, übernahm er das Kommando: »Die Vorstellungsprozedur wird am Tisch erledigt, wer ausgetrunken hat, geht mit mir! Die Damen vom AW-Service werden euch von den Gläsern befreien.«
Aus dem Hintergrund kamen vier recht unterschiedliche junge Damen, darunter auch meine Erstbekanntschaft Monika, alle etwa im gleichen Alter und alle im gleichen Kostümoutfit. Sie vermittelten trotz der Uniformierung mehr den Eindruck von Familienmitgliedern denn von lohnabhängigen Angestellten. Mir war auch nicht entgangen, dass einige der Herren bei der Bezeichnung »AW-Service« relativ unverhohlen feixten. Alfons legte mir den Arm um die Schulter und führte mich zur Tafel, unterwegs rief er, mit Leichtigkeit den Aufbruchlärm übertönend: »Im engeren Freundschaftskreis bei Weinbergers sagt man ›du‹, wie es in Niederbayern üblich ist!« Wieder ein Problem gelöst. Die deutlich lesbaren Tischkarten waren sogar mit Berufsbezeichnungen versehen. Bei mir stand unter meinem Namen »Lehrer und gescheiter Mann!« Ich musste mich kurz an unsere Klassentreffen erinnern, wo mir aufgefallen war, dass Alfons »gescheiter Mann« über jeden sagte, der ihn durch Worte oder Taten beeindruckt hatte. Ich nahm es also als Kompliment, wenn auch als verqueres. An eine weibliche Version dieser Auszeichnung konnte ich mich übrigens nicht erinnern – ich machte die katholisch-patriarchalische Tradition des geliebten Landstriches dafür verantwortlich.
Jedenfalls erfuhr ich dank der Tischkarten, dass ich zwischen Alfons und seiner Frau Sophie platziert worden war. Während Alfons konzentriert wartete, bis die erste Runde Weißwein durch den AW-Service den Weg in unsere Gläser fand und das zuletzt ankommene Ehepaar Platz genommen hatte, fand ich Zeit, mit Sophie Weinberger ersten Kontakt zu knüpfen. Ich schätzte sie um die Mitte fünfzig, sie hatte kurze, grau melierte Haare, gute Augen, war schlicht, aber stilvoll gekleidet, trug dezenten aber wahrscheinlich teuren Schmuck und machte offensichtlich kein großes Aufheben um ihre Person. Auf alle Fälle schien sie offen und unverkrampft, was sie mir ganz schnell näher brachte.
»Ich bin also der Lehrer und angeblich gescheite Mann!«
»Und ich bin Sophie, die – wie auf der Tischkarte steht – Ehefrau und Erbin zweier Mühlen! Der Humor meines Ehemannes ist manchmal etwas gewöhnungsbedürftig.«
»Und, hast du dich daran gewöhnt?«
»Ja, an den Humor und an den Ehemann. Man kann auch lernen, Gewöhnungsbedürftiges zu lieben!«
»Bin ich froh, dass dein Sohn offensichtlich die guten Seiten von euch beiden geerbt hat!«
»Kann es sein, dass du doch ein gescheiter Mann bist?!«
Kein schlechter Einstieg, mir kam es so vor, als wäre ich für wozu auch immer bei dem Rest der Familie Weinberger ganz gut aufgehoben.
Alfons begann mit seiner Begrüßung und mir dämmerte langsam, dass diese Einladung und diese Festlichkeit offensichtlich ganz und gar mir galten. Ich fing an, auf der Hut zu sein, weil ich es nicht begriff. Wollte er sich vor seinem engeren Kreis mit einem weiteren Akademiker schmücken? Da er mir am Anfang seiner Rede zuerst kurz alle Anwesenden vorgestellt hatte, wusste ich (wovon auch die Tischkarten zeugten), dass diese Runde Berufe wie »Notar«, »Architekt«, »Rechtsanwalt/Juristischer Berater«, »Pfarrer«, »Bürgermeister und Betriebswirt« mit Doktortitel, »Germanist und Journalist« und »Diplomsoziologin/Fachbuchautorin« schmückten. Da war ein Exlehrer wohl nichts, was besonders Eindruck machen konnte. Wollte er umgekehrt mich beeindrucken? Da hätte er wohl nicht so lange warten oder nur einen Blick auf mein verrostetes Auto werfen müssen. Gelegenheiten hätte es bei den Klassentreffen genug gegeben. Bis ich nicht genau wusste, was er eigentlich von mir erwartete, musste ich die Antwort offen lassen. Ich spürte aber ein gewisses Bedauern aufkeimen darüber, dass ich mir vor der Klärung dieser Fragen nicht die Entspannung gönnen konnte, die ich mir gerne vergönnt hätte.
Die Begrüßungsrede von Alfons war insgesamt launig und charmant, für mich aber stellenweise auch sehr peinlich. Er nannte als Anlass des Festes meine Pensionierung und pries dann wie eine Werbeagentur meine Eigenschaft als »gescheiter Mann«. Die Beispiele, die er dafür anführte, stammten zum großen Teil aus unserer gemeinsamen Schulzeit. Eines davon machte mich dann doch betroffen. Er kam ausgerechnet auf seine Sturzfahrt in die Kiesgrube zu sprechen, die er eine kindische und kindliche Trotzreaktion nannte, die »saudumm« hätte ausgehen können. Und als Beispiel meiner Klugheit verwies er darauf, wie ich als Einziger vorausschauend den Weg in den Kiesgrubenboden gewählt hatte, um bei Bedarf sofort helfen zu können. Auch er hatte also seine Erinnerungen!
Was mein Unbehagen aber steigerte, war die Tatsache, dass er eine ganze Reihe von Vorfällen aus meinem Berufsleben und selbst aus meinem kurzen Ausflug in die Politik eruiert hatte, die er ohne professionelle Nachforschung kaum in Erfahrung hätte bringen können. Und immer waren es Situationen, in denen meine Eigenschaft als angeblich »gescheiter Mann« für andere hilfreich und segensreich eingesetzt wurde. Ein Beispiel war etwa die telefonische Mitteilung einer pubertierenden Schülerin an für sie wichtige Personen, unter anderen auch an mich als einen ihrer Lehrer, sie stehe vor einer hohen Brücke und werde sich demnächst von dieser auf die Bahngeleise stürzen. Und dass ich ihr im Gegenzug empfohlen hatte, entweder zu springen oder mit mir abends in den Sportverein zu gehen. Die Polizei fand weder die Schülerin noch ihre Leiche, die Schülerin erschien aber pünktlich abends im Sportverein. Endlich kam Alfons dann zu einem vorläufigen Ende. Er und eine Reihe der anwesenden Freunde seien zu dem Schluss gekommen, dass so ein »gescheiter Mann« mit soviel Verstand, aber auch soviel Herz sich mit Sicherheit dem, wie noch zu sehen sein wird, selbstlosen Hilfegesuch seines alten Schulfreundes nicht entziehen werde. Und weil nach so langer Trennung dazu vorher noch Zeit zum Aneinander-Gewöhnen notwendig scheine, werde er erst nach dem Essen sein Anliegen und seine Bitte (und fast brach ihm die Stimme) vor all diesen lieben Menschen an mich heran tragen.
Während die anderen applaudierten, blickte ich in meiner Ratlosigkeit zuerst zu Mike und dann zu Sophie, erntete aber bei beiden nur Achselzucken. Seine Familie war also nicht informiert! Während ich noch darüber nachsann, wie das zu bewerten sei, klopfte der auf mich devot und untertänig (um nicht zu sagen leicht schmierig) wirkende Notar an sein Glas. Ausgerechnet dieser Typ war mit der Diplomsoziologin verheiratet, die nicht nur auf ihre Weise ausgesprochen hübsch war, sondern sich später auch noch als geistreich und charmant entpuppen sollte. Der Notar stand auf, nahm mich wie einen Geburtstagskandidaten oder einen Firmling ins Visier und hielt eine salbungsvolle Rede. Deren Quintessenz war: Wenn ein so geistreicher, erfolgreicher, selbstloser und willensstarker Mann wie Alfons Weinberger um Hilfe bat, dann konnten die Motive nur edel und lauter sein. Und ich hätte bei soviel moralischer Überzeugungskraft, aber auch Entschlossenheit eines Alfons Weinberger nicht die geringste Chance, seinem Wunsche nicht zu entsprechen.
Um dies zu untermauern, erzählte er die Geschichte von Alfons’ Rotweinmarke, die sehr wohl einiges über Alfons und seine Person verdeutlichte. Allerdings bot sie kaum Gelegenheit, daraus etwas über seine moralische Lauterkeit zu lernen: Alfons hatte von einem Spitzenwein aus Kalifornien namens »Opus One« gelesen, der eine Koproduktion eines berühmten kalifornischen Winzers mit der noch berühmteren Weinfamilie der Rothschilds aus Frankreich sei. Er ist daraufhin nach Amerika geflogen, habe den Wein für gut befunden und war wild entschlossen, eine entsprechende Menge dieses absoluten Spitzenweins zu ordern. Allerdings stellte er eine Bedingung, die wohl einmalig war. Er erwartete, dass ein gewisser Teil seiner Bestellung ein leicht abgeändertes Etikett bekommen sollte. All die Flaschen, die in den Räumen seiner Mühlenresidenz getrunken würden, sollten nicht »Opus One«, sondern »Number One« heißen dürfen. Er wollte damit zum Ausdruck bringen, dass in seiner Sparte in Niederbayern kein Betrieb und wohl auch keine Unternehmensleistung mit seiner AW vergleichbar sei, was doch wohl auch stimme. Der Winzer war ob dieses Ansinnen entsetzt, Alfons belagerte mit einer Reihe hoch qualifizierter, vor allem juristischer Fachleute (darunter auch der Redner!) mehr als drei Wochen lang die Winzerei. Am Ende gab es einen langen Vertrag mit exakt ausgehandelten Bedingungen und genauen Festlegungen, bei welchen Gelegenheiten dieses namentliche Unikat kredenzt werden dürfe, ohne saftige Konventionalstrafen zu provozieren. So eine Gelegenheit, die jeweils der Winzerei später mit einem von ihm, dem Notar, beglaubigten Protokoll berichtet werden müsse, sei übrigens heute! Ich solle Essen und Wein genießen und mich am Ende richtig entscheiden ...
Ich musste kurz durchatmen, stand dann aber, während noch geklatscht wurde, auf und antwortete knapp und ob der nervigen Theatralik und der insgesamt für mich absurden Situation nicht ganz ohne Irritation:
»Ich danke meinem Schulfreund herzlich für die Einladung und bin von vielem hier, wie könnte es anders sein, schwer beeindruckt. Ich danke auch für die schönen Worte, ich werde mir einige für meine Beerdigung merken (Gelächter). Ich kenne mich aber und weiß, dass ich ganz sicher nicht überdimensional ›gescheit‹ bin. Mein Leben ist wie das anderer auch voll von Fehlentscheidungen und Misserfolgen. Ich bitte dich Alfons, nicht Schulleistung mit Lebensleistung oder gar Lebensklugheit gleich zu setzen! Und zuletzt: Ich bedauere sehr, dass ich den angepriesenen Wein nicht so genießen kann, wie ich wünschte, weil ich sonst persönlich und juristisch in meiner später von mir offensichtlich erwarteten Entscheidungsfähigkeit beeinträchtigt sein würde. Und ich habe trotz allem jetzt großen Hunger und freue mich auf das Essen!« Schon wieder wurde geklatscht, ich spürte, wie Sophie kurz ihre Hand auf meine legte, was einfach gut tat, und bekam auch ein strahlendes Lächeln von Weinberger Junior. Die Runde (allen voran Alfons) prostete mir zu – und dann erschien der AW-Service und trug den ersten Gang auf.
Es folgten dann doch drei wunderschöne entspannte Stunden. Das lag einmal am Essen. Alfons hatte einen Starkoch aus dem fernen Passau engagiert, der ein irres Menü aus internationaler und niederbayerischer Küche kreiert hatte. Der Gipfel aber war der Rotwein »Number One« alias »Opus One«. Ich bin kein großer Weinkenner und auch kein großer Trinker, dies war aber unbestritten der beste und wohl auch teuerste Rotwein, den ich je kredenzt bekommen habe. Ich erlaubte mir, gegen den Widerstand des AW-Service in Gestalt von Monika, die offensichtlich vor allem das Ehepaar Weinberger und mich zu bedienen hatte, auch zum Fisch auf diesen Rotwein zu bestehen. Dass Alfons für teueres Geld darum gekämpft hatte, ihn »Number One« betiteln zu dürfen, machte mich immer noch sprachlos. Wäre doch nur er Klassenbester geworden! Im Hintergrund spielten übrigens bis spät in die Nacht hinein abwechselnd zwei Instrumental-Trios. Einmal eine recht bekannte und experimentierfreudige Volksmusikgruppe aus Passau und dann ein Zigeunerjazz-Trio mit einem fulminanten Geiger, das ich vor gar nicht langer Zeit im nicht weit entfernten oberbayerischen Jazzmekka Burghausen gehört hatte. Alfons lächelte nur auf meine Frage, woher er all die Hintergrundinformation zu meiner Person habe. Das Mühlrad und damit die ganze Glaswand waren jetzt dezent indirekt beleuchtet, was das Wasser noch grüner als bei Tageslicht erscheinen ließ. Mit dem Einschalten der Beleuchtung wurde auch das Wasser des Zubringerkanals unter dem Podest beleuchtet, sodass ein Lichtband über das Podest bis zum beleuchteten Wasserrad führte. Ein besonderer Effekt entstand, dass über eine Fernbedienung Texte auf diese Glaswand in die Fläche über und neben dem Mühlrad projiziert werden konnten. »Wasser spendet Leben!«, war der aktuelle Spruch des Tages. Bleibt noch zu erwähnen, dass auf dem Mega-Bildschirm gegenüber im Wechsel von etwa zwanzig Minuten verschiedene farbige Bilder von der Mühlenanlage und aus dem Landkreis gezeigt wurden. So hätte wohl auch ein Barockfürst in seiner Residenz, wäre er ins 21. Jahrhundert verschlagen worden, seine Feste inszeniert!
Schöne und anregende Stunden wurden es aber vor allem dank einer ganzen Reihe von höchst interessanten Menschen, die zu dieser Einladung meines Schulfreundes zusammengekommen waren. Alfons selber wirkte nach meiner Empfindung eher etwas angespannt und teilweise unkonzentriert. Ich vermied es, sein in Aussicht gestelltes »Anliegen« auch nur zu erwähnen. Unsere Gespräche kreisten während des Essens vor allem um die Mühlenresidenz und die Betriebsanlage der AW. Da uns der ungemein begeisterungsfähige etwa vierzigjährige Architekt des Ganzen, der aus dem niederbayerischen Simbach am Inn stammte, gegenübersaß, erhielt ich unter anderem Einblicke über die Lösung von enormen statischen Problemen beim Umbau und über die erfolgreichen Anstrengungen, mit einem Gemisch aus Wärmepumpen, Nutzung von Abfällen aus dem Mühlenbetrieb, Wasserkraft und Wärmeisolierung den Energieverbrauch so zu senken, dass für die gesamte Anlage bereits ein Umweltpreis des Regierungsbezirkes vergeben worden war. Als der Architekt dann von den Problemen mit dem Wasserrad und deren Lösungen berichtete, fielen mir Erzählungen über meinen Großvater ein, der vor über achzig Jahren an kalten Wintertagen mit einer großen Lötlampe versucht hatte, das Mühlrad vom Eise zu befreien. Und dabei regelmäßig in dieser feuchtkalten Lage zuerst gesungen, dann gebetet, danach geweint und zu guter Letzt geflucht hatte.
Ich bekam übrigens alle Informationen und noch mehr über die Mühlenresidenz später auf einem Demo-Video, das zur Verleihung des Umweltpreises gedreht worden war, noch einmal anschaulich auf dem Großbildschirm vorgeführt. Wobei außer der ganzen Technik darauf wenig vom Architekten, aber viel von Alfons zu sehen war. Der Architekt imponierte mir. Ich schätze Menschen, die sich für ihre Sache begeistern können, denen es dabei aber auch um die Sache geht. Wir vereinbarten für »später einmal« unter heftiger Zustimmung durch Alfons eine Betriebsführung durch die gesamte AW. Richtig wohltuend war bei diesem Architekten diese Kombination aus Intelligenz und erdigem Dialekt, die ebenso wie den Architekten viele dieser Menschen hier offensichtlich daran hinderte, Intellektuelle ohne Bodenhaftung zu werden.
Das galt im hohen Maße für Helga, die Frau des devoten Notars. Sie war auf dem besten Weg, eine echte Bedrohung für mein seelisches Gleichgewicht zu werden. Während wir uns nach dem Essen in zwanglosen Gruppen und umsorgt durch den AW-Service in der Halle verteilten, schlug ich ihr vor, doch eine soziologische Studie über niederbayerische Soziologinnen in Angriff zu nehmen. Da Mike wie selbstverständlich meine Nähe suchte, der Architekt alles andere als humorlos und auch der Rechtsanwalt und seine zu meiner Freude pferdenärrische Gattin sich als offene und sympathische Menschen entpuppten, hatten wir für die nächsten fünfzehn Minuten Stoff genug, uns die Inhalte dieser Studie auszuspinnen. Wobei sich der etwas resigniert, aber lebenserfahren wirkende »Germanist und Journalist« um die Fünfzig noch dazu gesellte. Sophie hielt sich mehr im Hintergrund, verfolgte unsere Blödelei aber sichtlich amüsiert. Alfons, der Bürgermeister, der katholische Pfarrer und der Notar bildeten längere Zeit eine eigene Gruppe.
Irgendwann kam dann in der Gesamtgruppe das Gespräch auf die Religion. Die mit großer Leidenschaft geführte Auseinandersetzung gab mir interessante Einblicke in das Denken eines Ausschnittes einer Art Oberschicht in einer zutiefst katholisch geprägten Region, in die erst nach 1945 mit den »Flüchtlingen« die ersten Menschen evangelischen Glaubens vorgedrungen waren. Alfons und ich hatten uns damals an das erste evangelische Mädchen in unserer Klasse angeschlichen und es beschnuppert, um zu erforschen, ob evangelische Mädchen anders riechen als katholische. Schließlich hatte uns unser Hochwürden von damals dringend davor gewarnt, mit diesen »Abtrünnigen« zu spielen. In der aktuellen Diskussion gefiel mir, nebenbei bemerkt, der amtierende etwa vierzigjährige Pfarrer, der viel von einem Sozialarbeiter hatte, ausgesprochen gut.
Alfons hatte sich die letzten Stunden eher von mir ferngehalten. Ich konnte ihn allerdings aus den Augenwinkeln oftmals dabei beobachten, wie er Monika ermahnte, sich ja um mich zu kümmern. Als er einmal dabei nah genug war, sagte Monika bewusst so laut, dass ich es hören musste: »Keine Angst, Alfons, schau doch hin, dem geht es saugut!« Ein scharfsichtiges Mädchen, offensichtlich, und alles andere als schüchtern. Alfons schaute zu vorgerückter Stunde öfter auf die verschiedenen Raumuhren, verschwand dann für etwa eine Viertelstunde und kam wieder mit einer eher bäuerlich und leicht verhärmt wirkenden rundlichen Frau um die Sechzig mit dunkler Kleidung und einer etwas überdimensionierten Handtasche. Es war mittlerweile kurz vor 11 Uhr abends. Der AW-Service hatte für den neuen Gast an der Tafel einen zusätzlichen Stuhl rechts von Albert platziert und bot außer Kaffee und Tee auch Süßigkeiten, Eis und Obst an. Auf einen Wink von Monika hörten die Jazzmusiker (wieder einmal) auf zu spielen. Alfons ergriff eine Tischglocke und nach kurzem Geklingel strebten alle Gäste zurück an die Tafel. Die Stunde der Enthüllung seines »Anliegens« und seiner »Bitte« an mich »vor all den lieben Menschen« war offensichtlich gekommen. Ich horchte in mich hinein und fand, dass ich mich trotz des genossenen Number One als »entscheidungsfähig« einstufen durfte.
Mit tiefernster Miene blickte Alfons längere Zeit schweigend in die Runde. Ich nahm mir fest vor, Sophie bei nächster Gelegenheit danach zu fragen, ob ihr Mann in den letzten Jahren an einem Manager- oder einem Rhetorik-Kurs teilgenommen hatte. In seinem weißen, sicher maßgeschneiderten Jackett, mit seinem grobknochigen Gesicht, den tiefschwarzen, mit wenigen grauen Fäden durchzogenen vollen Haaren, der immer noch fast schmalen Taille und dem muskulösen Oberkörper mit breiten Schultern erinnerte er mich figürlich an einen Navajo-Indianer. Allerdings war er auffallend blass, was wiederum seinen ungewöhnlich wandelbaren dunklen Augen unter buschigen schwarzen Augenbrauen enorm zur Geltung verhalf.
Mit einer Stimme, in der unterdrückte und kaum beherrschte Emotion mit schwang (Was war daran wieder echt!?) stellte er den neuen Gast dem »lieben Schulfreund« und den anderen »lieben Menschen in vertrauter Runde« als die »gute Freundin und verlässliche Geschäftspartnerin Anneliese Wiesinger« vor. Und sie, diese tapfere und vom Schicksal so hart getroffene Frau, sei der einzige und hoffentlich anerkennenswerte Grund für sein Ansinnen an mich. Wie ich sicher nicht wisse und einige im Raum eventuell schon vergessen hätten, sei der Riesenerfolg der AW, also auch alles, was hier zu sehen sei (große umschreibende Geste mit beiden Armen), fast ausschließlich dieser stillen und bescheidenen Frau zu verdanken. Er blickte ihr lange ins Gesicht, beugte sich dann zu ihr hin und küsste sie auf die Wange. Frau Wiesinger fühlte sich dabei sichtlich unwohl. Ich wartete darauf, dass sie samt großer Handtasche die Flucht ergriff, sie schien aber in der Tat eine tapferere Frau zu sein! Das Grausame dabei sei aber, fuhr Alfons mit bebender Stimme fort, dass es letztlich das Unglück von Anneliese Wiesinger war, das zum »Expandieren und dann Prosperieren« der AW geführt habe. Vor nunmehr knapp sieben Jahren sei ihr Mann, der geschäftlich erfolgreiche Fuhrunternehmer und als Mensch unvergessene Günter Wiesinger, von heute auf morgen spurlos verschwunden. Die Polizei und alle, die ihn gekannt hatten, gingen bis heute davon aus, dass es sich dabei nur um ein Verbrechen habe handeln können. Noch dazu, da eindeutig Blutspuren mit Günters Blutgruppe in seinem verlassenen Auto entdeckt worden seien. Vor allem ich als »gescheiter Mann mit soviel Herz und Verständnis« könne mir sicher vorstellen, was dies alles für eine Frau wie Anneliese Wiesinger bedeutet habe und bis heute bedeute. Ganz allein und verlassen, Kinder habe der liebe Gott Günter und Anneliese ja versagt, musste sie plötzlich das Leben meistern. Da sei einerseits diese schreckliche Ungewissheit gewesen, das Hoffen und Bangen, ob der geliebte Mann nicht doch wieder komme. Und andererseits musste ein großes Transportunternehmen für Futtermittel und Getreide mit etwa zwanzig Mann Belegschaft weitergeführt werden. Anneliese habe sich damals Hilfe suchend an Alfons gewandt, er habe sie daraufhin selbstverständlich eine längere Zeit bei der Betriebsführung unterstützt. Nachdem aber der Staatsanwalt ihren Mann »und unseren Freund Günter« für tot erklärt habe, sei das Fuhrunternehmen in der AW aufgegangen. Natürlich sei Anneliese heute finanziell abgesichert und auch am Jahr für Jahr steigenden Umsatz beteiligt. »Aber«, er wandte sich wieder direkt an mich, »du wirst verstehen, dass es grausam ist, nicht zu wissen, was eigentlich mit dem geliebten Manne passiert ist!«
Frau Wiesinger sah jetzt wirklich unglücklich und leidend aus. Und dann rückte Alfons endlich damit heraus, was er von mir wollte. Ich war wie vom Donner gerührt. Ich hatte schon fantasiert, ich solle die arme Frau adoptieren oder sie auf langen und von Alfons finanzierten Reisen begleiten, vielleicht ihr die neue Rechtschreibung erläutern oder gar Literaturkurse geben. Aber er wollte allen Ernstes, dass ich versuchte, den »Fall Wiesinger« nach sieben Jahren aufzuklären! Polizei und Staatsanwaltschaft hätten den Fall längst abgeschlossen. Er habe sogar »organisiert«, dass ich von behördlicher Seite jede erdenkliche Unterstützung bekäme. Und auch die Presse sei zur Zusammenarbeit bereit. Damit blickte er ans Ende der Festtafel zu dem müde und zugleich lebenserfahren wirkenden Germanisten und Journalisten, der übrigens Friedrich (Fritz) Jung hieß und jetzt brav mit dem Kopf nickte. Frau Wiesinger schluchzte in der Zwischenzeit in ein großes Taschentuch und ich verstand im Augenblick die Welt nicht mehr. »Es gab für mich keine andere Wahl, als unseren Klassenbesten darum zu bitten! Natürlich hätte ich auch Berufsdetektive beauftragen können. Aber die Polizei, die jahrelang mit einem Sonderkommando nach Günter und seinen Mördern gesucht hatte, sah darin absolut keine Aussicht auf Erfolg. Da bin ich auf dich gekommen. Ich habe, wie du gemerkt hast, mich etwas über dein Leben und Wirken schlaugemacht, was mich nur darin bestätigt hat, dich um Hilfe zu bitten. Natürlich sollst du das nicht umsonst machen. Im Gegenteil, solltest du Erfolg haben, geht es für dich um mehr als 250 000 Euro! Und wenn auch du nichts herausfinden kannst, dann können die arme Anneliese und auch ich wenigstens unseren Frieden finden bei dem Gedanken, dass wir alles, aber auch alles versucht haben, um Günters Verschwinden aufzuklären!«
Als ich unter Kopfschütteln endlich etwas sagen wollte, ließ er mich gar nicht erst zu Wort kommen: »Bitte, bitte, lieber Michael, bitte sage jetzt nichts. Ich habe dir von Friedrich Jung alles zusammenstellen lassen, was über den Fall bekannt ist. Friedrich steht dir übrigens morgen ab acht Uhr zur Verfügung. Ich habe dir weiter von unseren beiden Juristen eine Vereinbarung aufsetzen lassen, die ich dir im Entwurf ebenfalls heute schon übergebe. Darin ist alles geregelt, was aus unserer Sicht für deinen Auftrag geregelt werden musste. Beide Herren stehen dir ebenfalls ab morgen um acht Uhr zur Verfügung, wobei mein anwesender Freund und Rechtsanwalt Dr. Walter Klein, wenn es dir recht ist, deine Interessen vertreten und deine Wünsche und Änderungen vertragsgerecht formulieren wird. Um 11 Uhr treffen wir uns dann zu einem Brunch in unserem kleinen Sitzungsraum schräg gegenüber im ersten Gebäude!« Es folgte dann noch einmal ein eindringliches, wieder mit bebender Stimme gesprochenes »Bitte, lieber Michael, mach es, du bist Annelieses und meine letzte Hoffnung in dieser Sache!« Und wie auf Kommando erhob sich Frau Wiesinger, verweint und aufgelöst. Sie blickte auf den Tisch, stammelte ein kaum hörbares »Bitte helfen Sie mir!«, und stolperte hölzern und schluchzend aus der Halle – gefolgt von der besorgt wirkenden Sophie.
Es folgte betretenes Schweigen. Alle warteten offensichtlich auf eine Reaktion von meiner Seite. »OK«, sagte ich, nachdem ich mich wieder im Griff hatte, »ich wünsche mir noch ein halbes Glas Number One und die Unterlagen. Sollte noch ein Rest da sein, möchte ich zum Ausklang eine kleine Portion von der Rottaler Mehlspeisen-Spezialität namens ›Rupfhauben‹ essen und von der Jazzband will ich bitte nochmals die Ballade hören, die sie zuletzt gespielt hat. Morgen um sieben Uhr möchte ich dann bitte telefonisch geweckt werden, um acht Uhr will ich mich in meinem Zimmer, wenn es geht, zum Frühstück mit Friedrich Jung treffen und um 9.30 Uhr ebendort mit dem Herrn Rechtsanwalt. Weiter wünsch ich mir, dass bei dem Treffen um 11 Uhr auch Mike dabei sein kann!«
Die Anspannung im Raum löste sich in Applaus auf. Nachdem Monika bereits wusste, dass noch genügend Rupfhauben in der Küche waren, schlossen sich alle meinem Essenswunsch an. So kam bei Rotwein und aufgewärmter Rottaler Spezialität noch ein kurzes, aber trotz meiner inneren Anspannung für mich gemütliches Mitternachtsessen zustande. Alle meine übrigen Wünsche wurden zugesagt bzw. sofort erfüllt. Die Band musste in der verbleibenden Zeit die Jazzballade noch drei Mal spielen. Alfons schien zwar überhaupt nicht begeistert darüber, dass ich mir seinen Sohn als weiteren Teilnehmer der 11-Uhr-Sitzung ausbedungen hatte. Da Mike aber sofort zugesagt hatte, ließ er seine offensichtlichen Bedenken jedoch unausgesprochen – und so war auch dies abgemacht. Nach dem letzten Bissen Rupfhaube verabschiedete ich mich von Gastgebern und Gästen, wobei Sophie immer noch besorgt wirkte und Mike wieder einmal hoch amüsiert zu sein schien. Ich fuhr mit dem Schnurrelift zu Zimmer 3/3. Dort warf ich meine Unterlagen auf den Schreibtisch, duschte lang und ausgiebig, legte mich in das Chrombett und schlief traumlos, bis mich um sieben Uhr über Telefon die Stimme der niederbayerischen Schönheit Monika weckte. Sie wünschte mir nebst einem Guten Morgen auch noch einen »wunderbaren Tag und eine richtige Entscheidung«! Auf meine schlaftrunkene und fast schon unhöfliche Gegenfrage, ob denn das für sie irgendwie von Bedeutung sei, raunte sie: »Und ob!« Auch dieser Montag begann also mit einem Geheimnis.
Noch im Schlafanzug machte ich mich an die Lektüre des Vertragsentwurfes. Ich wollte zunächst an die Absurdität des Ansinnens gar nicht denken. Mir wurde für maximal fünf Monate ein generöses Angebot unterbreitet. Für meine »Ermittlungsarbeit« würden mir ein komplett ausgestattetes Büro, eine »angemessene« Wohnung, eine »Assistenzkraft« und ein kostenloses neuwertiges Dienstauto Marke Suzuki Vitara in Aussicht gestellt. (Wieder typisch für meinen Schulfreund Alfons! Wir kamen während unseres letzten Klassentreffens auf Autos zu sprechen und ich hatte von diesem relativ kleinen und handlichen Geländewagen in Weiß mit grauer Lederpolsterung geschwärmt.) Zudem bot der Vertrag ein Spesenkonto, Lebensunterhaltskosten mit eingeschlossen, von zunächst 10 000 Euro pro Monat. Sollten höhere Spesen notwendig sein, könnte kurzfristig eine »Spesenkommission« aus Alfons, den beiden Juristen und dem Journalisten zusätzliche Spesen genehmigen. Bei Nichterfolg meiner Ermittlungen verblieben mir das »Dienstauto« und 5000 Euro »Abfindung«. Bei einem Erfolg aber winkten tatsächlich nebst Auto 250 000 Euro »nach Abzug der Steuern«! Es sei übrigens juristisch abgesichert, dass mein Pensionsanspruch dadurch keinerlei Einbußen erfahren würde. Ein entsprechendes Schreiben der zuständigen Behörde der Landeshauptstadt war als Anlage beigelegt. Alfons musste also mit der Vorbereitung hinter meinem Rücken mindestens vor einem Jahr begonnen haben! Von mir wurde im Gegenzug eine enge Zusammenarbeit mit dem »Auftraggeber und AW-Eigentümer« und auch in Abstimmung mit diesem eine ebensolche Zusammenarbeit mit der örtlichen Presse erwartet. Ich hätte mir denken können, dass Alfons diese von ihm offensichtlich als soziale Tat eingestufte Aktion entsprechend vermarkten würde. Zum Glück war mir Friedrich Jung mit seiner leicht resignativen Art ausgesprochen sympathisch. Bei der Gelegenheit fiel mir ein, dass gestern außer dem zurückhaltenden Bürgermeister keine Politprominenz anwesend gewesen und das Thema Politik von Alfons bewusst gemieden und, wo es drohte, sogar abgewürgt worden war. Natürlich war Alfons Kreisvorsitzender der seit Jahrzehnten regierenden Landespartei und zugleich auch stellvertretender Bezirksvorsitzender obendrein. Da wir auf unseren Klassentreffen politisch oft andere Einschätzungen hatten, wollte er wohl jede Verstimmung vermeiden. Im Zusammenhang mit der Presse fehlte mir im Vertragsentwurf übrigens eine Regelung, wie bei unterschiedlicher Meinung zwischen Alfons und mir über die Art der Kooperation mit der Presse zu verfahren sei. Ich machte mir für alle Fälle entsprechende Notizen. Ich konnte übrigens zu jeder Zeit während der fünf Monate das Vertragsverhältnis kündigen, hätte dann aber auf Auto und Abfindung verzichten müssen. Ein vorzeitiges Kündigungsrecht der AW war seltsamerweise nicht vorgesehen.
Erst gegen Ende des Vertragstextes und kurz vor der Angabe des Gerichtsstandes kam die Leistung zur Sprache, die ich erbringen sollte: Ich sollte Ermittlungen führen über den Verbleib oder die Art und Umstände des Todes von Herrn Günter Wiesinger, Fuhrunternehmer aus Peterskirchen, Niederbayern, der seit dem 25. August 1997 verschollen und seit dem 5. November 1998 auf Antrag seiner Ehefrau Anneliese Wiesinger per Gerichtsbeschluss für tot erklärt worden wäre. Sollte Herr Wiesinger durch »Fremdeinwirkung« zu Tode gekommen sein, gehöre die Ermittlung der beteiligten Personen zum Umfang des Auftrages. Ob die Leistung von mir erbracht sei, entscheide spätestens nach fünf Monaten eine Kommission, die fast zusammengesetzt war wie die Spesenkommission. Allerdings, was ich sehr fair fand, war für diese Kommission keine Vertretung der AW, also kein Alfons, sondern an deren Stelle der katholische Pfarrer der Gemeinde vorgesehen. Die in Aussicht gestellte Erfolgsprämie bzw. das Geld für die Abfindung und die Summe für die angesetzten Spesen seien auf einem Treuhandkonto deponiert, das von den beiden Juristen der AW unabhängig verwaltet werde. Der PKW gehe mit Vertragsunterzeichnung in meinen Besitz über, allerdings gab es die besagte Klausel, dass er an die AW zurückfiele, wenn ich frühzeitig das Vertragsverhältnis kündigen würde. Die anfallenden Kosten für den Geländewagen würden, solange das Vertragsverhältnis bestehe, vom Auftraggeber übernommen. Dieser schließe zusätzlich für mich als Begünstigtem für die fünf Monate eine Risikoversicherung (Unfall, Invalidität und Tod) mit einer Deckungssumme in Millionenhöhe ab. Der entsprechende Vertrag liege bei und müsste mit unterzeichnet werden.
Endlich durfte ich ohne Widerspruch von Alfons meinen Kopf schütteln, so lange ich wollte. Nur beim anschließenden Zähneputzen, Duschen und Ankleiden erwies sich dies als hinderlich. Number One alias Opus One hatte übrigens keine Spuren hinterlassen, was ich von ihm auch hatte erwarten dürfen. Natürlich konnte ich das viele Geld und das Wunsch-Auto gut gebrauchen. Selbst wenn die Ermittlungen wie zu erwarten erfolglos verliefen, ging ich ja alles andere als leer aus. Und sollte das Unerwartete tatsächlich eintreten und ich würde diesen Wiesinger oder seine Mörder finden, könnte ich lange Zeit davon zehren. Ich könnte eine soziale Tat vollbringen (Der gute Mensch in mir meldete sich zu Wort!) oder meine langsam verfallende Hütte in Griechenland endlich renovieren lassen und nicht bis ans Lebensende Beton bewegen, Steine schleppen, Mauern aufrichten usw. (Dies war mehr die ich- und lustorientierte Seite, die da sprach!).
Da es fast acht Uhr geworden war, griff ich mir noch kurz den Fallbericht von Friedrich Jung. Er umfasste über fünfzig Seiten und begann mit einem langen Abschnitt über die Person und die Lebensumstände von Günter Wiesinger, um dann im Hauptteil die Ermittlungsergebnisse mit jeweils »offenen Fragen« als Fußnoten darzustellen. In der Kürze fiel mir nur auf, dass G. Wiesinger wohl kaum der sympathische Mensch gewesen sein konnte, als den ihn Alfons gestern verkauft hatte. Mir wurde bald klar, dass ich unabhängig vom Fall und den mageren Erfolgschancen mich fragen musste, ob ich grundsätzlich die erste Zeit meiner taufrischen Pension wenigstens um den Preis von 5000 Euro und eines neuen Autos als Ermittler verbringen wollte. Ich versetzte mich selbst in Erstaunen, als ich merkte, dass meine Mauer an Abwehr und Entrüstung über das widersinnige Angebot erste Risse zu bekommen schien. Das konnte ja heiter werden!
Vorerst einmal kamen pünktlich um acht Uhr Friedrich Jung und bald darauf Monika-AW-Service mit Servierwagen voller Frühstück. Nachdem sie das angenehm leichte Frühstück aufgedeckt hatte, machte mir Monika hinter dem Rücken von Jung durch Gestikulieren – in diesem Kulturkreis durch gebetsähnliches Falten der Hände! – nochmals klar, ich möge mich ja in ihrem und Alfons’ Sinne entscheiden. Ich ging hypothetisch davon aus, sie würde bei meiner Annahme des Deals eine Prämie oder eine Gratifikation anderer Art, z.B. einen verlängerten Urlaub oder dergleichen, bekommen.
Das Frühstück war gut und das Gespräch mit Friedrich Jung entspannt, offen und angenehm. Jung gestand gleich zu Anfang, dass auch er von Alfons eine allerdings kleine Erfolgsprämie bekommen würde in Form eines Urlaubs für zwei Personen auf den Kanaren. Ich musste lächeln und erzählte Jung meine Fantasien über die Gründe von Monikas werbendem Eifer. Er informierte mich weiter, Alfons habe es bei seinem Chefredakteur durchgesetzt, dass er, Jung, bei der Übernahme der Ermittlungstätigkeit durch mich die nächsten fünf Monate primär auf diesen Vorgang »angesetzt« sei. Er vermittelte dabei den Eindruck, als könne ihn nichts mehr überraschen. Wir waren uns beide sehr schnell einig in der Ablehnung eines anspruchslosen Sensationsjournalismus. Wir diskutierten die möglichen Hilfen, die er und seine Zeitung gegebenen Falls für mich sein könnten und zugleich die Probleme, die in der Veröffentlichung des Ermittlungsprozesses lagen.
Ich bedankte mich für den ausführlichen Fallbericht und kündigte an, dass ich diesen, sollte ich den verrückten Job übernehmen, als Erstes gründlich studieren wollte. Wir würden uns dann sicher mehrmals treffen müssen, wobei wir dabei ohne Skrupel die AW-Spesen verprassen könnten. Ich würde dabei auf seine, Jungs, Kenntnisse der gastronomischen Situation im Landkreis setzen! Dies war eine Aussicht, die selbst in seine müden Augen einen gewissen Glanz zu zaubern vermochte. Ich bat ihn auch noch um eine Einschätzung meiner Erfolgschancen, die er ohne Wenn und Aber als aus seiner Sicht »nicht vorhanden« bezeichnete. Er würde aber die Aufgabe an meiner Stelle, wenn er dazu sich äußern dürfte, trotzdem übernehmen. Sie sei, wie ich ja selbst gesagt hätte, absurd wie die Welt insgesamt, und deswegen für mich, so wie er mich einschätze, in meiner Situation nachgerade ein Glücksfall. Aha! Und nachdem er noch ein wenig herumgedruckst hatte, zog er einen schmalen, wie sich herausstellte im Eigenverlag erstellten Gedichtband aus der Brusttasche seiner leicht abgewetzten Cordjacke und schenkte ihn mir mit einem schiefen Lächeln. Das kleine Buch hatte den absolut zu seinen letzten Ausführungen passenden Titel: »Verrückte Welt«.
Da nach diesem Arbeitsfrühstück noch etwas Zeit bis zum Treffen mit dem Juristen Dr. Klein war, erging ich mich ein Stück den Sulzbach entlang. Mir fiel plötzlich ein, dass just in dieser Mühle meine längst verstorbene Mutter geboren worden war. Und ich verspürte für ein paar Sekunden an diesem sonnigen Julimorgen jenen satten Einklang mit dem was war und ist – und wie es war und ist. Ich versuchte, diesen Moment voll auszukosten und so langsam verklingen zu lassen, wie irgend möglich. Es gibt nicht all zu viele davon! Ich hatte plötzlich so eine Ahnung, dass es nicht gar so wichtig war, wie ich mich entscheiden würde.
Auch der Jurist Dr. Walter Klein kam, wie nicht anders zu erwarten, pünktlich wie vereinbart um 9.30 Uhr auf mein Zimmer 3/3. Er wirkte ausgeschlafen und jugendlich und vermittelte den Eindruck, als würde er sich auf dieses Gespräch freuen. Er begrüßte mich mit »Guten Morgen, Herr Ermittler!«, entschuldigte sich aber sofort. Er wolle dem Ausgang der Angelegenheit, der allerdings seiner Meinung nach schon fest stand (Vertiefung der Lachfalten im rundlichen Gesicht!), nicht vorgreifen. Er wurde dann aber sehr schnell sachlich und ich wandte die Methode an, die mir zum Verständnis juristischer Probleme bisher fast immer geholfen hatte: »Was passiert, wenn...?« Das heißt, ich fragte ihn z.B., was passieren würde, wenn Alfons in der Vertragszeit etwas zustoßen würde. Die Antwort lautete knapp und klar: »Keine Beeinträchtigung des Vertragsverhältnisses, bei Erfolg Auszahlung der treuhänderisch verwalteten Prämie. Also selbst wenn Alfons in der Zwischenzeit Pleite machen würde, wären Auto und Euros in deinem Besitz.« (Lachfalten in Aktion!) Auf diese Weise gingen wir den Vertrag und später auch noch die Versicherungspolice durch. Er musste laut lachen, als ich ihm meine (»gesetzt den Fall«) Ergänzungswünsche hinsichtlich Pressebeteiligung erläuterte. Es war genau das, was beide Juristen Alfons vorgeschlagen hatten. Dieser hätte aber gemeint, wenn ich nicht selber darauf kommen würde, wäre ihm die Nicht-Regelung im Entwurf lieber.
Bei der Gelegenheit erfuhr ich von Dr. Klein, dass er gerade noch mit dem AW-Eigner kurz gesprochen habe und dieser völlig atypisch »nervös und zappelig sei wie ein Kind vor der Weihnachtsbescherung«. Der Mann gab Rätsel auf – wir waren uns darin einig. Ich bat ihn noch um eine kurze Einschätzung des Notars, da er, Dr. Klein, ja heute mein »Rechtsbeistand« und Berater war. »Juristisch einwandfrei, brillant und absolut zuverlässig – menschlich eher ein Ekel und bigott wie selten ein Mann in Niederbayern!« Mein neuer Rechtsbeistand gefiel mir. Ich gestand ihm noch, dass ich liebend gerne, sollte ich den Job ... (Lachfalten!), mir für diese Zeit ein zuverlässiges, aber durchaus temperamentvolles Pferd ausleihen und dies über das AW-Spesenkonto finanzieren wollte. Als Antwort bekam ich zu hören, dass dies wie fast alles bei Alfons Weinberger schon vorgeplant und sogar mit seiner, Kleins, pferdeverrückten Frau geklärt sei. Sie hätte da sicher etwas Passendes im Stall stehen, die Finanzierung über das Spesenkonto sei ganz im Sinne von Alfons Weinberger.