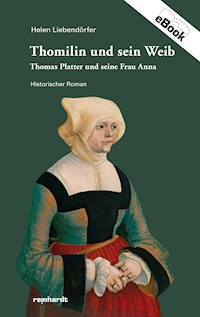Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Friedrich Reinhardt Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Mit Matthäus Merian und seiner Familie beleuchtet die Autorin Helen Liebendörfer in ihrem siebten historischen Roman die Zeit des 17. Jahrhunderts. Der in Basel geborene Kupferstecher hat mit viel Geschick seinen Verlag durch die kriegerischen Zeiten geführt. Acht Kinder schenkte ihm seine Frau Maria, zwei Kinder seine zweite Frau Sibylla und fast alle hatten das Talent ihres Vaters geerbt. Berühmt wurden vor allem Matthäus Merian d.J. und Maria Sibylla Merian. Sorgsam auf Fakten aufbauend und mit Fiktivem gemischt entsteht ein eindrückliches Bild der Familie Merian und der Zeit des Dreissigjährigen Krieges.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Helen Liebendörfer
Nun erst recht!
Matthäus Merian und seine Familie
Historischer Roman
Titelbild: Maria Sibylla Merian, Cédrat et arlequin de Cayenne, ca. 1701–1705, aquarelle gouachée sur vélin 36 x 27 cm, Londres, British Museum.
Alle Rechte vorbehalten
© 2020 Friedrich Reinhardt Verlag, Basel
Projektleitung: Claudia Leuppi
eISBN 978-3-7245-2485-4
ISBN der Printausgabe 978-3-7245-2434-2
Der Friedrich Reinhardt Verlag wird
vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag
für die Jahre 2016–2020 unterstützt.
www.reinhardt.ch
Wir danken für die freundliche Abdruckgenehmigung der Fotos. In einzelnen Fällen konnten die Rechteinhaber nicht ermittelt werden. Wir bitten um Hinweise an den Verlag, allfällige Honoraransprüche werden gerne abgegolten.
Inhalt
VORWORT
TEIL I
1. KAPITEL
2. KAPITEL
3. KAPITEL
4. KAPITEL
5. KAPITEL
6. KAPITEL
7. KAPITEL
TEIL II
8. KAPITEL
9. KAPITEL
10. KAPITEL
TEIL III
11. KAPITEL
12. KAPITEL
13. KAPITEL
14. KAPITEL
15. KAPITEL
16. KAPITEL
NACHTRAG
MATTHÄUS MERIAN UND SEINE FAMILIE
BIBLIOGRAFIE (AUSWAHL)
BILDNACHWEIS
AUTORIN
VORWORT
Die beste Möglichkeit, die Person des Kupferstechers und Verlegers Matthäus Merian etwas zu fassen und Rückschlüsse auf seinen Charakter zu ziehen, bieten die Werke von Lukas Heinrich Wüthrich. Abgesehen von der ausgezeichneten Biografie hilft vor allem die Herausgabe von Merians Briefen, wenn auch nur wenig persönliche Bemerkungen darin zu finden sind.
In Kleinbasel geboren und aufgewachsen, verfolgte Merian seine Pläne sehr zielgerichtet. Später, als Verleger in Frankfurt, kommen sein Kaufmannssinn und seine nüchterne Klugheit zum Tragen. Sein grosses Geschick als Geschäftsmann und seine vornehme Zurückhaltung, trotz der unbestritten grossen Leistungen, könnte man als typisch baslerisch bezeichnen. Vom sprichwörtlichen Basler Humor findet sich jedoch nichts. Das ist einerseits auf den offiziellen Charakter der Briefe zurückzuführen, andererseits auch aus der Zeit heraus verständlich, denn die grosse Not und das unsägliche Leid der Bevölkerung im Dreissigjährigen Krieg belasteten alle schwer. Besonders auffallend ist Merians Gottvertrauen. Sein Glaube, dass seine Arbeit Gott gefällig sei, wurde während der langen, schweren Zeit des Krieges von ihm nie in Zweifel gezogen.
Im Roman sind Authentisches und Fiktives gemischt, wobei ich versucht habe, mich möglichst genau an die Fakten zu halten. Hingegen ist die Figur der Magd Lisa frei erfunden, ebenso die Magd Olga. Alle andern mit Namen erwähnten Personen gehörten zum Umfeld der Familie Merian.
Helen Liebendörfer
TEIL I
Matthäus Merian (Stich von Sebastian Furck)
1. KAPITEL
Eigentlich wollte er nicht fort von Basel! Matthäus Merian sass am Werktisch und starrte mit seinen dunklen Augen auf einen Brief. Ratlos strich er sich über seine hohe Stirn und schob die schwarzen Locken zurück. Sein Schwiegervater, der Verleger Johann Theodor de Bry, war vor Kurzem gestorben, und nun wünschte die Schwiegermutter, dass er mit seiner Familie nach Frankfurt ziehen und den Verlag weiterführen solle.
«Du musst herkommen und helfen», schrieb sie dringlich, «ich habe zu wenig Ahnung vom Verlagsgeschäft und blicke nicht durch. Ich weiss weder ein noch aus.» Matthäus Merian hatte gewusst, dass dieses Ansinnen einmal auf ihn zukommen könnte, aber er hatte sich der kleinen, träumerischen Hoffnung hingegeben, es würde noch viele Jahre dauern bis dahin. Nun konnte er es drehen und wenden wie er wollte, er fand keine Möglichkeit, die Bitte abzuschlagen.
Unruhig erhob er sich, trat ans Fenster, drückte seine Stirn an die Scheibe und blickte hinunter auf das langsam fliessende Wasser. Es war ein Arm des Riehenteichs, den man durch diesen Kanal leitete, um die Mühlräder anzutreiben, so auch das Rad der Merian-Säge. Er vernahm das Geräusch der drehenden Mühlräder und das Plätschern des Wassers. Es gehörte zu Kleinbasel und zum Stadtteil, den er besonders liebte, dem geschäftigen, dicht bebauten Mühleviertel.
Merians Gedanken wanderten zurück, verloren sich in der frühen Kindheit. Damals war alles klar umrissen und selbstverständlich gewesen: Die Arbeit des Vaters als Säger und Dielenhändler, die Mutter, die alles überwacht und zusammengehalten hatte, seine sieben Schwestern und seine beiden Brüder.
Er hatte in der Merian-Säge eine glückliche Kindheit erleben dürfen, auch wenn er streng und betont fromm im christlichen Glauben erzogen worden war. Der sonntägliche Gang zur Theodorskirche und das tägliche Lesen in der Bibel hatten stets dazugehört. Die geheimnisvolle, faszinierende Welt des Mühlenviertels sowie das Wasser des Riehenteichs waren für Matthäus Merian und seine Spielkameraden verlockend gewesen. Wie viele Schätze hatten sie aus dem Teich gezogen und triumphierend heimgetragen, Dinge, die ein Knabenherz höher schlagen liessen, die ins Wasser gefallen und von der Strömung weitergetragen worden waren.
«Bleib vom Wasser fern, spiel nicht in der Nähe der Räder, denk an Conrad», glaubte er die Stimme seiner Mutter zu vernehmen. Noch jetzt fiel ihm dieser Satz ein, wenn er auf den Riehenteich blickte. Hier war sein Onkel Conrad mit fünfzehn Jahren ums Leben gekommen.
Da wurde Matthäus Merian aus seinen Gedanken gerissen, denn die junge, schmächtige Magd Lisa trat in die Werkstatt ein. Scheu blickte sie an ihm vorbei, trug den Krug mit Wein zu seinem Tisch und wollte gerade den Raum wieder verlassen, als ihr Merians Frau Maria entgegentrat. Maria hatte um den Kopf ein graues Tuch gebunden, das die dunklen Haare zusammenhielt, welche sie straff von der Stirne nach hinten gekämmt und zu einem Knoten im Nacken verschlungen hatte. Merian betrachtete sie liebevoll, die geröteten Wangen standen ihr gut. Sie sah immer noch mädchenhaft aus und erinnerte ihn an die Zeit, als er sie kennengelernt hatte. Der zweijährige Matthäus – alle nannten ihn Matthes – in einem kurzen Röckchen drängte an ihr vorbei und lief mit nackten Füssen in die Werkstatt, gefolgt vom Schwesterchen Susanne, dessen braune, dünne Rattenschwanzzöpfchen bei jedem Schritt auf und ab tanzten. Maria nahm den Buben rasch auf den Arm, denn es lagen zu viele Gegenstände herum, die für ihn verlockend waren. Die vielen Grabstichel in verschiedenen Grössen, Töpfe mit Farben, Kupferplatten, vor allem aber das Rad der Kupferdruckpresse hatten es dem Knaben angetan. Die vierjährige Susanne trat neugierig zum breiten Werktisch, um das Bild zu betrachten, welches ihr Vater in Arbeit hatte. Es war für ein Familien-Stammbuch vorgesehen und schilderte die Geschichte des barmherzigen Samariters.
Riehenteich in Kleinbasel, mittlerer Arm
«Oh, da steht ein Ross!», rief sie begeistert und deutete mit dem Finger auf das Tier. Maria trat mit dem kleinen Knaben auf dem Arm näher und nickte.
«Ja, Susanne, ein Ross … und ein grosser Baum … und ein kleiner Fluss mit einer Brücke.» Maria wandte sich an Merian: «Es gefällt mir, wie du die Geschichte schilderst, vor allem der Bischof, der bereits am Verletzten vorbeigewandert ist und über die Brücke läuft, ohne sich umzusehen. Dann der Gelehrte, der in sein Buch vertieft ist und weder rechts noch links blickt, und schliesslich der barmherzige Samariter, der vom Pferd gestiegen ist und sich um den Hilflosen kümmert. Daneben die knorrige Eiche und der Ausblick auf den Fluss – es spielt in einer Landschaft, die mich an unsere Gegend erinnert. Deshalb wirkt das Geschehen so vertraut, als ob es hier passiert wäre. Ist es das Birs- oder Wiesental?»
«Es ist eine Fantasielandschaft, aber natürlich inspiriert von meinen Ausflügen. Du weisst, ich liebe Flusslandschaften.» Maria strich sich eine vorwitzige Haarsträhne aus dem Gesicht und blickte Matthäus herausfordernd an, ihre dunklen Augen blitzten.
«Auch das Maintal?», fragte sie vorsichtig. Merian wusste genau, was sie mit dieser Frage ansprach. Er schmunzelte. Deshalb war sie also in seine Werkstatt gekommen! Er blickte zum Brief, der auf dem Tisch lag.
«Natürlich auch die Flusslandschaft des Main. Ich werde sie bald wiedersehen. Ich muss mich ja um den Verlag kümmern.» Marias geschwungene Lippen verzogen sich. Mit einem strahlenden Lächeln blickte sie in sein kluges, selbstbewusstes Gesicht.
Matthäus Merian: Der barmherzige Samariter, im Stammbuch des Daniel Stoltz von Stoltzenberg, 1624
«Du hast dich also entschlossen?»
«Nein, ich habe mich noch nicht entschieden. Ich fühle mich sehr wohl hier. In Basel bin ich geboren und aufgewachsen, dann ging’s nach meiner Lehre auf Wanderschaft, und schliesslich bin ich in Frankfurt bei deinem Vater de Bry hängengeblieben und habe dich kennengelernt.» Marias Augen leuchteten in Erinnerung an diese Zeit.
«Genau. Wir waren sehr glücklich zusammen in Frankfurt, nicht wahr?»
«Ja, natürlich. Doch die unsicheren Zeiten bewogen uns dann, nach Basel zu ziehen, zurück in meine Heimatstadt. Ich habe hier genug Arbeit und eine gut eingerichtete Werkstatt für meine Radierungen und Kupferstiche. Soll das alles nun ein Ende haben?»
«Der Verlag gehört zu meinem Erbe, Matthäus. Ich bin schliesslich die Tochter deines ehemaligen Meisters de Bry. Er hat mich dir zur Frau gegeben mit dem Hintergedanken, dass du einmal seine Verlagsarbeit fortsetzen wirst.»
«Ich weiss. Aber ich werde jetzt zuerst einmal nach Frankfurt reisen, um mir ein Bild von der Situation zu machen. Du hast ja auch noch zwei Schwestern. Der Verlag muss auf jeden Fall weitergeführt werden. Erweist es sich, dass ich dabei helfen muss, werde ich dich und die Kinder nachholen.»
«Ich würde mich freuen, heimzukehren. Nicht, dass es mir hier in Basel nicht gefällt», beeilte Maria sich anzufügen, «aber ich bin in Frankfurt gross geworden und fühle mich in jener Gegend zu Hause.»
«So wie ich hier in Basel, auch wenn ich einige meiner dreissig Jahre anderswo verbracht habe. Es würde mir gefallen, wenn auch unsere Kinder hier aufwachsen könnten. Unser kleiner Matthes und auch unser Jüngstes, das Margrethlein, wurden in der Theodorskirche getauft, genauso wie ich – so müsste es weitergehen.» Maria drückte den Buben an sich.
«Ich kann dir versichern, in Frankfurt gross zu werden ist keine Strafe, im Gegenteil. Es wird weniger gefährlich sein als hier beim Teich mit den vielen Mühlrädern.»
«Die Säge ist schon seit Jahrzehnten im Besitz der Merians, und es ist erst einmal etwas passiert.»
«Ich weiss, dein Onkel Conrad ist ins Mühlrad geraten und gestorben. Das haben du und Friedrich mir schon oft erzählt.»
Matthäus Merians jüngerer Bruder Friedrich hatte die Säge nach dem Tod von Vater Merian übernommen und führte sie seither erfolgreich weiter. Maria und Matthäus waren vor vier Jahren nach Basel gekommen und hatten in der Merian-Säge einige Zimmer bezogen. Sie war gross genug, um zwei Familien Platz zu bieten. Das Zusammenleben mit der Familie des Bruders hatte sich unterdessen eingespielt.
«Ich würde sehr ungern von hier wegziehen. Es sind so viele Erinnerungen mit Basel verbunden. Ich habe zu den wenigen Kleinbasler Knaben gehört, welche die Lateinschule am Münsterplatz besuchen durften. Nur der Sohn des Pfarrers und die Kinder vom Haus Zum Kayserstuhl an der Rheingasse waren mit dabei. Wir haben viel Schönes zusammen erlebt.» Matthäus Merian wandte sich an die kleine Susanne.
«Weisst du, meine Freunde und ich haben zusammen nicht immer den direkten Heimweg gewählt, sondern sind oft den Schlüsselberg hinuntergerannt zum Rathaus und haben in der verwinkelten Gegend rund um den Andreasplatz Verstecken gespielt.» Susanne blickte ihn staunend an.
«Oder wir sind zur Schol gelaufen, dem Schlachthaus über dem schmalen, offenen Fluss Birsig. Das Abstechen der Tiere und Zerlegen mit dem Schlachterbeil hat uns stets erschauern lassen, aber umso mehr gefesselt. Es hat Mut gebraucht, zuzusehen ohne zurückzuweichen. Und dazu dieser unangenehme Geruch!» Merian strich Susanne über den Kopf. Seine Gedanken verloren sich und er lächelte, bis ihm einfiel, dass alle seine Kleinbasler Kameraden bei der letzten grossen Pestepidemie gestorben waren, alle seine Freunde, ausser einem.
Maria holte ihn aus seinen Erinnerungen in die Gegenwart zurück.
«Wann willst du reisen?»
«Sobald ich die dringendsten Aufträge beendet habe. Das Stammbuch, welches ich im Moment in Arbeit habe, eilt nicht, aber es warten noch ein paar andere Sachen. Ich bin ja gerade erst aus Frankfurt zurückgekommen und muss sehen, dass mein Geschäft nicht darunter leidet, wenn ich so oft weg bin.»
«Der Gedanke, dass du am Sterbebett meines Vaters gesessen hast, Matthäus, ist für mich sehr tröstlich.» Merian blickte verständnisvoll in Marias warme, braune Augen.
«Es war ein schöner Zufall, dass ich genau zur richtigen Zeit dort weilte.» Mit seinem Schwiegervater hatte er im Laufe der Jahre ein gutes Verhältnis aufgebaut, zuerst als Geselle, dann als Mitarbeiter. Ihre Ansichten und die Art, wie sie beide zielstrebig und talentiert der Arbeit nachgingen, hatte sie verbunden. «In seinem Sinn muss nun auch die Verlagsarbeit weitergeführt werden, dazu fühle ich mich verpflichtet, nicht nur, weil ich dich geheiratet habe. Dein Vater war ein ausgezeichneter Kaufmann und brillanter Kupferstecher. Diese beiden Talente ermöglichten seinen Erfolg.»
«Richtig. Und diese Talente hast du auch, Matthäus.»
«Ich weiss, dass ich ein guter Kupferstecher bin, aber ob ich einen Verlag führen kann, muss sich erst noch weisen.» Er fragte sich im Stillen, ob sich sein kaufmännisches Geschick während der kriegerischen Zeiten bewähren würde?
«Als Kind habe ich gerne viel gezeichnet. Einmal hatte ich sogar die Gelegenheit, im Haus Zum Kayserstuhl das Amerbach-Kabinett anzusehen, eine Wunderkammer voll faszinierender Gegenstände und Gemälde. Beim Betrachten der herrlichen Bilder ist der Wunsch in mir hochgestiegen, auch einmal so gut malen zu können. Vor allem die Gemälde von Holbein haben es mir angetan. Ich bin sofort heimgerannt und habe zu zeichnen angefangen. Die Enttäuschung, dass es bei Weitem nicht so gut gelang, wie auf jenen Bildern, spüre ich heute noch. Ich habe mich aber nicht davon abhalten lassen und es immer wieder versucht. Mein Talent hat die Aufmerksamkeit des Vaters geweckt, so dass er mich schliesslich zu einem Glasmaler in die Lehre gegeben hat.»
«Ach, Glasmaler warst du auch?», fragte Maria erstaunt.
«Als ich zwölf Jahre zählte, waren Glasgemälde beliebte Geschenke zur Ausschmückung der Zunftstuben und Ratssäle. Auch Wohlhabende konnten es sich leisten, die Fenster der Stuben damit zu zieren.» Er blickte zum Fenster, an welchem eines seiner Glasbilder von damals hing. Es zeigte die Merian-Säge, auch seine eigene Person war darauf zu sehen. Merian betrachtete es schmunzelnd. «Vielleicht hätte ich diesen Zweig weiterverfolgt, doch es kamen andere Dinge in Mode, vor allem die Radierungen. Deshalb hat mich Vater nach Zürich geschickt, um bei Dietrich Meyer das Radieren und Stechen zu lernen», erklärte er. «Es ist eine lehrreiche Zeit gewesen, mit Buchillustrationen, Monatsbildern, Jagdbildern, Bauerntänzen und allegorischen Figurenbildern… und danach ging’s von Basel aus auf die Wanderschaft. Wie viele Städte habe ich besucht, gezeichnet und Kupferstiche davon hergestellt. Strassburg, Paris, Heidelberg, Frankfurt …» Maria lächelte fein. Es war nicht das erste Mal, dass sie davon hörte. Wenn Merian ins Erzählen kam, hörte er so schnell nicht mehr auf.
«Gut», unterbrach sie seinen Gedankengang, «ich werde mich gleich um deine Kleidung kümmern, damit du bald abreisen kannst. Komm, Lisa, es gibt einiges zu tun», forderte Maria die junge Magd auf, fasste den kleinen Matthes in ihrem Arm wieder fester und lief mit ihm zur Tür.
Lisa hatte mit wachsender Unruhe dem Gespräch zugehört. Nach Frankfurt ziehen? Der Gedanke erschreckte sie. Oder nahm man sie gar nicht mit? Musste sie sich nach einer neuen Arbeit umsehen? Vollkommen verwirrt folgte sie der Meisterin, ohne einen Blick auf Merians Bild zu werfen, was sie sonst stets begierig tat.
«Ross!», rief der kleine Matthes weinerlich und streckte seine Ärmchen zurück zum Tisch, aber Maria verliess mit den Kindern ohne zu zögern den Raum. Merian setzte sich wieder an den Werktisch und betrachtete seine Arbeit, während er sich den dunklen, krausen Bart strich. Ja, das Pferd ist mir nicht schlecht gelungen, dachte er befriedigt. Tiere gehörten nicht zu seinen bevorzugten Darstellungen, ihm lagen die Landschaften und Städte viel näher. Das war schon immer so gewesen.
Er fröstelte. «Mit einem eigenen Verlag in Frankfurt hätte ich ganz andere Möglichkeiten», ging ihm durch den Kopf, «ich könnte meine geheimsten Pläne umsetzen, dazu meine Kupferstiche verwenden und neue schaffen. Ideen hätte ich genug. Eine Bilderbibel, eine Weltchronik … ich wäre dann Zeichner, Stecher und Verleger, könnte mein eigenes Verlagsprogramm machen. Wenn nur der Krieg nicht wäre!», seufzte er laut.
Der Glaubenskrieg zwischen der Katholischen Liga und der Protestantischen Union war gleichzeitig auch ein Kampf um die Vorherrschaft im Heiligen Römischen Reich zwischen dem Habsburger Kaiser, mehreren Landesfürsten sowie Frankreich, Dänemark und Schweden. Er lähmte die Wirtschaft spürbar. Von Böhmen aus hatte sich der Religionskrieg bis zur Pfalz ausgeweitet, der spanische Grande Spinola war bis Oppenheim vorgedrungen – zum Glück hatte Merian vorher Frankfurt verlassen können und war mit seiner Familie nach Basel gezogen.
Die Welt wurde mit jedem Tag unbegreiflicher, die vielen Nachrichten konnte man kaum einordnen, und sie überholten sich immer wieder. Bis jetzt war die Stadt Basel verschont geblieben von den kriegerischen Ereignissen, doch es wimmelte von Soldaten und von Flüchtlingen, vor allem Waisenkinder aus dem nahen Elsass lungerten in den Gassen herum. Eidgenössische Schutztruppen waren überall untergebracht und mussten versorgt werden. In der Stadt war es verhältnismässig ruhig, nur hatte jeder Hausbesitzer «Soldatengeld» beizusteuern. Nach dem sonntäglichen Gottesdienst zog eine Delegation des Rates von Haus zu Haus, um eine «Vermögenssteuer» von einem Prozent einzuziehen, einerseits für die Truppen und ihre Unterbringung, aber auch zur Bezahlung der Verstärkungen der Stadtmauern und für die Bastionen, die in Eile erstellt wurden.
«Die kriegerischen Auseinandersetzungen dauern jetzt schon fünf Jahre», ging es Merian durch den Kopf. «1618 hat alles begonnen und jetzt zählt man das Jahr 1623 – darf ich damit rechnen, dass sie bald enden? Und wenn nicht? En Dieu mon espoirence»,1 sprach Merian laut und deutlich, als ob er in der Kirche sässe. Sein Blick fiel auf das Albumblatt. Diesen Satz würde er über das Bild schreiben! Er nahm den Federkiel, tauchte ihn in die schwarze Tinte und schrieb die Worte fein säuberlich über die Zeichnung im Stammbuch.
Maria war unterdessen mit Lisa in die Kammer geeilt, um nach Merians Reisekleidung zu sehen. Sie bewegten sich leise, denn das wenige Monate alte Margarethlein schlief nebenan in der Wiege, doch der Holzboden knarrte trotzdem vernehmlich. Maria öffnete eine Truhe, wischte sich die Hände an der Schürze ab und nahm sorgfältig zwei weisse Mühlsteinkrausen in Augenschein.
«Die sind in Ordnung, aber ich glaube, er trägt sie nicht zu dieser Reise. Da genügen sicher die einfacheren, liegenden Kragen. Davon hat es noch genug. Auch den Hut und das Reisecape kann man belassen», befand sie erleichtert. Kritisch unterzog sie nun die Hemden und die Beinkleider einer genauen Prüfung. Wie erwartet, waren sie keineswegs sauber. Seit Merian zurückgekehrt war, hatte sie noch nicht gewaschen. Maria schüttelte unwillig den Kopf.
«Ach, wer rechnete schon damit, dass mein Mann gleich wieder verreisen wird? Diese Pluderhosen müssen gewaschen werden, die Strümpfe sowieso, dieses Wams hat es auch nötig … und auch dieses hier. Oh, da hat es einen bösen Fleck … es könnte Wein sein. Ob es genug schmutzige Sachen sind, um die Wäscherin Küngold zu bestellen? Sie wäscht immer mit dem kalkarmen Wasser der Wiese2, deshalb bringt sie die Wäsche jeweils nach Kleinhüningen, wo der Fluss in den Rhein mündet. Geh, Lisa, frag in der Küche nach, ob meine Schwägerin Christine auch etwas mitwaschen möchte.» Lisa war noch immer benommen von dem, was sie gehört hatte. Sie lief in die Küche, froh, aus den schweren Gedanken gerissen zu werden.
Ein Duft von Erbsmus schlug ihr entgegen. Ihre Augen mussten sich zuerst an das düstere Innere gewöhnen. Schattenhaft nahm sie die Gestalt der gesuchten Schwägerin Christine wahr. Matthäus Merians Bruder Friedrich war verheiratet mit der feingliedrigen Christine Syff. Sie war die Urenkelin von Hans Holbein, was man in der Familie oft mit Stolz hervorhob. Lisa wusste, dass ihre Herrin Maria sich stets etwas zurückgesetzt fühlte deswegen, obwohl der Name de Bry durchaus auch angesehen war. In Basel hatte der Name Holbein einen besonderen Klang, war der Maler doch jahrelang in der Stadt tätig gewesen und hatte sichtbare Spuren hinterlassen. Zwar hatte die von allen angestaunte Fassadenmalerei am Haus Zum Tanz unterdessen ihren Glanz eingebüsst und war recht verblasst, aber die Bilder auf den Orgelflügeln im Münster und die Wandmalereien im Rathaus wurden immer noch sehr bewundert und gerühmt.
«Meine Meisterin lässt fragen, ob wir zusammen eine Fuhre Wäsche hätten für die Küngold? Der Meister muss bald wieder nach Frankfurt reisen.» Christine sass am Tisch und war mit Gemüserüsten beschäftigt. Erstaunt blickte sie auf.
«Was, schon wieder? Zum Glück reist mein Mann nicht so oft umher! Die Arbeitskleidung aus der Sägerei häuft sich allerdings auch. Ich glaube, wir haben einiges beieinander, oder nicht?», wandte sie sich an die Magd, welche am Herd stand und eifrig im Erbsmus rührte. Die Magd war schon lange in der Familie von Friedrich Merian tätig, konnte tüchtig anpacken und war zuverlässig, wie alle Dienstboten aus dem Wiesental. Während sie überlegte, schob sie die Unterlippe vor und nickte schliesslich bedächtig, ohne sich vom Topf abzuwenden.
«Sie wollen nach Frankfurt ziehen», platzte Lisa mit der Nachricht heraus, die sie so sehr beschäftigte. Die Magd hörte auf mit Rühren und blickte sie erschrocken an. Sie wusste genau, was das für Lisa bedeutete.
«Noch ist nichts entschieden, Lisa. Wart erst einmal ab. Geh jetzt zu Küngold und frag nach, ob sie bald kommen kann», entgegnete Christine tröstend. Lisa wusste, dass sie nichts weiter zu sagen hatte, persönliche Fragen standen ihr nicht zu. Abgesehen davon liebte sie Aufträge, welche sie etwas weiter entfernt vom Haus erledigen durfte.
Mit gesenktem Kopf lief sie durch den Hof und den zahlreichen Baumstämmen entlang, die zum Sägen bereitlagen. Sie bemerkte, dass die Gassen noch feucht waren vom letzten Regen, es störte sie jedoch wenig, denn das Barfussgehen im Regen hatte sie schon immer geliebt. Während sie sich zur Rheingasse begab, beobachtete sie die vielen Leute, welche unterwegs waren, vor allem am Brückenkopf gab es geschäftigen Verkehr. Sie bemerkte Handkarren, Ochsenwagen, Reiter, dazu die Brotstände und die Fleischbänke – Lisa wäre gerne stehen geblieben, aber das schickte sich nicht. Sie warf einen raschen Blick zur Brücke und lief dann mit züchtig niedergeschlagenen Augen vorbei am Gesellschaftshaus Zum wilden Mann und der Niklauskapelle und folgte dem schmalen Schmutz-Bächlein, das durch die Gasse floss. Die Wäscherin Küngold wohnte im Haus Zum Birnboum.3 Dort waren über dem Eingang drei Birnen gemalt und für Lisa deshalb einfach zu finden. Sie hatte nie lesen gelernt, denn es war für ihre arme Familie nicht möglich gewesen, einen Schulbatzen zu bezahlen. Hätte man so viel Geld aufbringen können, so wären zuerst ihre Brüder zur Schule geschickt worden, sicher nicht die Mädchen. Aber auch dafür hatte es nicht gereicht.
Das Haus Zum Birnboum gehörte einem finsteren, mürrischen Fischer, dem Lisa möglichst aus dem Weg ging. Seine Frau hatte sie bis anhin nie zu Gesicht bekommen. Ob er überhaupt eine Frau besass? Sie hatte noch nie etwas von ihr gehört. Jedoch erzählte man, dass in der Stube des Fischers Bilder an die Wand gemalt seien, eine ganze Stadt mit Mauern und Kirchen. Das hätte sie sich gerne einmal angeschaut.
Die Witwe Küngold bewohnte zusammen mit ihren drei Kindern zwei kleine Zimmer unter dem Dach. Im engen Treppenhaus roch es nach Fisch, für Lisa ein vertrauter Geruch, denn auch ihr Vater war Fischer. Während sie die steilen Stufen emporstieg, verspürte sie ein leichtes Ziehen. Wenn sie nur wieder heimgehen könnte! Sie wusste natürlich, dass das ein frommer Wunsch bleiben würde. Ihre Familie lebte im nahen Dorf Kleinhüningen und war auf ihren bescheidenen Lohn angewiesen. Der Vater hatte sich bei einer Wirtshausschlägerei verletzt, der gebrochene Arm und die verrenkte Schulter waren nie mehr richtig verheilt, so dass er seinen Beruf nur noch eingeschränkt ausüben konnte. Seither war die Mutter noch schweigsamer geworden, ein bitterer Zug lag um ihren Mund. Sie arbeitete tagaus, tagein still und zugeknöpft. Sie hatte für sieben Kinder zu sorgen und war froh, wenigstens Lisa anderswo unterbringen zu können. Stolz brachte Lisa alle zwei Wochen an ihrem freien Nachmittag etwas zu essen mit für die Kleinen, welches ihr die alte Magd der Merians auf die Seite gelegt hatte. Auch vom spärlichen Lohn konnte sie etwas abliefern. Sie wusste, man wartete sehnlichst darauf, um wieder Mehl für Brot kaufen zu können.
Die Wäscherin Küngold empfing sie unfreundlich. Alle drei Kinder lagen krank in einem grossen Bett. Mit fieberglänzenden Augen blickten sie zu Lisa hinüber. Sie blieb an der Türe stehen und richtete aus, was man ihr aufgetragen hatte. Küngold sah sie mit müden, übernächtigten Augen an.
«Du siehst doch, dass ich nicht weg kann. Wer soll nach den Kindern sehen, wenn ich den ganzen Tag unterwegs bin?», murrte sie. Lisa kannte längst ihr raues Wesen und versuchte es nochmals.
«Es eilt, soll ich sagen, mein Meister muss nach Frankfurt.»
«Es eilt immer. Doch ist er nicht gerade erst aus Frankfurt zurückgekehrt?» Die Waschweiber wussten alles, was in der Stadt vor sich ging, denn beim Waschen liess sich leicht tratschen, und alle Neuigkeiten machten die Runde. Lisa nickte und senkte den Kopf.
«Vielleicht ziehen bald alle nach Frankfurt», platzte sie heraus. Küngold blickte sie bestürzt an. Sie ahnte, was das Mädchen beschäftigte. Das lange, schmale Gesicht, umrahmt von spröden, blonden Haaren wirkte angespannt und plötzlich fast erwachsen.
«Du meinst, du musst auch fortziehen?»
Lisa zuckte mit den Schultern.
«Ich weiss es nicht. Niemand sagt etwas zu mir.» Tränen standen in ihren wasserblauen Augen. Küngold verstand. Sie betrachtete mitleidig die schmächtige Gestalt.
«Mach dich nicht verrückt, Lisa. Noch ist nichts entschieden. Und vielleicht findet sich für dich eine andere Stellung.» Den letzten Satz hatte sie ohne grosse Überzeugung ausgesprochen. Für ein vierzehnjähriges, schmächtiges Ding, unerfahren und mit wenig Kraft versehen, war es bestimmt nicht einfach, eine Stelle zu finden. «Geh jetzt und richte aus, dass ich kommen werde, sagen wir in drei Tagen. Bis dahin sollte es den Kindern besser gehen.»
1Auf Gott meine Hoffnung
2Fluss aus dem Schwarzwald
3Rheingasse 84
2. KAPITEL
In Frankfurt wartete Matthäus Merians Schwiegermutter ungeduldig auf ihn. Sie machte einen gequälten Eindruck, als sie ihn in Empfang nahm.
«Da bist du ja endlich», rief sie anstelle einer Begrüssung. Die Stube, in welche sie ihn führte, war dunkel, denn das dreiteilige Fenster liess nicht viel Licht herein. Der Raum war blitzsauber, alles stand an seinem Platz, trotzdem machte er keinen einladenden Eindruck. Merian hatte es nicht anders erwartet. Während seiner Zeit bei de Bry hatte er die zurückhaltende, nüchterne Art der Hausfrau bereits kennengelernt. Mit ihrer kerzengeraden Haltung und der knochigen Figur verkörperte seine Schwiegermama das Ideal einer streng gläubigen Calvinistin. Sie gehörte zu den niederländischen Familien, welche aufgrund ihres Glaubens nach Frankfurt geflüchtet waren.
Margarete de Bry, geborene von der Heyden, trauerte aufrichtig um ihren Mann. Das schlichte, schwarze Trauerkleid stand ihr gut und zeugte von zurückhaltendem, aber erlesenem Geschmack. Merians wache Augen nahmen das Bild in sich auf, registrierten aber gleichzeitig etwas Kaltes und Eigenwilliges unter der Oberfläche. Der müde, gequälte Blick täuschte ihn nicht darüber hinweg, dass eine gewisse Schärfe in der Stimme zu hören war. Mit hochgezogenen Brauen antwortete er höflich:
«Ich bin so rasch als möglich hergereist, nachdem dein Brief angekommen ist. Ich hatte allerdings noch einiges zu erledigen. Ich soll dich von Maria und den Kindern herzlich grüssen.»
«Du hättest sie gleich mitbringen können, ihr werdet so oder so hierherziehen müssen. Ich benötige eure Hilfe.»
«Lass uns das morgen in Ruhe bereden. Vorerst möchte ich mich umziehen und mich von den Reisestrapazen erholen. Vielleicht besorgt deine Magd mir etwas zu trinken?» Mit leicht verbissenem Gesicht nickte sie und verliess den Raum. Merians Schultern entspannten sich. Es würde nicht einfach werden, mit seiner Schwiegermutter die Zukunft des Verlags zu besprechen. Sie behandelte ihn immer noch wie den Gesellen von einst, doch er wusste genau, dass er nun Können und Erfahrung als Kupferstecher in die Waagschale werfen konnte. In Frankfurt gab es nur wenige seines Fachs. Er hatte bei seinem letzten Besuch bemerkt, dass viele Verleger gezwungen waren, die Kupferstiche auswärts zu ordern. Aber wollte er tatsächlich Basel verlassen und hierherziehen?
Mit langsamen, unsicheren Schritten kehrte die Schwiegermutter zurück, blickte ihn leidend an und stellte einen Becher Wein vor ihn hin.
«Hier ein guter Frankenwein! Du siehst, das Gehen macht mir jeden Tag mehr Mühe», seufzte sie, «ich bin nicht mehr die Jüngste. Ich brauche nicht nur dringend jemanden im Verlag, sondern auch im Haushalt.» Merian begriff, dass es ihr nicht nur um den Verlag ging. Seine Schwiegermutter wünschte zudem die Hilfe ihrer Tochter.
«Lass uns morgen die Aufträge ansehen und was sonst ansteht im Verlag», versuchte er es nochmals, «ich bin wirklich müde. Es bringt nichts, wenn du mir jetzt gleich alle Probleme unterbreitest.» Doch sie war nicht zu bremsen, zu gross waren ihre Sorgen, und zu lange hatte sie schon auf ihn gewartet.
«Du bist es Maria und deinen Kindern schuldig, es ist ihr Erbteil, Matthäus. Und du weisst, ich muss meinen Unterhalt mit dem Verlag bestreiten. Ich habe nichts mehr für den Verkauf. Man muss die vergriffenen Bücher neu auflegen, zuerst aber mit frischen Kupferstichen versehen, denn die alten Kupferplatten sind zu abgenutzt, und …»
«Lass es gut sein und warte bis morgen. Dann schaue ich mir alles an», unterbrach Merian ihren Wortschwall. «Kann ich in meinem gewohnten Zimmer unterkommen? Dann lege ich mich jetzt hin.» Ohne ihre Antwort abzuwarten, nahm er sein Gepäck, verliess fast fluchtartig die gute Stube und stieg die Treppe empor zum oberen Stock. Er schlüpfte aus der staubigen Reisekleidung und wusch sich die Hände, indem er sich Wasser aus einem irdenen Krug darüber goss. Während er sich zur Ruhe begab, murmelte er laut vor sich hin: «Immerhin gibt es ja noch die beiden Schwestern und ihre Männer.» Mit diesem beruhigenden Gedanken schlief er ein.
«Johannes? Margarethes Mann? Nein, auf ihn kann man nicht zählen – er hat einen eigenen Verlag gegründet», beschied ihm Schwiegermama de Bry am kommenden Morgen, «er berät mich höchstens manchmal.» Merian war bass erstaunt über das Vorgehen.
«Er hat einen eigenen Verlag gegründet? Warum hat Johannes sich selbstständig gemacht, ohne vorher mit seiner Familie darüber zu beraten, wie es mit dem Verlag de Bry weitergehen soll?»
«Ich weiss es nicht. Kaum war Vater unter der Erde, hat Johannes mir eröffnet, dass er einen eigenen Verlag gründen wolle.»
«Aber Margarethe und er sind doch noch am Verlag de Bry beteiligt.»
«Natürlich. Aber es interessiert ihn wenig», gab sie aufgebracht zurück. Ihre calvinistische Grundhaltung kam dabei zum Vorschein, nämlich der Gedanke, dass man den durch Fleiss erreichten Wohlstand nur dank Gottes Hilfe erreichen konnte. Der Satz ‹Es interessiert ihn wenig› zeigte seine Undankbarkeit und war ein deutlicher Vorwurf. Merian konnte sich leicht vorstellen, dass die Zusammenarbeit der beiden zu Problemen geführt hatte. Er begann sorgfältig, alle Auftragsbücher zu studieren.
Nach einem Treffen mit seinem Schwager Johannes am selben Nachmittag musste er sich eingestehen, dass es ihm auch nicht besser ging als seiner Schwiegermutter. Sie hatten ganz andere Vorstellungen vom Führen des Verlags. Johannes war ein verschlossener Kerl, machte einen mürrischen Eindruck und war keineswegs bereit, von seinen Ansichten über die Zukunft des Verlags abzuweichen, genauso wenig wie seine Schwiegermutter. Als Merian ihn darauf ansprach, weshalb er so überstürzt einen eigenen Verlag gegründet habe, presste er nur die Lippen zusammen und schwieg.
Ein starker Wind blies durch die Gassen von Frankfurt und liess erste Gedanken an den nahenden Herbst aufkommen. Während Merian im Bett lag, hörte er, wie der Luftzug an den Fensterläden rüttelte. Er spürte eine grosse Unruhe in sich. Sie liess ihn nicht einschlafen. In seinen Gedanken wurde er hin- und hergerissen. Sollte er helfen, den Verlag weiterzuführen? Seine Tatkraft schien tatsächlich gefragt zu sein, doch war er im Zweifel, ob seine Schwiegermutter ihm genügend freie Hand lassen würde, um seine Ideen umzusetzen. Und was sollte er mit Johannes und Margarethe und deren Beteiligung am Verlag anfangen? Dann war da noch die andere Schwester, Susanne, die noch heiraten wollte. Auch der Gedanke an seine Maria liess Merian keine Ruhe, denn er wusste, dass sie gerne nach Frankfurt ziehen würde.
Es war richtig, dass ich meine Familie aus dem Gefahrenbereich des Krieges gebracht habe und nach Basel gezogen bin, und es wäre einfach und bequem, alles so zu belassen, wie es ist, dachte er erschöpft. In Basel gehöre ich zu den führenden Kupferstechern, habe meine Kunden, und es herrscht Friede. Hier in Frankfurt hingegen weiss ich nicht, was auf mich zu kommt, alles steht auf unsicheren Beinen, die politischen Verhältnisse, der Verlag, die Zusammenarbeit mit meiner Schwiegermutter und dem Schwager Johannes … Doch wie gerne würde ich zeigen, wie man es besser macht! Dann rief er sich zur Ordnung: «Ne nimis alta pete», murmelte er, «strebe nicht zu hoch! Es wird sicher ein harter Kampf werden, um letztlich Erfolg zu haben. Ob es genügend Käufer gibt bei diesen unsicheren Zeiten?»
Merian wälzte sich im Bett, er konnte einfach keinen Schlaf finden. Er wusste, die Probleme liessen sich in dieser Nacht nicht lösen, doch eine Entscheidung konnte er nicht mehr lange hinausschieben, die Situation im Verlag verlangte rasches Handeln. Die finstere Nacht stand drohend vor ihm, die undurchdringliche Dunkelheit dämpfte jegliche Zuversicht. Er fühlte sich wie in einem Schiff, umtost von hohen Wellen, ohne zu wissen, wie er die Segel setzen sollte. Da fiel ihm die Bibelstelle vom Sturm auf dem See Genezareth ein. Diese Geschichte hatte ihn immer besonders beeindruckt. Jesus stand auf und rief in das Toben der See: Sei still! Schweige! Daraufhin legte sich der Sturm, und tiefe Stille breitete sich aus. Merian sah die Szene vor sich, denn er hatte bereits einige Kupferplatten für die von ihm geplante Bilderbibel fertiggestellt. Das Schiff in der stürmisch aufgewühlten, vom Wind aufgepeitschten See, Christus ruhig schlafend im schwankenden Boot, trotz der verzweifelten Apostel – wie tröstlich! Auf einmal wusste er, dass seine Bilderbibel ein Erfolg werden würde, selbst in unruhigen Zeiten wie diesen! Oder gerade deshalb. Er würde die fertigen Kupferplatten hierher mitbringen und die Bilderbibel im Verlag herausgeben. Da breitete sich eine wunderbare Ruhe in ihm aus, und er schlief endlich ein.
Am folgenden Morgen musterte ihn seine Schwiegermutter mit einer Mischung aus Skepsis und Neugier. Sie meinte zu spüren, dass er zu einem Entschluss gekommen war, sein wacher, energischer Gesichtsausdruck sprach für sich. Sie fürchtete sich davor, den Entscheid zu hören. Auch sie hatte schlecht geschlafen, unter ihren Augen zeigten sich dunkle Ringe und verschärften ihre verbissenen Züge. Es ist nicht zu übersehen, wie verbittert es macht, wenn man abhängig ist, dachte Merian, während er sie betrachtete. Nachdem sie mit der Hand ihre Haare zurückgestrichen hatte, fragte sie mit ängstlicher Spannung im Gesicht:
«Nun, Matthäus, hast du dich entschlossen?»
«Ich will nochmals alle Auftragsbücher mit dir durchgehen, danach werde ich dir meine Pläne unterbreiten, und wenn wir uns einig werden, kann ich mir eine Zusammenarbeit vorstellen.» Sie begann erleichtert zu lächeln – zum ersten Mal, seit er hier war, stellte Merian fest. In ihrem vergrämten Blick zeigte sich ein leiser Hoffnungsschimmer.
«Und Johannes?» Merians Gesicht verdüsterte sich. Seine dunklen Augen blieben undurchdringlich. Er schwieg ziemlich lange, den Mund fest geschlossen. Schliesslich fuhr er sich durch seinen Bart.
«Da werden wir nach einer Lösung suchen müssen. Eine Zusammenarbeit mit ihm scheint mir schwierig, denn wir verstehen uns schlecht. Das bringt zweifellos auf die Länge nichts.» Margarete de Bry nickte bedächtig.