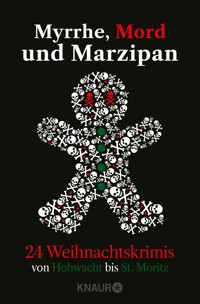Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: USM Audio
- Kategorie: Krimi
- Serie: Laufende Ermittlungen
- Sprache: Deutsch
Tote Marathon-Läufer*innen und ein Kommissar außer Atem - »Der erste Krimi, der mich zum Laufen animiert hat.« Jan Frodeno Der humorvolle Berlin-Krimi »Nur der Tod ist schneller« ist der erste Kriminalroman von Achilles: Sein laufender Kommissar Peer Pedes ermittelt mit unorthodoxen Methoden, Witz und Tempo in einer Mordserie in der Berliner Läuferszene. Peer Pedes, Ermittler beim Berliner LKA, war mal ein begabter Marathonläufer. Als ein verhasster Kollege seine alten Rekorde bricht, humpelt sein Ego mehr denn je, und er will allen wieder die Hacken zeigen. Er wird beim Berlin-Marathon mitmachen – und gewinnen! Bei Peers erstem, quälend langem Trainingslauf ist es aber sein Job, der ihn einholt: Von der Oberbaumbrücke baumelt die Leiche eines jungen Mannes mit spitzen Laufschuhen. Kurz darauf taucht Peer in eine Welt ein, die er einst gut kannte: die Lauf-Community, die nur einem Motto folgt – Lieber tot als Zweiter. Als weitere Athlet*innen ermordet werden, wird Peer klar, dass er Gas geben muss, wenn er den Serienmörder verhaften will. Der lustige Regionalkrimi aus Berlin ist der erste Band der Krimi-Reihe »Peer Pedesʼ laufende Ermittlungen«: Ernsthafte Kriminalfälle treffen auf die teils skurrile Welt der Jogger*innen und des Marathons. Der Krimi ist ein spannender Spaß für Fans von Thomas Raab oder Tommy Jaud – und natürlich für alle, die selbst gerne laufen (oder von laufenden Kolleg*innen und Angehörigen geplagt sind.)
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Achilles
Nur der Tod ist schneller
Laufende ErmittlungenKriminalroman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein leichtfüßiger Ermittler. Ein unaufhaltsamer Killer. Und die schnellste Verfolgungsjagd, die Sie je erlebt haben!
Peer Pedes, Ermittler beim Berliner LKA, war mal ein erfolgreicher Marathonläufer. Als ein verhasster Kollege seine alten Rekorde bricht, humpelt sein Ego. Doch Peer plant sein Comeback beim Berlin-Marathon, wo er allen noch mal die Hacken zeigen will. Schon bei seinem ersten, quälend langen Trainingslauf holt ihn der Job wieder ein: Von der Oberbaumbrücke baumelt die Leiche eines jungen Mannes mit auffallend edlen Laufschuhen. Die ersten Spuren führen Peer in die unbekannte Welt der Party-Läufer und Fitness-Influencerinnen, die nur einem Motto folgen – Lieber tot als Zweiter. Als die Leichen sich häufen, wird Peer klar, dass beim Ermitteln wie beim Marathon nur eines zählt: Tempo. Und die Tricks einer geheimnisvollen V-Frau. Denn der Mörder ist der Polizei immer einen Schritt voraus.
»Achilles ist ein hochdekorierter Läufer, ein extrem pointensicherer Erzähler und ein absolut verkommenes Subjekt – schön, dass er diese drei Eigenschaften hier so kunstfertig zusammenbringen konnte.« Micky Beisenherz, Journalist und TV-Moderator
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 42,195
Danksagung
Leseprobe »Lügen haben schnelle Beine«
Prolog
»Platz!«, brüllt Peer.
Die Rechenmaschine im Kopf rattert. Dreihundert Meter pro Kilometer aufholen – das ist kein Marathon mehr, das ist verschärftes Intervalltraining. Peer hebt den Oberkörper und schiebt die Hüften vorschriftsmäßig nach vorn. Seine Lungen gieren nach Sauerstoff.
»Platz!«
Die entkräfteten Gestalten vor ihm quälen sich mühsam zur Seite, manche missmutig, andere raunen voller Bewunderung. Unvorstellbar, auf den letzten Kilometern noch einmal das Tempo derart zu verschärfen. Aber sie jagen auch keinen Mörder.
Hirn aus. Ab in den Tunnel. Du schaffst das. Die innere Jukebox auf volle Pulle: Queen – Don’t Stop Me Now.
Peer rennt wie seit seinen besten Tagen nicht. Die Häuser links und rechts verschwimmen mit den Zuschauern zu bunten Wänden, die sich zu einem endlosen Tunnel verengen. Augen nach vorn. Schultern zurück. Frequenz halten. Fokus, Pedes. Don’t Stop Me Now. Der rote Bereich ist längst überwunden, erste schwarze Blitze zucken durch sein Blickfeld. Peer fliegt durch die Kurve an der Philharmonie. Eintauchen in die Schlucht zwischen den Hochhäusern. Der nächste Tunnel. Am Potsdamer Platz die letzten jubelnden Menschen.
»Gib alles!«, brüllt einer.
WhatsApp von Stephanie: 250 m.
Stephanie sollte Trainerin werden. Ihr Timing ist so gut wie Mamas. Zweihundertfünfzig Meter sind keine Entfernung, sondern Ansporn.
Das Brennen im Schritt ist wieder da. Glut in den Lungen. Die Messer in den Beinen. Gut so. Die Theorie vom Gegenschmerz besagt, dass mehrere Schmerzherde besser sind als einer, weil sie voneinander ablenken. Das ist kein Schmerz, sagt Mama. Nur eine Rückmeldung des Körpers, dass du in der Lage bist, im Spitzenbereich zu funktionieren.
»Platz!«
Peer fegt an weiteren Läufern vorbei in die Leipziger Straße.
Plötzlich eine vertraute Stimme: »Bleib dran, Rakete!«
Stephanie im Hertha-Trikot auf dem Klapprad, irgendwo hinter der Absperrung. Die Kollegin radelt mit hochrotem Kopf. Peer nickt knapp. Jetzt keine Mätzchen. Blick nach vorn.
Kapitel 2
Türsteher sind die wahren Machthaber der Welt. Mögen die Boutiquen-Verkäuferinnen am Ku’damm vor den Scheichs knien, Minister vor Investoren, die Kellner im Grill Royal vor irgendwelchen Filmnasen – Türsteher knien nie, die vom Berghain schon gar nicht. Die Legende vom besten Club der Welt speist sich auch aus der harten Tür. Die Zerberusse des Berghains sind weder mit Geld noch mit Ruhm zu überwinden. Was ist besser für den Ruf? Brad Pitt auf der Tanzfläche oder Brad Pitt, der mit einem kalten »Heute nicht« abgewiesen wird? Türsteher sind die Macht.
An diesem Morgen trägt die Macht Schwarz, Yeezys, eine schmal geschnittene Hose mit aufgesetzten Taschen und unter der Bomberjacke einen Rollkragenpullover, der die tätowierten Zacken am Hals nicht ganz verdeckt. Die Hände stecken in Handschuhen mit abgeschnittenen Fingern. Kein Pumperschrank, eher ein geschmeidiger Athlet.
Als Gast würde Peer niemals an diesem Typen vorbeikommen. Nicht, dass er es je probiert hätte. Peer kann sich nicht erinnern, wann er überhaupt zum letzten Mal ausgegangen ist. Klar, am Anfang mit Ina, ein paarmal. Nach Ina bestimmt nicht. Seit der Trennung heißen sein Clubs Netflix und Playstation. Die lassen jeden rein.
Die Macht an der Tür mustert Peer, seine altrosa Laufkombi, das zerzauste Haar, das Japsen, die Hände, die sich auf die Oberschenkel stemmen. Auch wenn ihn längst nicht mehr der Trainingsfleiß früherer Zeiten treibt, auch wenn die Bündchen der Laufklamotten jedes Jahr etwas tiefer ins Hüftfleisch schneiden, ist Peers klassische Sportlerfigur nicht zu übersehen. Breites Kreuz, schmale Hüfte und Europameisterbeine, dazu das blond melierte, volle Haar eines Surfers und die warmen, gleichwohl forschenden dunklen Augen. Sein Aussehen hätte allemal für eine Karriere als Sportswear-Model gereicht, doch Peer war die eigene Erscheinung nie wichtig. Eitelkeit ist hinderlich, wenn man im Ziel ohnehin aussieht wie Rocky in Runde fünfzehn.
Lieber schnell als schön, hat Mama gepredigt. Mit harter Liebe hat sie ihn von frühester Kindheit an für den erbarmungslosen Kampf auf der Laufbahn abgerichtet. Das echte Leben ist da oft zu kurz gekommen. So gibt es in Wirklichkeit zwei Peers: den gnadenlos auf Erfolg getrimmten Spitzensportler, hart im Training und im Rennen ein gewiefter Taktiker, der unerbittlich den eigenen Vorteil sucht, die Schwächen der anderen wittert und eiskalt ausnutzt. Und den großen Jungen, der seine Wirkung auf andere allenfalls ahnt, ein Lehrling des Lebens, der als Polizist und als Partner neugierig nach den Mechanismen des Miteinanders abseits der Tartanbahn forscht.
Weil Peer an der auch morgens um halb sieben noch beachtlich langen Clubschlange vorbeigestürmt ist, maulen die Wartenden in den ersten Reihen. Aber nicht zu laut. Vielleicht ist Peer ja ein Kumpel des Türstehers. Und mit der Macht will es sich keiner verscherzen, der endlich vorn angekommen ist.
»Ich muss in den Club, ich bin Polizist.«
Die Macht verzieht keine Miene, sondern wartet schweigend auf den Rest der Story. Die Leute haben hier schon ganz andere Sachen versucht. Peer zieht das Smartphone aus der Rückentasche seines Laufhemds. Für solche Fälle hat er ein Foto von seinem Dienstausweis gespeichert.
»Bitte im Original«, entgegnet die Macht unbeeindruckt.
»Kriminalkommissar Pedes, achte Mordkommission«, betont Peer.
Die Macht verzieht keine Miene.
Peer wischt zum Foto des Toten.
»Haben Sie diesen Mann gesehen? Der muss heute Nacht hier gewesen sein.«
Die Macht blickt auf das Display. Beiläufig knetet eine Hand die Knöchel der anderen. Schweigen. Autorität hochfahren.
Peer wackelt leicht mit dem Smartphone: »Ein Anruf, und ihr habt hier in zwanzig Minuten eine Razzia.«
Der Zeigefinger der Macht weist ihn nach rechts. »Würden Sie bitte kurz auf die Seite gehen.«
Peer ist im Abseits geparkt, während die Macht drei Wartende in knappem transparentem Schwarz zu sich winkt. Man kennt sich. Die Tür ist das Portal zu einer anderen Welt. Während die einen Einlass begehren, taumeln andere blinzelnd in die Morgensonne, müde Einzelkämpfer, turtelnde Paare und größere Gruppen. Allesamt Zeugen. Jede verdammte Minute zählt.
Peer nimmt das Smartphone ans Ohr. Die Zentrale verbindet ihn mit dem Kollegen Ingo an der Oberbaumbrücke.
»Könnt ihr einen Wagen zum Berghain schicken? Hier gibt’s Probleme«, sagt Peer laut genug, dass die Macht mithören muss.
»Geht klar, wir kommen sofort«, sagt Ingo mit aufgekratzter Amtlichkeit. »Die Ermittler von der zuständigen Mordkommission sind gerade eingetroffen; wir übergeben.«
Die Erste ist da. Aber davon will Peer sich nicht beirren lassen. Er liegt bereits an der Spitze des Feldes. Und die wird er verteidigen.
»Sie werden bestimmt sofort erraten, wer den Fall übernimmt«, sagt Ingo schrecklich gut gelaunt.
Arschloch Koslowski, denkt Peer.
»Kollege Koslowski«, sagt Ingo.
Die Macht bleibt aufreizend unbeeindruckt, als Kollege Ingo sich vor ihm aufbaut. Kurz zuvor gingen Wogen der Unruhe durch die Schlange, als die beiden Schutzmänner die Formation der Partypeople abschritten. Frauen nestelten an ihrem Dekolleté, Männer an den Strümpfen. Tütchen mit Pillen und Pulver wurden in möglichst private Körpergegenden verlegt.
»Herr Pedes ist vom LKA«, erklärt Ingo dem mäßig beeindruckten Türsteher. »Er ermittelt zu einem aktuellen Tötungsdelikt, das in direktem Zusammenhang mit Ihrem Unterhaltungsbetrieb steht.«
Die Macht nickt: »Könnte ich das Foto bitte noch einmal sehen.«
Peer wischt das Bild des Toten auf sein Display.
»Den hab ich hier öfter gesehen, heute auch, Herr Kommissar«, erklärt der Türsteher, plötzlich erstaunlich hilfsbereit. »Immer mit der Running Crew. Ziemliche Partyhyänen. Keine Ahnung, wie er heißt. Ist vor ungefähr zwei Stunden gegangen. Allein.«
Hart trainieren, härter feiern, am härtesten sterben, denkt Peer.
»Wo finde ich die Leute von der Running Crew?«
Der Türsteher hebt die Arme: »Mein Arbeitsplatz ist hier draußen.«
Unmerklich drückt er plötzlich das Kreuz durch.
»Hi, Adi«, ruft er knapp.
Mit ein paar müden Ravern kommt ein Muskelwürfel mit gut eineinhalb Metern Kantenlänge aus dem Club. Die Nähte seines schwarzen Anzugs sind gespannt. Adi kompensiert mangelnde Länge offenbar durch Volumen.
»Was ist hier los, Juri?«, bellt er.
Die Macht hat einen Namen. Juri deutet auf Peer und seine Kollegen.
»Die Herren von der Polizei wollen im Club ermitteln.«
Adi pumpt sich vor Peer auf.
»Ich bin der Geschäftsführer. Dürfte ich bitte den Durchsuchungsbefehl sehen?«
Eine weitere Gruppe, die schwatzend ins Freie tritt, beobachtet die Szene amüsiert.
»Es heißt Durchsuchungsbeschluss«, erklärt Peer mit rasch ausfransendem Geduldsfaden. »Und den brauchen wir nicht. Hier ist Gefahr im Verzug. Vielleicht befindet sich ein Mörder in Ihrem Laden.«
Adi mustert das altrosa Laufensemble und schüttelt den Kopf.
»Unsinn. Hier wird getanzt, aber nicht getötet. Ohne Staatsanwalt geht gar nichts. Zeigen Sie mir ein Durchsuchungspapier.«
Peer spürt Ingos erwartungsvollen Blick im Nacken. Staatsmacht gegen Clubmacht. Einer dieser Schlüsselmomente, in denen ein Kommissar lebenslänglichen Ruhm ernten kann oder ewige Verachtung. Peer tippt schweigend in sein Smartphone.
»Pedes hier, direkt vorm Berghain«, sagt er ruhig. Kurze Pause. »Tötungsdelikt Oberbaumbrücke. Gefahr im Verzug. Zeugenbefragung im Berghain wird blockiert.« Pause. »Schickt alle, die ihr entbehren könnt. Danke.«
Türsteher Juri blickt zu Adi. Staatsmacht gegen Clubmacht. Zweite Runde.
»Niemand verlässt den Laden, ohne dass wir die Personalien aufgenommen haben«, befiehlt Peer. »Die Kollegen sind unterwegs.«
Ingo und sein fülliger Partner nicken. Genau der richtige Ton für diese Bande. Peer hat die Führung übernommen, was er in den vergangenen Jahren viel zu selten getan hat. Machtspielen ist er meistens aus dem Weg gegangen. Warum eigentlich? Warum kann fürs Ermitteln nicht dasselbe gelten wie fürs Laufen: angreifen! Das eigene Tempo finden, den anderen dein Rennen aufdrängen.
»Auf welcher rechtlichen Grundlage?«, bellt Adi und verschränkt seine Popeye-Arme trotzig vor der Brust.
Blitzschnell macht Peer drei Schritte auf den jungen Mann zu, der mit glasigen Augen, Latexshorts und ziemlich versteinert vorn in der Schlange wankt. Peer bückt sich, greift dem Mann an den Knöchel und zieht ein Tütchen mit weißem Pulver aus der Socke.
»Offenbar werden hier Drogen konsumiert und womöglich auch gehandelt«, sagt Peer mit der dramatischen Empörung des Gesetzeshüters. »Schwerer Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.«
Ingo grinst und stellt sich einem Pärchen entgegen, das fröhlich fummelnd ins Sonnenlicht stolpert.
»Ihre Personalien bitte.«
Adi bebt und schweigt. Juri bleibt ungerührt, auch wenn hier gerade etwas Ungeheuerliches geschieht. Peer hat gegen ein ungeschriebenes Gesetz der Hauptstadt verstoßen. Und das lautet: Die Staatsmacht kümmert sich um alles, was draußen passiert. Drinnen herrschen eigene Regeln, und die setzt jeder Laden selbst durch. Was im Club passiert, bleibt im Club. Ein echter Standortvorteil Deutschlands, vor allem Berlins. Wo sonst auf der Welt kann sich die Gemeinde der Partywütigen mit Betäubungsmittelinteresse auf einen solchen Burgfrieden verlassen? Normalerweise.
Eigenartiger Geruch, denkt Peer, als Juri ihn durch dunkle Flure eskortiert. Viel Schweiß mit einem satten Hauch von Urin. Fast wie in der Umkleide des Mommsenstadions, wo Peer früher oft trainiert hat. Doch die Kopfnote Sperma und ein Hauch bitterer Chemie weisen darauf hin, dass hier nicht nur dem Tanzsport gefrönt wird. Der anschwellende Bass kitzelt Peers Magen. Wahllos zeigt er verschreckten Gästen sein Display.
»Kennen Sie diesen Mann?«
Wortloses Kopfschütteln.
Der Gang mündet in eine gigantische Halle. Menschenmassenwogen. Jetzt schlägt der Bass voll zu. Lichtblitze knallen direkt ins Hirn. Peers Knie knicken leicht ein, aber er drängelt sich weiter durch schwitzende Leiber, die eine Gasse bilden.
»Kennt jemand diesen Mann?«
Lachen, Kopfschütteln, aber die meisten Leute drehen sich weg. Keine Realität jetzt! Sie wollen in ihrem Paralleluniversum bleiben. Wie soll Peer in diesem humanoiden Heuhaufen anständig ermitteln?
Juri strebt auf einen ewig langen Tresen zu. Ungefragt kippt die barbusige Barfrau Ginger-Mate in ein großes Glas voll Eis. Juri nickt ihr einen knappen Dank zu, er hat den Laden im Griff.
»Running Crew?«, brüllt Peer durch den Technostampf in Juris Ohr.
Juri zuckt bedauernd mit den Schultern.
Peer fährt herum. Wer zupft da an seinem Laufhemd? Eine kernige Rothaarige in einem Nichts von Top deutet auf sein Smartphone, das er ihr im Vorbeigehen unter die Nase gehalten hat. Sie will das Bild noch einmal sehen. Peer zeigt das Display. Ihre von Glitter umrahmten Augen weiten sich erschrocken, sie nickt und brüllt in sein Ohr: »Sam!«
Peer kann sein Glück nicht fassen. Der ausgestreckte Arm der jungen Dame weist den Tresen entlang. Peer folgt ihr. Die Musik hämmert, aber zunehmend leiser. In einem Gang bleibt die Frau stehen. Statt Wummern im Bauch nun der beißende Geruch überlasteter Toiletten in der Nase. Peer atmet flach, stellt sich vor und zeigt ihr erneut das Display.
»Sam«, flüstert sie.
Das Foto lässt keine Zweifel daran, dass es Sam nicht gut geht. Tränen, die durch Glitter rollen.
»Was ist passiert?«
»Wer ist Sam?«, fragt Peer. »Und wer sind Sie?«
»Tilda«, sagt die Frau. »Ich gehöre zur Running Crew. Sam ist … Sam war …« – fragender Blick, Peer nickt – »einer von uns. Er war heute hier. Aber nur kurz. Wollte trainieren am Sonntag. Berlin-Marathon.«
Interessantes Konzept, denkt Peer. Er hat immer Wert darauf gelegt, möglichst ausgeschlafen und nüchtern zu laufen.
»Sind noch mehr Leute von der Running Crew hier?«
Tilda zögert. Frische Tränen. Peer kann zuschauen, wie Sams Tod bei ihr langsam einsinkt, von den Ohren über den Kopf bis ins Herz. Sie ist berührt, nein, die Nachricht macht sie fertig. Peer schweigt. Die Frau will ihm helfen. Seine Frage hallt nach. Tilda nickt.
»Wo finde ich die Sportsfreunde?«
Sie deutet hinter sich: »Toilette.«
Im Sanitärtrakt wird gedrängelt wie auf der Tanzfläche. Männer? Frauen? Egal. Unisex. Wilder Geruch, schummriges Licht, der Bass wummert bis hier. Juri ist verschwunden. Irritiert beobachtet Peer, dass sich meist kleine Gruppen in eine Kabine zwängen, kichernd, frei von Scham, alle durch-, alle miteinander. Manche Türen stehen halb offen. Zu erkennen ist trotzdem kaum etwas.
»Licht an!«, ruft Peer.
»Ernsthaft?«, schallt Juris Stimme aus der Düsternis. Wo steckt der Kerl?
»Licht an!«, wiederholt Peer eine Spur barscher. »Das ist eine polizeiliche Anordnung.«
Türen öffnen sich. Irritierte Blicke von schniefenden Druffis. Die Ersten machen sich aus dem Staub. Andere gucken belustigt, weil sie den Vogel in Altrosa für einen Scherzkeks auf Ketamin halten.
»Polizei!«, ruft Peer. »Keiner verlässt den Raum. Draußen wartet eine Hundertschaft.«
Notlügen sind in unübersichtlichen Lagen erlaubt. Neonröhren flackern unentschlossen an der Decke.
»Mehr Licht«, ruft Peer.
»Fuck you, Goethe!«, entgegnet eine Stimme kühn vom Urinal.
Juri ist nun auch wieder zu sehen: Er beruhigt geduldig ein paar verstrahlte Frauen, die von der plötzlichen Beleuchtung überfordert sind.
»Jonas und Martin«, wispert Tilda Peer zu und deutet auf zwei Männer an der Rinne, die in der freien Hand einen Drink halten.
»Da ist Kati.«
Sie deutet auf eine Frau, die um die Hüften etwas sehr Schmales trägt, entweder einen sehr kurzen Rock oder einen breiten Gürtel. Lasziv lungert sie in einer Kabinentür und wartet offenbar darauf, an den Spülkasten vorgelassen zu werden, wo eine ebenfalls spärlich bekleidete Frau hektisch Linien weißen Pulvers durch einen Strohhalm in die Nase zieht. Tilda winkt Kati zu sich, die ihre Poleposition aber nicht aufgeben will. Vor ihr nur noch ein Mädchen mit blondem Zopf. Peer stutzt. Er kennt das Gesicht der Blonden. Aber woher?
»Die auch?«, fragt er Tilda. »Running Crew?«
Sie schüttelt den Kopf. Tilda lässt Peer stehen, kreuzt durch die schnatternde Menge, flüstert in ausgewählte Ohren. Auffällig unauffällig drängen sich plötzlich Menschen in die Kabinen, Tütchen fliegen in Kloschüsseln, Spülungen rauschen, Textilien werden angelegt.
Peer mustert das Mädchen mit dem Zopf, wie es sich ungerührt den Strohhalm ins linke Nasenloch schiebt und zum Spülkasten hinabbeugt. Keine zwanzig, ortsüblich textilarm, aber dennoch adrett, Marke höhere Tochter. Ihre Unterwäsche, die sich unter dem transparenten Overall abzeichnet, wurde offenbar aus Angelschnur und Zahnseide gefertigt. Woher kennt Peer dieses Mädchen, das die letzten Krümel unbedingt vor der Kanalisation retten will?
»Was ist denn los hier?«, bellt einer der Männer aus der Running Crew.
Peer starrt auf das Mädchen im Overall. Na klar! Das Familienfoto auf Rusches Schreibtisch. Auf dem Bild trägt sie allerdings ein artiges Sommerkleid. Sieh an, Sophia Rusche! Ihr Vater ist Leiter der ersten Mordkommission und Sophia sein ganzer Stolz. Ungefragt gibt Rusche ständig mit ihrem Einserabi an. Ob Papa weiß, dass sich seine adrette Musterschülerin nachts in eine koksende Partymaus im Pornokostüm verwandelt?
Endlich versteht Sophia den Ernst der Lage. Hektisch wedelt sie die Reste vom Pulver hinters Klo, wischt sich die Nase ab und verschwindet.
»Geben Sie draußen bitte Ihre Personalien an«, ruft Peer ihr mit mühsam unterdrückter Genugtuung hinterher. Der Morgen wird immer interessanter.
Peer wendet sich an Tilda, die einen Kreis von sechs jungen Menschen um sich versammelt hat. Durchweg makellose Körper mit teuren Laufuhren und Laufschuhen, kein Paar unter dreihundert Euro. Bange Blicke.
»Das hier sind die Personen, die Sam kannten?«
Schweigen. Tilda nickt stellvertretend für die Running Crew.
Peer weiß jetzt endgültig: Das ist sein Fall.
Kapitel 3
Landeskriminalamt 1. Delikte am Menschen. Nach außen verströmt der Bau in der Keithstraße granitene Autorität, nach innen den Mief von hundert Jahren. Der vierte Stock beherbergt seit Ewigkeiten das Dezernat 11, Tötungsdelikte & Co., insgesamt acht Mordkommissionen. Peer genießt den Einmarsch mit einer halben Loveparade im Schlepptau. Frischer Wind, den wollen doch immer alle. Bis auf Koslowski vielleicht, der schweigend im Flur wartet. Hoher Haaransatz, nachtblauer Anzug, polierte Lederschuhe. Er hat die Arme verschränkt, mustert Peers Beuteleute milde herablassend. Er lässt die Nasenflügel beben, als ob er nur Peer riechen würde. Dabei dünstet die ganze Bande, ob Mitglieder der Running Crew oder die anderen Partypeople, die glauben, Sam gesehen zu haben.
Schweigend fixiert Koslowski Peer. Anzug gegen Altrosa.
»Was wird denn das?«, fragt Koslowski schließlich.
»Alles Zeugen«, antwortet Peer.
»Können die sich überhaupt an irgendwas erinnern?«
Peer ignoriert Koslowskis Sticheleien.
»Und die sind alle freiwillig mitgekommen?«
Koslowski spricht übertrieben laut. Er will die Partybande provozieren. Und Peer natürlich erst recht.
Einer der Druffis beißt tatsächlich an: »Wie, freiwillig? Hatten wir ’ne Wahl?«
Peer fixiert Koslowski. Dieser lächelt souverän, während sich unter den Zeugen die Neuigkeit verbreitet, dass offenbar niemand aufs Revier hätte mitkommen müssen. Peer hatte schlicht zu wenig Kollegen am Berghain, um alle Kandidaten in Ruhe zu befragen. Deswegen hatte er die Mitglieder der Running Crew und die angeblichen Zeugen kurzerhand ohne juristische Grundlage in einen Polizeitransporter verfrachtet.
Koslowski ist noch nicht fertig.
»Warum haben Sie die Leiche eigentlich einfach so hochgezogen?«, fragt er mit als Interesse getarnter Tücke. »Da wäre doch zuerst mal die SpuSi an der Reihe gewesen.«
»Und wenn er noch gelebt hätte?«, entgegnet Peer.
Koslowski ignoriert die Antwort und feuert weiter: »Und wie kommen Sie darauf, die Kollegin aus der Achten an einem Sonntag ins Präsidium zu bestellen? Die Erste hat Bereitschaft!«
Viel zu spät kapiert Peer, was hier aufgeführt wird: eine öffentliche Inquisition. Es geht nicht um die Ermittlungen, sondern um Zuständigkeit. Peer hat sich etwas genommen, was nicht seins war. Und Koslowski will den offenkundig spektakulären Fall nun zurück. Auf der Oberbaumbrücke hat er bereits Interviews gegeben, inhaltslos zwar, aber doch mit einer klaren Botschaft versehen: Das hier ist sein Fall. Wer das Gesicht in die Kamera hält, hat recht.
»Vielleicht duschen Sie vor der Befragung erst mal«, hört Peer noch, als er sich durch die motzende Meute zu seinem Büro vorarbeitet.
Gäbe es einen Wettbewerb für unspektakuläre Arbeitsplätze, Peer hätte einen der vorderen Ränge sicher. Der Schreibtisch ist der Spiegel der Seele, das hat ihm sein Vater schon zu Zeiten der Polizeischule eingeschärft. Unordnung am Platz weist auf Unordnung im Kopf hin. Während die Kollegen ihre Schreibtische mit Grünpflanzen oder anderen traurigen Staubfängern in eine Art Ersatzwohnzimmer verwandeln, zelebriert Peer die Kargheit mit drei Pokalen. Penibel achtet er darauf, dass weder Akten noch Schreibgeräte dauerhaft im Dreieck von Bildschirm, Tastatur und Telefon herumliegen. Einzige weitere Attraktion ist ein Fotowürfel aus Acryl, den seine Mutter ihm geschenkt hat: Die sechs Bilder zeigen Mama, Papa, alle drei, den jungen Peer als Schülermeister, den Hoffnungsträger Peer auf dem offiziellen Europameisterbild und schließlich die Urkunde mit dem goldenen Eichenlaub. Erste Amtshandlung jedes Büromorgens: Peer dreht den Würfel. Sein Lieblingsbild ist das von seinem Vater. Peer ist sicher, dass er ihn vom Foto aus beobachtet, meistens wohlwollend.
Frisch machen, kurz durchatmen, Gedanken sortieren. Während Peer im schmalen Schrank nach Hemd und Hose sucht, hält ihm Stephanie wortlos ein Handtuch hin.
»Kannst du die Bande kurz beruhigen? Bin in zwei Minuten da.«
Stephanie nickt und marschiert Richtung Flur.
Peer ist froh, dass Stephanie einstweilen das Kommando über die verpeilte Berghain-Bande übernimmt. Er muss sich noch daran gewöhnen, sie nicht »Rüdiger« zu nennen, was er anfangs getan hat. Ist doch witzig. Fand Stephanie allerdings nicht. »Die Kollegin aus der Achten« ist eine trans Frau, die ihm der Innensenat zugeteilt hat. Diversitätsoffensive. Peer, das schnuckelige Laufmaskottchen und Kriminalkommissarin auf Probe Stephanie, die ihre kantigen Züge auch mit langem Haar und Ohrringen nicht ganz übertünchen kann – das diverse Vorzeigepaar der Berliner Polizei als Mischfutter für die Medien. Und die Kollegen grinsen. Willkommen im Märchenberlin der Marketingagenturen.
Stephanie ist ein Jahr älter als Peer, aber trotzdem gerade erst mit dem Studium fertig. Was sie davor getrieben hat, weiß Peer nicht. Sie redet nicht über ihre Vergangenheit. Überhaupt über Privates. Ihr Leben habe mit dem Tag begonnen, an dem sie sich offiziell »Stephanie« nennen durfte, hat sie Peer am ersten Arbeitstag vor zwei Monaten erklärt. Die Übersetzung: Frag einfach nicht!
An diesem Sonntag trägt sie ein großgeblümtes Kleid aus den Fünfzigerjahren. Stephanie scheint einen Audrey-Hepburn-Fimmel zu haben. Frauen, also gebürtige, cis oder was auch immer, würden so einen Fummel nicht mal mit der Kneifzange anfassen. Peer hat noch mit den Begrifflichkeiten zu kämpfen. Im Grunde kann ja jeder (oder jede), wie er (oder sie) will, aber sprachlich, gedanklich und humortechnisch macht es das verdammt schwierig.
Anfangs hat Peer versucht, Stephanies alten Namen zu ermitteln, einfach so, aus sportlichem Ehrgeiz. Doch in den Akten fand sich nicht der geringste Hinweis. Datenschutz. Dann eben Rüdiger, dachte Peer trotzig, sagt es aber nicht. Nicht mehr. Einen halben Vormittag lang hat er Namen bei ihr getestet und sie wahllos Norbert, Malte, Kevin, Achim oder eben Rüdiger gerufen. Daraufhin hat sie ihm ruhig erklärt, dass er auf den Tatbestand der Diskriminierung zusteuere, was sie von Amts wegen melden müsse. Peer lachte. Aber nur kurz. Er musste sich entschuldigen, um eine Eskalation zu vermeiden, bei der er nicht gewinnen konnte. Dabei war es nur Spaß gewesen, noch nicht einmal vor den anderen. Doch Stephanie ist nicht nur trans, sondern eine Spaßbremse dazu, die von einem Reihenhaus in Zehlendorf träumt, inklusive Carport und Kugelgrill. Was ist nur aus den guten alten selbstironischen Queers geworden? Elton John würde kotzen. Einen Vorteil hat Stephanies Spießigkeit immerhin: Sie ist manisch korrekt, pflichtbewusst und hoch motiviert zur Stelle, Tag und Nacht.
Peer zwängt sich in die graue Notfallhose, die er in einer trainierteren Lebensphase im Schrank gebunkert hat. Nähte am Limit.
Vom Flur tönt Stephanies knarzige Stimme: »Bitte bilden Sie zwei Reihen: links alle die, die sich mit unseren Kollegen kurz über die vergangene Nacht unterhalten möchten …« – lautes Murren – »und rechts alle die, die sofort gehen möchten. Sie müssten dann eine kleine Blutprobe abgeben, die wir auf illegale Substanzen überprüfen.«
Stille. Stephanie ist langweilig, aber schlau.
Peer atmet aus. Hoffentlich erträgt der Hosenknopf die Spannung. Eine Strickjacke soll die Hüftwülste umspielen. Ein Minimum an textiler Autorität, um Koslowski in Schach zu halten.
Inzwischen sind Schröder, Brandt und Schmidt aus der Ersten aufgetaucht. Plus ein Ekelpaket im Anzug. Zu fünft werden sie die Zeugen befragen, zumindest die, die nicht vorher davongelaufen sind.
Die Befragungen zu Sam bleiben maximal unergiebig. Nachts Tanzen, Wodka, Nasenpulver, tagsüber Laufen. Keine Feinde, alles tutti, toller Sport- und Feierkumpel. Übereinstimmend das Eingeständnis, dass die Running Crew ihr nächtliches Training gegen fünf Uhr morgens kollektiv auf die Unisex-Toilette verlegt hat, ohne Sam. Der war früh gegangen, was nicht weiter ungewöhnlich war. Alle haben ein Tageslichtleben, voll mit Studium oder Job, vor allem aber mit Laufen, sehr viel Laufen. Dazu das Schwarzlichtleben, das Kraft kostet. Und Erinnerungsvermögen. Richtig gut kannte offenbar keiner Sam. Viel Lyrik, wenig wirklich Relevantes. Offenbar ist die Running Crew weniger ein Freundeskreis als vielmehr eine unverbindliche Zweckgemeinschaft, in der sich junge Menschen, die sich für unkaputtbar halten, gegenseitig über ihre Grenzen pushen.
Nur einer war Sam etwas näher. Mediziner Jonas, ein Kraftpaket Ende zwanzig, scheint Kopf der Running Crew zu sein, schlau und schnell zugleich, was eine seltene Kombination ist. Er hat Pupillen wie Untertassen, aber bemerkenswert definierte Waden. Jonas blickt sich dauernd um, ein typisches Anzeichen für Koks-Paranoia. Er hat Sam einige Male auf Trainingsläufen begleitet, wo genug Zeit zum Reden ist. Schulden? Beziehungsstress? Ärger im Job? Jonas hebt die Schultern: »Wenn Sam Schulden hatte, dann auf seinem Trainingskonto.«
Stephanie liefert die harten Fakten: Sam Welzer, fünfundzwanzig, aufgewachsen in Tempelhof, Apartment im aufstrebenden Neuköllner Schillerkiez, eigentlich zu teuer für einen BWL-Studenten. Keine Vorstrafen. Überhaupt nichts Auffälliges.
Die meisten der Nachtschwärmer sind gegangen. Nur die Tür zu Koslowskis Büro ist noch geschlossen. Tilda ist bei ihm.
Nach pflichtschuldigem Klopfen steckt Peer den Kopf durch den Türspalt. Er will verhindern, dass der selbstgefällige Kollege alles kaputtermittelt.
»Lassen Sie uns doch bitte noch kurz allein, Pedes!«
Koslowski spricht seinen Namen oft und gern so hinterlistig undeutlich aus, dass es nahezu unmöglich ist, nicht »Penis« zu verstehen. Hat Tilda gegrinst? Peer ignoriert die Bitte und schließt provozierend langsam die Tür hinter sich.
»Ich kenne die junge Frau aus dem Club, und sie hat mir eine Menge erzählt«, erklärt Peer. »Wir sollten das Gespräch gemeinsam führen.«
Koslowski nickt überfreundlich und weist auf einen Hocker. Peer setzt sich und taxiert Tilda. Von der Nacht, von Sams Tod geschafft, bemüht sie sich dennoch um Haltung. Läuferdisziplin.
»Wo waren wir gerade?«, fragt Koslowski.
Tilda gewährt Peer einen Blick, der einen angenehmen Moment zu lang dauert: »Bei meinen fast zweihunderttausend Followern auf Instagram.«
»Und ich bin einer davon«, sagt Koslowski. »Wirklich toll, was Sie da für die Läufer-Community auf die Beine gestellt haben, diese Mischung aus guter Information und Style. Da hat man sicher nicht nur Freunde?«
Triefender Schleimbeutel, dein Name ist Koslowski. Jeder anständige Läufer belächelt diese Jogging-Darsteller, die fortwährend ihre durchgefilterte Fitness posten. Noch lachhafter sind all die unsportlichen Follower, die ihren Lebenszweck im Anbeten finden. Würde die Zeit und Energie, die dieser Social-Media-Irrsinn verschlingt, für echtes Training aufgebracht, wäre Deutschland fitter, schneller und weniger neurotisch.
Doch Koslowski macht weiter auf Fanboy.
»Würden Sie einem Laien wie mir erklären, wie man so eine enorme Followerschaft auf Instagram aufbaut?«
Tilda lächelt. Peer schweigt. Wie kann eine erwachsene Frau auf diese Zuckerwattetour reinfallen?
Tilda: »Hm, bin da eher reingerutscht. Vor ein paar Jahren habe ich angefangen, Fotos und Lauftipps zu posten, erst mal nur für Freunde und die Leute aus der Running Crew. Wir haben uns bei einem Lauftreff kennengelernt, an der Spitze des Feldes. Wir waren schneller als der Rest, ambitionierter, aber auch gnadenloser. Hart feiern, hart laufen – Berlin halt. Mein Account bekam immer mehr Follower. Dann kamen die ersten Anfragen von Firmen, die mit mir werben wollten. Ich hatte keine Ahnung, wie viel Geld man mit einem Foto in Laufklamotten verdienen kann. Also habe ich meinen Job auf halbtags reduziert, mich in die Technik reingearbeitet, Strategien entwickelt und all das. Als dann der Deal mit FitShit kam, war mir klar: Das machste jetzt Vollzeit.«
»FitShit«, zwitschert Koslowski. »Die haben gutes Zeug!«
Peer murmelt: »Teurer Urin.«
Stahlblick von Koslowski. Tilda schaut auf.
»Na, diese ganzen sauteuren Nahrungsergänzungsmittel – ist doch alles dubios«, erklärt Peer. »Bleibt kaum was im Körper, geht alles in die Kanalisation …«
Koslowski richtet sich auf und fixiert Peer mit einem Handschellenblick.
»Also ich habe mit dem Eisenpräparat von FitShit sehr gute Erfahrungen gemacht, gerade was die Regeneration angeht. Hat mir bei meiner Marathon-Bestzeit sehr geholfen.«
Die Spitze ging direkt an Peer.
Tilda nickt: »Ja! Sehr hohe Bioverfügbarkeit. Die Produkte sind echt nicht billig, aber sie wirken. Lehmann geht da total radikal vor, mit seiner Akribie und den Studien. Er verkauft nur das, was funktioniert. ›Ihr bei der Running Crew macht keine Kompromisse, wir bei FitShit auch nicht‹, sagt Lehmann immer. Perfect Match.«
Koslowski will weitersäuseln, doch Peer ist schneller.
»Aber es geht auch um viel Geld, da gibt’s doch Neid, Eitelkeiten. Sam war nicht so berühmt. Keine Follower, kein Geld. Hat er Ärger gemacht?«
Tildas professionelle Fassade wankt. Aber was verbirgt sich dahinter? Sie schaut zu Peer, aber ganz anders als zu Koslowski. Sie will Klartext reden, mit ihm. Nur mit ihm. Sie öffnet den Mund. Doch Koslowski merkt mal wieder gar nichts. Er räuspert sich eine Spur zu laut und zu schnell, dann setzt er sein Vipernlächeln auf.
»Herr Kollege, ich begrüße Ihre Mitarbeit. Aber es wäre hilfreich, wenn wir die Meinungsbeiträge vorerst zurückstellten.«
»Wieso Meinung? Ich stelle nur Fragen.«
»Sie suggerieren.«
»Lassen Sie mich einfach meine Zeugin befragen«, raunt Peer.
Plutoniumblick Koslowski.
»Meine Zeugin! Ich trage die Verantwortung für den Fall.«
Peer registriert, dass Tilda dichtmacht. Die Chance ist vertan, mehr über Sam zu erfahren, die Running Crew, Lehmann. Und nur wegen Koslowskis Platzhirschigkeit.
Na gut, dann eben das Dicke-Eier-Spiel: »Ich war als Erster am Tatort und habe schon im Berghain ermittelt, als Sie fürs Lokalfernsehen Interviews gegeben haben.«
»Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, vom zuständigen Leiter der Ermittlungen informiert zu werden.«
Gespannt wie verwirrt verfolgt Tilda die Machtschlacht der Polizisten. Früher, also noch letzte Woche, hätte Peer zurückgesteckt. Aber es geht um ihn, seine Chance, sein Schicksal. Also Attacke.
»Ich kenne die Laufszene, ich habe die Leiche entdeckt, und ich treibe die Ermittlungen voran. Es ist mein Fall.«
Koslowski guckt ihn wie ein esoterischer Hundetrainer an, der einen störrischen Dackel mit Klangschalen abrichten will.
»Lieber Herr Pedes«, sagt er und macht eine provozierend lange Pause. »In unserem Laden gibt es Regeln, die sogar für ehemalige Marathon-Champions gelten.«
Tilda erhebt sich. »Leute, ich hab alles gesagt, was ich weiß. Sorry, aber ich kann nicht mehr. Wenn Sie Ihre Probleme geklärt haben und ich noch irgendwie helfen kann: Sie haben ja meine Daten.«
Als die Tür langsam ins Schloss gefallen ist, starren Peer und Koslowski sich gegenseitig immer noch vorwurfsvoll an.
Der Leiter der ersten Mordkommission Jörg Rusche ist der perfekte Bulle. Kantiger Schädel, schneidiger Ton, auffallend heiles Privatleben. Ernst zu nehmender Kandidat für höhere Posten. Er leitet die erste Mordkommission unnachgiebig, aber umgänglich. Mit stillem Amüsement betrachtet er das seltsame Paar der Jungkommissare vor seinem Schreibtisch: ein Verstrubbelter in viel zu engen Hosen und ein Überangepasster in nachtblauem Anzug mit Einstecktuch, natürlich Paisley. Keine Vorabendserie würde derlei Vögel aufbieten, nur die Berliner Polizei.
Peer weiß, was kommt. Mag die Gerechtigkeit auch auf seiner Seite stehen, Koslowski ist leider im Bund mit den Vorschriften. Die Leier von der zuständigen Mordkommission. Die Erste hat Bereitschaft. Blabla.
»Haben Sie das verstanden, Pedes?«, schließt Rusche.
Peer deutet ein Nicken an, während Koslowski neben ihm sein Triumphgrinsen zelebriert. Na warte, du Ratte. Der größte Fehler des Läufers ist es, bereits hundert Meter vor dem Ziel die Arme hochzureißen. Peer wird sich diesen Fall zurückholen, mit allen Mitteln. Allen. Jahrelang hat er sich in die zweite Reihe drängen lassen. Schluss jetzt. Peer hat den peerfekten Plan, bösartig und wirkungsvoll zugleich. Er wundert sich über die wilde Erotik, die allein der Gedanke an kriminelle Energie entfacht.
»Ich würde gern noch einen Moment mit Ihnen allein reden«, sagt Peer zu Rusche.
Koslowski hat bereits die Türklinke in der Hand und guckt für einen Moment irritiert.
»Zwei Minuten«, sagt Rusche genervt.
Beruhigt verlässt Koslowski das Büro. Die Tür lässt er einen Spalt offen stehen, als wolle er sagen: Kann ja nichts Wichtiges sein.
Sorry, denkt Peer und blickt auf die Rückseite des Familienfotos auf Rusches Schreibtisch. Sorry, Sophia! Es würde ernste Gespräche beim Abendbrot im Hause Rusche geben. Die Tochter des Chefs in maximaler Transparenz auf der Unisex-Toilette, mit Betäubungsmitteln in der Nase – nachhaltiger lässt sich jede Hoffnung auf den Posten des Dezernatsleiters kaum zerstören. Peer schließt die Tür zum Flur und reicht dem überraschten Rusche die Liste der Zeugen aus dem Berghain. Sicherheitshalber ist die betreffende Zeile säuberlich mit Textmarker hervorgehoben: Sophia Rusche, 19, Studentin.
Vater Rusche erbleicht.
»Wir sind nicht ganz sicher, ob diese Person wirklich ihre korrekten Daten angegeben hat«, sagt Peer amtlich. »Falls es sich um einen Irrtum handelt, werden wir sie natürlich von der Liste entfernen. Allerdings war bei ihr der Betäubungsmittelkonsum nicht zu übersehen. Eine Blutuntersuchung wäre dringend angeraten. Sie wissen ja, die Vorschriften. Ich müsste die junge Frau morgen zum Test bitten. Hier aufs Revier. Was meinen Sie?«
Rusche versteht. Er hat sich blitzschnell gefangen. Keinerlei Anzeichen von Irritation. Sein »Okay!« klingt geschäftsmäßig. Er greift zum Hörer. Erpressung scheint in diesen Kreisen normal zu sein. Machen wahrscheinlich alle, bis auf Peer.
Koslowski schreitet wie ein Reiher in Rusches Büro. Triumph quillt ihm aus jeder Pore.
»Kann ich noch was für Sie tun, Chef?«
»Sie sind Kunde bei FitShit?«, fragt Rusche, ohne Koslowski einen Platz anzubieten. »Und FitShit-Chef Lehmann sponsert den Marathon in Bad Düben auf Ihr Bestreben hin?«
Koslowski nickt unsicher. Was läuft hier? Flackernder Blick zu Peer, der diese kleinen, scheinbar unbedeutenden Informationen an den Chef weitergereicht hat wie zuvor die Zeugenliste.
»Ist schon Jahre her, dass ich Herrn Lehmann mal kontaktiert hab wegen des Marathons in meiner Heimatstadt und …«
Herrische Geste von Rusche.
»Sie werden verstehen, dass wir damit ein Problem bekommen, Koslowski. Wenn die Medien das herausfinden – und sie werden es herausfinden –, dann haben wir eine Befangenheitsdebatte am Hals, die weder Ihnen persönlich gelegen kommt noch uns als Institution, deren größtes Kapital die Glaubwürdigkeit ist.« Koslowski erstarrt. »Ich bitte um Ihr Verständnis, dass ab sofort der Kollege Pedes die Ermittlungen leitet. Das bin ich meiner Fürsorgepflicht schuldig. Wir versetzen ihn dafür kurzzeitig zu uns in die Erste.«
Schlagartig trägt Koslowski das Gesicht, das bis vor wenigen Minuten Peers war. Rusche hat nicht lange gefackelt. Ein Telefonat mit dem Dezernatsleiter und ein weiteres mit Bülow, dem Chef von Peers achter Mordkommission, und schon war die Ausleihe entschieden. Peer konnte nicht hören, was Bülow geantwortet hat, aber das war auch gar nicht nötig. Seinem bisherigen Chef war er ziemlich egal. Der grummelige Zyniker hatte nur eines im Blick: seine baldige Pensionierung. Einer allerdings fieberte Bülows Ruhestand noch ungeduldiger entgegen: Peer.
Es gibt Kommissionsleiter, die in Würde altern, ihr Wissen großzügig weitergeben, Nachfolger aufbauen, den Laden für die Zukunft aufstellen. Und es gibt Ausgebrannte wie Bülow, deren Kernkompetenz sich im Alter auf permanentes Giftspritzen reduziert. Junge Kollegen wie Peer sind dem alten Sack unheimlich, weil sie schnell sind, digital und hungrig, also das komplette Gegenteil von ihm. Bülows Nachwuchsförderung basiert auf einem einzigen Grundprinzip: »Die Jungen müssen erst mal Scheiße fressen.« In vier Jahren hat er Peer nicht einmal mit der Leitung eines Falles betraut. »Unser Donald«, sagte Bülow, der fälschlicherweise denkt, dass er witzig sei, immer wieder: »Unser Donald.« Die Kollegen lächelten gequält. Sein Chef hält Peer für einen Tollpatsch und »Donald Duck« für einen lustigen Spitznamen.
Rusche ist deutlich härter, aber auch klarer und gerechter; man spürt sofort den früheren Zehnkämpfer. Rusche, das ist Peers Chance für einen Neuanfang. Wenn er den Fall löst. Vielleicht kann er nach dem Fall sogar in der Ersten bleiben. Während ein versteinerter Reiher zurückbleibt, federt Peer wie auf Flummis aus Rusches Büro. Jeder Schritt ein kleiner Freudensprung. Er ist vorn mit dabei im Rennen. Wo er hingehört. Endlich.
Kapitel 4
»In die Erste? Wir beide? Wow!«
Stephanies Freude über den Wechsel ist echt. Auch wenn in der ersten Mordkommission Koslowski & Co. lauern, herrscht mit Rusche zumindest ein einigermaßen fairer Chef. Und kein Bülow. Stephanie hat nicht vergessen, wie sie an ihrem ersten Arbeitstag vom Dezernatsleiter vorgestellt wurde. Bülow hat nichts gesagt, aber sein Blick sprach Sammelbände.
»Na ja, wir sind eben das Traumpaar der Berliner Polizei«, erklärt Peer und würde gern fein ironisch wirken. »Der Laden bricht doch zusammen, wenn wir nicht mehr zusammenarbeiten.«
Kommt an bei Stephanie. Zarter Verbündetenblick. Peer versteht Stephanie zum ersten Mal nicht als Fremdkörper, sondern als Schwester im Geiste. Wenigstens ein vertrautes und verlässliches Gesicht in Koslowskis Hyänenrudel.
»Das Traumpaar der Berliner Polizei.« Mit dieser Schlagzeile hatte eine Boulevardzeitung ein Foto der beiden betitelt. Im letzten Jahr vermutlich die einzige positive Erwähnung des Ladens in den Medien. Und zugleich ein schrecklicher Fluch. Die Kollegen wissen positive PR einerseits zu schätzen, andererseits hassen sie es, wenn ausgerechnet junge Kollegen medial hochgejubelt werden, die »noch gar nichts geleistet haben«, wie Bülow sagen würde.
Leisten. Leistung. Hochleistung. Es gibt Rennen, die darf man auf keinen Fall verlieren, weil es um viel mehr geht als eine Medaille. Es geht um Respekt. Peer ist vollkommen klar, was sein erster eigener Fall bedeutet: Hat er, haben sie Erfolg, dann wird aus Hohn Respekt. Versagen sie, bleibt er lebenslänglich »Donald«. Und das Traumpaar wird zum Albtraumpaar, dem nur eines sicher ist: ewiger Spott.
Peer hockt sich vor Stephanies Schreibtisch. Augenhöhe. So wichtig.
»Wir dürfen die Nummer nicht verkacken, auf keinen Fall.«
Stephanie nickt entschlossen. Sie sitzt mit ihm in einem wackeligen Boot und weiß: Es ist ernst. Und eilig. Denn die ersten achtundvierzig Stunden nach einem Mord sind die wichtigsten. Die Spuren sind frisch, Erinnerungen stabil, die Zeugen verunsichert, die Konfliktlage unklar. Überall Pulverdampf. Sobald die Anwälte aufmarschieren, verhärten sich die Fronten. Zeugen werden zum Schweigen verdonnert, unter Druck gesetzt, sprechen sich ab. Erinnerungen verblassen, Spuren werden verwischt. Und das Ermitteln wird mühsam.
»Die ersten achtundvierzig Stunden«, sagt Stephanie.
Manchmal ist Gedankenlesen ganz einfach.
»Genau. Deswegen werden wir uns aufteilen. Zwei Jobs stehen an.«
»Müllers Horrorkabinett …«, ahnt Stephanie.
»Und die Eltern des Opfers«, ergänzt Peer.
Zwei ebenso unangenehme wie wichtige Aufgaben. In der Rechtsmedizin schnippelt der furchtbare, aber leider brillante Dr. Müller die Leiche auf und wird erste Erkenntnisse zum Tathergang präsentieren. In Tempelhof wiederum sitzen zwei ältere Herrschaften in ihrem Häuschen, die nicht ahnen, dass sich ihr Leben an diesem Sommersonntag für immer verändern wird. Das Überbringen einer Todesnachricht gehört zu den traurigsten Momenten des Ermittlerlebens, kann aber auch zu entscheidenden Erkenntnissen führen.
»Sam Welzer hatte ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern. Er war oft zu Hause.« Das hat Peer aus der Befragung der anderen Läufer herausgehört.
»Ich gehe davon aus, dass du das Horrorkabinett übernimmst?«
Stephanie gibt sich keinerlei Illusionen hin. Die unbequemsten Jobs werden nach unten delegiert.
»Ich bin doch nicht Bülow«, entgegnet Peer und ballt die Faust. »Schere, Stein, Papier.«
Auf dem Flur laufen die beiden Bülow in die Arme. Ausgerechnet. Er hat seinen Vize Glöckner im Schlepp, dessen Muffelblick auf einen langen Sonntag schließen lässt. Die Achte hat einen Mord im Milieu an der Backe. Schießerei in einer Weddinger Kneipe, eine typische Racheaktion, ziemlich tölpelhaft ausgeführt. Der Täter steht praktisch fest, dennoch hat Bülow sowohl Peer als auch Stephanie tagelang zum Klinkenputzen die Müllerstraße hoch und runter geschickt. Zeugen suchen, die es in der Regel nicht gibt und die auch keiner braucht. Bülow weiß zu demotivieren. Heute steht nun die Vernehmung des Beschuldigten an. Der einzige spannende Teil an dem Fall, über den Peer erst aus dritter Hand erfahren hat. So läuft das immer in der Achten.
»Glückwunsch, Donald«, schnarrt Bülow. »Das nenne ich Anfängerglück, wenn der erste eigene Fall nicht allzu komplex ist. Bekiffte Clubgänger, Körperkult, Internet-Schnickschnack – das sind genau die spektakulären Designer-Fälle, wie sie sich der gut aussehende Nachwuchs wünscht. Hätte ich auch mal gern. Wir schlagen uns derweil mit Profis herum.«
Ein typischer Bülow. Über Jahre verdichtete Bullenbitternis entlädt sich in perfiden, persönlichen Beleidigungen, notdürftig als Gesellschaftskritik getarnt. Weil er mit seinem Welt- und Lebensschmerz allein nicht fertigwird, sollen alle anderen mitleiden, vor allem die Jungen mit ihrem Internet- und Gender-Zeug, das er nicht versteht, weil er es nie verstehen wollte. Früher galt Bülow als brillanter Ermittler, heute verteidigt er verbissen das letzte Faxgerät auf dem Flur und seinen uralten Nokia-Knochen.
»Vielen Dank für Ihre netten Worte und viel Glück im Wedding«, sagt Peer mit aufreizender Höflichkeit. »Wir werden jetzt ein paar Designerdrogen nehmen und im Berghain feiern. Die Pics stellen wir extra für Sie auf Insta. Die Kollegen erklären Ihnen sicher gern, was das ist.«
Bülow schnappt nach Luft. Glöckner macht sich nicht mal die Mühe, sein breites Grinsen einzuhegen. Stephanie schreitet stoisch Richtung Tür. Und Peer ist froh, dass er sich nicht zu einer weiteren Spitze hat hinreißen lassen, zur Rente mit dreiundsechzig etwa.
Peer nimmt die U-Bahn nach Tempelhof. Warum hat er Papier genommen und nicht Schere? Chinesische Forscher haben herausgefunden, dass Männer in der ersten Runde überdurchschnittlich oft Stein nehmen. Deswegen nimmt Peer am Anfang immer Papier. Aber Stephanie ist ja kein Mann. Mehr. Oder war sie nie einer? Es bleibt verwirrend. Auf jeden Fall hat sie mit Schere begonnen, laut chinesischer Forschung typisch für Frauen. Hätte Peer ahnen können. Dann wäre er jetzt nicht auf dem Weg, eine heile Welt zu zerstören.
Das Fliegerviertel nahe am ehemaligen Flughafen ist eine Oase, geradezu erschreckend leise, aufgeräumt und angenehm unhip. Vom Tempelhofer Damm aus geht es durch einen Torbogen in eine vor über hundert Jahren geplante Siedlung, deren sanft gekurvte Straßen preußisch gründlich auf eine fast dörflich anmutende Lebensqualität hin angelegt wurden. Die Häuschen sind klein, aber liebevoll in Schuss gehalten. Auf vielen Dächern glänzen Solarpanels. Die geparkten Autos weisen auf Durchschnittsverdiener hin. Das Sozialprestige wird hier über die Pracht der kleinen, aber aufwendig bepflanzten Vorgärten verhandelt. Rosen und Rhododendren, Fuchsien und Tränende Herzen liefern sich ein gigantisches florales Duell und bieten zugleich einen bunten Schutzwall. Hätte der junge Peer sich den Traumort für eine unbeschwerte Kindheit aussuchen dürfen, hätte er die Fliegersiedlung gewählt, ein Hort der Heimeligkeit inmitten des ruppigen und dauernervösen Berlins. Irgendwo planschen Kinder, Kaffeegeschirr klappert, Sonntagnachmittagsgeplauder schwirrt durch die Sommerwärme.
Das Haus der Welzers ist von charmanter Normalität. Die Familie scheint sich auf Teerosen spezialisiert zu haben. Unter dem Türbogen mit den vielen kleinen Blüten holt Peer dreimal tief Luft. Er hat versucht, sich die passenden Worte zurechtzulegen. Soweit es passende Worte für das Überbringen von Todesnachrichten gibt, besonders wenn es sich beim Opfer um das einzige Kind handelt. Peer schüttelt sich, richtet sich auf und drückt den Klingelknopf aus Messingimitat an der beige verputzten Hauswand. »Willkommen«, ruft die Fußmatte. Noch ein tiefer Atemzug. Die Tür öffnet sich, aber nur einen Spaltbreit. Die neugierigen Augen einer älteren Frau blicken Peer an.
»Ja?«
»Frau Welzer?«
»Ja. Und wer sind Sie?«
»Peer Pedes. LKA Berlin.«
Er hält ihr seine Marke hin.
»Ich muss mit Ihnen reden. Darf ich reinkommen?«
Nicht zwischen Tür und Angel. Eine Sitzgelegenheit sollte in der Nähe sein. Das lernt man sogar in der Polizeischule. Mechthild Welzer zögert noch einen Moment, dann öffnet sie blitzschnell die Tür, zerrt mit patentem Griff den verdutzten Peer über die Schwelle und knallt die Tür hinter ihm zu.
»Unsere neue Katze«, sagt sie entschuldigend. »Läuft weg, sobald sie eine Möglichkeit wittert. Dabei hat das verwöhnte Viech draußen keine Chance. Die würde von einem Spatzen verprügelt werden. Aber mein Mann wollte ja unbedingt so eine lebensuntüchtige Ragdoll.«
Sie rollt mit den Augen.
»Das habe ich gehört«, brummt Ewald Welzer, der plötzlich hinter seiner Frau auftaucht. »Sie zieht permanent über meinen Liebling her. Aber wenn Camilla sich erst mal eingewöhnt hat, wer wird dann die ganze Zeit mit ihr kuscheln?«
Er deutet vielsagend auf seine Frau, die ihn gespielt empört anschaut. Peer lächelt. Ein süßes Paar, die Welzers. Graue Haare, randlose Brillen, Hemden und Hosen in gedeckten Farben. Partnerlook, die nicht aufdringliche Variante.
»Aber Sie sind ja nicht von der Katzenpolizei«, stellt Frau Welzer fest. »Worum geht es denn?«
»Wer sind Sie?«, hakt Herr Welzer sicherheitshalber nach.
»Pedes. Kriminalkommissar Peer Pedes, erste Mordkommission des LKA.«
»Mordkommission?« Frau Welzer blickt irritiert zu ihrem Mann. »Wieso denn Mordkommission?«
Peer steht nun im eichendunklen Wohnzimmer vor der Couchgarnitur. Die Ledersofas bieten ausreichend Sitzgelegenheiten für die Überbringung von Todesnachrichten. Blick zur Terrasse. Von der geblümten Wachstischdecke erhebt sich ein Erdbeerkuchen, flankiert von Thermoskanne und Sahnespender. Laufen, Kuchen, Sahne – ein magisches Dreieck. Peer denkt an Sam, wie er sich all die Jahre vergnügt über Mutters Kuchen hergemacht haben muss. Wie in jeder Läuferfamilie. Er holt Luft, sammelt sich, doch der Mut kommt nicht mit. Noch einmal tief Luft holen, noch einen letzten Moment in jener heilen Welt bleiben, die seit ein paar Stunden unwiederbringlich zerstört ist.
»Sie sind beide in Rente, richtig?«
»Ja, seit zwei Jahren. Ewald war Busfahrer bei der BVG. Siebenunddreißig Jahre. Dann hat der Rücken gemeutert.«
»Bei dem Garten wird Ihnen bestimmt nicht langweilig.«
»Sie kommen doch nicht her, um mit uns übers Gärtnern zu plaudern«, drängelt Ewald.
Es ist so weit. Peer fürchtet die Tränen, das Schluchzen, das Warum. Unheilvolle Pause. Er nimmt die Schultern leicht zurück. Die Welzers starren ihn an. Sie ahnen Unheil, wollen es aber nicht wahrhaben. Natürlich nicht. Adrenalin hämmert in seinen Ohren. Ruhig, Junge, du schaffst das.
»Frau Welzer, Herr Welzer, ich bringe leider die schlimmstmögliche Nachricht: Ihr Sohn Sam ist tot. Mein herzliches Beileid.«
Die Welzers gucken erst sich an, dann Peer.
»Sam ist was?«, fragt sein Vater.
»Er wurde ermordet, heute Nacht, an der Oberbaumbrücke. Die Kollegen und Kolleginnen sind seit den frühen Morgenstunden auf der Suche nach dem Täter. Ich leite die Ermittlungen.«
»Das muss ein Versehen sein, eine Verwechslung. Sam ist ein guter Junge.«
Frau Welzer kämpft einen letzten aussichtslosen Kampf.
»Es besteht kein Zweifel, liebe Frau Welzer.«
Peer überlegt, ihr das Handyfoto des toten Sam zu zeigen, entscheidet sich aber dagegen. Der Anblick würde den Schock nur verstärken.
»Sam! Mein Junge.«
Schluchzend fällt Frau Welzer ihrem Mann in die Arme. Immer neue Schockwellen schütteln ihren Körper, ihre Knie scheinen zeitweise einzuknicken. Ewald Welzer steht wie versteinert da, seine Hände schützend um seine wimmernde Frau gelegt. Wenn jemand seine Gefühle im Griff hat, dann ein Berliner Busfahrer.
Peer sprudelt Leitungswasser auf, schon zum dritten Mal. Ewald Welzer hat den Umzug in die Küche initiiert. Auf der Küchenbank hält er seine Frau immer noch stoisch im Arm. Ihr Wimmern ist leiser geworden, das Zucken seltener. Mit der freien Hand dirigiert er den Kommissar, der sich benimmt wie ein guter alter Freund. Nicht viel quatschen, empathisch auf die schmerzhaften Fragen antworten, ansonsten einfach nur da sein, helfen, kümmern. Ewald deutet auf die mittlere Tür des Hängeschranks. Auf dem dritten Brett stehen die Schnapsgläser. Ewald deutet Richtung Wohnzimmer: »Auf der Anrichte.« Peer kehrt mit einer Flasche Obstler zurück. Sie prosten sich zu.
Peer war mehrfach dabei, als Bülow Todesnachrichten überbracht hat. Er überrollte die Leute wie ein Schützenpanzer, schnarrte ein stumpfes »Beileid« und begann umgehend mit der Befragung: Feinde? Drogen? Seitensprünge? Waffen? Schulden? Natürlich reagierten die Menschen verzweifelt, unwirsch oder schwiegen. Was für Bülow wiederum ein sicheres Indiz war, dass die Leute etwas zu verbergen hatten. Immerhin hatten diese gruseligen Begegnungen einen paradoxen Lerneffekt: Einfach das Gegenteil dessen tun, was Bülow getan hätte. Oft fragte sich Peer, an welchem Punkt seiner Laufbahn Bülow falsch abgebogen war. Und ob jeder Kommissar eines Tages an diesen Punkt der Komplettverbitterung kommt.
In das Schweigen der Welzers hinein stellt Peer sich vor, wie seine Mutter reagieren würde, bekäme sie eine solche Nachricht überbracht. Mutter Pedes und Mutter Welzer sind vom selben Berliner Schlag, robuste Kodderschnauzen nach außen, aber im Kern unendlich zart. Diese wunderbaren Muttertiere brauchen ein bisschen Geduld, Behutsamkeit und manchmal nur ein Lächeln. Wären da nicht diese elenden achtundvierzig Stunden.
Immerhin hat Ewald Welzer stockend berichtet, dass Samuel, wie er ihn nennt, noch vor drei Tagen zum Abendessen bei ihnen zu Hause gewesen war. Peers Nachfragen hat er allerdings sanft abgeblockt, ebenso seinen Wunsch, Sams altes Zimmer inspizieren zu dürfen.
»Nicht jetzt.«