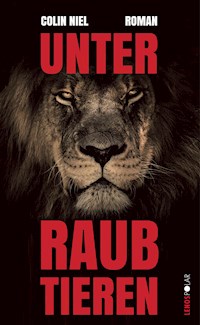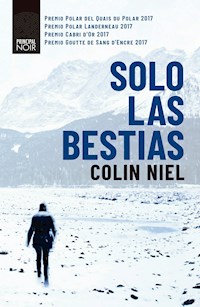13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lenos Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Lenos Polar
- Sprache: Deutsch
Évelyne Ducat verschwindet eines Tages spurlos, und das Städtchen im französischen Zentralmassiv rätselt. Es kursieren Gerüchte und Beobachtungen. Doch nicht alles wird der Polizei preisgegeben, denn hier in der abgeschiedenen Bergwelt hüten die Menschen ihre Geheimnisse. Die Sozialarbeiterin Alice hat ein Geheimnis mit ihrem Klienten Joseph, dem einsamen Schafzüchter. Und der verhält sich nach dem Verschwinden der Frau merkwürdig. Und in welcher Beziehung stand die Verschwundene zu der jungen Maribé, die eines Tages im Städtchen auftauchte und alle Blicke auf sich zog? Mit jedem Kapitel erhält eine andere Person das Wort, und ein neues Geheimnis, ein neuer Verdacht taucht auf, bis sich das Puzzle um Évelyne Ducats Verschwinden zusammenfügt. Colin Niels preisgekrönter Roman noir ist mehr als ein raffiniert konstruierter Krimi: Er gibt ebenso fesselnd Einblick in prekäre soziale Milieus und erzählt von der verzweifelten Suche nach Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Évelyne Ducat verschwindet eines Tages spurlos, und das Städtchen im französischen Zentralmassiv rätselt. Es kursieren Gerüchte und Beobachtungen. Doch nicht alles wird der Polizei preisgegeben, denn hier in der abgeschiedenen Bergwelt hüten die Menschen ihre Geheimnisse. Die Sozialarbeiterin Alice hat ein Geheimnis mit ihrem Klienten Joseph, dem einsamen Schafzüchter. Und der verhält sich nach dem Verschwinden der Frau merkwürdig. Und in welcher Beziehung stand die Verschwundene zu der jungen Maribé, die eines Tages im Städtchen auftauchte und alle Blicke auf sich zog? Mit jedem Kapitel erhält eine andere Person das Wort, und ein neues Geheimnis, ein neuer Verdacht taucht auf, bis sich das Puzzle um Évelyne Ducats Verschwinden zusammenfügt.
Colin Niels preisgekrönter Roman noir ist mehr als ein raffiniert konstruierter Krimi: Er gibt ebenso fesselnd Einblick in prekäre soziale Milieus und erzählt von der verzweifelten Suche nach Liebe.
Colin Niel, geboren 1976 in Clamart, ist eine der grossen Stimmen des französischen Roman noir. Nach einem Studium der Evolutionsbiologie und Ökologie arbeitete er zunächst als Agrar- und Forstingenieur im Bereich Biodiversität, u. a. mehrere Jahre in Französisch-Guayana. Mit einer vierteiligen guayanischen Serie, die vielfach ausgezeichnet wurde, gelang ihm der Durchbruch als Autor. 2017 erhielt er für Seules les bêtes u. a. den Prix Landerneau Polar und den Prix Polar en séries. Der Roman wurde von Dominik Moll fürs Kino verfilmt. Heute lebt Colin Niel als Schriftsteller in Marseille.
Colin Niel
Nur die Tiere
Roman
Aus dem Französischenvon Anne Thomas
Die Übersetzerin
Anne Thomas wurde 1988 in Karl-Marx-Stadt/Chemnitz geboren und wuchs in Flensburg auf, nachdem sie 1989 mit ihrer Familie aus der DDR geflohen war. Seit 2013 ist sie als freiberufliche literarische Übersetzerin tätig (u. a. Éric Plamondon, Gabriel Katz, Anna Boulanger, Marie Desplechin). Sie lebt und arbeitet in Paris, London und Berlin. Anne Thomas organisiert und leitet Übersetzungsworkshops in Schulen in Deutschland und Frankreich und ist als Dolmetscherin bei literarischen und kulturellen Veranstaltungen tätig.
Titel der französischen Originalausgabe:
Seules les bêtes
Copyright © 2017 by Éditions du Rouergue
E-Book-Ausgabe 2021
Copyright © der deutschen Übersetzung
2021 by Lenos Verlag, Basel
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagfoto: pio3/shutterstock
eISBN 978 3 85787 989 0
www.lenos.ch
Für Charlotte,
Minigazelle am Fusse der Welt.
In mir, wenn auch noch verborgen.
Inhalt
Alice
Joseph
Maribé
Armand
Michel
Dank
Alice
Die Leute wollen immer einen Anfang. Sie bilden sich ein, wenn eine Geschichte irgendwo anfängt, muss sie auch ein Ende haben. Dann ist das Unwetter vorbei, sie können in ihren Alltag zurück, noch mal davongekommen. Ist ja auch verständlich. Und irgendwie beruhigend. So was braucht man auch, denn das, was in dem Jahr passiert ist, hat so manchen verunsichert. Unten im Tal, auf den Wochenmärkten und an den Trödelständen, erzählen sie sich heute noch davon. Die Hälfte ist übrigens gesponnen, jeder hat was dazuerfunden, über Monate zurechtgebastelt. Würd ich auch so machen: Da hat man wenigstens was zu erzählen, jeder will irgendwas zu erzählen haben, sonst existiert man ja nicht. Das ist menschlich. So. Für die Leute ist der Anfang jedenfalls immer die Meldung im Fernsehen.
Der 19. Januar.
Der Tag, an dem Évelyne Ducat verschwunden ist.
Ich hab es am nächsten Morgen erfahren. Der Winter war nun wirklich da, Schnee bedeckte meinen Berg wie ein viel zu weisses Leintuch, und Wind fegte unablässig über die Hänge. Nachts heulte er um den Hof. An dem Morgen fuhr ich sehr vorsichtig, weil die Strassen ja trotz Schneeketten gefährlich waren, bei vollaufgedrehter Heizung, damit meine beschlagene Windschutzscheibe frei wurde. Ich schlich die Serpentinen zwischen den an den Hängen aufgetürmten Granitblöcken hinunter; als Kind hatte ich mir vorgestellt, dass sie bei einem gewaltigen Gewitter vom Himmel gefallen waren. In Gedanken war ich beim Vortag, deshalb achtete ich nicht auf die dunkelblauen Autos an der Landstrasse, genauso wenig wie auf die Polizisten, die mit Karten und Handys mit schlechtem Empfang hantierten. Normalerweise hätte ich herausfinden wollen, was los ist, wäre neugierig gewesen und hätte mir gesagt Ist nicht dein Bier. Aber diesmal bin ich einfach weitergefahren, in den Ort, und hab beim Marktplatz geparkt.
War nicht viel los, oben an der Fussgängerzone drei, vier Stände von Bauern, die sich irgendwie warm hielten. Ich traf ein paar alte Bekannte, Männer, die ich schon von klein auf kannte und nun älter werden sah; wir sagten uns kurz hallo, weil wir schliesslich wussten, wo wir herkamen, obwohl wir kaum noch was gemeinsam hatten. Dort, in der Kälte des Marktes, wurde mir klar, dass es kein normaler Tag war. Die Händler, die sich über Lammkoteletts und Maronenkonfitüre fröstelnd die Hände rieben, die in Parkas eingemummelten Kunden, alle hatten nur ein Thema. Die Gespräche stiegen als eisige Dampfwölkchen auf. Und natürlich war auch Éliane da, den Einkaufskorb voll Gemüse am Arm. Sie überfiel mich gleich, Sieht nicht gut aus, die finden sie doch nie. Dann kapierte sie, dass ich nicht wusste, wovon sie redete, und starrte mich an, als käm ich geradewegs aus dem Winterschlaf.
Also klärte sie mich auf, bei einer Tasse Kaffee im einzigen Bistro der Stadt, das zu dieser Jahreszeit aufhatte. Wir waren die Einzigen.
»Eine Frau wird vermisst. Die Polizei sucht nach ihr. Hast du gestern Abend keine Nachrichten geguckt?«
Nein, ich hatte nicht ferngesehen. Michel schon, die Lokalnachrichten und das Wetter. Klar, wie alle Viehzüchter der Gegend fragte er sich, was das Schicksal in den nächsten Tagen wohl bereithielt für ihn und die Tiere. Aber ich war so mit mir selbst beschäftigt gewesen, ich hatte gar nicht hingehört, was die erzählten.
»Sagt dir Évelyne Ducat was?«
»Ducat … Die sind doch von hier, oder?«
»Ja. Und nicht gerade irgendwer.«
Die Vermisste war die Frau von einem hohen Tier, einer von hier, mit achtzehn ging er nach Paris, und als er im Ausland ein Vermögen gemacht hatte, kam er zurück ins Tal. Der ist halt reich, hatte ich in dem Moment gedacht, deshalb reden alle davon. Wenn einer meiner Bauern, die kurz vor dem Bankrott standen, verschwunden wäre, hätte das doch kaum Aufsehen erregt. Damit sollte man mir lieber gar nicht erst kommen, das konnte sonst Stunden dauern. So.
Der Geschäftsmann hatte seine Frau zuletzt in der gemeinsamen Villa gesehen, als sie nachmittags allein zum Wandern aufbrach. Eine kurze Tour, wie so oft, um dem Winter auf dem Plateau oder drüben am Berg zu trotzen, wo genau, hatte sie nicht gesagt. Und seitdem nichts mehr. Man hatte ihr Auto am Ortseingang gefunden, es stand einfach am Strassenrand.
Ein hübsches Gesprächsthema im eisigen Januar, wo alle auf das Frühjahr warteten. Jeder hatte eine Theorie. Ganz oben auf der Liste stand der Worst Case, und der schwemmte alte Erinnerungen nach oben.
Die tourmente.
Ja, manche sagten, die tourmente habe Évelyne Ducat erwischt, wie einst. Tourmente, so wird der Wintersturm genannt, der manchmal über die Gipfel tobt. Ein Sturm, der Unwetter und heftigen Schneefall mit sich bringt, hinter jedem Felsbrocken Verwehungen anhäuft und den sicheren Tod bedeutet, schlimmer als Wundbrand, wie es früher hiess. In den vierziger Jahren waren zwei Lehrerinnen auf diese Weise ums Leben gekommen, ich kenne die Geschichte, seit ich klein bin. Die beiden jungen Frauen waren zu Fuss in die nur zwei Kilometer von ihrem Dorf entfernte Schule aufgebrochen und hatten sich im Schneesturm verirrt. Man hatte sie aneinandergeschmiegt unter einem eisbedeckten Baum gefunden, erfroren. Unsere Grossväter hatten Glockentürme in den Dörfern gebaut, es wurde geläutet, um Verirrte zu leiten, wenn der Winter mit aller Härte zuschlug. Heute war das nur noch Folklore, ein Relikt aus jener Zeit, als alles ein bisschen schwerer war. Die tourmente brachte heutzutage keinen mehr um. Aber Éliane liess sich weiterhin jedes Jahr Angst einjagen.
Und das war jetzt natürlich ein gefundenes Fressen.
»Oder, was denkst du?«, holte sie mich aus meinen Gedanken.
Ich musterte sie, in ihrer Daunenjacke mit ihren rosigen Wangen, die sie jünger wirken liessen, als sie war. Sie wollte meine Meinung hören, wie immer. Aber diesmal gab ich keine Antwort.
»Du bist ja sehr gesprächig heute. Stimmt was nicht?«
»Nein, alles gut.«
Ich log natürlich. Wenn ich ehrlich war, hatte ich nur die Hälfte von dem mitbekommen, was sie mir da gerade in dem überheizten Café erzählt hatte. Sie rieb sich an der Meldung auf, die tagelang die Schlagzeilen beherrschen sollte, fragte sich, ob es wohl in den landesweiten Nachrichten käme. Aber es half nichts, ich konnte einfach kein Interesse aufbringen. Hätte ich mal machen sollen. Wenn ich früher begriffen hätte, wie sehr die Geschichte auch mich betraf, hätte ich vielleicht verhindern können, was sich da anbahnte. Aber ich war ganz woanders, irrte auf gewisse Weise selbst durch den Schneesturm. Also liess ich Éliane fertigerzählen, stellte der Form halber ein paar Fragen, dann ging ich und fror mir in der Kälte draussen wieder einen ab.
Ich hatte an dem Tag keine Hausbesuche, ging einkaufen und erledigte zwei, drei Sachen in der Stadt, nichts, wo ich allzu viel nachdenken musste. Und abends fuhr ich zurück auf die verschneiten Höhen meiner Berge. Hinauf zu den massiven Granithäusern, dem in den Felsen gehauenen Brunnen; dem Dorf, in dem ich aufgewachsen war, wahrscheinlich würde ich bis zu meinem Tod hier leben. Ich parkte am Hang, der graue Nebelfluss schlängelte sich durchs Tal und verschlang jedes noch so kleine Dorf. Zu Hause stellte ich seufzend alles ab, wenig später kochte ich in der Stille meiner Küche Kartoffeln und zwei Würste.
Michel kam kurz darauf, als das Abendessen fertig war. Ich stand mit dem Rücken zu ihm, hörte, wie er seinen Overall im Flur auszog und zum Duschen ins Bad tapste. Wortlos. Dann setzte er sich mit nassen Haaren an den grossen Holztisch, der den Raum teilte, von Fenster zu Fenster. Unter seinem Pullover guckte das T-Shirt der Jungen Landwirte hervor, das zog er immer an nach harten Tagen. Er schnitt ein Stück von der Wurst ab, kaute eine Weile. Und erst dann sagte er: »Na?«
»Ja«, antwortete ich, als wäre es ein ganz normaler Tag gewesen.
Ich redete, weil ich das am besten kann, erzählte, wo ich gewesen war, wen ich getroffen, was ich eingekauft hatte. Michel hob die Augenbrauen, das hiess Aha. Einen Augenblick lang musterte ich sein stumpfes Gesicht, die durchgehenden Brauen, von einer Schläfe zur anderen, seine Augen, deren Farbe ich noch nie hatte benennen können.
»Und bei dir? Wie war dein Tag?«
Er umklammerte das Messer mit der Faust, zuckte die Schultern. »Sie kalben.«
Sie kalben, das war’s, mehr sagte er nicht. Nicht nötig, er wusste, dass ich Bescheid wusste. Weil ich den Beruf kannte, als wär ich selber Bäuerin, seit meiner Kindheit gab das den Takt vor. Kalben, das hiess, er schlief kaum, verbrachte die meiste Zeit im Stall und behielt die Kühe im Auge, reinigte die Krippen, schüttete Heu auf. Ab und zu fuhr er ins Tal, traf sich mit Kunden und regelte technische Probleme. Es war eine harte Zeit für ihn. Daher, nein, er musste nicht viel mehr sagen, damit ich verstand. Fürs Gespräch allerdings, für mich, für uns, wär es nicht schlecht gewesen. Nach dem Essen wischte er sich den Mund ab, legte die Serviette hin, stand auf und stellte seinen Teller in die Spüle.
»Ich mach mal weiter«, sagte er leise. »Hab noch Papierkram.«
Dann ging er hinaus und ins Büro, das er sich im Keller eingerichtet hatte, man musste aussen rumgehen. Dort füllte er Formulare aus und erstellte am Computer seine Bilanzen. Ich blieb sitzen, starrte die Wohnzimmerwand an, die gerahmten Fotos meiner Neffen am Strand, ganz allein mit der Stille, die mir viel zu vertraut geworden war.
Michel und ich sprachen nur noch über Organisatorisches in Haus und Hof. Und ich muss zugeben, dass mir das in letzter Zeit entgegenkam. Vor allem an dem Abend. Weil ich in Gedanken war, ach, eigentlich wie besessen, nennen wir es ruhig beim Namen. Nicht wegen Évelyne Ducat und ihrem Verschwinden wie Éliane und alle anderen aus dem Tal. Nein, seit dem Vortag dachte ich nur an eins: an Joseph in seinem Haus drüben auf dem Causse*.
Joseph, in den ich mich mit der Zeit verliebt hatte.
Joseph, der mich nicht mehr wollte.
Und ich dachte nicht mal im Traum daran, dass mein Liebhaber in die Geschichte verwickelt sein könnte, die sie im Fernsehen brachten.
Joseph hätte einfach ein ganz normales Mitglied der Agrargenossenschaft sein können, einer von denen aus meinem Sektor, die ich täglich besuchte. Das ist unser Job, meiner, Élianes und der von drei anderen. Fünf Sozialarbeiterinnen für viertausend Bauern, wir fahren die Höfe der Gegend ab und treffen uns mit denen, die kaum noch jemand besucht, sagen ihnen Nein, ihr seid nicht alleine, ihr habt Rechte, es gibt finanzielle Unterstützung für Haushaltshilfen oder jemanden, der sich wenigstens mal eine Woche im August um die Herde kümmert. Niemand kann sich vorstellen, was in diesen Betrieben los ist, wohin sich sonst nur noch beruflich jemand verirrt. Wir dagegen wissen mehr, als uns lieb ist. Erfolgreiche, junge Landwirte, die sich niederlassen, Neuerungen einführen, Arbeitsplätze schaffen und sich auch im Internet präsentieren, die dem Beruf alle Ehre machen, ja, die gibt es, an die denken wir manchmal, um uns Mut zu machen. Aber sehen tun wir die nicht.
Was wir sehen, sind zerrüttete Familien, Beziehungen, die in die Brüche gehen, weil Madame ein Kind will, Monsieur dagegen einen neuen Stall; Männer, die unter der schieren Last der Arbeit in Depressionen versinken, Rentner, die verkümmern, wenn ihre bessere Hälfte gestorben ist und die Söhne in die Stadt fliehen. Und als mich vor zwei Jahren der Bürgermeister einer kleinen Gemeinde angerufen und mir die Lage von Joseph Bonnefille, einem Schafzüchter vom Causse, geschildert hatte, war ich nicht besonders überrascht gewesen.
»Kein schlechter Kerl«, hatte er zu mir gesagt. »Aber seit seine Mutter gestorben ist, geht’s ihm nicht gut, wissen Sie. Dieses Jahr hat er kein Heu gemacht, und seine Tiere laufen frei rum.«
Er hatte kein Heu gemacht, die Tiere liefen frei rum. Die Anzeichen trogen nicht, das wusste ich genauso gut wie der Bürgermeister. In solchen Situationen kam der Hilferuf oft von aussen, von Kindern, Kommunalpolitikern, Nachbarn. Nie im Leben hätte Joseph sich von sich aus gemeldet.
An einem trockenen, heissen Sommermorgen machte ich mich daher auf den Weg zum Causse, ohne zu wissen, dass hier etwas seinen Anfang nahm, was mein Leben auf den Kopf stellen würde. Ich weiss noch genau, ich fuhr durch die Stadt, zum oberen Ortseingang, und auf den Serpentinen, die sich zum Steilhang emporschraubten, schaltete ich in den zweiten Gang. Mir klebte schon die Bluse am Rücken, ich kurbelte die Fenster runter, damit ein bisschen Fahrtwind reinkam. Nach und nach erhaschte ich Blicke auf die Täler zu meiner Rechten, eingepfercht zwischen bewaldeten Hängen, auf denen der Schatten der Bergkämme vorbeiflog. Als ich höher kam, erahnte ich im Süden von ferne Dörfer, die sich an die Hänge klammerten. Und auf der anderen Seite lagen die sanfte Silhouette meiner Berge und ein paar ausgefranste Wölkchen, die den Gipfel zu suchen schienen wie ein Lamm das Mutterschaf.
In den Kurven schaltete ich runter, sobald es geradeaus ging, beschleunigte ich. Und kam zu den grauen Felswänden des Causse, die schrägen Strahlen der aufsteigenden Sonne blendeten mich. Mit einem Mal ging es nicht mehr so steil, ich war auf dem Plateau, dieser riesigen, ebenen Insel, die in den Sommerhimmel hineinragte, als ob der gar nicht richtig dazugehörte. Über mir strichen drei Geier durchs Blau, die riesigen Schwingen reglos im Höhenwind. Ich nahm Strassen, die sich durch die Steppen schlängelten, um mich herum gelbliches Gras, blasse Einfriedungen und Steinmäuerchen, die das Land in Parzellen teilten. Unterwegs begegnete mir ein Schafzüchter mit seiner Herde auf der Trift, ein aufgeregter Hund und ein brauner Esel bildeten die Nachhut.
Am Dorfeingang stand ein massives Kreuz, aus dem weissen Gestein des Plateaus gehauen, zur Erinnerung, dass man sich hier auf katholischem Boden befand. Ich fuhr an vier Häusern mit geschlossenen Fensterläden vorbei, dann tauchte hinter ein paar Felsblöcken das Bauernhaus auf. Typisch für die Gegend, aus Kalkstein, schmiegte es sich zum Schutz vor eisigem Wind an einen Hügel. Es war ganz still, geradezu unheimlich, ohne das Auto dicht an der Hauswand hätte man denken können, der Ort wäre verlassen.
Ich parkte im Hof, nahm meine Mappe und stieg die Stufen zur Terrasse hoch. Ich klopfte. Keine Reaktion. Ich klopfte noch mal. Da hörte ich endlich schlurfende Schritte hinter der Holztür, ein Klicken, als der Schnapper aufsprang. Quietschend ging die Tür auf. Und durch den Spalt erhaschte ich einen ersten Blick auf den lädierten Mann, der einmal mein Liebhaber werden sollte, sah die ausgebeulte Jeans, das bekleckerte graue Hemd, das zerstrubbelte Haar. Aber vor allem sah ich das Jagdgewehr, das er mit beiden Händen quer vor sich hielt, als wollte er mir den Zutritt verweigern. Netter Empfang, dachte ich.
Trotzdem hatte ich keine Angst. Nein, wirklich, ich hatte nie den Eindruck, er wäre gefährlich, vielleicht war das auch der Fehler, wenn ich so drüber nachdenke. Ausserdem war ich natürlich solche Typen gewöhnt. Aber vor allem fühlte ich mich sicher, weil ich über den Gewehrlauf hinweg sofort gesehen hatte, dass da mehr Verzweiflung als Aggressivität war. Die dunklen Augen unter den gerunzelten Brauen blickten ebenso verloren wie dieses lebensleere Haus. Ich hörte seinen Hund, der sehen wollte, was los war, drinnen herumtänzeln.
Er musterte mich wortlos von Kopf bis Fuss. Ich stellte mich vor, sagte ganz klar, wer ich war, warum ich hier war. Ein paar Worte, die erfahrungsgemäss beruhigend wirkten: Ich wollte sichergehen, dass alles in Ordnung war, vielleicht konnte ich helfen, aber nur, wenn er wollte, Na, wie wär das? Es dauerte eine Weile, er war misstrauisch, umklammerte fest sein Gewehr. Aber ich ahnte, dass ich zu ihm durchdrang, als seine gerunzelte Stirn sich entspannte, seine Züge allmählich weicher wurden und unter dem schwarzweissen Bart ein beinahe kindliches Gesicht offenbarten. Schliesslich warf er einen Blick hinter sich, liess das Gewehr sinken und sagte mit einer Stimme, die wohl seit Ewigkeiten nicht benutzt worden war: »Kommen Sie rein.«
Für mich war das der Anfang. Da betrat ich seine Welt.
Er wohnte allein in seinem Haus auf dem Plateau, keine Frau, keine Eltern mehr, immer weniger alte Schulfreunde im Departement, nur sein Hund, der um ihn rumscharwenzelte, und zweihundertvierzig Schafe, die er gerade so versorgte. Er war der einzige ganzjährige Bewohner der kleinen Häuseransammlung in der Steppe, sonst nur noch Ferienhäuser. Ich ging in seine Küche, die gleichzeitig das Esszimmer war, kalter Steinfussboden, Gewölbedecke. Über der Spüle schmutzig gelbe Fliesen. An der hinteren Wand stand ein Kaminherd, aber nicht so ein moderner wie in den Häusern der Städter, die sich noch immer gern bei uns niederlassen. Nein, ein Relikt aus der noch ganz frischen Vergangenheit, in der Mutter Bonnefille den Haushalt führte und ihrem alleinstehenden Sohn jeden Abend den Teller füllte. Rechts stand eine wuchtige Kommode, am oberen Rand steckten mehrere Ansichtskarten aus Lourdes. Von den Wallfahrten der Mutter, nahm ich an, schon wieder sie. Im Haushalt hatte ich Schlimmeres erwartet, der Hund hatte sich zwar ausgebreitet, aber es war einigermassen aufgeräumt.
Wir sassen uns auf den Bänken des Holztisches gegenüber. Er schob Papiere, Zeitschriften und ungeöffnete Post beiseite, um Platz zu schaffen, wischte mit der Hand die Staubschicht weg. Ich schob die Gummibänder von meiner Mappe, darin war mein Startset: Schnellhefter, Büroklammern, Textmarker.
Mit sorgsam gewählten Worten, damit er nicht zumachte, fing ich an: »Wir gucken mal, wie es mit Ihrer Zusatzkrankenversicherung aussieht, o. k.?«
Er sagte O. k., und in seiner Stimme schwang eine riesengrosse Erwartung, die Hoffnung, dass ich ihn vor einer Art Schiffbruch rettete, in den er samt seinem Hof geraten war. Also machten wir uns an die Arbeit. Er holte stapelweise Post aus einem Schrank, seit Monaten angesammelt, wir sortierten alles. Wir sprachen über die Zusatzversicherung, eine Begutachtung durch einen Agrartechniker für eine Zwischenbilanz seiner Schafzucht, sogar über soziale Mindestsicherung, falls seine Einkünfte zu niedrig werden sollten. Wir füllten Formulare aus. Hauptsächlich bestritt ich das Gespräch, er stimmte zu, ging mit, nickte, kratzte sich den Stoppelbart oder warf etwas ein, Hm, stimmt oder Nein, hab ich nicht.
Und ganz allmählich erahnte ich zwischen all dem Verwaltungsjargon, wie wohl sein Leben aussah.
Ich hab Erfahrung in dem Beruf, mach ihn auch ganz gut. Ich versuche, Lösungen zu finden und zuzuhören, auch wenn ich manchmal zu viel rede. Und wenn man einen Betrieb, der den Bach runtergeht, wieder auf die Beine bringen will, braucht das Zeit. Normalerweise zwei Jahre. Bei Joseph lagen wir im Durchschnitt.
In den ersten Monaten fuhr ich oft hin, erledigte einen Grossteil des Papierkrams. Manchmal stellte ich sogar, je nach Jahreszeit, ein paar fachliche Fragen, als Hilfe. Haben Sie schon Stroh für den Winter gekauft? Haben Sie die neugeborenen Lämmer gemeldet? Er war nicht gesprächig, manchmal sass er stumm vor mir, kramte sichtlich nach etwas, was er mir erzählen konnte seit dem letzten Besuch. Also überbrückte ich, dachte mir Gesprächsthemen aus, hielt Monologe in die Leere hinein, und er hörte zu, im Mundwinkel so etwas wie ein Lächeln. Einmal gestand er mir schulterzuckend: »Tja, ich weiss nur, wie man mit Schafen redet. Und dem Hund.«
Er meinte es wohl als Entschuldigung. Dabei sah ich etwas anderes. Auf seine Weise, schüchtern und zögerlich, scheibchenweise, konnte er manchmal von sich erzählen. Ich war wahrscheinlich auch die Einzige, der er persönlichere Dinge sagte, jetzt, wo seine Mutter nicht mehr war. Mit allen anderen, dem Tierarzt, den Lieferanten, gab es nur ein Thema: seine Schafe, Gewicht, Krankheiten, Preise, das Fleisch.
Wenn ich zu ihm kam, merkte ich natürlich, dass er sich Mühe gab, sich ein bisschen rausputzte für mich, versuchte, das Haus vom Hund zurückzuerobern. Er war nett zu mir, ab und zu hatte ich sogar den Eindruck, er wagte einen kleinen Scherz, der etwas hinkte und rührend war, wegen der guten Absicht. Damals fühlte ich mich, glaub ich, nicht zu ihm hingezogen, dafür fehlte es ihm an Schwung, muss ich sagen.
Aber ich hatte ihn gern.
Mir gefielen seine kleinen Aufmerksamkeiten, als wäre es ein Ereignis, in diesem abgelegenen Haus eine Frau zu empfangen. Ich war wichtig. Aber für ihn empfand ich vor allem Mitleid. Ich fand es so schade, dieser einsame Bauer, der allein lebte, weil er keine gefunden hatte, die das Schafzüchterleben mit ihm teilen wollte. Denn ich merkte es ganz genau: Auch wenn meine Arbeit schliesslich Früchte trug, er allmählich aus dem Schlamassel rausfand, seinen Viehbestand wieder im Griff hatte; nie verschwand der Schmerz, der in seinen Augen brannte.
Joseph war ein Mann, den die Einsamkeit kaputtgemacht hatte. Er litt an einem bekannten Übel: Depressionen. Einmal wagte ich es, schlug einen Besuch beim Psychologen vor.
Er machte sofort zu, sagte: »Bin doch nicht verrückt.«
Also spielte ich die Psychologin, ganz ohne Diplom. Und vielleicht gefiel mir die Rolle auch irgendwie.
Nach einem Jahr, nach all den häppchenweise bei meinen Besuchen gewährten Satzfetzen, hatte ich das Gefühl, ihn zu kennen. Vielleicht sogar unter den Lebenden die zu sein, die ihn am besten kannte. Und egal wie oft ich es durchspiele, nie sah ich bei ihm Anzeichen von dem, was er dann tun würde. Das heisst, von dem ich glaube, dass er’s getan hat.
Und natürlich hörte ich aus seinem Mund nie den Namen Évelyne Ducat.
Ich denke manchmal noch an meine Ehe, daran, wie es vor dem Ganzen war. Und es tut mir leid. Ja, trotz allem tut’s mir leid, jetzt, mit Abstand, denk ich, es ist meine Schuld. Dass Michel heute nicht mehr da ist, ist meine Schuld.
Ich erinnere mich, wie wir uns kennengelernt haben, an den gar nicht so fernen Anfang, als ich ihn schön fand wie einen verirrten Riesen. Den Tag, als er zum ersten Mal einen Fuss auf den Hof setzte, Papa hatte ihn eingestellt, damit er ihm beim Kalben zur Hand ging, in dem Jahr, als sein Ischias zu einem Handicap wurde. Michel war Landarbeiter, gerade erst ins Departement gekommen, aber mit Kühen kannte er sich aus, er war in einer typischen Rindergegend aufgewachsen. Eines Morgens war er einfach aufgetaucht, in einem grünen Overall, der für seine breiten Schultern viel zu klein war, mit verwuschelten Haaren, als käme er gerade aus dem Bett. Er gefiel mir sofort.
Denn geliebt hab ich ihn, meinen Mann, das kann mir keiner vorwerfen. Als wir zusammenzogen, er den Hof übernahm und ich das Haus, waren wir glücklich. Wir hatten Vertrauen in uns, einen Haufen Pläne. Ich wollte diesen Ort zu unserem machen, mir das Dorf zurückerobern, von dem ich immer gedacht hatte, nach dem Studium bin ich weg; wollte Kinder. Michel machte Inventur, welche Maschinen ersetzt werden mussten, sprach davon, Papas Bestand durch bessere Selektion zu veredeln, den Stall zu mechanisieren, um Zeit zu sparen. Wir hofften, Urlaub nehmen zu können, wenigstens im August, allein das wäre schon ein Sieg gewesen. Wir träumten von fernen Reisen, von Afrika. Ja, eines Tages würden wir hinfliegen, redeten wir uns ein. Wir, die hausbackenen Landeier, würden unsere Ängste überwinden, uns der Welt öffnen, Geld und Zeit fände sich dann schon, es war nur eine Frage des Wollens.
Das war es, glaub ich, was uns gefehlt hat. So war Michel, es hat ein bisschen gedauert, bis ich dahinterkam. Ideen hatte er viele, er war ein Träumer, aber mit der Umsetzung haperte es. Er hat den Betrieb nie weiterentwickelt, gab sich damit zufrieden, zu erhalten, was Papa aufgebaut hatte. Manche behaupteten, ich wäre nicht ganz unschuldig, ich würde ihn erdrücken. Mit mir kann man’s ja machen. In Wahrheit fehlte es Michel an Ehrgeiz.
Und in all den Monaten, als ich zu Joseph fuhr, lag unsere Liebe im Sterben. Franste aus wie ein altes Wollknäuel. Über unsere Träume als Frischvermählte, Kinder, Reisen, sprachen wir nicht mehr, wir dachten wahrscheinlich nicht mal mehr daran. Am Esstisch redete ich ins Leere, und Michel sprach immer weniger. Ich erkannte meinen schönen Aufschneider von früher kaum wieder. Dabei wirkte er nicht unglücklich, an manchen Tagen sah er sogar richtig beschwingt aus, aber er war ganz woanders, in Gedanken bei seinen Kühen und der Zucht. In seiner Welt, in der ich, so schien es, keinen Platz mehr hatte.
Trennung, daran hab ich ab und zu gedacht. Bei einem normalen Paar wäre es wohl auch irgendwann dazu gekommen, eines Tages hätten wir gemeinsam festgestellt, dass wir uns geirrt hatten, jeder wäre seiner Wege gegangen und fertig. Aber das war ja unmöglich, ich hatte mich auf etwas eingelassen, was sich nicht rückgängig machen liess. Und jeden Sonntag wurde ich rituell daran erinnert, falls ich es mal vergessen sollte.
Nach dem Mittagessen stieg ich ins Auto und brauste den Berg hinunter zum Altersheim in dem einsamen Dorf an der Klamm, wo Papa seinen Lebensabend verbrachte, für zweitausend Euro im Monat. Ich stieg die Stufen des modernen Gebäudes hoch, betrat sein Zimmer und fand ihn jedes Mal am selben Platz, in seinem elektrisch verstellbaren Sessel am Fenster, die Schirmmütze fest mit den Stirnfurchen verschraubt. Wenn er mich sah, machte er ein Gesicht, das eher Wurde auch Zeit ausdrückte als Schön, dass du mich besuchen kommst, meine Liebe. Ich gab ihm einen Kuss auf die Wange, setzte mich, fragte, wie es ihm ging. Als ehemaliger Bauer hier sein Leben zu fristen war eine Prüfung, das wusste ich, also liess ich ihn seine Kritik an den Mahlzeiten loswerden, Ja, Papa, ich weiss. Ich erzählte ihm von meiner Woche, meiner Arbeit, deren Nutzen er nie begriffen hat, So was brauchten wir damals nicht …
Und sobald alle seichten Themen abgehakt waren, räusperte er sich bedeutungsschwer, versenkte den Blick seiner grauen Augen in meinem und sagte mit seiner Raucherstimme: »Gut … Und … und der Hof? Kommt Michel zurecht?«
Dann erfüllte jedes Mal Stille sein kleines Zimmer. Der Brugier-Hof, wie die Leute ihn noch immer nannten, war sein einziges Anliegen. Bis zur Besessenheit. Sein Leben lang hatte er konsolidiert, was sein Vater ihm hinterlassen hatte. Die Herde aufstocken, seine fünfzig Mutterkühe, deren Gesundheit wichtiger war als seine eigene. Den Hof erweitern, das Anwesen vergrössern, Land zwischen den eigenen Parzellen dazukaufen, alles um die Wirtschaftsgebäude herum, für leichteres Umstallen. Und natürlich etwas höhere Betriebsprämien kassieren, die nach Fläche vergeben wurden und die kleineren Betriebe kaputtgemacht hatten.
Land, Papa hätte sein Leben gegeben für ein günstig gelegenes Stück Land. Ich seh noch seinen ernsten Blick unter der Baskenmütze, wenn er vom Strassenrand aus die Parzellen eines Nachbarn musterte, der Gerüchten zufolge bald sterben würde. Sein zufriedenes Lächeln, wenn er ein gutes Geschäft gemacht hatte. Und seine zerknirschte Miene, Zigarette im Mundwinkel, wenn er sich über einen Patzer ärgerte, Verflucht, das hätt ich kaufen sollen.
Aber vor allem erinnere ich mich an seine Worte, einige Monate bevor er in Rente ging. Er thronte oben auf dem Hang vom Hof und hatte mit herrschaftlicher Geste deklamiert: »Guck mal, Alice. Alles, was du hier siehst, gehört jetzt uns. Jetzt kann ich ruhigen Gewissens ins Altersheim, verstanden?«
Er hatte seinen Traum wahr gemacht, wollte er mir damit sagen.
Aber da schwang noch etwas anderes mit, ein Unterton, das hatte ich genau herausgehört an dem Tag. Eine Erinnerung, wie wichtig es war, dass der Betrieb weiterlief. Und damit auch meine Ehe. Mit einem Sohn, der sich sehr früh der Mechanik zugewandt hatte, und einer Tochter, die sich mehr für Menschen als für Tiere interessierte, hatte Papa lange den schmerzlichen Moment gefürchtet, wo er das Familienerbe einem fremden Aufkäufer abtreten oder, noch schlimmer, stückchenweise würde verkaufen müssen, vergeudet wie Konfetti, das der Wind über den Bergen verstreut. Michel bedeutete für ihn deshalb mehr als die Freude, seine Tochter verliebt zu sehen. Er war die Rettung.
Der unverhoffte Schwiegersohn rettete den Brugier-Hof vor der Zerstückelung.
Und ich, ich steckte bis zum Hals mit drin. In der Falle. Über Trennung nachdenken hiesse, die Familienzerstörung zu planen.
Und Mamans Andenken zu beschmutzen, denn auch sie hatte diese Ehe als Segen betrachtet.
Was mich letztendlich aus der Bahn warf, der Auslöser, das war wahrscheinlich Popeyes Selbstmord. Das hatte uns schon alle erschüttert.
Popeye war einer von Élianes Klienten, ein Milchbauer im Norden des Departements. Ich hatte ihm diesen Spitznamen verpasst, weil er stets die Pfeife im Mundwinkel hatte. Damals fanden wir das witzig, meine Kolleginnen und ich. Wir wollen schliesslich auch mal was zu lachen haben. Wir konnten ja nicht ahnen, was passieren würde. So.
Er war dreiundvierzig, seit vier Jahren geschieden, wir konnten uns denken, warum. Seither lebte er allein, ein bisschen mit seinen Eltern, die im Nachbarhaus wohnten, vor allem aber mit seinen Kühen. Er hatte Schwierigkeiten mit seinem Milchviehbestand. Der Vater hatte in der Vergangenheit viel investiert, sich zu stark vergrössert, der kleine Familienbetrieb war zu einem Unternehmen geworden, es galt, den Umsatz zu kontrollieren, Lieferanten wollten bezahlt, Maschinen abbezahlt werden. Die Last war zu gross für einen einzelnen Mann. Im Grunde hatten die Behörden ihm nur den Gnadenstoss versetzt. Bei einem Kontrollbesuch stellten die Beamten fest, dass er zu viel Grünland angegeben hatte. Vielleicht absichtlich, jetzt, wo die Landwirte so auf die EU angewiesen sind, weil ein grosser Teil ihres Umsatzes von Direktzahlungen abhängt, muss man sich nicht wundern, wenn manche den Bogen überspannen. Aber vielleicht hatte Popeye sich nur vertan, hatte die Verbuschung auf manchen Parzellen überschätzt. War eigentlich auch egal. Jedenfalls hatte der Staat einen Teil der Grünlandprämie zurückverlangt, mit Rückzahlungen für die letzten drei Jahre. Es war gar nicht so viel, ein paar tausend Euro, den Experten zufolge hätte er es verkraftet. Aber es gibt etwas, womit die Buchhalter nicht rechnen, und das ist die Scham, die tief drinnen in einem Menschen leise wächst. Und das war dann zu viel gewesen. Der Tierarzt hatte ihn eines Morgens im Melkstand gefunden, umgeben von seinen Kühen, die klagend muhten, weil man sie nicht in den Stall zurückgebracht hatte.
Popeye hatte sich an einem Balken erhängt.
Ich bin dann auf seine Beerdigung, Éliane konnte das nicht. Da sass ich nun in meinem engen Rock und Absatzschuhen auf einer polierten Holzbank in der Kirche aus Granit, inmitten der kleinen Menschenmenge, alle schockiert über den Selbstmord des Bauern. In den ersten Reihen sass die Familie, Brüder oder Cousins, die sowohl nach Worten als auch nach einer Erklärung für Popeyes Tat suchten. Dahinter sassen die Leute aus dem Dorf, der Bürgermeister, die Ladenbesitzer, die, die mit ihm zur Schule gegangen waren, damals, als es ihn mit Stolz erfüllte, wenn er beim abendlichen Melken helfen durfte. Und hinten sassen wir. Wir, die Aussenstehenden, die diskreten Behörden, wir, die wir ihn so wenig kannten. Einfach aus Solidarität mit der Landwirtschaft, die den Tod eines der Ihren verwinden musste. Aufrichtig und gleichgültig zugleich.
Dort, als ich sah, wie der Priester am Ende des Kirchenschiffs seine Gebete abspulte, dort wirbelte in meinem Kopf alles durcheinander. Als ob ich auf einmal Bilanz zog, die Bilanz meines Lebens und der Welt um mich herum. Ich dachte an diesen Beruf, an unsere erbärmliche Armee Sozialarbeiterinnen, wie wir mit notdürftigen Mitteln und gutem Willen Situationen in Ordnung bringen, denen wir nicht gewachsen sind. Ich dachte an all die Popeyes, denen wir täglich begegneten, unfreiwillige Junggesellen, zu stolz für Hilferufe, wenn ein Unglück sie traf. Ich dachte an meine angeschlagene Ehe, an Michel, der mit einer Frau an seiner Seite gesegnet war, aber nichts tat, um unsere Liebe am Leben zu erhalten.
Dann dachte ich an Joseph und seine kleinen Aufmerksamkeiten, das winzige Lächeln, wenn mein Palaver ihn für einen kurzen Moment von seiner Lage ablenkte. Und mir wurde klar, dass ich etwas empfand, wenn ich an ihn dachte. Zärtlichkeit.
Ja, das tat mir gut.
Am Tag nach der Beerdigung fuhr ich hoch zum Causse, eine vage Idee spukte mir durch den Kopf. In jeder Kurve fragte ich mich, ob ich das wirklich durchziehen würde, und sagte mir Du hast sie doch nicht mehr alle, Mädel. Ich fuhr an frisch gemähten Getreideparzellen vorbei und sah Josephs Hof hinter grünlichen, von welken Flechten bedeckten Kalkblöcken auftauchen. Ich stellte das Auto ab und nahm die Stufen. All das ähnelte der Routine, die ich bei jedem Besuch abspulte.
Ich klopfte an die Tür und wünschte mir einen Moment lang, er wäre nicht da. Mein Herz schlug plötzlich schneller, als müsste ich auf der Bühne vor dreihundert Leuten eine Rede halten. Es dauerte ein paar Sekunden, bis er mir aufmachte, ich dachte schon Vergiss es, er ist im Schafstall, fahr wieder. Aber er war da. Die offene Tür gab den Blick auf seine gedrungene Gestalt frei, und er sagte mir leise lächelnd guten Tag. Sein Hemd war gebügelt. Er streckte die Hand aus, ich auch, und ich spürte die raue Haut seiner Handfläche auf meiner. Ich ging hinter ihm her ins Haus und drückte meine Mappe fest gegen die Brust wie einen kleinen Schild. Ich holte Papiere raus, wir mussten Formulare ausfüllen, damit er über Weihnachten einen Landarbeiter einstellen und seinen Onkel besuchen konnte, der hundert Kilometer entfernt wohnte.
Ich war mir unsicher, das merkte ich, als ich anfing. Ich sass neben ihm, spürte ganz nah seinen Atem. Ich wartete auf den richtigen Moment, ich wollte es, und gleichzeitig machte es mir Angst. Ich hatte das noch nie getan, meinen Mann betrügen, ich bin nicht so eine. Ich schluckte, es war wie Sand.
Und dann tat ich es einfach.
Als er sich zu mir drehte, presste ich meine Lippen auf seinen Mund und küsste ihn. Ja, einfach so, ohne nachzudenken, ich küsste diesen Mann, den ich seit Monaten betreute, seit damals, als er ganz unten war, und der sich gerade erst wieder hochrappelte. Zuerst fuhr er zurück, er starrte mich an, einen Haufen Fragezeichen im Gesicht, in den weit wie nie aufgerissenen Augen, den plötzlich gerunzelten Brauen, auf dem noch kussfeuchten Mund.
Er stammelte. »Was machen Sie …«
Ich küsste ihn noch mal, damit er still war. Um ihm zu zeigen, dass ich es nicht bereute, immer noch wollte. Diesmal liess er es zu, schloss die Augen, als koste er von einer Frucht, die ihn an eine längst vergangene Zeit erinnerte, als er glücklich gewesen war.
An dem Tag war es nicht so berauschend, als wir miteinander schliefen. Ich übernahm die Führung, von vorne bis hinten. Ich knöpfte sein Karohemd auf, half ihm aus den Sachen. Sein Körper war so, wie ich ihn mir vorgestellt hatte, kräftig, gebräunt, dichte graue Haare auf der Brust, eine gerade Linie bis in die verwaschene Unterhose hinein. Ich hatte seinen Geruch gefürchtet, angenommen, dass er die Hygiene schleifen liess, tat er aber nicht. Er roch nach Schaf, klar, er hatte sich um seine Tiere gekümmert, kurz bevor ich kam, aber den Geruch kannte ich so gut, dass ich ihn nicht mehr wahrnahm. Ich führte ihn mit ruhigen Bewegungen an mich heran. Ich streichelte sein Geschlecht, damit er sich entspannte, sein Blick wanderte erregt über meine zu blasse Haut, von tausend stummen Empfindungen durchzogen. Und als er in mich eindrang, sah ich zu ihm auf und lächelte.
Nicht dass er sich besonders geschickt anstellte, er war ein bisschen grob, klar, sein letztes Mal war lange her. Trotzdem gefiel es mir. Ja, es gefiel mir, mich so begehrt zu fühlen, ich sah in ihm, was ich schon lange nicht mehr in Michel sah. Das tat mir gut, wieder ein bisschen aufleben. Er wich meinem Blick aus, verdattert, was da gerade passierte, über den Moment, den er seinem Alltag abgeluchst hatte, seiner Herde, die auf dem Causse wartete, während er sich mit mir auf dem Sofa wiederfand, in diesem riesigen Raum, der alles von ihm wusste. Er kam mit geschlossenen Augen.
Und sein genüsslich verzogenes Gesicht ging mir den ganzen Tag nicht aus dem Kopf, als ich meine anderen Klienten besuchte, über die steinigen Grasflächen des Causse von einer Familie zur anderen fuhr.
Du hast deinen Mann betrogen, dachte ich unablässig, Du hast deinen Mann betrogen.
Und ich wusste nicht, ob ich mich schämte oder freute. Joseph wurde also mein Liebhaber. Ungefähr alle zwei Wochen fuhr ich zu ihm, und wir liebten uns, so wie beim ersten Mal, in seinem Wohnzimmer. Er sagte fast nichts, sah mich nicht an. Er hat mich nie vom Hocker gerissen, kein siebter Himmel, kein Feuerwerk, nichts von alldem. Da machte ich mir auch gar keine Illusionen, das war es nicht, was ich suchte. Ehrlich gesagt, komm ich am besten alleine zum Höhepunkt. So. Ich werd das jetzt hier nicht auswalzen. Trotzdem genoss ich es, ja, ich schlief gerne mit ihm, spürte ihn gerne Haut an Haut. Und mir gefiel das Verbotene unserer Beziehung, von der niemand wusste.