
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Platz 1 des tolino media Newcomerpreis 2020
Richie hat genug und klaut vierzehntausend Euro und ein Auto. Zu spät bemerkt er, dass er in dem Auto nicht alleine ist und ein ungeplanter Road Trip beginnt.
Richie hat die Schnauze voll.
Immer hat er sich an die Regeln gehalten, das Leben gab ihm trotzdem nichts. Er beschließt, es selbst in die Hand zu nehmen und seinem Leben ein bisschen auf die Sprünge zu helfen: er beklaut eine Tankstelle und flüchtet mit gut vierzehntausend Euro sowie einem geklauten Auto Richtung Süden.
Dumm nur, dass auf der Rückbank des Autos Leon schläft ...
Eine Geschichte über Selbstliebe und Freundschaft und darüber, dass es manchmal auch okay ist, wenn es nicht so läuft, wie man immer dachte, dass es laufen würde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Catherine Strefford
Nur kurz leben
© 2020 Catherine Strefford
c/o WirFinden.Es, Naß und Hellie GbR
Kirchgasse 19, 65817 Eppstein, Deutschland
Cover und Buchsatz: Catherine Strefford, www.catherine-strefford.de
Lektorat: Kia Kahawa, www.kiakahawa.de
Korrektorat: MD Grand, www.mdgrand.com
Mit Musik von den Foo Fighters (Walk) und One Republic (If I lose myself).
ISBN: 978-3-73948-958-2
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ohne schriftliche Zustimmung ist unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über dnb.dnb.de abrufbar.
Für die, die sich trauen.
Content Notes
Unheilbare Erkrankung
Betrug
Verrat
Diebstahl
Trennung
Verlust
Sterblichkeitsbewusstsein
Tod
Beerdigung
Samstag
Von Kopf bis Sohle durchschnittlich.
Die Antwort auf die Frage, wie ich so bin. Bemerkenswerterweise erkenne ich das erst jetzt in diesem Moment, als ich die Einkäufe anderer Leute über den Scanner ziehe. Butter – Piep, eingeschweißte billige Salami – Piep, Kaffee – Piep, zwei Kartons Milch – Piep Piep, teure Schokocreme – Piep, Senf – Piep, ein Glas Gurken – Piep und Klopapier – Piep. Die nervige Piepsalve eines vorbildlichen Durchschnittseinkaufs. Ich rattere mein Repertoire an Kassierergeschwafel herunter. Mein großer Moment auf der Supermarktbühne: Haben Sie eine Kundenkarte? Aber vielleicht eine Punkte-Karte? Vielleicht möchten Sie wenigstens Treuepunkte sammeln? Aber die Sammelbildchen, die nehmen Sie doch sicher mit? Schade, in Ordnung. Bar oder mit Karte? Dort eine Unterschrift, hier Ihr Bon. Bittedankeschön. Haben Sie noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Verbeugung, Applaus, Abgang.
Schneller Outfitwechsel und weiter zur nächsten Vorstellung. Schwarz-braunes Poloshirt mit weißem Kragen löst weißes Hemd und rote Weste ab. Nur der Name auf dem Namensschild bleibt: R. Krienhagen. Ihr Versager vom Dienst, wie kann ich Ihnen helfen?
Den kühlsterilen Supermarktflair mit seiner Schlagermusik tausche ich gegen die fettwarme Luft einer Fast-Food-Hölle. In meinen Ohren ein unentwegtes Zisch- und Piepkonzert der Fritteusen.
Guten Tag, herzlich willkommen, Ihre Bestellung bitte. Hamburger mit Pommes und Cola. Ein Glanzstück an Durchschnittlichkeit. Groß oder klein? Sauce dazu? Aktuell haben wir auch Rabattgutscheine. Noch einen Cheeseburger dazu? Natürlich, kein Problem. Fahren Sie bitte vor zum zweiten Fenster. Dankeschön. Vorhang zu, Vorhang auf. Herzlich willkommen, Ihre Bestellung bitte.
Textaufsagen in Dauerschleife.
Nach viereinhalb Stunden sitze ich hinter dem Restaurant auf dem Bordstein, Rücken und Kopf an die Wand gelehnt und die Augen geschlossen. Eine kurze Pause in der Hoffnung, das Piepen der Fritteusen aus meinem Kopf zu kriegen. Aber ich höre es immer noch. Nicht sicher, ob das Geräusch in meinem Kopf widerhallt oder ob es tatsächlich durch die Mauern dringt. Die Tür, auf der nur noch EINGAN UR FUR MITARBEI ER steht, schwingt auf, erwischt mein Knie. Kollege Teamleiter steht im Rahmen. Er versucht lässig auszusehen, damit ich mich von seiner Autorität nicht bedroht fühle. Will mein Kumpel sein. Versaut es prompt.
„Deine Arbeitszeit ist aber rum, oder?“
„Ja, keine Sorge.“ Ein alter Tanz, für den ich nicht mal meine Augen öffne.
„Gut.“ Und erneut: „Gut.“ Schon verschwindet er wieder hinter der Mitarbeitertür. Zurück in den Bau, fleißige Ameise.
Meine Armbanduhr piept. Warum muss alles piepen?
Ich stehe auf und nehme den nächsten jobbedingten Outfitwechsel vor. Fleißige Ameise, die nichts anderes kann als zu arbeiten.
Das Poloshirt mit Fettaroma weicht einem knallblauen Shirt mit gelben Säumen. Ich fühle mich, als hätte ich die Klamotten eines Fünfjährigen an. Grell und unsexy. Fehlt nur noch ein Aufdruck à la Wild Boys oder Real Superhero.
Ein letztes Mal Luft holen und Akt drei beginnt.
Guten Tag. Einmal Säule vier. Möchten Sie die Superpflege-Autowäsche dazu? Die ist aktuell dreißig Prozent günstiger. Nicht? Okay. Macht fünfzig Euro. Bar oder Karte? Ist nichts Persönliches, ich muss alle Fünfzigeuroscheine prüfen. Heute Morgen noch selbst gedruckt, ja, haha, sehr witzig. Ihr Bon. Einen schönen Abend noch, danke, bis zum nächsten Mal. Und damit beginnen vier Stunden mit den schlechtesten Witzen für Tankstellen-Kassierer. Ihr Hauptdarsteller: weiterhin Ich.
Bei jedem Kunden der reinkommt, frage ich mich, ob sein Leben genauso ist wie sein Tankbetrag: durchschnittlich. Wissen diese Jemande, wie öde ihre Kassierer-Witze sind? Stört sie diese Mittelmäßigkeit ihres Seins? Oder denken sie, sie seien originell und einzigartig? Hatte einzig ich diesen Moment der Erkenntnis? Bin ich der einzige Mensch auf der Welt, dem seine Mittelprächtigkeit einigermaßen bewusst ist? Der irgendwann deswegen wahnsinnig werden wird?
Wohl oder übel wird das mit dem Wahnsinn noch warten müssen. Wenigstens bis alles abbezahlt ist. Aktuell ist es schlicht keine Option, auch nur einen der Jobs zu verlieren. Wahnsinnig zu werden ist eben auch wieder eines dieser Dinge, die ausschließlich den Wohlhabenden vorbehalten sind. Kann ich mir nicht leisten. Ebenso wenig wie das, was sich alle anderen in meinem Alter leisten: Auto, Haus, Familie.
Was ich mir mit meinen achtundzwanzig Jahren dagegen leisten kann: einen Kühlschrank, fast antik, gefüllt mit Discounter-Käse, Discounter-Ketchup, Discounter-Marmelade, Discounter-Joghurt. Ein Discounter-Leben. Zudem eine Couch, die gleichzeitig Bett ist – und das ohne schicke Ausklappfunktion. Wie man sich bettet, so lebt man. Unbequem, beengt, knarzend.
Der einzige Luxusgegenstand, der aus einer besseren Zeit übrig ist: mein Fernseher. Nicht nötig zum Leben, aber nötig zum Überleben.
Das Auto musste ich verkaufen. Das Symbol für Status und Unabhängigkeit aufgegeben, als die Miete fällig und kein Geld mehr da war. Bin eh kaum noch damit gefahren, Sprit ist ja auch so ein Luxusgut.
Einer der Obdachlosen am Bahnhof reißt mich aus meinen Gedanken. „Hey Kumpel, haste vielleich’n bisschen Klimpergeld übrich?“
„Verdammte Scheiße! Nein, ich habe nichts übrig. Wenn du Geld brauchst, dann such dir einen Job.“ Spucketröpfchen fliegen dem Mann entgegen. Ausfallend füge ich noch hinzu: „Ich pflücke mein beschissenes Geld auch nicht von den Bäumen!“ Meine Stimme hallt von den Wänden der Unterführung wider, klingt verzerrt, weil meine Stimmbänder diese Tonlage nicht gewohnt sind. Ich bin mich nicht gewohnt, erschrecke mich vor mir selbst. Der Typ macht einen Schritt rückwärts und hebt beschwichtigend die Hände. Wie ein Spiegelbild mache ich gleichzeitig die gleiche Bewegung, allerdings entschuldigend. Für gewöhnlich gehe ich andere Menschen nicht so an. Hastig stopfe ich meine Hände in die Taschen meiner Jeansjacke, marschiere weg von ihm. Weg von meinem schlechten Gewissen.
Vor der Haustür begrüßt mich der muffig herbe Duft von abgestandenem Urin. Der Hauseingang ist die Toilette der feiernden Nachtschicht. Diesen Luxus bekommt man gratis dazu, wenn man in die billigste Straße der Stadt zieht. Schon von draußen höre ich den Bass, der aus einer der Studenten-WGs im Haus wummert. Im Hausflur brennt Licht. Ich beschäftige mich länger als nötig mit dem Briefkasten, in der Hoffnung, heute weiterem Kontakt mit Menschen entgehen zu können.
Eine kostenlose Wochenzeitung und zwei Flyer für neue Schnellrestaurants in der Gegend. Den Flyer vom Chinesen stopfe ich in den Briefkasten unter meinem, den vom Inder behalte ich. Außerdem ein großer Umschlag, in dem ich meine verknickte Bewerbung samt höflicher, aber unpersönlicher Absage vermute. Ich klemme mir Umschlag und Flyer unter den Arm und mache mich auf den Weg nach oben. Dachgeschoss, eineinhalb Zimmer, famoser Ausblick auf die Backsteinmauer des Nebengebäudes. Auf der zweiten Treppe schleicht die alte Bugajczyk nach oben, schleppt zwei Stoffbeutel voller Einkäufe. Ehe sie mir irgendwelchen Hausflur-Smalltalk um die Ohren knallen kann, dränge ich mich an ihr vorbei, nehme je zwei Stufen auf einmal. Ignoriere ihr „Guten Abend, Herr Krienhagen“. Tür auf, Tür zu. Verpiss dich, Scheißtag. Danke für nichts.
Sehr geehrter Herr Krinnhagen,
wir bedauern sehr, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir Ihnen keine Stelle in unserem Unternehmen anbieten können.
Blabla. Nicht mal mein Name ist richtig geschrieben. Der ganze Kram landet auf dem Boden neben meinen alten Fachbüchern vom Studium. Ich sehe mir den Flyer vom Inder genauer an.
NEUERÖFFNUNG!
Curry-Palace
Wählen Sie, was Sie wollen.
Hallo, Curry-Palace? Ich hätte gerne einmal ein weniger frustrierendes Leben. Bitte zum Mitnehmen. Danke!
Ich versacke in der alten Couch wie in der Umarmung einer liebenden Mutter, und folge halbherzig dem Actionfilm im Fernsehen. Erst am Montag wieder Dienst. Den Rest des Wochenendes habe ich frei und somit eine Menge Zeit, um Filme anzuschauen. Der beste Teil meiner Woche. Im Fernsehen eine Explosion, ein Tresor der durch mehrere Stockwerke rauscht und im venezianischen Gewässer landet. Taucher, die Goldbarren für Goldbarren aus dem Tresor holen. Wenn es doch so einfach wäre, loszuziehen, sich zu nehmen was man braucht und damit auch noch durchzukommen, wie Wahlberg und Norton.
Und was, wenn es so einfach ist?
Ich springe auf und suche meinen Taschenrechner. Ein Relikt aus der Schulzeit. Ich rechne meine acht Stunden der kommenden Doppelschicht an der Tankstelle in Minuten um. Dann geschätzte Autos, die tanken, multipliziert mit der Anzahl der Tanksäulen und das wiederum multipliziert mit dem Betrag, der getankt wird, macht … rund vierzehntausend Euro. Vierzehntausend Euro in einer Achtstundenschicht! Damit wären die Schulden bezahlt. Und es wäre sogar noch ein bisschen was übrig. Nicht unbedingt das, was Mark Wahlberg und seine Crew aus dem Tresor in Venedig rausgeholt haben, aber genug für mich. Genug für einen Neustart. Ich muss nichts weiter dafür tun, als kaltschnäuzig zu sein und diese Stadt, dieses Leben, hinter mir zu lassen. Wenn’s sonst nichts ist.
Die Konsequenz: Ich werde zum Dieb. Dieb einer beachtlichen Summe. Spielt die Summe eine Rolle? Dieb bleibt Dieb. Dieb. Dieb. Dieb. Wenn man es oft sagt, klingt es irgendwann nur noch wie ein Geräusch. Wie die Fritteusen der Fast-Food-Hölle. Wie der tropfende Wasserhahn im Bad.
Ich werfe mich wieder aufs Sofa. In meiner Hand noch immer der Taschenrechner, auf dessen Display die Ziffern 14.400 stehen.
Verdammte Moral. Kaltschnäuzig war ich nie. Im Fernsehen jagen sich ein paar Mini Cooper.
Montag
Schichtbeginn.
Die Tür öffnet sich mit einem Zischen. Klingt ein bisschen wie die Türen eines Raumschiffs. Nur nicht so cool. In dem viel zu stark heruntergekühlten Verkaufsraum bekomme ich Gänsehaut. Hinter der Kasse steht Ajit und wartet darauf, dass ich ihn ablöse. Außer ihm ist noch Bauarbeiter-Toni da. Am Stehtisch vor der Bistro-Ecke trinkt er seinen täglichen Kaffee und hat bereits seine Mittagsbockwurst gegessen. Und mein Chef ist da. Frank Bader. Ungewöhnlich, denn sonst verbringt der nur die Vormittage für Buchhaltung und Bestellungen hier. Ein schlechtes Omen?
Er winkt mich ran und ohne abzuwarten, ob ich hinterherkomme, verschwindet er in die hinteren Räume, wo sein Büro ist und die Kunden keinen Zutritt haben. Ein fragender Blick in Richtung Ajit. Der zuckt mit der rechten Schulter. Was für ein Blödmann.
In seinem Büro sitzt Bader schon auf dem überteuren Schreibtischstuhl mit Lederüberzug. Echtes Leder, selbstredend. Völlig fehlplatziert in dem ansonsten ramschigen Büro mit Wellblechwänden. Geschäftig schiebt er Papiere zusammen, als hätte er in den dreißig Sekunden, die er eher im Büro war, so viel erledigen können. Er locht die Papiere, obwohl ich sehen kann, dass es Lieferscheine sind, die sonst grundsätzlich im Papiermüll landen.
„Ich mach’s kurz und schmerzlos, Richie.“ Er versucht, wie ein Kumpel zu klingen, benutzt meinen Spitznamen und zwinkert sogar. Idiot. „Ich muss dich entlassen.“ Ein Räuspern, kurzer Blick. „Leider“, fügt er hinzu, weil es sich so gehört.
Schlechtes Omen.
Ich nehme den Umschlag, den er mir entgegenhält.
„Ajit übernimmt deine Schichten ab nächstem Monat.“
Deswegen nur der einseitige Schulterzucker vom Kollegen Blödmann.
„Okay“, sage ich.
„Okay“, sagt Bader, der Idiot. Er sieht mich erneut an, dann schnell wieder weg. Räuspert sich ein weiteres Mal und fährt sich durch den grauen Bart.
Ich rühre mich nicht. Sehe ihm bei seinem Unwohlsein zu. Das ist das Mindeste. Ich warte geduldig und will, dass er es sagt. Den immer wiederkehrenden Satz. Sein Markenzeichen, seinen Slogan: „Dann jetzt ran an die Arbeit.“
Ja, genau, ran an die Arbeit. Ich verlasse das Büro und stelle meinen Rucksack auf den Stuhl im Aufenthaltsraum. Stopfe den Umschlag mit der Kündigung in eines der vorderen Fächer und ziehe die Jeansjacke aus.
Oma hat immer gesagt, kleine Sünden bestrafe der liebe Gott sofort. Manchmal hat sie von Karma geredet. Und am Häufigsten sagte sie: „Von Nichts kommt Nichts.“
Scheiß drauf!
Ich nehme meinen Rucksack und die Jacke mit nach vorne hinter die Kasse. Das dürfen wir eigentlich nicht. Aber was habe ich zu verlieren?
Nachdem Blödmann und Idiot endlich gegangen sind, öffne ich das Hauptfach vom Rucksack, in dem mein Portemonnaie, zwei Shirts und einige Unterhosen liegen, in einem Anfall von Größenwahn vorsorglich für eine Flucht eingepackt. Immer noch unsicher, ob ich überhaupt flüchten werde. Ich lege den Rucksack auf dem Tresor ab, der unter der Kasse steht und darauf wartet, mit dem Umsatz meiner Doppelschicht gefüttert zu werden. Mit dem Cuttermesser, mit dem ich sonst die Verpackungsfolie der Warenpaletten und Zigarettenkartons öffne, ritze ich das Kabel des Kartenlesegeräts an. Testweise drücke ich ein bisschen auf dem Gerät rum. Das Display bleibt dunkel. Ich stelle das selbstgebastelte Schild mit der Info Kartenlesegerät defekt !! ! an der Kasse auf. Draußen hänge ich die Anhänger mit derselben Information an die Zapfhähne der Tanksäulen. In der Nase der Geruch von Diesel. Den ganzen Tag werden die Kunden deswegen meckern, aber wenn der Rucksack am Ende voll mit Geld ist, soll es mir egal sein.
Als hätte man mir die Ruhe für die Vorbereitungen gegönnt, fahren erst jetzt wieder Autos auf den Hof. Drei gleichzeitig. Parken an den Säulen. Ich warte geduldig an meinem Platz hinter der Kasse. Sehe zu, wie die Tanksummen steigen. Das erste Mal, seit ich hier arbeite, ist das Lächeln, das ich den Kunden schenke, echt.
Die Doppelschicht ist wie jede andere Montagsschicht. Stressig, unzählige Kunden. Sie sind mal besser, meistens aber schlecht gelaunt. Wegen der Situation mit dem kaputten Kartenlesegerät. Es macht ihnen Umstände, dass sie bar bezahlen müssen. Ich bekomme viel Frust ab. Aber die unzähligen Geldbündel, die statt im Tresor im Rucksack neben meinen Klamotten landen, schaffen mir einen Schutzschild, der die mosernden Kunden aushaltbar macht.
Der Hof liegt im Dunkeln und wird nur von den Leuchtstoffröhren des Regendachs beleuchtet. Noch zwölf Minuten. Viele Kunden werden bis Feierabend nicht mehr kommen. Ich stehe vor dem Süßigkeitenregal und überlege, welche Schokoriegel ich einpacken soll.
Mir ist bewusst, dass ich heute das Kriminellste meines Lebens vorhabe. Nach dieser Schicht werde ich ein Dieb auf der Flucht sein. Dann gibt es kein Zurück mehr.
Dass mein Chef die meiste Zeit ein Arschloch war, hilft ungemein, das schlechte Gewissen kleinzuhalten. Außerdem wird er erst morgen Vormittag feststellen, dass das Geld fehlt. Bis dahin bin ich über alle Berge. Muss mich mit dem Problem nicht mehr befassen. Und deswegen suche ich in aller Ruhe Schokoriegel aus.
Ein silberner Volvo Kombi fährt auf den Hof und hält an Säule zwei. Eine Frau steigt aus und betankt den Wagen.
Ich entscheide mich für ein paar Schokoriegel und eine Packung Kekse. Die Sachen landen im Rucksack neben den vielen Geldbündeln, die mit Gummibändern zusammengehalten werden. So präpariert, wie sie sonst im Tresor gelandet wären.
Das Telefon klingelt. Die Frau tankt voll, das dauert, daher hebe ich ab.
„Ich habe die Buchhaltungsordner vergessen. Bitte warte, bis ich da bin. Dann muss ich nicht erst noch den Schlüssel holen.“
Mein Chef. Arschloch.
Mist. Es lief auch alles viel zu gut.
Ich lege auf mit einem Gefühl im Magen, als hätte jemand kräftig darin rumgerührt.
Auf einmal bin ich mir mit meinen bisherigen Entscheidungen nicht mehr so sicher und zwirble nervös am Telefonkabel herum, während ich versuche, Ruhe in meine Gedanken zu bringen. Was soll ich tun? Das Geld aus der Tasche in den Tresor werfen und die Schokoriegel zurücklegen? Oder die Tasche packen und abhauen?
Die Frau hat den Wagen betankt. Sie kommt auf den Nachtschalter zu.
Alles zurücklegen oder abhauen?
Sie zahlt und fragt nach dem Toilettenschlüssel.
Alles zurücklegen oder abhauen?
Ich ziehe die Schublade des Nachtschalters mit dem Geld zu mir rein, tausche es gegen den Bon und den Schlüssel für die Kundentoilette. Schublade wieder raus.
Zurück oder abhauen?
Die Frau bedankt sich müde lächelnd, nimmt beides und macht sich auf den Weg zur Toilette.
Zurück oder abhauen???
Sie hat ihren Autoschlüssel auf der Ablage vor dem Nachtschalter liegen lassen.
Abhauen!
Ich öffne die Kasse, fische die letzten Scheine und das Kleingeld heraus und stopfe mir ein paar weitere hundert Euro in die Hosentaschen. Ich ziehe den Reißverschluss des Rucksacks zu, werfe ihn mir über die Schulter, schnappe meine Jacke. Ich kann es mir nicht verkneifen, den Mittelfinger in die Kamera zu strecken, ehe ich auf den Hof verschwinde. Ich greife mir den Schlüssel der Frau und entriegle damit den Wagen. Die Blinker leuchten flackernd auf, die Scheinwerfer schalten sich ein. Schickimicki-Karre. Ich gleite auf den Fahrersitz, mein Rucksack landet neben mir. Sitz und Spiegel einstellen, Zündschlüssel drehen, auf geht’s – tschüss, beschissenes Leben.
Das Klauen eines Autos hat Vor- und Nachteile.
Ein Vorteil ist, dass man bei der Flucht mit rund vierzehntausend Euro in der Tasche nicht an öffentliche Verkehrsmittel gebunden ist.
Ein Nachteil ist, dass nach einem geklauten Auto natürlich irgendwann gesucht wird.
Mein Herz rast. Ein wildgewordenes Etwas, das versucht, sich aus meiner Brust zu hämmern. Aber ich halte mich an die Verkehrsregeln, fahre ruhig und besonnen. Wie jemand, der nicht auf der Flucht ist und schnell weg will. Schließlich soll mein neues Leben nicht enden, bevor es überhaupt richtig angefangen hat.
Ich blinke links und biege auf den Zubringer zur Autobahn ab. Auf der Beschleunigungsspur drücke ich aufs Gaspedal, jage den Tacho nach oben und bringe den Kombi endlich auf ein Tempo, das meinem rasenden Herzen entspricht.
Mein Blick fällt auf den Anhänger am Schlüsselbund. Ein Foto. Die Frau, deren Auto ich geklaut habe, mit zwei Jugendlichen, vermutlich ihre Kinder. Ich hole tief Luft. Mein Gewissen meldet sich. Ich klaue die Einnahmen einer Doppelschicht ohne mit der Wimper zu zucken, aber die Tatsache, dass ich der Frau das Auto geklaut habe, mit dem sie ihre Kinder zur Schule bringt, bereitet mir ein Ziehen im Magen. Ich muss das Auto so bald wie möglich irgendwo stehen lassen, damit es gefunden wird und sie es schnell wiederbekommt.
Ich drücke das Gaspedal komplett durch und der Wagen heult vor Anstrengung, weil ich mit dem Schalten nicht hinterherkomme. Mit fast hundertvierzig Sachen heize ich über die leere, dunkle Autobahn. Nach einer halben Stunde habe ich bereits zwei Mal die Autobahn gewechselt. Offenbar bleibt eine großangelegte Suchaktion mit Verfolgungsjagd und Helikoptern aber vorerst aus. Kein Sirenengeheul, kaum jemand unterwegs. Mir schmerzt der Nacken vor Anspannung und ich merke, wie steif ich auf dem Sitz kauere. Das Lenkrad so fest in den Händen, dass meine Finger schmerzen. Tief ein- und ausatmen, erstmal entspannen. Ist doch alles gut gegangen.
Von der Rückbank höre ich plötzlich ein Husten.
„Ach du Scheiße!“ Ich verreiße das Lenkrad, der Wagen reißt aus, direkt auf die Mittelspur. Mit Mühe und quietschenden Reifen bekomme ich den Kombi wieder unter Kontrolle. Nur gut, dass sonst niemand unterwegs ist. Mir zittern die Hände, als ich auf dem Seitenstreifen anhalte.
„Meine Fresse! Ich hab mir fast in die Hose gemacht!“, schreit der Jugendliche, der auf der Rückbank geschlafen hat. Er sitzt kerzengerade da und krallt sich mit beiden Händen an den Vordersitzen fest, obwohl der Wagen steht.
„Ja, frag mich mal!“, brülle ich zurück und drehe mich zu ihm um. Dem vermeintlich blinden Passagier wird bewusst, dass ich nicht seine Mutter bin.
„Was zum …? Wer bist du?“ In seiner Stimme schwingt Unsicherheit mit. „Ein Serienkiller oder sowas?!“ Empörung gemischt mit Angst. Er fummelt an seinem Gurt, macht Anstalten, sich abzuschnallen.
„Quatsch. Red doch keinen Unsinn.“
„Jetzt sitze ich hier im Auto mit einem perversen Autobahnkiller und kriege den verdammten Gurt nicht los“, flucht er.
„Ich bin doch kein Autobahnkiller!“, protestiere ich. Er schnaubt. Glaubt mir nicht.
„Ich bin bloß … ich habe mir das Auto bloß kurz geliehen. Ich geb’s zurück. Hab nicht gesehen, dass du auf der Rückbank liegst.“
„Ein Idiot also?“, fragt er zynisch und gibt sich dem nicht öffnenden Gurt frustriert geschlagen.
„Wenn du so willst.“ Ich beuge mich zu ihm hin und öffne den Gurt. „Und jetzt steig bitte aus.“
„Hier? Ich weiß nicht mal, wo ich bin.“
„Ein paar hundert Meter in die Gegenrichtung war eine Raststätte. Geh einfach dahin.“
„Aber das ist die Autobahn.“
„Mitten in der Nacht. Du wirst es überleben.“
„Meine Ma wird dich umbringen, wenn du mich nicht nach Hause bringst.“
„Deswegen sollst du ja aussteigen“, entgegne ich genervt.
„Ich steige nicht aus“, antwortet er trotzig.
„Jetzt steig endlich aus!“
„Nein!“
Wir sitzen einen Moment da. Atmen wütend im Takt des Warnblinklichts. Drei Autos fahren vorbei. Eins davon ein Polizeiwagen.
„Hör zu. Ich hab ein paar Probleme und muss schnell weiter. Also steig jetzt aus, geh zu der Raststätte, ruf dort die Polizei und lass dich von denen nach Hause fahren.“ Meine Stimme klingt flehender, als ich beabsichtige. „Bitte.“
„Vergiss es! Ich steig nicht aus.“
„Fein! Dann nehme ich dich halt mit“, brülle ich und wende mich wieder dem Lenkrad zu. Bringe den Wagen auf Tempo, ehe ich ihn zurück auf die Autobahn lenke. Eine Weile fahren wir schweigend durch die Dunkelheit. Irgendwann stelle ich überrascht fest, dass der blinde Passagier eingeschlafen ist.
Kurz vor Luxemburg zeigt die Armatur des Wagens eine furchtbar frühe Uhrzeit an und ich halte an einer Raststätte. Ich muss mir die Beine vertreten, brauche frische Luft und spaziere neben dem Kombi auf und ab. Wie viele Jahre Knast kriegt man für Entführung? Und wenn’s unbeabsichtigt war? Zählt das? Gibt es ‚Entführung aus Versehen‘ überhaupt? Fakt ist, je länger ich den Jungen im Auto habe, umso dringender sucht man uns. Faszinierend, wie schnell Karma manchmal zuschlägt. Die Stimme meiner Oma klingt mir in den Ohren: „Ich hab’s dir doch gesagt!“
„Morgen.“
Ich fahre zusammen. Brumme missmutig, statt den morgendlichen Gruß zu erwidern. Der Junge gähnt ausgelassen, wuschelt sich durch die dunkelblonden Haare. Er reckt sich. Mein Blick fällt auf die Beule in seiner Hosentasche, die verrät, dass er ein Smartphone dabeihat.
„Bist du irre?“, frage ich perplex.
„Ich bin Leon“, entgegnet er trocken und streckt mir seine Hand entgegen. Als hätten wir uns auf einer Tagung kennengelernt und nicht, weil ich ihn aus Versehen beim Autoklau entführt habe.
„Schalt das verdammte Handy aus!“
Überrascht lässt Leon seine ausgestreckte Hand wieder sinken. Sieht mich mit großen Augen an. „Bleib locker, Mann.“ Er zieht das Smartphone aus seiner Tasche und balanciert es auf seiner Handfläche. „Die deutsche Autobahnpolizei ist hinter uns her, nicht das FBI.“
„Scheiß drauf! Mach es aus!“ Ich brülle. Ich kann es nicht fassen, dass letztlich das Handy eines Smartphone-Junkies alles zunichte machen wird. Leon rührt sich nicht, starrt mich bloß an. Trotzig, herausfordernd und auch leicht amüsiert. Abschätzend, ob er gehorchen oder weiter sarkastische Sprüche klopfen soll. Schließlich hält er es mir vor die Nase. Drückt einen Knopf, der Bildschirm bleibt dunkel. „Hab’s schon vor Ewigkeiten ausgeschaltet.“ Er zuckt mit den Schultern. „Bin ja kein totaler Idiot.“
Wir stehen einen Moment da, weichen unseren Blicken aus, sind beide nicht sicher, wie es nun weitergehen soll. Was verlangt die Etikette in so einer Entführungssituation in Sorry-war-keine-Absicht-und-jetzt-bin-ich-auch-noch-übertriebenerweise-ausgerastet-Manier?
„Richie“, sage ich schließlich. Ich deute auf mich selbst. Komme mir dabei sofort wie ein Idiot vor. Leon zuckt unwillkürlich mit dem Kopf. Eine Bewegung zwischen Kenntnisnahme und Egalsein.
„Ich brauche dringend was Warmes“, sagt er und schlurft zur Raststätte. Als er darin verschwunden ist, schließe ich so leise wie möglich die hintere Autotür, aus der er geklettert ist. Ich eile um das Auto herum und rutsche auf den Fahrersitz. Noch leiser schließe ich meine Tür und lasse vorsichtig den Wagen an. Als ob Vorsicht dafür sorgen könnte, dass der Wagen leiser anspränge als gewöhnlich. Meine Hände halten das Lenkrad, meine Füße ruhen auf den Pedalen. Losfahren. Und schon gibt es ein Problem weniger. Einfach fahren. Warum fahre ich nicht?
Das Geräusch des Motors brummt in meinen Ohren und erinnert mich an das Auto meiner Oma, das sie mir hinterlassen hat. Zusammen mit all den Schulden, die sich angehäuft haben, weil sie sich um mich gekümmert hat. Ich mache ihr keinen Vorwurf. Ich werfe einen Blick aus dem Seitenfenster, sehe, dass Leon mit zwei Bechern Kaffee und allem, was er an Keksen und Chips tragen kann, auf das Auto zu latscht.
Letzte Chance, ohne ihn loszufahren. Für einen Moment überlege ich, ob ich einfach wieder nach Hause fahre, alles wieder in die alten Bahnen biege. Geld und Leon einfach absetzen und weiterleben wie bisher.
Leon stellt sich neben die Beifahrertür und fordert mit einem Kopfnicken, dass ich ihm die Tür öffne. Wir starren uns durch das Seitenfenster an. Der Typ mit vierzehntausend Euro im Rucksack und der Junge, der seinem Entführer Kaffee mitbringt. Mit einem Ausdruck im Gesicht, den ich selbst in den letzten zehn Jahren perfektioniert habe. Ich seufze. Nehme meinen Rucksack vom Beifahrersitz und werfe ihn auf die Rückbank. Lasse den Jungen ins Auto. Leon lässt sich gekonnt mit den Kaffeebechern und all den Verpackungen in den Armen auf den Beifahrersitz fallen. Streckt mir, gehindert durch all die Süßigkeiten, einen der Becher entgegen. Ich nehme ihn und Leon verteilt die Kekse und Chips im Seitenfach der Tür und auf dem Armaturenbrett. „Ich dachte, du würdest mich stehen lassen.“
„Ich auch“, sage ich. Leon nimmt einen Schluck von seinem Kaffee und schnallt sich dabei an.
„Wie alt bist du? Darfst du schon Kaffee trinken?“ Ich sehe ihn skeptisch an.
„Keine Sorge, Mama, ich bin alt genug.“
Dienstag
„Fühlst du manchmal deine Zähne?“
Leon schaut mich angewidert an. Knisternde Verpackungen haben eine ganze Zeit die Stille zwischen Leon und mir gefüllt. Aber jetzt dröhnt sie mir in den Ohren, macht mich fast wahnsinnig.
„Du weißt schon. Die meiste Zeit sind sie einfach da, man merkt sie nicht sonderlich“, füge ich hinzu. Für gewöhnlich halte ich es gut aus zu ignorieren und ignoriert zu werden, schweigend dazusitzen. „Aber manchmal, da fühl ich meine Zähne so deutlich, dass ich mich frage, wie ich das sonst nicht fühlen kann.“ Heute nicht. Vielleicht will ich mich auch einfach wach halten.
„Vielleicht solltest du zum Zahnarzt“, schlägt Leon vor.
„Nein, ich meine nicht, dass sie wehtun …“
„Was soll denn der Scheiß mit den Zähnen?“, blafft Leon mich an.
Ich zucke mit den Schultern. „Keine Ahnung. Dachte, wenn wir schon zusammen durch die Gegend fahren, dann können wir uns auch unterhalten.“
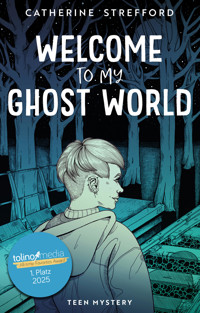
















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











