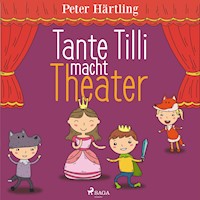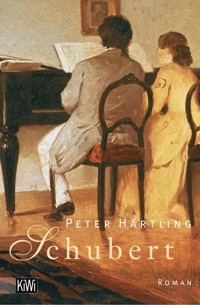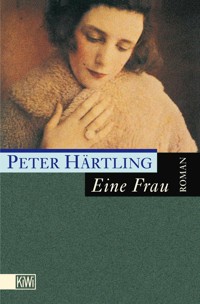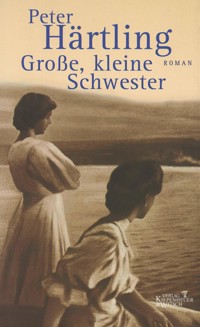12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zu seinem 75. Geburtstag schenkt uns Peter Härtling ein neues Buch In seiner Erzählung vom Großvater O'Bär und seinem dreijährigen Enkel Samuel gelingt Peter Härtling eine spielerische und anrührende Verquickung von eigenem Erleben und literarischer Fiktion – und das Porträt einer innigen Beziehung. Nicht alle Schriftsteller haben eine Familie, aber die meisten. Schriftsteller schreiben nicht immer, aber meistens. Wenn ein Schriftsteller mal nicht schreiben kann, dann kann, sofern vorhanden, die Familie der Ausweg sein, gerade wenn sie über mehrere Generationen reicht und sich auch kleine Kinder darunter finden. In diesem Fall ist es Enkel Samuel, der die Sprache lernt, die dem Schriftsteller zu fehlen scheint. Samuel findet und erfindet Wörter, liefert die aberwitzigsten Silbensprünge und Bubenstreiche und versetzt seinen Großvater in größtes Erstaunen. Die überbordende Fantasie des »kleinen Herrn« führt dem Großen die eigene Blockade vor Augen, die sich durch Reisen zu Reden und Vorträgen längst nicht mehr durchbrechen lässt. Und so gibt es nur eine Lösung: Die wunderbar inspirierenden Spannungen zwischen Kind und Greis, die wortbefreiende Komik des Alltags und die innige Beziehung beider müssen erzählt werden. Und der Enkel muss erfahren, wie wichtig er für den Großvater geworden ist. Das geschieht in fünf Briefen an Samuel, dem Kernstück dieser warmherzigen Erzählung. Peter Härtling gelingt ein Kunststück: Aus der genauen Beobachtung des Verhaltens und Sprechens eines Kleinkindes erschließt sich ihm ein Weg, von den großen Themen – Liebe, Alter, Verantwortung, Tod – zu erzählen und den Leser dabei tief zu berühren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 96
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Peter Härtling
O’Bär an Enkel Samuel
Eine Erzählung mit fünf Briefen
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Peter Härtling
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Peter Härtling
Peter Härtling, geboren 1933 in Chemnitz, gestorben 2017 in Rüsselsheim, arbeitete zunächst als Redakteur bei Zeitungen und Zeitschriften. 1967 wurde er Cheflektor des S. Fischer Verlages in Frankfurt am Main und war dort von 1968 bis 1973 Sprecher der Geschäftsführung. Ab 1974 arbeitete er als freier Schriftsteller. Peter Härtling wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, zuletzt mit dem Hessischen Kulturpreis 2014 und dem Elisabeth-Langgässer-Preis 2015. Das gesamte literarische Werk des Autors ist lieferbar im Verlag Kiepenheuer & Witsch, zuletzt erschien sein Roman »Gedankenspieler« (2018).
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Zu seinem 75. Geburtstag schenkt uns Peter Härtling ein neues Buch
In seiner Erzählung vom Großvater O’Bär und seinem dreijährigen Enkel Samuel gelingt Peter Härtling eine spielerische und anrührende Verquickung von eigenem Erleben und literarischer Fiktion – und das Porträt einer innigen Beziehung.
Nicht alle Schriftsteller haben eine Familie, aber die meisten. Schriftsteller schreiben nicht immer, aber meistens. Wenn ein Schriftsteller mal nicht schreiben kann, dann kann, sofern vorhanden, die Familie der Ausweg sein, gerade wenn sie über mehrere Generationen reicht und sich auch kleine Kinder darunter finden.
In diesem Fall ist es Enkel Samuel, der die Sprache lernt, die dem Schriftsteller zu fehlen scheint. Samuel findet und erfindet Wörter, liefert die aberwitzigsten Silbensprünge und Bubenstreiche und versetzt seinen Großvater in größtes Erstaunen. Die überbordende Fantasie des »kleinen Herrn« führt dem Großen die eigene Blockade vor Augen, die sich durch Reisen zu Reden und Vorträgen längst nicht mehr durchbrechen lässt. Und so gibt es nur eine Lösung: Die wunderbar inspirierenden Spannungen zwischen Kind und Greis, die wortbefreiende Komik des Alltags und die innige Beziehung beider müssen erzählt werden. Und der Enkel muss erfahren, wie wichtig er für den Großvater geworden ist. Das geschieht in fünf Briefen an Samuel, dem Kernstück dieser warmherzigen Erzählung.
Peter Härtling gelingt ein Kunststück: Aus der genauen Beobachtung des Verhaltens und Sprechens eines Kleinkindes erschließt sich ihm ein Weg, von den großen Themen – Liebe, Alter, Verantwortung, Tod – zu erzählen und den Leser dabei tief zu berühren.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2008, 2009, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln
ISBN978-3-462-30079-6
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Textbeginn
Für
Marie
Brigitta
Hannah
Paul
Frederik
Samuel
und
Fanny
Ich muss mich erfinden, muss die Rolle wechseln, nicht um mich zu verjüngen, dem Alter zu entwischen – im Gegenteil, um eine wichtige Distanz zu finden, von einem ›Ich‹ zu reden, mit dem ich Empfindungen und Erfahrungen teile. Ich suche nach einer Methode, mit dem Objekt und dem Subjekt zu mogeln – aus Liebe. Ich werde als Gerald Weber auftreten, als ein Journalist im Ruhestand, einer, der nicht stillhalten kann, der noch mitmischt. Kaum jedoch habe ich meinen neuen Namen geschrieben, kommt er mir lächerlich vor, widersetze ich mich seinem gewöhnlichen Anspruch: Gerald! Nein, das geht nicht. Wenn schon Weber, dann – ein Rest als Klammer soll bleiben – Peter. Peter Weber.
Ein paar Seiten früher wurde Peter Weber zum fünften Mal Großvater, mit dem ersten Kind seiner jüngsten Tochter. Webers besuchten Vater, Mutter und den dreihändegroßen Sprössling in einer Klinik in Hamburg. Webers Frau Grete stellte fest, dass in dem runzligen Zwerg eine intelligente Schönheit stecke. Weber kamen ähnliche Gedanken, die er aber nicht auszusprechen wagte. Das zappelnde, in der Luft rudernde Wesen hatte eine Aura. Dennoch nahm er es nicht auf den Arm, vermied, wie bei seinen eigenen Kindern, diese aneignende Geste. Aus Furcht vor deren Zerbrechlichkeit, erklärte er sich und seiner Frau. Genau genommen ging die Angst tiefer: Die Hilflosigkeit des Geschöpfs könnte ihn hilflos machen, und er könnte es fallen lassen.
In der Bahn, auf der Reise zurück nach Frankfurt, sprach er so gut wie kein Wort mit seiner Frau, die allerdings, wie er auch, in Gedanken versunken war. Sonderbar, sagte sie einmal, und er erfuhr nicht, was ihr sonderbar vorkam. Sie konnte nicht ahnen, dass er mit dem Kind, das Samuel heißen sollte, redete.
Er war als Großvater nicht ungeübt. Vier Enkel – zwei Mädchen, zwei Buben – kamen regelmäßig zu Besuch. Er mochte die lärmenden Überfälle, hielt sich aber zurück, spielte so gut wie nie mit den Kindern, las nicht vor, blieb an der Peripherie, beobachtete sie und genoss es, wenn sie die Distanz überwanden. »Du siehst, die Zwerge nehmen es mir nicht übel, wenn ich mich nicht auf ihre Turbulenzen einlasse.«
Das Jahr vor Samuels Geburt hatte Weber gepeinigt. Er hatte eine Reihe seiner Reportagen und Interviews als Buch veröffentlicht, und die Gleichgültigkeit, mit der seine ehemaligen Kollegen die Publikation übergingen, hatte ihn aufgebracht. Sicher, er gehörte nicht mehr dazu, befand sich im Ruhestand. Er geriet in einen psychosomatischen Aufruhr, wurde ernsthaft krank, eine schwere Lungenentzündung führte zu einem Erstickungsanfall und einem Emphysem. Der Notarzt begleitete ihn auf die Intensivstation. Zwei Infarkte hatten ihm zuvor zugesetzt. Er merkte, wie er den Wörtern verloren ging. Er steckte in einer Krise. Nur dachte er nicht daran, sie vorzuführen. Wahrscheinlich fühlte seine Frau die wachsende Unsicherheit. Sie erkundigte sich öfter als üblich nach seinem Befinden. Das sich von Neuem verschlechterte: Sein linkes Bein knickte häufig ohne Grund ein, worauf er die Balance verlor und hinfiel. Dies geschah, ohne dass es durch Schmerz angekündigt wurde. Der folgte aber mit einer solchen Intensität und Ausdauer, dass Weber, der nach allen Malaisen Ärzte mied, sich von seiner Frau zum Orthopäden fahren ließ, der diagnostizierte, ihn plage ein Bandscheibenvorfall. Er wurde in die Universitätsklinik, Abteilung chirurgische Neurologie, überwiesen und nach einer Woche vergeblicher Schmerztherapie operiert. Neben den Medikamenten wurde ihm die Zuversicht in knappen Sätzen verabreicht: Nur wenige Tage nach der Operation werde er wohlgemut aus dem Bett hüpfen und mühelos gehen können. – Noch ein Jahr danach bereitete ihm jeder Schritt Schmerzen. Die Schwermut schnürte ihn ein und beraubte ihn seiner Handlungsfähigkeit.
Im Frühjahr nach dem Eingriff in die Wirbelsäule überkam ihn Fernweh, die Lust, doch wieder zu reisen. Weber nahm die Einladung alter, lieber Freunde nach Marseille an: ans Mittelmeer, in die Piratenstadt, die er nur aus Anna Seghers Roman »Transit« kannte. An ihn dachte er, als ihn sein Freund Carlo von der Rue Paradis zum Hafen hinunterbegleitete, bei jedem Schritt stützte. Er dachte die Exilgeschichten mit, die angstvollen Zeilen aus den Briefen, dachte an den jungen Amerikaner, der die französischen Behörden und die Nazi-Polizei täuschen musste, Freibriefe für Flüchtlinge ausstellte, ihnen die Ausreise in die Vereinigten Staaten verschaffte.
Schon auf dem Frankfurter Flughafen, nachdem sie das Gepäck abgegeben und die Sicherheits-kontrolle hinter sich hatten, begriff er, in welch labilem Zustand er sich befand. Die elend langen Korridore überwand er auf dem Rollband. Unterwegs zum Gate wurde er unversehens angerempelt, und das mit einer sonderbar gezielten Wut. Eine Faust oder ein Ellbogen fuhr ihm unter die Rippen, dass ihm der Atem stockte. Immer, wenn er sich aufregte, begann Webers Nase zu laufen. Er bat seine Frau um ein Papiertaschentuch. »Was fehlt dir?«, fragte sie und setzte beruhigend hinzu: »Die Maschine fliegt pünktlich.«
Carlo und Felizia erwarteten sie am Ausgang. Weber hatte sich auf das Wiedersehen gefreut. Vor zwei Jahren waren die beiden aus der Nähe von Köln nach Marseille gezogen. Sie hatten Haus und Betrieb verkauft. Carlo, der alte Setzer, ging in Rente. Er bestand darauf, den Schritt in den Ruhestand als einen über die Grenze zu verstehen. Sie liefen aufeinander zu, fielen sich in die Arme, und Weber genoss die wiedergefundene Nähe, dieses Damals, das gut gelaunt ins Heute reichte, die Erinnerung an Feste, lange Nächte, gemeinsam Ferien in der Bretagne, an die Kinder. Carlo hatte am Telefon noch um die Zeit gehandelt, die Weber sich als Stadturlaub vorgenommen hatte. »Doch nicht nur eine Woche!« Als sie jetzt im Wagen saßen, die Stadt auf sie zukam, eine Ballung von silbergrauem Stein, war Weber drauf und dran, eine Verlängerung vorzuschlagen: »Könnten wir nicht?« Als wolle Carlo die Stimmung des Freundes ausnützen, fuhr er langsamer, öffnete das Verdeck, und sie glitten im offenen Wagen durch eine laue, die Sinne reizende Luft. Weber fand, Carlo und Felizia bewegten sich freier, lockerer. Sie hatten sich in der Stadt schon eingerichtet. Als sie in die Garage fuhren, in der Carlos Wagen die meisten Tage stand, da die beiden bevorzugt zu Fuß unterwegs waren, Stadtwanderer, gab Weber der Erregung des Empfanges nach. Die Marseiller überrumpelten ihn mit ihrer Lebenslust. Weber stieg, ohne an seine Beschwerden zu denken, mit Schwung aus dem Wagen und knickte ein. Der Schreckens-seufzer Gretens begleitete ihn zu Boden. Carlo hob ihn lachend auf: »Also du bist noch nicht so gut dran, mein Knickebein.« Von da an hängte sich Weber bei dem Freund ein und brachte ihn mitunter ins Wanken.
Die Wohnung, die ihnen Carlo und Felizia nicht ohne Stolz vorführten, überraschte sie. Nachdem sie durch eine tiefe Toreinfahrt gegangen waren, betraten sie einen von den Mauern eines Palazzo umgebenen Hof. Die hellen Fassaden spielten mit dem Licht. Sie verließen mit einem Schritt den Hof, der im Nachhinein zu einem großzügigen Entree wurde. Das Zimmer, das sie nobel und hell empfing, war, der Lebenskunst der beiden entsprechend, geteilt in Küche und Wohnraum, von dem aus wiederum ein winziges Hinterhöfchen zu erreichen war, in dem sich Gesträuch und Blumen, gleichsam als Versprechen und Erinnerung an einen Garten, um eine Sitzgruppe drängten. Ein Aufenthalt für kleine Gesellschaften bei Wein und Gespräch.
Oben, in der ersten Etage, hatten die beiden für Webers ihr Schlafzimmer frei gemacht und sich in eine enge Kammer zurückgezogen. Die Fenster im Zimmer gaben den Blick in den Hof frei. Weber hörte, während er auf und ab ging, schon in Gedanken die morgendlichen Geräusche von unten, Stimmen, Motorenlärm, Rufe.
Die hellen, unaufwendig, doch komfortabel eingerichteten Räume erschienen Weber wie ein Horchposten in der großen, Stein und Wasser verbindenden Stadt. Nach der Führung durch die Wohnung setzten sie sich zum Abendessen. Felizia blieb hinterm Tresen in der Küche, von den andern beobachtet und angefeuert. Längst bevor die Speisen auf den Tellern lagen, wurde rheto-risch abgeschmeckt. Das zarteste Fleisch, aber von einem eigenen Geschmack, begann Carlo seine Arie auf die Rougets, die roten Fische, die, wie Webers bald auf den Spaziergängen erfuhren, im Hafen von den Fischhändlern nur selten angeboten würden, Kostbarkeiten, von den Feinschmeckern gesucht.
Carlo ist, sagte sich Weber gegen die wachsende Erschöpfung – allmählich wurden ihm die Gänge durch die Stadt zu ausführlich und zu anstrengend –, mir nah wie wenige.
Unvermeidlich traf dann an einem Morgen Weber die Frage, woran er schreibe, ob er bald wieder unterwegs sein werde. Er gab vor, in einer umfangreichen Reisereportage zu stecken, also