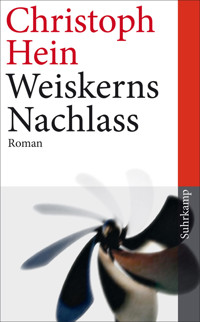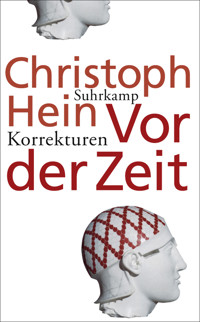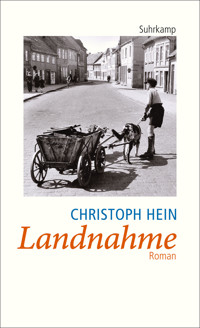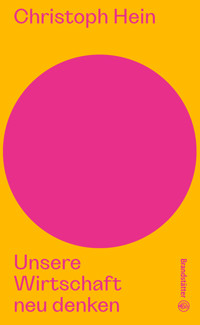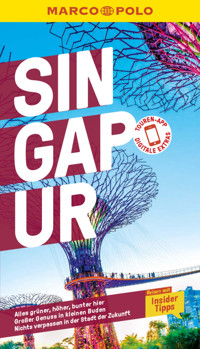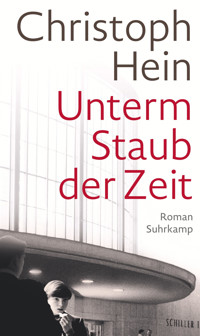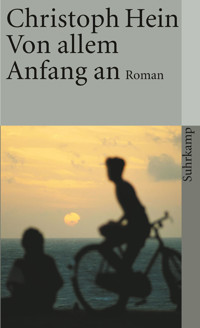11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Schreiben, um zu beschreiben, beschreiben, um weiterarbeiten zu können, um hoffen zu können. Auch um auf Änderungen, Veränderungen hoffen zu können.« Christoph Hein, eine der wichtigsten Stimmen der deutschen Gegenwartsliteratur, gibt mit den hier versammelten Essais und Gesprächen aus den Jahren 1978 bis 1986 Einblick in seine Arbeit. Er stellt die Frage nach dem Stellenwert der Kunst in einem geteilten Deutschland, nach Macht und Machtlosigkeit der Literatur. Er erzählt von der Theaterarbeit in der DDR und der Schwierigkeit, die eigenen Stücke aufgeführt zu sehen – »Wenn wir nur etwas Geduld und Seelenstärke aufbringen, so können wir zu meinem 25., 50. etc. Todestag Inszenierungen der Stücke erleben« –, setzt sich mit Jakob Michael Reinhold Lenz, mit Anna Seghers, Thomas Mann und Walter Benjamin auseinander und gibt Aufschluß über eigene Werke wie die Novelle Der fremde Freund/Drachenblut oder das Stück Cromwell.
Diesem engagierten Plädoyer für eine kritische Kunst liegt die Einsicht zugrunde, daß Kultur der öffentlichkeit bedarf – und zwar ohne Restriktionen irgendeiner Art.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Christoph Hein
Öffentlich arbeiten
Essais und Gespräche
Suhrkamp
Inhalt
Lorbeerwald und Kartoffelacker. Vorlesung über einen Satz Heinrich Heines
Anmerkung zu ›Lassalle fragt Herrn Herbert nach Sonja. Die Szene ein Salon‹
I
2
3
Öffentlich arbeiten
I
2
Sprache und Rhythmus
Worüber man nicht reden kann, davon kann die Kunst ein Lied singen. Zu einem Satz von Anna Seghers
Über Friedrich Dieckmann
Zwei Sätze zu Thomas Mann
I.
2.
Waldbruder Lenz
I
2
3
Ein Interview
Besson oder Der Mangel an Geschmack
I.
2.
3.
Anmerkungen zu ›Cromwell‹
Gespräch mit Christoph Hein
Brief an M. F., Regisseur der westdeutschen Erstaufführung von ›Schlötel oder Was solls‹
Linker Kolonialismus oder Der Wille zum Feuilleton
Die Intelligenz hat angefangen zu verwalten und aufgehört zu arbeiten. Ein Gespräch
Maelzel's Chess Player Goes To Hollywood. Das Verschwinden des künstlerischen Produzenten im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit
Quellenverzeichnis
Lorbeerwald und Kartoffelacker
Vorlesung über einen Satz Heinrich Heines
In dem Vorwort zu seiner ›Lutetia‹ schreibt Heine: »Dieses Geständnis, daß den Kommunisten die Zukunft gehört, machte ich im Tone der größten Angst und Besorgnis, und ach! das war keineswegs eine Maske! In der Tat, nur mit Grauen und Schrecken denke ich an die Zeit, wo jene dunklen Bilderstürmer zur Herrschaft gelangen werden: mit ihren rohen Fäusten zerschlagen sie alsdann erbarmungslos alle Marmorbilder der Schönheit, die meinem Herzen so teuer sind; sie zertrümmern alle jene Spielzeuge und phantastischen Schnurrpfeifereien der Kunst, die dem Poeten so lieb waren; sie hacken mir meine Lorbeerwälder um und pflanzen darauf Kartoffeln; die Lilien, welche nicht spannen und arbeiteten und doch so schön gekleidet waren wie König Salomon in all seinem Glanz, werden ausgerauft aus dem Boden der Gesellschaft, wenn sie nicht etwa zur Spindel greifen wollen; den Rosen, den müßigen Nachtigallbräuten, geht es nicht besser; die Nachtigallen, die unnützen Sänger, werden fortgejagt, und ach! mein ›Buch der Lieder‹ wird der Krautkrämer zu Tüten verwenden, um Kaffee oder Schnupftabak darin zu schütten für die alten Weiber der Zukunft. Ach! das sehe ich alles voraus, und eine unsägliche Betrübnis ergreift mich, wenn ich an den Untergang denke, womit das siegreiche Proletariat meine Gedichte bedroht, die mit der ganzen alten romantischen Weltordnung vergehen werden. Und dennoch, ich gestehe es freimütig, übt eben dieser Kommunismus, so feindlich er allen meinen Interessen und Neigungen ist, auf mein Gemüt einen Zauber, dessen ich mich nicht erwehren kann; in meiner Brust sprechen zwei Stimmen zu seinen Gunsten, zwei Stimmen, die sich nicht zum Schweigen bringen lassen, die vielleicht nur diabolische Einflüsterungen sind − aber ich bin nun einmal davon besessen, und keine exorzierende Gewalt kann sie bezwingen.
Denn die erste dieser Stimmen ist die der Logik. ›Der Teufel ist ein Logiker!‹ sagt Dante. Ein schrecklicher Syllogismus behext mich, und kann ich der Prämisse nicht widersprechen: ›daß alle Menschen das Recht haben zu essen‹, so muß ich mich auch allen Folgerungen fügen. Wenn ich daran denke, so laufe ich Gefahr; den Verstand zu verlieren, alle Dämonen der Wahrheit tanzen triumphierend um mich her, und am Ende ergreift eine verzweiflungsvolle Großmut mein Herz, wo ich ausrufe: Sie ist seit langem gerichtet, verurteilt, diese alte Gesellschaft. Mag geschehen, was recht ist! Mag sie zerbrochen werden, diese alte Welt, wo die Unschuld zugrunde ging, wo die Selbstsucht gedieh, wo der Mensch vom Menschen ausgebeutet wurde! Mögen sie vollständig zerstört werden, diese übertünchten Gräber, in denen die Lüge und die Ungerechtigkeit hausten! Und gesegnet sei der Krautkrämer, der einst aus meinen Gedichten Tüten verfertigt, worin er Kaffee und Schnupftabak schüttet für die armen alten Mutterchen, die in unsrer heutigen Welt der Ungerechtigkeit vielleicht eine solche Labung entbehren mußten − fiat justitia, pereat mundus!
Die zweite der beiden zwingenden Stimmen, die mich behexen, ist noch gewaltiger und noch infernalischer als die erste, denn sie ist die des Hasses, des Hasses, den ich einer Partei widme, deren furchtbarster Gegner der Kommunismus und die aus diesem Grunde unser gemeinsamer Feind ist. Ich rede von der Partei der sogenannten Vertreter der Nationalität in Deutschland, von jenen falschen Patrioten, deren Vaterlandsliebe nur in einem blödsinnigen Widerwillen gegen das Ausland und die Nachbarvölker besteht und die namentlich gegen Frankreich täglich ihre Galle ausgießen.«
Soweit Heinrich Heine in seinem Vorwort zur ›Lutetia‹. Zwei gewichtige Grabsteine der alten Ordnung benennt Beine, die ihm die entscheidenden Gewichte für die heraufkommende neue Ordnung sind: den Hunger, den die alten Ordnungen der Gesellschaft nicht beseitigen konnten und nicht wollten, und den Nationalismus, dessen sie bedurften. Diese Steine hängt er frohlockend um den Hals einer Gesellschaft, die er zum Tode verurteilt sieht und deren Untergang er ebenso freudig herbeisehnt wie herbeikommen sieht. Und Heine kennt die Kosten, und er nennt sie vor mehr als einem Jahrhundert auf eine so direkte und mitleidslose Art, daß es uns, den späten Nachfahren des Propheten Heinrich Heine, noch vor Grauen das archaische Nackenhaar sträubt. Er benennt den Preis fast heiter, obgleich dieser Preis alles kostet, was Heine ausmacht, was er ist. Sein Urteil lautet: Die Gerechtigkeit möge siegen (kein Hunger, kein völkerbedrohender, kriegerischer Nationalismus mehr), soll auch alle Poesie darüber zum Teufel gehen. Und seine Prophezeiung verheißt uns: Die alte Gesellschaft wird von den Kommunisten mit einem Fußtritt zertreten, und unter die Füße kommen dabei die Nachtigall und die Lerche, jene, »die nicht spannen und arbeiteten und doch so schön gekleidet waren«, die Kunst.
Wir sind es, die Heine anspricht; unsere Gesellschaft ist gemeint, denn bei uns wurde die alte Ordnung beseitigt, um der Gerechtigkeit willen. Wir sehen also, wir haben es hier mit einer Hetzschrift zu tun, einer antikommunistischen Hetzschrift: Die These, daß die Errichtung der Diktatur des Proletariats und die Verwirklichung der Ideale von der Urgesellschaft her über das Christentum bis zur Französischen Revolution gleichbedeutend sei mit kulturellem Stillstand, vollständiger Nivellierung alles Außerordentlichen und das Ende der unnützen, weil nicht errechenbaren Nutzen bringenden Poesie und Kunst, sie ist uns vertraut als eine der Grundthesen des Antikommunismus.
Ein Land, in dem die soziale Revolution vollzogen wurde und dessen Staat sich auch als Wahrer und Hort der Künste versteht, weist solche Angriffe nicht allein verbal zurück, sondern mit Gesetzeskraft. Und ich, ein juristischer Laie, könnte mehrere Artikel unseres Strafgesetzbuches zitieren, gegen die der vorgelesene Heine-Text gröblichst verstößt. Zum Beispiel: § 220, Öffentliche Herabwürdigung (»Wer in der Öffentlichkeit die staatlichen Organe oder staatliche Organe, Einrichtungen oder gesellschaftliche Organisationen oder deren Tätigkeit oder Maßnahmen herabwürdigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung, Haftstrafe, Geldstrafe oder mit öffentlichem Tadel bestraft. Ebenso wird bestraft, wer Schriften, Gegenstände oder Symbole, die geeignet sind, die staatliche oder öffentliche Ordnung zu beeinträchtigen, das sozialistische Zusammenleben zu stören oder die staatliche oder gesellschaftliche Ordnung verächtlich zu machen, verbreitet oder in sonstiger Weise anderen zugänglich macht«).
Dennoch, der Text ist wiederholt gedruckt und verbreitet worden, und wir fragen nach den Gründen. Auszuschließen ist der blinde Zufall, ein Versehen, Sehstörungen im Auge des Gesetzeshüters. Möglich wäre stillschweigende Duldung auf Grund anderer Verdienste des Autors: seine wiederholt geäußerte Neigung zum Kommunismus; seine bekannten Beziehungen zu nicht unwesentlichen Vertretern der marxistischen Bewegung; gewisse brauchbare Schriften, denn Heine ist nicht nur der Autor des ›Buches der Lieder‹, sondern auch Verfasser sozialer, ja, sozialistischer Kampfschriften und −gedichte. Aber auch dies liefert keine hinreichende Begründung, da in solchem Fall dem das Gesetz schützenden Beamten das Prinzip der Selektion zur Verfügung steht, die bequeme und häufig genutzte Möglichkeit der Auswahl. So stehen wir als gute Staatsbürger schutzlos vor diesen Inkriminierungen und ahnen, daß der ungehinderte Druck und die fortgesetzte Verbreitung dieses Heine-Textes uns vor eine Aufgabe stellt: den Aufsatz zu lesen, zu bedenken und ihn und uns zu prüfen.
Verlangt wird da nichts weniger als die Überprüfung aller uns heiligen Werte, auf daß sie uns nicht zu Götzen werden. Götzen, wir wissen es, bedürfen nur des Glaubens und der Anbetung, also der Unterwerfung. Überprüfen aber heißt: kritisch werten und in Kenntnis der Dinge. Sachkenntnis und Kritik also, zwei schwer zu vereinbarende Angelegenheiten. Kritik ungetrübt von Sachkenntnis ist immer ergiebiger und bravouröser. Ist der Kopf nicht belastet, läßt es sich fröhlicher dreinschlagen. Und Sachkenntnis setzt ein Kennenlernen voraus: kennenlernen aber heißt verstehen, heißt auch, sich selbst verstehen, und wer vermag dann noch zu kritisieren. Unter dem aber ist Kritik, wirkliche Kritik, nicht zu haben, denn alle Kritik, will sie nicht banal, dumm oder nur äußerlich sein, ist zuletzt immer Selbstkritik. Ich bin das Maß, mit dem ich messe; ich bin es, der da verglichen, bewertet wird, wenn ich vergleiche und bewerte; jede Messung erfordert, zuerst das Maß zu prüfen.
Sie sind beschäftigt mit dem Studium der Germanistik, was nicht nur, was aber auch nicht nur unter anderem das genauere Kennenlernen wichtiger Texte der Literatur bedeutet. Vorausgesetzt, daß Sie dazu bereit sind, werden Sie hier mit einem Instrumentarium ausgerüstet, das Sie befähigen kann, Literatur besser kennenzulernen, sie fast wissenschaftlich zu begreifen − wenn das überhaupt möglich sein kann bei einem so unwissenschaftlichen und regelwidrigen Gegenstand −, um sie zu ergründen, ihren Inhalt, ihre Form, ihren Gehalt und die ihr innewohnende Poesie. Sie werden, da keine Literaturgeschichte ohne Geschichte denkbar ist, die Bindungen und Abhängigkeiten, die modischen Verirrungen und die erstaunlichen Erfindungen, Entdeckungen konkreter literarischer Texte erkennen. Sie werden Literatur dadurch besser verstehen, Literatur wird Ihnen mehr sagen können, denn wie jede Schöne − und Belletristik ist es auch da noch, wo sie schrecklich, erschreckend ist − will sie, daß man sich um sie bemüht. Und wo Ihnen der Atem oder die Kraft dazu ausgehen oder auch nur die Lust, da bleibt Ihnen die Ästhetik, jenes feine Netz voller Knoten, Verstrickungen und Querverbindungen, jener Hanfstrick, mit dem die Literaturwissenschaft noch jeden Poeten in die für ihn reservierte Abteilung hängen konnte.
Literatur und Literaturwissenschaft, zwei so verschiedene Dinge wie Schmetterling und Schmetterlingskunde. Letzteres manifestiert in den großen Glaskästen, in denen all die Tagfalter und Nachtschwärmer, das Pfauenauge und der Admiral wie auch der einfache Kohlweißling, von einer Nadel aufgespießt, verstauben und den trügerischen Eindruck erwecken sollen, sie, die Gekreuzigten, seien das lebendige, blutvolle Abbild der einstmals Lebenden. Welche empfindsame Seele verspürt nicht angesichts der Glaskästen mit den aufgespießten Nichtsnutzen von Schmetterlingen oder der grauen, vielräumigen Gebäude, in denen die Literaturwissenschaftler zu Werke sind, einen leisen, schmerzlichen Nadelstich mitten durch sein Herz?
Aber noch haben Sie uns nicht, noch haben Sie die Zeitgenossen nicht. Dafür fehlt vor allem anderen die Stecknadel, auf der diese neu geschlüpften Flattergeister aufzuspießen sind, die eiserne Klammer des Begriffs, die Ästhetik, mit der der Produktion der Zeitgenossen beizukommen ist. Denn alle Ästhetik − Sie werdens ungern hören − ist nur Ausfluß von Poesie, ist ihr nicht beabsichtigtes, nicht angestrebtes Ergebnis, ist die spätere wissenschaftliche Auf- und Zubereitung. Es gibt keine Ästhetik, die dem Produzenten von Literatur Richtlinien, Hilfestellungen oder Sicherheiten zu geben vermag. Produktion ist allein von gegenwärtiger Geschichte, der Jetztzeit, und der Fantasie, dem Bewußtsein und dem Interesse eines Individuums abhängig. Gegenwärtige Geschichte ist ein Prozeß, den spätere Zeiten auf sehr unterschiedliche Nenner bringen werden und den wir, die Beteiligten, erfahren und erleben mit allen Einschränkungen, Beschränkungen des Verstandes, der Gefühle und der Sinne eines einzelnen. Es ist ein komplexer Prozeß, den jedes Individuum komplex wahrzunehmen vermag und dessen Sicht sich dennoch tausendfach, und durchaus nicht allein in Nuancen, von den Wahrnehmungen eines beliebigen Nächsten unterscheidet; ein Prozeß, der sich widersprüchlich vollzieht und damit die Unterschiede, die Möglichkeiten der Wahrnehmung potenziert. Ein Vorgang, von dem die Bürokratie, das Berichtswesen traurige Lieder zu singen weiß und sich behilft mit Pattern, mit Denkschemata.
Bei diesen Schwierigkeiten eines so belanglosen Vorgangs, wie kann es da verwundern, wenn ein vielfältigeres, reicheres Bild mit ungleich größeren Schwierigkeiten zu tun hat.
Literatur will Welt auf den poetischen Begriff bringen, möglichst viel Welt, um die poetische Mitteilung sich entsprechend zu machen, sich selbst also und seiner Welt. Da bedarf es der Entdeckung, der Erfindung, des Neuen also. Das Überlieferte würde uns Beifall garantieren, und die auf den Erfolg Angewiesenen, die Unterhaltung, die Medien, die Professionellen schwören daher auf eben diese überkommenen Ästhetiken. Wer den Erfolg benötigt, wird die Tradition zu schätzen wissen; er wird keine anderen Tugenden dulden, schon gar keine umstürzlerischen, unerprobten. Er wird die Tradition schätzen, schätzen nach ihren Möglichkeiten zur Vermarktung.
Balzac wurde so zum Strickmuster für den harten, publikumssicheren Krimi, Goethe findet sich wiedergeboren in der klassizistischen Pose des Kleinbürgersalons, Ibsens Dramaturgie beherrscht seit einem Jahrhundert die Theater und wird weltweit zur Herstellung von Fernsehspielen und −serien genutzt. Ästhetik, so verstanden, wird zum Algorithmus der Beliebigkeit, die so verfertigten Texte stehen mit dem Rücken an der Wand, gesichert aus der Tradition, vermeintlich genau und der Wirklichkeit auf der Spur, weil erfolgreich gewordene Rezepte der Vorväter kolportierend. Der Verweis auf diese Ahnen scheint Vertrautheit, Geborgenheit zu wecken, Nähe von Inhalt, Gehalt und Form zu den großen Entdeckungen unserer Vorzeit. Damit auch einem Publikum entgegenkommend, vielmehr hinterherlaufend, das, durch das fehlende gültige Bild seiner Welt verunsichert, von dessen Vorhandensein es überzeugt ist durch Bildung, aber auch durch Verbildung. Durch eine Überfülle ihm aufgedrängter, widersprüchlicher und sich widersprechender Bilder, radikal in seinem Weltbild und seiner Ästhetik, in seinen Ansichten und Wertungen verunsichert, will es aus den Verwirrungen seiner Zeit sich flüchten in das geordnete, ordnende Abbild einer Welt, die nicht seine ist, aber vertraut und anheimelnd, der alte Mutterschoß, die Nestwärme der Vergangenheit.
Heiner Müller sprach davon, daß Kunst sich durch Neuheit legitimiere und anderenfalls, also wenn sie mit Kategorien gegebener Ästhetiken beschreibbar sei, parasitär ist. Dies ist eine überaus scharfe Definition von Kunst, ein Seziermesser, das die deutsche Literatur, ja selbst die Weltliteratur zu einer übersichtlichen Handbibliothek verkürzt. Literaturgeschichte wird dann zu einer Geschichte permanenter Revolutionen der Formen, der Ästhetik, eine höchst beunruhigende Folge von Widersprüchen, Fantasie und Neuerungen. Sie ist es ohnehin, aber durch einen Wust von Makulatur, den erst die Jahrhunderte mühselig lichten, ist uns der klare Blick darauf verstellt.
Die Produktion von Makulatur befriedigt Bedürfnisse, vor allem das Bedürfnis nach sicheren Werten, die dort fortgesetzt geliefert werden, übernommen aus der Tradition. Sie wird produziert mit dem Rücken an der Wand, sagte ich, und die Wand bröckelt, verschüttet die hergestellte Makulatur fast im Moment ihres Entstehens. Dennoch, die unaufhörlich hergestellten Ewigkeitswerte, Ersatz für verschlissene Religionen, werden begierig und rasch verschlungen, sie erfüllen offenbar Bedürfnisse. Von ihrer stabilisierenden Funktion sprachen wir bereits: der der Herstellung leicht verdaulicher Bilder, die übersichtlich, geordnet und in ihren Werten durch ein vergangenes Jahrhundert scheinbar bestätigt, die gegenwärtige Welt in leicht faßliche und beruhigende Muster bringen. Zudem ist Makulatur wichtiges Futter zum Wiederkäuen, das wir aus der Tier- und Menschennahrung als Ballaststoffe kennen: unverdauliche, verdauungsfördernde Nahrungsbestandteile. Die Buch- und Papierproduktion kennt es als Füllstoff: ein dem Papier als verbilligendes Streckmittel hinzugefügtes, möglichst neutrales Pigment, das Lücken auszufüllen hat, dem Papier die regelmäßige Oberfläche gibt, seinen Weißgrad erhöht, eine größere Glätte erzielt und seine Transparenz mindert.
Makulatur hat darüber hinaus gesellschaftliche Funktionen. Kein Staat dieser Welt, der darauf verzichten könnte. Hegel vermeinte noch, im Staat die Verkörperung einer sittlichen Idee zu sehen. Seit Engels und Lenin wissen wir, »er ist das Eingeständnis, daß diese Gesellschaft sich in einen unlösbaren Widerspruch mit sich selbst verwickelt, sich in unversöhnliche Gegensätze gespalten hat, die zu bannen sie ohnmächtig ist. Damit aber diese Gegensätze, Klassen mit widerstreitenden ökonomischen Interessen nicht sich und die Gesellschaft in fruchtlosem Kampf verzehren, ist eine scheinbar über der Gesellschaft stehende Macht nötig geworden, die den Konflikt dämpfen, innerhalb der Schranken der ›Ordnung‹ halten soll; und diese, aus der Gesellschaft hervorgegangne, aber sich über sie stellende, sich ihr mehr und mehr entfremdende Macht ist der Staat Um diese öffentliche Macht aufrechtzuerhalten, sind Beiträge der Staatsbürger nötig − die Steuern. Diese waren der Gentilgesellschaft vollständig unbekannt. Wir aber wissen heute genug davon zu erzählen.«
Die Steuern im Bereich der Kunst, das eben ist die Makulatur, die staatserhaltende Phrase, um mit Lenin zu sprechen. Insofern hat Hegel so falsch nicht gegriffen mit der sittlichen Idee, sie gehört durchaus zur Verkörperung des Staates hinzu, zu seinen Werten und Wertvorstellungen, ein Religionsersatz, der Gral des aufgeklärten Staatsbürgers.
Ich nannte als die wesentlichen Ursachen und Triebkräfte für die unabdingbar erforderliche Makulatur:
1. den Drang nach überlieferten, also gesicherten Ästhetiken, um sich in einer poetischen Welt zurechtzufinden, da die tatsächliche Welt neu und somit erschreckend ist;
2. die unverdaulichen, aber verdauungsfördernden Theoreme jedweden Glaubens, die keine Erkenntnisse vermitteln und uns nichts mitteilen, was nicht bereits wohlbekannt ist, dafür aber geeignet sind, unser sittliches Selbstverständnis zu kräftigen;
3. die gesellschaftliche und staatliche Funktion. Kunst ist öffentliche Angelegenheit, Angelegenheit des Volkes, res publica, Literatur sind Mitteilungen von Individuen an die Gesellschaft. Der Staat als Unterdrückungsmechanismus einer Klasse gegenüber anderen Klassen − wie Lenin sagt ordnet sich alle öffentlichen Angelegenheiten als die seinen unter, verwaltet also stellvertretend die öffentlichen Angelegenheiten des Volkes, somit auch die Künste. Das Eingreifen des Staates kann verschieden sein, sich der künstlerischen Produktion freundlich oder weniger aufgeschlossen zeigen, es können auch andere, nichtstaatliche Kräfte wirken (die Bourgeoisie entwickelte beispielsweise das Mäzenatentum, um korrigierend die Interessen der eigenen Klasse − nämlich Selbstdarstellung − gegenüber den beschränkten Einsichten ihrer eingesetzten Verwaltung durchzusetzen), immer aber, solange wir in sich selbst widersprüchlichen Gesellschaften leben, werden wir Staaten haben und die Mißlichkeiten einer eingreifenden Verwaltung. Das aber beschäftigt uns hier nur am Rand, wenn auch an einem nicht zu übersehenden.
Ich nannte drei Gründe für die Notwendigkeit von Makulatur und sagte, sie seien alle so neu nicht. Sie beschäftigten und belasteten Kunst und Künstler durch die Jahrhunderte. Ich zitiere Goethe. Im Alter von fast siebzig Jahren spricht er mehrmals über das Theater in Deutschland; lassen Sie sich von dieser Einschränkung nicht irritieren, die Zustände, die er beschreibt, haben auch in den anderen Künsten ihre Wirkung: »Das Theater ist in dem modernen bürgerlichen Leben, wo durch Religion, Gesetze, Sittlichkeit, Sitte, Gewohnheit, Verschämtheit und so fort der Mensch in sehr enge Gränzen eingeschränkt ist, eine merkwürdige und gewissermaßen sonderbare Anstalt.
Zu allen Zeiten hat sich das Theater emancipiert, sobald es nur konnte, und niemals war seine Freiheit oder Frechheit von langer Dauer. Es hat drei Hauptgegner, die es immerzu einzuschränken suchen: die Polizei, die Religion und einen durch höhere sittliche Ansichten gereinigten Geschmack. Die gerichtliche Polizei machte den Persönlichkeiten und Zoten auf dem Theater bald ein Ende. Die Puritaner in England schlossen es auf mehrere Jahre ganz. In Frankreich wurde es durch die Pedanterie des Cardinal Richelieu gezähmt und in seine gegenwärtige Form gedrängt, und die Deutschen haben, ohne es zu wollen, nach den Anforderungen der Geistlichkeit ihre Bühne gebildet …
Es entstand schon vorher die Frage: ob überall ein Christ das Theater besuchen dürfe; und die Frommen waren selbst untereinander nicht einig, ob man die Bühne unter die gleichgültigen (adiaphoren) oder völlig zu verwerfenden Dinge rechnen solle. In Hamburg brach aber der Streit hauptsächlich darüber los, in wie fern ein Geistlicher selbst das Theater besuchen dürfe; woraus denn gar bald die Folge gezogen werden konnte, daß dasjenige, was dem Hirten nicht zieme, der Heerde nicht ganz ersprießlich sein könne.
Dieser Streit, der von beiden Seiten mit vieler Lebhaftigkeit geführt wurde, nöthigte leider die Freunde der Bühne, diese der höhern Sinnlichkeit eigentlich nur gewidmete Anstalt für eine sittliche auszugeben. Sie behaupteten, das Theater könne lehren und bessern und also dem Staat und der Gesellschaft unmittelbar nutzen. Die Schriftsteller selbst, gute wackere Männer aus dem bürgerlichen Stande, ließen sich's gefallen und arbeiteten mit deutscher Biederkeit und gradem Verstande auf diesen Zweck los, ohne zu bemerken, daß sie die Gottschedische Mittelmäßigkeit durchaus fortsetzten und sie, ohne es selbst zu wollen und zu wissen, perpetuirten …
Wenn man sich in der letzten Zeit fast einstimmig beklagt und eingesteht, daß es kein deutsches Theater gebe, worin wir keineswegs mit einstimmen, so könnte man auf eine weniger paradoxe Weise aus dem, was bisher vorgegangen, wie uns dünkt, mit größter Wahrscheinlichkeit darthun, daß es gar kein deutsches Theater geben werde, noch geben könne.«
Goethe spricht die Zustände radikaler an als Heine, den mehr die Zukunft das Fürchten lehrte, eine Zukunft, die unsere Gegenwart ist. Das, sagten wir, ist für uns Anlaß und Aufgabe, Heines böse Schilderung unserer Zustände zu bedenken. Lorbeerwald oder Kartoffelacker also, Buch der Lieder oder Papiertüten für den Krautkrämer?
Der dialektisch geschulte Denker wird hier sofort sein Sowohl-als-auch einwerfen, eines bedinge das andere, jenes sei Voraussetzung von diesem, Höherentwicklung, Negation der Negation, Hegelsche Aufhebung, Entwicklung als beständige Progression zur idealen Gesellschaftsform, Reich der Freiheit über dem Reich der Notwendigkeit, und so fort bis zum Elysium. Dies alles im Ohr und Hinterkopf, wagen wir einen Blick auf die Realität, einen philosophisch gewappneten Blick.
Bedarf unsere Gesellschaft noch der Kunst, oder hat sie diese dem Gemeinwohl, den sozialen Bedürfnissen aller Individuen zum Fraß vorgeworfen? − und das, falls es zutrifft, mit Recht, wie Heine sagt.
Die Frage nach der Notwendigkeit von Kunst für eine Gesellschaft ist eine Frage an uns, eine Frage nach unseren Bedürfnissen. Gleichgültig, ob das einzelne Individuum sich in Konsens oder Dissens mit dem Staat befindet, es ist Teil der Gesellschaft, mitverantwortlich. Alle Kritik, sagten wir, ist, wenn sie nur einigermaßen fundiert und durchdacht ist, Selbstkritik. Alles andere ist Phrase, Pharisäertum, Oberfläche. Der anklagende Zeigefinger richtet sich immer auf die eigene Person, wenn wir nur den Mut aufbringen und den klaren Blick, uns selbst in dem Angeklagten zu erkennen. Wir sind befragt, wenn Heines fürchterliche Zukunftsvision einen Adressaten hat; unser Verhältnis zur Kunst müssen wir befragen. Es geht nicht um fremde Versäumnisse und Mängel. Der Verlust ist, so wir ihn zu konstatieren haben, unser Verlust.
Wir nähern uns unserem Thema in Kurven. Es sind Kurven aus gegebener Zurückhaltung, ein Eingeständnis von Angst vor dem zu erwartenden Ergebnis. Die jetzige Abschweifung heißt: Was ist moderne Kunst, was sind die Kriterien, mit denen wir heutige Kunst vom bloß Unterhaltenden, dem Epigonalen, der Kunst als Gewerbe, dem gefälligen Kunstgewerbe und den ebenso gefälligen oder doch spektakelerregenden Modernismen unterscheiden können?
Wir sprachen davon, daß alle uns zur Verfügung stehenden Ästhetiken allein vergegenständlichte, vergangene Kunst erfassen können. Eine erste, unzureichende Definition ist demnach: Alles, was wir mit bewährten, überlieferten Kriterien als Kunst erfassen und werten können, ist heute keine Kunst.
Das uns zur Verfügung stehende Instrumentarium der Literaturwissenschaft ist unter anderem gewonnen aus der methodischen Beschäftigung mit der überlieferten Literatur. Mit diesem Besteck können wir die vergangenen, aufgehobenen Kunstleistungen als solche definieren, ordnen, sezieren etc. Mit diesen Instrumenten an neue Literatur heranzugehen bringt uns in die Situation eines Hufschmieds, der Automobile zu bewerten hat. Er hat Berufserfahrung, Handwerk, und sein Urteil ist geläutert und überprüft durch Generationen und Jahrhunderte. Und er wird jenes Automobil küren, dem zwei Pferde vorgespannt sind.
Die Wissenschaft läßt uns nicht ganz im Stich. Zumindest haben wir Methoden in der Hand, die es uns erlauben, all jenes, was ihnen entspricht, was den Kriterien der Literaturwissenschaft genügt, auszuschließen aus der modernen Kunst und Literatur.
Negativ-Definitionen haben ihre Mängel. Wir wissen jetzt vielleicht, was nicht Kunst ist, was Kunst nicht sein kann. Was aber ist Kunst?
Eine Wandkritzelei − um mich verständlich auszudrücken: ein Sgraffito − lautet: »Kunst ist, was man nicht kann, denn wenn mans kann, ists ja keine Kunst.« Gewiß, hier liegt eine semantische Stufenverwechslung vor, und überdies lebt der Witz von zwei verschiedenen Bedeutungsinhalten des einen Wortes. Er ist zweifellos ironisch gemeint, unernst. Und doch, mit dieser Definition können wir etwas anfangen. Was man kann, das ist eben das Handwerk, das sind Voraussetzungen. Das zu tun, was man kann, ist ehrenwert und brav, aller Ehren wert, aber es sind Tugenden anderer Stände, anderer Künstler, etwa des Haarkünstlers, des Friseurs. Da entsteht tatsächlich Kunstvolles, Bewunderungswürdiges, aber doch nicht Kunst. »Was man nicht kann« − das scheint wohl eher die Schwelle zu sein, die uns endlich zu dem bringt, um das es uns hier geht. »Kunst ist, was man nicht kann.« Eine bedenkenswerte und sehr bedenkliche Definition. Eingeschränkt gültig ist sie gewiß für Kunst als Prozeß, für die Produktion, für die Arbeit. Was man nicht kann, dennoch zu tun, das beinhaltet die Möglichkeit des Scheiterns, das verhindert jede Sicherheit, bietet einen Ansatz für das Laboratorium des Prozesses Kunst. Zu tun, was man kann, zeichnet den Handwerker aus, den Routinier. Das ist viel und Voraussetzung jeglicher Arbeit, und dennoch nicht hinreichend. Es ist die Grundlage, die Voraussetzung für Erfindungen, für die neu zu erfindende Wirklichkeit, was ja Poesie schließlich ist. Die Erfindung selbst hat sich von allem überkommenen Handwerk frei gemacht, sie ist etwas Unvergleichliches. Das ist keine emphatische Wertung, denn sie ist unvergleichbar, weil sie außerhalb aller Kriterien und Wertmaßstäbe ist, weil wir uns, um sie zu beurteilen, nicht auf mühselig erworbene Kenntnisse stützen können. Es gibt kein anderes Kunstwerk, das wir vergleichend heranziehen können, um das neu entstandene zu erfassen und es möglicherweise gleichfalls als Kunst zu kennzeichnen. Gäbe es das vergleichbare, wäre das neu entstandene Werk alles mögliche, nur nicht Kunst.
Haben wir nun definiert, was moderne Kunst ist?
Der übliche Einwand dagegen lautet: Das, was man nicht kann, ist Nichtgekonntes. Kann das Kunst sein? Ist das Kunst? Es muß nicht Kunst sein, aber es kann sein, daß es Kunst ist. Ich habe keine Sicherheiten anzubieten. Alles, was uns an sicheren Werten aus den Jahrhunderten überliefert wurde − Begriffe wie Schöpfertum und Genialität, Aura, Einzigartigkeit und Imagination, Ewigkeitswert, das Geheimnis der Meister etc. − all dies hat sich inzwischen gründlich desavouiert. Walter Benjamin verwies darauf, daß diese Begriffe in ihrer unkontrollierten oder doch schwer kontrollierbaren Anwendung zur Verarbeitung des Tatsachenmaterials im faschistischen Sinn führen. Wir sind − geschüttelt durch Geschichte − hoffentlich hellhöriger geworden und verunsicherter. Hart bedrängt von dem traditionellen Kunstverständnis jeder Gesellschaft, die ihre Kunst vor der Politisierung bewahren möchte als ein Fleckchen ungetrübten Menschseins, als eine Trauminsel des homo ludens, des spielenden Menschen, und daher fortgesetzt Verlängerungen produziert, Verlängerungen abgestorbener Prozesse (die Ästhetik der Toten ist tote Ästhetik), sind wir mit unseren Kunstsinnen, mit unserer Sinnlichkeit für Kunst in einer Welt des schönen Scheins daheim oder in einer Wüste der Begriffslosigkeit, konfrontiert mit abstrusen Erfindungen, die sich uns als neue Kunstwerke zu präsentieren suchen. Es fällt uns schwer in unserer Verstörung, rabiate Maßnahmen zu unterdrücken, zu denen wir dann neigen. Wir kennen die übliche Reaktion darauf, vor der uns nur unsere Verunsicherung und die Kenntnis ähnlicher Vorgänge in der Geschichte bewahrt.
Ich zitiere im folgenden einen Leserbrief, der in einem Berliner Lokalblatt zu einer Kunstausstellung erschien. Auf nähere Angaben kann ich verzichten, der Brief könnte in fast jeder Zeitung zu fast jeder Präsentation neuster Werke erscheinen: »Wenn diese Zeilen erscheinen, dann hat die Ausstellung … ihre Pforten wohl schon geschlossen. Das ist gewiß kein Nachteil, denn was dort gezeigt wurde, war nicht durchweg meisterlich. Vieles hatte man vor Jahren und Jahrzehnten schon besser gesehen. Es gab kaum Originelles, und wenn etwas unbedingt originell sein wollte, so war es weitgehend unverständlich. Die meisten Gemälde, ob Aquarell, ob Öl, ob Ton, waren grau in grau. Haben die jungen Künstler in ihrer Jugend und Studienzeit nichts erlebt, was mehr Aktion, Farbe, Frohsinn und Zeitbezogenheit in der Darstellung verdient hätte? Der Besucher, der selbst noch lernen möchte und Maßstäbe für die Kunstbetrachtung sucht, könnte vielleicht dieses oder jenes für Kunst halten, was lediglich von einem Künstler stammt. Die Zielrichtung unserer Kunst in den nächsten Jahren kann das wohl nicht gewesen sein.«