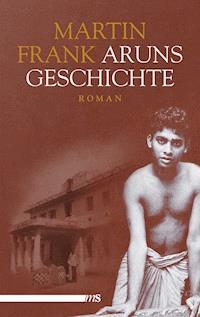9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
«Die Oma hat a Schlagerl ghobt!» Der Kabarettist Martin Frank ist auf einem niederbayrischen Bauernhof aufgewachsen, und seine Großmutter ist seine wichtigste Bezugsperson. Als er gerade 19 ist, erleidet sie einen Schlaganfall und ist von heute auf morgen auf Pflege angewiesen – und Martin beschließt: Er wird sich um seine Oma kümmern. Fünf Jahre pflegt er sie, bis zu ihrem Tod, und berichtet nun über diese Zeit, die nicht nur traurig, sondern skurril-komisch, liebevoll und wichtig für ihn war. Ein tragikomisches Buch über Familie, Zusammenhalt und den Umgang mit dem Tod – erzählt mit bayrischem Charme, Warmherzigkeit und viel Zuversicht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Martin Frank
Oma, ich fahr schon mal den Rollstuhl vor!
Als ich vom Enkel zum Pfleger wurde
Über dieses Buch
«Die Oma hat a Schlagerl ghobt!»
Der Kabarettist Martin Frank ist auf einem niederbayerischen Bauernhof aufgewachsen, und seine Großmutter ist seine wichtigste Bezugsperson. Als er gerade 19 ist, erleidet sie einen Schlaganfall und ist von heute auf morgen auf Pflege angewiesen – und Martin beschließt: Er wird sich um seine Oma kümmern. Fünf Jahre pflegt er sie, bis zu ihrem Tod, und berichtet nun über diese Zeit, die nicht nur traurig, sondern skurril-komisch, liebevoll und wichtig für ihn war. Ein tragikomisches Buch über Familie, Zusammenhalt und den Umgang mit dem Tod – erzählt mit bayerischem Charme, Warmherzigkeit und viel Zuversicht.
Vita
Martin Frank wurde 1992 in Hutthurm nahe Passau geboren. Er wuchs auf dem elterlichen Bauernhof auf und absolvierte eine Ausbildung zum Standesbeamten. Mit 21 kündigte er, sprach an der Schauspielschule Zerboni in München vor und wurde zur dreijährigen Schauspielausbildung zugelassen. 2015 erschien sein erstes Kabarettsoloprogramm. 2018 folgten neben dem zweiten Soloprogramm der Bayerische Kabarettpreis, der Prix Pantheon sowie der Jury- und Publikumspreis beim Großen Kleinkunstfestival der Berliner Wühlmäuse.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2023
Copyright © 2023 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Redaktion Ulrike Gallwitz
Covergestaltung zero-media.net, München
Coverabbildung Andreas Kusy
ISBN 978-3-644-01574-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Vorwort
Liebe Leserinnen und liebe Leser,
sind Sie sich sicher, dass Sie dieses Buch lesen möchten? Es gibt Hunderte von großartigen Autorinnen und Autoren, die Sie mit ihrer bildhaften Sprache in den Bann ziehen könnten. Vielleicht war es ein Versehen? Wahrscheinlich haben Sie bei einem großen Onlinehändler einen Nasenhaarschneider erwerben wollen, und plötzlich hieß es: «Kunden, die diesen Artikel kaufen, interessierten sich auch für diesen Artikel!» Schwups, schon lag ich in Ihrem Warenkorb, und Sie haben es überhaupt nicht mitbekommen. Oder vielleicht waren Sie in einer klassischen Buchhandlung, und ich lag völlig verloren zwischen dem 1000-seitigen Bildband «Antike Keramiktöpfe aus Ostasien» und der Biografie von Dieter Bohlen. Dann hat man mich wohl falsch einsortiert oder fallen gelassen. Sollte das der Fall sein, dann müssen Sie mich jetzt wohl doch lesen, denn dann sind wir wahrscheinlich füreinander bestimmt.
Ich kann es ja selbst kaum glauben, dass ich ein Buch geschrieben habe. Wurde mir doch nach der vierten Klasse der Übertritt in die Realschule Tittling verweigert, weil ich mit einer glatten Fünf in Deutsch durch die Aufnahmeprüfung gerasselt bin. Aber zu Recht. Ich und meine Kommasetzung waren einfach noch nicht so weit. Ich bin ein klassischer Spätzünder. Einigermaßen vorzeigbare Noten kamen erst so ab der fünften Klasse, meinen letzten Milchzahn verlor ich mit 15, und meinen ersten richtigen Kuss hatte ich mit Anfang 20.
Mein Know-how in der Literatur beschränkt sich leider auch nur auf eine Handvoll Schullektüren, die ich lesen musste. Darunter «Krabat» von Otfried Preußler und «Die Wolke» von Gudrun Pausewang. Großartige Werke. Und auch da habe ich nicht jede Seite gelesen, sondern mir in aller Knappheit im Schulbus davon berichten lassen.
Trotzdem war es mir ein großes Bedürfnis, die letzten Jahre mit meiner Oma aufzuschreiben. Wenn Sie mich schon von der Bühne kennen, dann wissen Sie, dass die Oma einen großen Platz in meinen Programmen hat. Ich erzähle immer nur von dieser einen Oma. Dabei hatte ich zwei ganz großartige Omas, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Die eine lernen Sie samt meiner geliebten Großtante in diesem Buch kennen.
Die andere ist tief in meinem Herzen verankert. Damit auch sie nicht zu kurz kommt, möchte ich Ihnen zumindest hier im Vorwort von meiner «Stadt-Oma» erzählen, die – wie der Name verrät – in der Stadt, und zwar in Passau, lebte. Sie stammte ursprünglich aus Schlesien und kam als Flüchtlingskind in die Passauer Gegend. Im Gegensatz zu meiner «Land-Oma» war meine «Stadt-Oma» von einer sehr zierlichen Statur. Außerdem hatte sie immer sehr blasse glänzende Haut. Was vielleicht daran lag, dass sie die meiste Zeit in der Wohnung verbrachte. Mit ihr trank ich literweise grünen Tee, aß dazu Unmengen an Prinzenrolle und amüsierte mich über die griechische Landschildkröte, die meine gesamte Kindheit über träge durch die Wohnung schlich. Sie hörte auf den kreativen Namen «Schüldi». Den Großteil meiner Schulzeit verbrachte ich in Passau, und nach dem Mittagessen besuchte ich hin und wieder meine Oma. Wenn ich dann fragte, wo Schüldi sei, tippte sie mit ihrem Zeigefinger gegen ihre rosigen Lippen, damit ich still war, und wir horchten in den Raum. Aus irgendeiner Ecke hörte man dann, wie Schüldi ihren Panzer die Sockelleiste entlangschliff. Dann lachten wir uns still an, als hätten wir uns gerade gegenseitig ein Geheimnis verraten, und schlürften an unserem viel zu heißen Tee. Hier war alles so anders als bei meiner Oma auf dem Land. Es gab den großen Wohn- und Essbereich, in dem sich das Leben abspielte. Während meine Oma am Küchentisch saß und schweigend Kreuzworträtsel löste, lag mein Opa auf seinem Kanapee in einer Nische im Wohnzimmer und sah ein Fußballspiel. Dabei schrie er den Fernseher an, als würde er selbst auf der Trainerbank sitzen und Anweisungen über den Platz verteilen.
Gleich nebenan gab es noch das «weiße Wohnzimmer». In diesem Raum war alles weiß – die Couch, der Teppich, die Wohnwand, ja sogar der kleine Zeitungsständer neben der Tür. Außer den Plätzchendosen (ebenfalls weiß) während der Adventszeit hielt sich hier aber nie jemand auf. Genauso wenig wie im Salon, einem weiteren sehr edlen und hellen Raum, eingerichtet mit dunklen Barockmöbeln am Ende des Ganges. Vom Salon war ich fasziniert. Es war, als hätte jemand vor Jahrzehnten picobello sauber gemacht, alle Uhren zum Stillstand gebracht und anschließend die Türe hinter sich verschlossen. Wenn ich als kleiner Junge zusammen mit meiner Mama meine Oma besuchen kam, war mein erster Gang in den Salon. Ich stand einfach nur mitten im Raum und ließ ihn auf mich wirken. In meiner Vorstellung saßen hier die wohlhabenden Leute aus der Stadt. Frauen gehüllt in schicken Kleidern mit großen weißen Punkten und langen Satin-Handschuhen. Alle tranken aus edlen Porzellantassen ihren Kaffee, spreizten dabei den kleinen Finger von sich und lachten völlig übertrieben über unlustige Witze.
Genauso wenig wie das «weiße Wohnzimmer» wurde auch der Salon benutzt. Damit meine Oma den weiten Weg vom zweiten Stock hinunter in den Keller, wo die Gefriertruhe stand, nicht länger auf sich nehmen musste, wurde irgendwann kurzerhand ein steriler weißer Gefrierschrank in den Salon gestellt, und so war es um die Anmut des Raumes geschehen. Es war, als hätte sich ein Stück Speck auf eine Pizza Margherita verirrt. Der einzige Mensch, der den Salon jetzt öfter betrat als ich, war der Bofrost-Mann, der die Truhe auffüllte.
Dadurch, dass meine «Stadt-Oma» aus Schlesien kam, sprach sie kein Bairisch, sondern Hochdeutsch mit einer kleinen süddeutschen Färbung. Außerdem war sie eine Meisterin der Sprichwörter. Wenn sie von meiner Mama darauf hingewiesen wurde, dass der weiße Lampenschirm im weißen Wohnzimmer schief stand, konterte sie mit: «Schief ist Englisch, und Englisch ist modern!» Durch sie lernte ich auch norddeutsche Worte kennen, die ich wahrscheinlich auf unserem Bauernhof so nie gehört hätte. Wenn ihr zum Beispiel jemand im Weg stand, dann schrie sie immer: «Geh mir aus der Latichte!», was übersetzt so viel heißt wie: «Geh mir aus dem Licht!»
Während mein Opa als Karosseriebauer eine eigene Werkstatt hatte, war es meiner Oma nicht erlaubt, arbeiten zu gehen. Dabei hätte sie es so gerne getan. Lediglich zweimal durfte sie während der Weihnachtszeit in einem Passauer Kaufhaus aushelfen. Dort saß sie an der Kasse, und es machte ihr die größte Freude. Der Kontakt mit anderen Frauen, die Arbeit an sich und das Gemeinschaftsgefühl mit ihren Kolleginnen, all das tat ihr unwahrscheinlich gut.
Irgendwann erkrankte sie an Parkinson und konnte ihre Bewegungen nicht mehr kontrollieren. Ich sehe sie heute noch an ihrem Herd stehen, wie sie in einem Topf rührt und wegen ihrer unkontrollierten Bewegungen spaßeshalber sagt: «Schau, Sohni, ich muss nicht mal rühren! Das macht der Parkinson von alleine!»
Donnerstag, 16. April, 07.00 Uhr Sterbebegleiter aus heiterem Himmel
Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, jemanden beim Sterben zu begleiten? Nicht? So geht es mir auch. Schon gleich gar nicht in meinem Alter und auf nüchternen Magen. Ich bin vor Kurzem erst 24 geworden, und nichts liegt mir ferner, als über den Tod nachzudenken. Weder über den eigenen noch über den von anderen. Wenn, dann mache ich das vielleicht so ab 80, nachdem ich sämtliche Länder der Welt bereist, den Dachboden entrümpelt und mir meinen Kindheitstraum einer eigenen Eisdiele erfüllt habe. Und dann auch nur vielleicht.
Lange Zeit war mir auch gar nicht klar, dass es Menschen gibt, die sich bewusst dafür entscheiden, anderen beim Sterben beizustehen. Aber jetzt, da ich es weiß, würde ich mir wünschen, jeder hätte das Grundrecht auf eine Sterbebegleitung. Wie oft hört man in den Nachrichten, dass ältere Menschen erst Wochen nach ihrem Tod leblos in ihrer Wohnung gefunden werden. In unserer Tageszeitung las ich vor einiger Zeit von einer älteren Dame, deren Ableben drei Wochen lang niemandem aufgefallen war, weil ein Nachbar ihr täglich geliefertes «Essen auf Rädern» einfach geklaut und selbst gegessen hatte.
Dabei gäbe es doch Möglichkeiten, einen solch einsamen und unwürdigen Tod zu vermeiden. Wir leben schließlich im Land der Bürokratie und der Statistiken. In Deutschland liegt die durchschnittliche Lebenserwartung für Frauen bei 83,6 Jahren und die für Männer bei 78,9 Jahren. Wäre es nicht sinnvoll, jeder würde ab seinem 75. Geburtstag regelmäßig Post von seinem staatlich zugewiesenen Sterbebegleiter bekommen? Ähnlich wie beim Ablauf des Personalausweises. Nur statt «Denken Sie an die Verlängerung Ihres Personalausweises!» wird man mit den Worten «Denken Sie daran, mich rechtzeitig vor Ihrem Ableben zu kontaktieren!» an dessen Service erinnert. Ob ich dieses Angebot dann wirklich in Anspruch nehme, bleibt mir überlassen.
Natürlich wissen wir in der Regel nicht, wann wir das Zeitliche segnen, aber ab einem bestimmten Alter kann man ungefähr sagen: «Okay, ich plane jetzt mal keinen größeren Kredit mehr ein!» Meine Mama hat sich erst neulich ein Auto gekauft und meinte dann zu mir: «Also, das ist jetzt das letzte!» Die gefühlte Endzeitstimmung in diesem Satz hat mich doch etwas schockiert, und ich sagte nur empört: «Mama! Du bist 64! An so was will ich noch gar nicht denken!»
Aber wahrscheinlich hat sie mit ihrer Einstellung recht. Uns allen würde ein etwas entspannteres Verhältnis zum Tod nicht schaden. Meine Schwester lebte zum Beispiel viele Jahre in Mexiko, und ich habe sie dort oft besucht. Sie wohnte jenseits der Touristenhochburgen, und das ermöglichte es mir, tief in das authentische Mexiko einzutauchen. Einmal habe ich dort durch Zufall ein mexikanisches Totenfest erlebt. Den «Día de los Muertos», was übersetzt «Tag der Toten» bedeutet. Es ist das Pendant zu unserem Allerheiligenfest. Während jedoch bei uns in Bayern ab 2 Uhr früh sogar ein Tanzverbot gilt und wir dunkel gekleidet, still und andächtig an den Gräbern stehen, wird in Mexiko mit Musik, Tanz und Unmengen an Speis und Trank ausgelassen gefeiert.
Mexikanische Friedhöfe sind zum Totenfest auch ganz anders geschmückt, als man das bei uns kennt. Meine Familie beauftragt zu Allerheiligen jedes Jahr die örtliche Gärtnerei mit einem exorbitant teuren Gesteck. Dieser Blumenschmuck besteht dann meistens aus irgendwelchen kunstvoll drapierten Gräsern, getrockneten Tannenzweigen, weißen Rosen und vertrockneten Kiefernzapfen. Die wichtigste Vorgabe an die Floristin unseres Vertrauens lautet jedoch stets: gedeckte Farben. Was natürlich in erster Linie geschmackliche Gründe hat. Außerdem, glaube ich, spiegelt so ein Grabgesteck doch einiges an Charakter wider. Und wir sind eine stinknormale Familie, die alles andere als auffallen will. Und schon gleich gar nicht an Allerheiligen mit einem exzentrischen Grabgesteck.
Schon Tage zuvor ist mein Onkel damit beschäftigt, das Grab fein säuberlich von allen herabgefallenen Herbstblättern zu befreien, die teure tiefschwarze Graberde aufzutragen und die Grabränder akkurat mit einer breiten Holzlatte zu formen. Nur für diesen einen Tag und nur für diese paar Minuten, die wir am Grab verbringen, bis der Herr Pfarrer mit seiner Gefolgschaft auf einer Weihrauchwolke vorbeischwebt und unsere Anwesenheit mit einem Spritzer Weihwasser quittiert. Und natürlich auch, um nicht in Gedanken von den Grabnachbarn abgewatscht zu werden: «Ja, was is denn des für ein greisliges Gesteck?! Des schaut ja aus wie ein toter Fuchs!»
In Mexiko ist Allerheiligen das komplette Gegenteil. Bei allem Respekt, aber ich habe in meinem Leben noch keinen kitschigeren Friedhof gesehen als dort. Zum Día de los Muertos werden die Gräber mit allerhand Heiligenfiguren geschmückt, mit buntem Lametta, Plastikblumen und allem, was der Dachboden sonst noch so hergibt. Für das konservative niederbayerische Auge sieht das aus wie die Überreste einer ausgearteten Frauenbund-Faschingsparty.
Ich selbst habe zwar kein verklemmtes Verhältnis zum Tod, bin mir aber trotzdem nicht sicher, ob ich beim Sterben begleitet werden möchte. Gut, wenn ich wüsste, dass ich schön sterbe, dann vielleicht. Aber am Ende sterbe ich total unappetitlich, kann meine Körperflüssigkeiten nicht mehr kontrollieren und rede so wirres Zeug, dass es mir später im Jenseits noch peinlich ist. Dann doch lieber allein, dann kann ich wenigstens hinübergehen, wie ich will.
Ich war auch immer der Meinung, ich könnte niemanden beim Sterben begleiten. Ich bin ja viel zu emotional, und was man während des Sterbeprozesses am wenigsten gebrauchen kann, ist ein wie ein Schlosshund weinender Teenager. Das Problem ist aber, ich bin einfach schon immer viel zu nah am Wasser gebaut. Wenn ich mich an meine Zeit als Ministrant zurückerinnere, so haben mich Beerdigungen damals regelrecht zerlegt. Wenn unser Telefon klingelte und auf dem Display die Nummer unserer Mesnerin erschien, wurde mir schon ganz schlecht: «Ja, da is d’Müller Marianne, mia brauchadn an Martin für a Leich!» Für den Fall, dass Sie des Bairischen nicht mächtig sind, möchte ich den Satz kurz erklären. «[…] mia brauchadn an Martin für a Leich!» bedeutet nicht, dass die Müller Marianne angerufen hat und einen 12-Jährigen darum bittet, aus jemandem eine Leiche zu machen, oder etwa, wie eine Urlauberin mal glaubte, eine Leiche zu obduzieren. Gott bewahre! Obwohl ich auf dem Gebiet der Obduktion zugegebenermaßen nicht ganz unerfahren war. Im zarten Alter von sechs Jahren habe ich bereits sämtliche toten Hühner auf unserem Hof persönlich seziert und anschließend meiner Oma den Befund «Tod durch Marderbiss» mitgeteilt. Aber die Anatomie des Huhnes unterscheidet sich dann doch sehr von der des Menschen. Und soweit ich weiß, stirbt man als Mensch an einem Marderbiss nur in Einzelfällen. Sie ahnen es schon, «a Leich» ist bei uns im Bayerischen Wald das Synonym für eine Beerdigung. Es gibt auch «a scheene Leich», das sind dann Beerdigungen, die besonders emotional und anrührend sind.
Bei uns in der Pfarrei konnte der Beerdigungschor – der meistens aus fünf heiseren Rentnerinnen bestand – noch so schief singen und unser Organist noch so falsche Töne der Orgel entlocken, für mich war jede Beerdigung emotional und anrührend. Denn obwohl ich die meisten Leute, die da in die Grube gelassen wurden, gar nicht kannte, musste ich immer weinen. Bei der Bestattung unserer ehemaligen Bistumsblattausträgerin – der Huber Maria, die im zarten Alter von 95 Jahren friedlich eingeschlafen war – hatte ich so viele Tränen in den Augen, dass ich aus Versehen mein Weihrauchfass gegen ihren teuren Eichensarg schlug. Gott sei Dank spielten in dem Moment die Blechbläser so laut «Näher, mein Gott, zu dir», dass es außer meinen Mitministranten und dem Herrn Pfarrer niemand mitbekam. Und als würde das nicht schon reichen, flog bei dem Aufprall auch noch ein Stück glühende Kohle mitsamt einem Dutzend kleiner bunter Weihrauchkügelchen aus dem Fass mitten in das Blumengebinde, das umgehend anfing zu rauchen. Um einen möglichen Flächenbrand zu verhindern, schickte der Pfarrer geistesgegenwärtig eine Überdosis Weihwasser hinterher.
Wäre die Frau Huber zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht richtig tot gewesen, sondern hätte nur tief und fest geschlafen, hätte ich sie durch meinen Weihrauchunfall mit Sicherheit wieder ins Leben katapultiert. Von da an war ich – zumindest bei Beerdigungen – vom Weihrauchdienst freigestellt.
Bei einer anderen Beerdigung hatte ich Kreuzträgerdienst. Man geht in diesem Fall als Ministrant dem Trauerzug voran und ist dafür verantwortlich, dass die Trauergemeinde zur Beisetzung dann auch am richtigen Grab steht. Es war eine wahnsinnig emotionale Beerdigung. Ein Junge, der gerade einmal zwei Jahre älter war als ich, verstarb völlig unerwartet mit 14 Jahren an einem unerkannten Herzfehler. Obwohl ich mit ihm persönlich nichts zu tun hatte und ihn auch nur vom Sehen kannte, ging mir das Ganze ziemlich nah. Als Schlusslied klang aus einem kleinen CD-Player «Dieser Weg wird kein leichter sein» von Xavier Naidoo. Dass dieses Lied auch für mich gleich Wahrheit werden sollte, ahnte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Nach dem Requiem versuchte einer der Sargträger mir den Weg zu erklären, ich war aber von der ganzen Situation so dermaßen aufgelöst, dass sich die Phrasen aus seinem Mund für mich wie Mandarin anhörten. Mehr als ein abwesendes «Mhm!» brachte ich als Bestätigung nicht aus mir heraus. Anschließend lief ich schnurstracks in die völlig falsche Richtung, und hinter mir setzte sich der lange Trauerzug mit Eltern, Großeltern, Urgroßeltern – die mit Müh und Not ihre Rollatoren durch den Kiesweg schleiften – sowie Mitschülern, Lehrern, Vereinsmitgliedern und sonstigen Trauergästen in Bewegung. «Wir müssen in den Ostteil! Wo gehst du denn hin?», zischte einer der Sargträger zu mir nach vorne. «Ich weiß es nicht!», schluchzte ich zurück und führte die Trauerkarawane einmal im Kreis über den ganzen Friedhof.
Warum ich Ihnen das erzähle? Ich will damit sagen, dass, wenn es um den Tod geht, ich der denkbar schlechteste Ansprechpartner bin. Ja, ich weiß, sterben ist menschlich, vor allem wenn man ein hohes Alter erreicht hat, aber ich will halt nicht dabei sein müssen. Und trotzdem sitze ich jetzt im Wohnzimmer meiner Großtante, das wir zur Pflegestation meiner Oma umfunktioniert haben, und warte, bis diese ein letztes Mal einschläft.
07.08 Uhr Drei Schwestern
«Wos is denn?! Kimmt d’Kathe eh ned zum Frühstück?», schreit meine Großtante Anni, die wir liebevoll immer nur «Tante» nennen, von der Küche aus ins Wohnzimmer. «Naa. I glaub, sie hod koan Hunger!», antworte ich ihr und höre, wie sie mit einem kurzatmigen «Hö!» an ihrem viel zu heißen Kaffee schlürft. «Hö» ist ein Laut, den sie immer unkontrolliert von sich gibt, wenn sie aufgeregt ist oder von einer Situation überfordert. Die Demenz meiner Großtante ist bereits so weit fortgeschritten, dass sie – Gott sei Dank, muss man fast sagen – die unschönen Dinge sehr schnell vergisst und nicht mehr alles mitbekommt. «Jetzt hob i sauber z’vui Kaffee gmocht! Wos treib i denn jetzt damit? Hö, hö!» Ich will mir nichts anmerken lassen und sage beschwichtigend: «I trink na dann!» Ich habe noch nie Kaffee getrunken, aber auch das weiß meine Großtante natürlich nicht mehr. Ich halte die Hand meiner Oma und blicke einfach nur starr vor mich hin.
Meine 89-jährige Oma und meine 87-jährige Großtante Anni, die hier ständig aus der Küche plärrt, haben sich in den letzten vier Jahren zum Mittelpunkt meines Lebens entwickelt. Bei ihnen verbrachten mein zwei Jahre jüngerer Bruder Fabian und ich die meiste Zeit unserer Kindheit. Hier auf einem kleinen Milchviehbetrieb im tiefsten Niederbayern. Mein Papa bewirtschaftete den Hof, und meine Mama war selbstständig mit zwei kleinen Lebensmittelmärkten, etwa 20 Autominuten entfernt. Meine Mama musste jeden Tag gegen halb sieben das Haus verlassen, damit sie pünktlich um acht Uhr ihre Läden öffnen konnte, und mein Papa stand ab sechs Uhr bei seinen «Muggaln» im Stall.
Mein jüngerer Bruder Fabian und ich wurden deshalb schon sehr früh zur Selbstständigkeit erzogen. Zur Einschulung hatte ich in meiner Schultüte einen Wecker, der die Form einer Giraffe hatte und lustige Geräusche von sich gab. Ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass ich von nun an dafür verantwortlich war, dass mein kleiner Bruder und ich rechtzeitig aufstanden, um pünktlich um 8 Uhr im Klassenzimmer zu sitzen. Im Alter von acht Jahren wusste ich, dass die Gurkenscheiben in einer Wurstsemmel von zwei Wurstscheiben umschlossen sein müssen, damit sie die Semmel bis zur großen Pause nicht völlig aufweichen, und ich konnte beurteilen, ab wann ein T-Shirt so viele Bolognese- und Grasflecken hatte, dass ein «Das geht schon noch!» nicht mehr akzeptabel war. Ohne mich selber loben zu wollen, würde ich behaupten, dass ich mit acht Jahren bereits selbstständiger war als so mancher Mittdreißiger, der seiner Mama die Wäsche bringt.
Aber wir waren natürlich nicht immer auf uns allein gestellt. Zum einen wohnten nebenan im Austrag (so nennt man das zusätzliche Haus auf einem Bauernhof, in dem die ältere Generation ihren Ruhestand verbringt) meine Oma und meine Großtante, zu denen wir samt Kuschelbär und Hausaufgaben jederzeit übersiedeln konnten. Zum anderen holte meine Mama zur Unterstützung regelmäßig tschechische Au-pair-Mädchen ins Haus, was für damalige Verhältnisse ziemlich fortschrittlich war. Zumindest kannte ich keinen anderen Bauernhof, der regelmäßig junge tschechische Damen über die Grenze «schmuggelte», und wenn, dann bestimmt für andere Zwecke, als wir es taten. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich oft in Erklärungsnot geriet, wenn mich meine Mitschüler fragten, wer denn diese Frau sei, die mich immer in die Schule brachte und anschließend wieder abholte. Es war ja weder meine Schwester, noch meine Tante, und «Au-pair-Mädchen» gehört jetzt nicht unbedingt zum Wortschatz eines Siebenjährigen, deshalb entspann sich dann in etwa folgender Dialog:
Martin: «De hod da Papa aus der Tschechei gholt!»
Mitschüler: «Warum holt dei Papa a Frau aus der Tschechei?»
Martin: «Damit sie mich in d’Schui bringt!»
Mitschüler: «Dei Papa holt extra a Frau aus da Tschechei, damit sie dich in d’Schui bringt?»
Martin: «Ja!»
Mitschüler: «Aha!»
Gott sei Dank können Kinder Diskussionen auch ohne befriedigende Antworten für beendet erklären. Ich hätte mich aber nicht besser erklären können. Für uns waren es halt einfach die Elisabeth, Renata und Lucie, die jeweils im Zweijahrestakt bei uns wohnten. Von denen habe ich auch viel gelernt. Unter anderem, dass man die Kombination aus Spiralnudeln und geriebenem Apfel durchaus essen kann, dass das tschechische Wort für «Servus» «Ahoj» ist und dass man ein Papiertaschentuch vor ein Schlüsselloch kleben muss, wenn man sich vor den heimlichen Blicken eines Hals über Kopf verliebten Grundschülers schützen möchte.
Meine Mama quält bis heute ein schlechtes Gewissen, weil sie nicht so viel Zeit mit uns verbringen konnte, wie sie es gerne gemacht hätte. «Wenn ich heute daran denke, dass ich dir zur Einschulung einen Wecker in die Schultüte gesteckt habe, treibt es mir die Tränen in die Augen!», hat sie erst kürzlich zu mir gesagt. Deshalb hier noch mal ganz offiziell: «Mama, du hast alles richtig gemacht! Wir haben dich lieb!»
Und das schlechte Gewissen meiner Mama hatte auch durchaus Vorteile: Es machte sich nämlich immer besonders an Weihnachten bemerkbar. Natürlich zu unseren Gunsten. Denn unsere Wunschzettel konnten noch so lang sein, die Wünsche darauf noch so teuer, die Gewissensbisse saßen tief genug, dass wir immer alles bekommen haben. Nach einem regelrechten Geschenkpapiermassaker, das mit diversen «Cool», «Geil» und «Wahnsinn» kommentiert wurde, standen wir dann völlig reizüberflutet vor unserem Berg aus Geschenken und wussten gar nicht, ob wir jetzt zuerst die Carrera-Bahn aufbauen oder mit dem Harry-Potter-Zauberstab im Punsch rühren sollten.
Meine Mama konnte auch deswegen nicht weniger arbeiten, weil uns unser Papa niemals ausschließlich mit der Landwirtschaft hätte ernähren können. Unser Bauernhof ist im Vergleich zu heutigen Betrieben sehr klein und nicht mehr zeitgemäß. Zudem sind wir mitten in der Ortschaft eingezwängt, sodass es keine Möglichkeit gibt, den Hof zu erweitern. Vor vielen Jahren stand mein Papa vor der Entscheidung, auszusiedeln und außerhalb des Ortskerns einen neuen Hof zu errichten. Neben den finanziellen Mitteln fehlte aber auch der Wille meiner Oma, und deshalb wurde das Vorhaben schnell wieder im Keim erstickt.
Meine Oma und meine Tante waren von Kindesbeinen an ein unzertrennliches Gespann.
Meine Oma ist Jahrgang 1925 und die älteste von drei Schwestern. Sie war erst fünf Jahre alt, als ihre Mutter an einer schweren Lungenkrankheit starb. Obwohl sich der Vater rührend um seine drei Töchter kümmerte, musste meine Oma schon früh die Verantwortung für ihre zwei jüngeren Schwestern übernehmen. Sie schlüpfte unweigerlich in die Rolle der fehlenden Mutter und Bäuerin. Eine Ausbildung oder gar ein eigenständiges Leben fern des Hofs kam für sie daher nie infrage. Neben der damals noch aufwendigen Hausarbeit musste sie zusätzlich ihrem Vater von morgens bis abends auf dem Bauernhof zur Hand gehen. Eine richtige Kindheit war ihr nicht vergönnt, und ich hatte oft den Eindruck, meine Oma lebte in einem aus Arbeit bestehenden Tunnel, den sie lediglich am Sonntag für den Gottesdienst kurzzeitig verließ.
Sie war vierzehn Jahre alt, als der Zweite Weltkrieg begann, und zwanzig Jahre, als er endete. Wir haben nie viel über diese Zeit gesprochen. Unterbewusst trug sie aber sicher viel mit sich herum, was hin und wieder völlig unerwartet zum Vorschein kam. Meine Cousine erzählte mir mal, dass meine Oma eines Tages von jetzt auf gleich alle Stammbäume und Ariernachweise, die sie zufällig auf dem Dachboden gefunden hatte, im Hof auf einen Haufen warf und anzündete. Auf die Frage meiner Cousine, was denn hier gerade vor sich gehe, meinte meine Oma nur wutentbrannt: «Doads des Glump weg!» Zudem erzählte sie mir mal, dass sie sich geweigert hatte, dem Bund Deutscher Mädel beizutreten, was im Dritten Reich mehr oder weniger den Ausschluss aus dem gesellschaftlichen Leben bedeutete. Die meisten Ausflüge und Veranstaltungen wurden in dieser Zeit vom BDM organisiert, außerdem machte sich die Mitgliedschaft gut im Lebenslauf, und man wurde bei Stellenausschreibungen bevorzugt behandelt. Meine Oma jedoch hat sich zeit ihres Lebens nicht verbiegen lassen, egal, wie viele Vorteile sie davon gehabt hätte.
So schrecklich der Zweite Weltkrieg auch war, er brachte meiner Oma die große Liebe. Es war ein Jugoslawiendeutscher namens Martin Frank, ein Flüchtling also, der ihr Herz eroberte. 1946 musste er im Alter von 23 Jahren zusammen mit seiner Mutter aus Serbien fliehen, und das Schicksal verschlug sie nach Niederbayern. Genauer gesagt nach Wotzmannsdorf, in ein kleines Dorf in unserem Gemeindegebiet. Beide wurden auf einem Hof aufgenommen. Zur damaligen Zeit, also der Zeit vor Mähdrescher und Maschinenring, haben sich die Bauern noch gegenseitig bei der Arbeit unterstützt, anders wäre sie wohl auch nicht zu bewältigen gewesen. So kam es, dass mein Opa auch irgendwann auf dem Hof der drei alleinstehenden Schwestern stand und sich in meine 21-jährige Oma verschaute. Mein Opa musste meine Oma wirklich vergöttert haben. Anders hätte es vermutlich auch nicht funktioniert, denn er übernahm ja mit ihr nicht nur den Hof, sondern er heiratete zusätzlich ihre beiden Dauersingle-Schwestern, die mit im Haus wohnten.
Das war aber wahrscheinlich auch der Grund, warum die Wochenenden bei ihm ziemlich durchgetaktet waren. Meistens ging es schon freitags nach der Stallarbeit entweder zum Kegelscheiben, zu den Schützen oder zur Feuerwehr. All das, wofür der Freitagabend zu kurz war, wurde auf den Samstag gelegt. Sonntags ging es nach der Stallarbeit erst in die Kirche und anschließend zum Frühschoppen. Während meine Oma, ihre Schwestern und die vier Kinder am Sonntag um Punkt halb zwölf zu Mittag aßen, kam mein Opa irgendwann am frühen Nachmittag nach Hause und aß alleine sein Mittagessen. Es dauerte aber nie lange, bis sich meine Oma ganz sehnsüchtig zu ihm setzte und über den neuesten Klatsch und Tratsch informiert werden wollte. Und mitreißend erzählen konnte er.
Nicht selten war er sogar selbst Bestandteil des Dorfratsches. Noch heute, wenn ältere Dorfbewohner anfangen, mir von meinem Opa zu erzählen, beginnen die Geschichten fast immer mit: «Mei, dei Opa, des war oana!» Zum einen war er wohl ein wahnsinnig hilfsbereiter Mensch. Da konnte mitten in der Nacht im schlimmsten Schneegestöber ein Anruf kommen, weil ein Freund irgendwo mit dem Auto stecken geblieben war, und mein Opa sprang auf und tuckerte mit seinem Traktor los. Zum anderen war er sich für keinen Scherz zu schade. Die Legende besagt, dass er mal eine Wette verloren und als Wetteinsatz augenzwinkernd einen Wirtshausbesuch mit einem seiner Kaltblüter angeboten hatte. Obwohl das alle für einen Witz hielten, stand sein Ross kurze Zeit später wiehernd im Foyer der Brauereigaststätte, und mein Opa – hoch zu Pferd – meinte nur trocken: «Mia dadn gern wos bestellen!»
1972 starb seine Mutter – also meine Urgroßmutter. Zu ihr hatte er von jeher eine sehr enge Bindung. Die Flucht aus Serbien, der Verlust des eigenen Hofes und der gemeinsame Neuanfang in der neuen Heimat in Niederbayern hatte die beiden erst recht zusammengeschweißt. Es heißt, vom Tod seiner Mutter habe er sich nie mehr richtig erholt. Nur drei Jahre später erlitt er während der Stallarbeit einen Schlaganfall und verstarb kurze Zeit später, erst 52-jährig, im Krankenhaus.
Das Dorf war erschüttert von seinem frühen Tod. Die Predigt bei seiner Beerdigung begann der Pfarrer damals mit den Worten: «Hutthurm ist nicht mehr das, was es einmal war. Martin Frank ist nicht mehr unter uns!» Und so stand meine Oma kurz vor ihrem 50. Geburtstag wieder alleine da. Meine Großtante meinte einmal zu mir: «Seit dem Tag hab i unser Kathe nimma singa ghead!»
1926, ein Jahr nach meiner Oma, wurde die mittlere Schwester Maria geboren. Sie wurde liebevoll «s’Maral» genannt. Leider starb sie schon, als ich ein Jahr alt war, und deshalb kenne ich sie und ihr schicksalhaftes Leben nur aus Erzählungen. Als junge Frau war sie verlobt, aber ihr Lebensgefährte fiel im Zweiten Weltkrieg. Von diesem Schlag erholte sie sich nie mehr. In der Zeit danach schlief sie jede Nacht bei ihrer ebenfalls alleinstehenden Schwester Anni im Bett, sie wollte ihren nächtlichen Dämonen wohl nicht allein begegnen. Hin und wieder ertränkte sie ihren Schmerz im Alkohol. Dann schlich sie im weißen Nachthemd und mit etlichen Promille im Blut durchs Haus, stellte sich vor das Bett meiner großen Schwester Bianca und riss sie mit den Worten «Huh! I bin a Geist!» aus dem Schlaf. Darauf antwortete meine damals 17-jährige Schwester stets sehr nüchtern: «Maral, du bist koa Geist, du bist wieder bsuffa!», und brachte sie zurück in ihr Bett.
Die jüngste der drei Schwestern, meine Großtante Anni, wurde 1927 geboren. Sie war Schneiderin und so geschickt, dass sie nicht nur die Kleidung für die ganze Familie nähte, sondern für viele Damen im Dorf sogar die Brautkleider. Nur eines für sich selbst nähte sie nie. Ich kenne meine Großtante nur alleinstehend, und nach dem Tod ihrer Schwester Maria schlief sie in einem winzigen Bett, das auch einer Klosterschwester hätte gehören können. Dabei weiß ich, dass sie stets verschiedenste Verehrer hatte, nur scheinbar immer die falschen. Einmal fuhr ein kleiner Mann aus Kalteneck – einem Ortsteil unserer Gemeinde – an einem Sonntag in unseren Hof. Man sah ihm an, dass er sich extra in sein schickstes Outfit geschmissen hatte. Als meine Großtante das Auto in den Hof rollen sah, rief sie ihren Nichten zu: «Wenn der zur Tür reinkommt, i bin ned da!», und verschwand in ihrer Nähstube. Wenige Augenblicke später stand ihr Verehrer auch schon im Hausflur und fragte ganz vornehm: «Is denn des Fräulein Gruber da?» Meine Tanten verneinten wie befohlen, und der kleine Galan ging enttäuscht wieder seines Weges. Und so hat es bis zum Schluss nie ein Mann geschafft, meine Großtante aus ihrer Nähstube in sein Herz zu holen.
Dafür war sie immer ungebunden und konnte auf