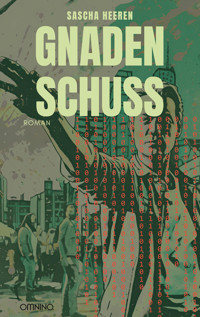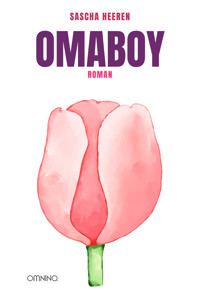
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Omnino Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Es mochte der Eindruck entstehen, sie läge einen bedächtigen und intensiv ausharrenden Akt des Entkleidens hin. Die Wahrheit war jedoch, dass sie weder zeitschindend noch erotisch handelte. Sie konnte sich einfach nicht schneller ausziehen. Nicht nur der Spiegel neben dem Bett verriet ihr Alter – warum sollte sie dann ablegen können wie ein junges Ding?“ Inge und Jens sind Geschäftspartner. Sie ist 73, er halb so alt, arbeitslos und ihr Zuhälter. Dass er in dieser Hinsicht keine Erfahrungen vorzuweisen hat, weder als Arbeitsloser noch als Lude, hält ihn nicht davon ab, ihr zu helfen. Denn auch Inges bisheriger Lebensweg ist alles andere als einschlägig für diesen Bereich. Doch für sie gilt irgendwann: Konto leer, Leben leer. An genau diesem Punkt endet die Freiwilligkeit. Selbstbestimmung wird unbezahlbar. Weder Inge noch Jens beginnen ihren steinigen Pfad in die Prostitution freiwillig. Das Leben gerät aus den Fugen. Die Daseinsberechtigung bröckelt, und schon schwinden die Optionen. Die Abzweigungen werden übersichtlich, undenkbar. Dann heißt es: Finde einen Weg und mache ihn zu deinem. „Omaboy“ skizziert die Grundfesten unseres Seins und deren Erosion. Prostitution im Alter? Allein diese Frage bringt unsere Wertvorstellungen ins Wanken. Aber was tun, wenn die Optionen immer spärlicher werden? „Omaboy“ ist ein eindringlicher Roman, der die Fragilität unserer Existenz mit zunehmendem Alter thematisiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Omaboy
Impressum
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN: 9783958943179
© Copyright: Omnino Verlag, Berlin / 2024
Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen und digitalen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten.
Inhalt
Liebe Leserin, lieber Leser
Ein Tagtraum oder: Keine Zeit zum Explodieren
Prolog – Einsammeln, absetzen, zurückfahren
Hinterlassenschaften
Einsturzgefährdete Decken
Ein neues Kapitel, ob du willst oder nicht
Beine breit
Das Zeug dazu haben
Ein Familiendienst
Wie eine Schnapspraline
Blutig gepflockt und erschrocken
Wiedergutmachung
Der Geschäftsmann
Nicht viel verlangt
Kein Spaß
Wenn auch in Eile
Innen und Außen
Nicht sofort sterben oder: Keiner redet hier vom Töten
Appetitanregende Dinge
Hi, my name is …
Die erste Platte des Büfetts
Robuste Natur
Greifbare Bilder
Bock und Gärtner
Der Unfallbeauftragte
Ein Heißgetränk, das an Urin erinnert
Zum Glück
Epilog – Klarschiff
Liebe Leserin, lieber Leser,
das Geschehene, das ich mit den folgenden Seiten versuche zu schildern, ergibt sich – wie beinahe alles im Leben – nicht nur durch ein einziges Paar Brillengläser. Nicht aus einer einzelnen Perspektive. Da mir naturgegeben allein meine eigene zur Verfügung steht und diese selbstverständlich nur einen Teil des Ganzen erleuchten kann, habe ich mir erlaubt, hier auch andere Blickwinkel anzunehmen. Nicht aus künstlerischem Drang, sondern aus der Verpflichtung zur Vollständigkeit heraus. Vor dem Hintergrund der ganzen Geschichte mag es anmaßend scheinen, dass ich aus Inges Perspektive schildere, wo ich doch nicht weiter von ihrer Sichtweise, der einer Frau, entfernt sein könnte. Habe ich die gleichen Eingriffe erleben müssen wie sie? Und wenn, stand nicht auch hier eine naturgemäße Unvergleichbarkeit im Raum? Doch ich versichere, ich tue dies nicht, um es mir einfach zu machen oder eine Version zu schaffen, die es meinem Weltbild nicht allzu schwer macht. Ich spreche nicht mit Inges Stimme, um besser schlafen zu können. Ganz im Gegenteil, ohne Inge gäbe es diese Geschichte schlichtweg nicht, und damit auch keine Wahrheit. Und ohne Wahrheit bliebe von all dem, was uns widerfahren ist, nichts. Da ich allerdings keineswegs so selbstlos bin und hier schreibe, wie an dieser Stelle der Anschein entstehen könnte, sage ich Ihnen: Für nichts ist einfach zu viel geschehen. Kunst hin, Vollständigkeit her. Am Ende bleibt mir nur, gerade auch Inges Sicht zu schildern und im gleichen Atemzug zu bitten, auf meine gewissenhafte Sorgfalt zu vertrauen, wenn auch nur auf die eines Mannes.
Inge ist doppelt so alt wie ich, und doch hat uns die gemeinsame Zeit in einer Art und Weise zusammengeschweißt, dass Alter und Geschlecht zur Nebensache geworden sind. Allein dies hier zu schreiben, lässt mich wieder einmal spüren, wie wenig präsent ihr Alter in all der Zeit und bei all unseren Aktivitäten war. Aber genau darin liegt und lag auch stets die Gefahr – der ich mir vielleicht erst jetzt richtig bewusst werde. Wie muss sich dieser Mensch, so ganz anders als ich, gefühlt haben? Eine Frau in ihrem Alter, in ihrer Situation? Wenn ich es damals nicht wusste oder leichtsinnig abtat, mag das mein jugendlicher Leichtsinn erklären – auch wenn er es immer nur gut meinte. Aber jetzt, nach dem, was war, was geschah, darf einfach nichts Jugendliches und Leichtsinniges mehr am Steuer sitzen. Ob ich es heute besser weiß, da bin ich mir nicht sicher. Umso mehr weiß ich, dass Inges Perspektive mein ganzes Bemühen und meine größte Anstrengung verdient. In diesem Sinne ist jedes Urteil, was Sie sich nun über das Geschehene und mich bilden, erlaubt.
Ihr Jens Probst
Ein Tagtraum
oder: Keine Zeit zum Explodieren
Ich habe Kaffee aufgesetzt. Es dauert nur noch wenige Minuten. Nicht dass es zu meinen Aufgaben gehören würde, Kaffee zu kochen. Ich habe studiert. Ich mache es also nebenbei. Die Maschine arbeitet in den letzten Zügen. Es dauert nur noch wenige Sekunden. Ich koche nebenbei, und es macht mir absolut nichts aus. Ich trinke das Zeug selbst. Abgesehen davon würden meine Kollegen meinem Chef den Vogel zeigen, und das auch nur, weil es schneller geht, als den Mittelfinger in Stellung zu bringen. Der Kaffee ist fertig, und ich habe ihn aufgesetzt. Die Zeit ist um.
Freundlicherweise hat mein Chef seine Tasse gleich neben die Maschine gestellt. Erspart mir einen Weg. Ich fülle seinen Becher. Lasse noch ein wenig Platz, den ich mit dem üblichen Schuss Milch abrunde. Zucker nimmt er nicht. Fast nie. Nur spätabends, wenn er bereits seit mehr als zwölf Stunden wild gestikuliert hat und dabei jedem seiner Mitarbeiter tierisch auf die Nüsse gegangen ist. Auch jedes Mal, wenn er sein Büro verlässt und pfeifend über den Flur schlendert, dabei den Habt-ihr-nichts-zu-tun-Blick parat. Nur dann nimmt er spätabends noch Zucker.
Ich greife mir seine Tasse und meinen Sprengstoffgürtel. Beide sind gut. Den einen habe ich gekocht, den anderen nicht von der Stange. Das ist tatsächlich Maßanfertigung. Qualität. Nicht vom Laden um die Ecke. Der Gürtel trägt sich bequem, auch die Schulterriemen schnüren nicht unter dem Gewicht der C4-Blöcke ein. Die kleinen Täschchen mit den Metallkügelchen verursachen keinen unangenehmen Druck auf der Haut. Zumindest noch nicht. Meine vorherige Weste hatte Nägel und Schrauben eingenäht. Auf Dauer nervt dieses Stechen. Die Spitzen finden immer irgendeinen Weg durch den Stoff. Dann stecken sie in der Haut. Unschön, gerade die roten Flecken.
Ich klopfe. Ich warte. Dann öffne ich, denn wir sind ein offener Haufen. Da gibt es keine verschlossenen Türen. Ich warte nur so lange, damit mein Chef die Chance hat, den Finger aus der Nase zu nehmen. Ich verharre zwei Meter vor seinem Schreibtisch. Er würdigt mich keines Blickes und sagt: „Herein!“ „Ihr Kaffee“, sage ich, aber er schaut noch immer nicht von seinem Bildschirm auf. In diesem Moment bin ich froh, die blinkende Variante ausgewählt zu haben. Sie macht was her. Eine rote, eine gelbe und eine grüne LED-Leuchte blinken abwechselnd an meinem Sprengstoffgürtel. Erinnern an die Windschutzscheibe eines Trucks und sind so angebracht, dass der Betrachter, wenn er den Lämpchen folgt, einmal quer über das gesamte C4-Sortiment geführt wird. Mein Chef sieht sie nicht. Schade eigentlich, aber egal. Ich denke, die Investition hat sich trotzdem gelohnt, auch wenn die Beleuchtung nur Show ist.
In der Rechten den Totmannschalter, reiche ich mit der Linken den Milchkaffee rüber. Erst jetzt nimmt er mich wahr. Seine Blicke wandern vom Monitor zum Becher. „Vielen Dank“, sagt er. Jetzt bestaunt er auch meine neue Weste. Rot, gelb, grün. Er folgt den Wegweisern. „Keine Ursache“, sage ich. Ich meine es auch so. Das hätte doch jeder getan. Jeder an meiner Stelle. Jeder in der Abteilung. Plötzlich öffnet sich die Tür hinter mir. Es hat vorher nicht geklopft. Die Tür fliegt förmlich auf.
Soll es das jetzt tatsächlich gewesen sein? Ich erinnere mich, wie mich der Verkäufer beglückwünschte. Zu meinem Gespür für Qualität. Ich hatte Hilfe, entgegnete ich und verwies auf das Preisschild. „Qualität hat halt ihren Preis“, räusperte er sich, aber es war kein verlegenes Räuspern. Es war ein ehrliches, ein stolzes. „Sie müssen sich immer vor Augen halten, dass ein preisgünstiges Exemplar ohne Frage seinen Zweck erfüllen wird – die sind alle geprüft –, aber ob Sie damit glücklich werden? Das steht auf einem anderen Blatt. Es zwickt hier. Es quetscht da. Das ist bei Klamotten nicht anders. Wer billig kauft, kauft zweimal, sagt man doch, nicht wahr? Wenn Sie sich also nicht sicher sein sollten, dann sparen Sie nicht am falschen Ende. Womöglich verlieren Sie noch Ihr Gesicht. Und das ist doch das Letzte, was man will.“
Die Tür zum Büro meines Chefs steht sperrangelweit offen. Die Vorzimmerdame, die mich vor circa dreißig Sekunden noch gequält angelächelt hatte, stürmt mit feuerrotem Schädel und einer leicht feuchten Stirn an mir vorbei. Sie hat was vor. Ihre Augen fixieren den angefetteten Oberkörper unseres Chefs. Er schlürft seinen ersten Schluck und nickt wohlwollend. Sie erinnert mich an diese Selbstmordattentäter, die bereits seit Minuten durch selbstbestimmtes Gebrabbel versuchen, sich in den Tatendrang zu wiegen. Aber sie hat bloß ein Messer dabei. Bloß ein Messer. Es betreten zwei weitere Figuren das Büro. Sie haben mehr als nur Messer dabei. Zwei Pistolen. Noch bevor die Dame den Schreibtisch unseres Chefs erreichen könnte, macht ein Teil ihrer Schädelinnenseite vor, was dem Rest ihres schmächtigen Körpers verwehrt bleiben wird.
Ein Traum, oder?
Prolog
Einsammeln, absetzen, zurückfahren
Inge hat gute Arbeit geleistet. Gute Vorarbeit, wenn man es genau nimmt. Der alte Siebensitzer ist voll, heißt also abzüglich Fahrer und Lockvogel: fünf zahlende Gäste.
Ich habe mir den Ausdruck Gast angewöhnt, denn Kunde hört sich zu distanziert an. Was hier geschieht, bedeutet die wortwörtliche Überschreitung von Grenzen. Sie dringen in dich ein. Passieren deine Linie. Natürlich mit deiner freundlichen Einladung, aber letztlich nur durch Euros legitimiert. Eure Verbindung, ihr Eindringen in dich, liegt also irgendwo zwischen Kunde und Fremder, zwischen höflich und unverschämt, zwischen Distanz und Überschreitung deiner höchstpersönlichen Grenze. Es geht in dich hinein. Es gibt keine persönlichere Form, deine Schwelle zu überschreiten.
Ich finde, Gast liegt irgendwie dazwischen, ohne zu verdrängen, dass es letztendlich doch nur um Geld geht. Selbst ein Hotelgast wird – zumindest in den Hotels, die auf wiederkehrende Kundschaft bauen – von allen Seiten gehegt und gepflegt, in aufopferungsvoller Weise und unter Wegfall der eigenen Grenzen. Allerdings bekommt niemand ein schlechtes Gewissen, wenn am Ende die ehrlichste aller Fragen im Raum steht: Zahlen Sie bar oder mit Karte?
Ich stelle diese Frage schon im Auto. Es ist eigentlich keine Frage, es ist vielmehr ein organisatorischer Hinweis. „Bitte zahlen Sie direkt auf dem Zimmer. Wir akzeptieren nur bar“, sage ich auch dieses Mal. Zum zweiten Mal heute.
Vormittags schafft es ein Fahrer, je nach Berufsverkehr und Schulferien, eine Wagenladung hin- und zurückzukutschieren. Nachmittags ebenfalls eine. Letztlich steht und fällt jedoch der Abfahrtsplan mit dem Tempo, in dem der Wagen mit Gästen gefüllt wird. Wir fahren erst, wenn wir voll sind – oder zumindest sehr nahe daran. So lautet die Regel.
Inge ist ausgestiegen. Die fünf Herren verlassen ebenfalls das Auto und folgen ihr unsicher. Mancher macht den Eindruck, schon mal hier gewesen zu sein. In diesen Gesichtern geht mit jedem Schritt näher ein wachsendes Lächeln auf, sie schauen sich nicht wie ertappte Jungs um. Der Weg vom Wendehammer zum Reihenendhaus dauert nur wenige Sekunden. Dann ist die Meute im Hauseingang verschwunden.
Eine dritte Runde werde ich nicht mehr schaffen, auch wenn es erst kurz nach Mittag ist. Diese Wagenladung – eine nicht zu verachtende und selten genug vorkommende Fünferpackung – will auch erst mal abgearbeitet werden. Dafür wird jeder benötigt. Inge ist jetzt im Haus gefragt. Ich parke also den Wagen, bereite alles für den morgigen Einsatz vor und tapere dann selbst ins Reihenhaus.
Wenn ich der Fahrer bin, was noch immer vorkommt, dann macht Kadim die Ansage im Haus. Meist in der Küche. Fünf Gäste finden problemlos einen Platz in dem kleinen Raum, der je nach Tageszeit nach Kaffee oder Eintopf riecht. Wir haben auch einen kleinen Hocker. Der ermöglicht es, allen direkt in die Augen zu schauen. Von oben herab. Ich parke also das Auto, und Kadim bläut unsere Grundregeln ein. Edith, Ursprung des Kaffee- oder Eintopfgeruchs, verlässt mittlerweile nicht mal mehr die Küche, wenn unser kleines Einmaleins an die Gäste verteilt wird.
Die Küche ist ein guter Platz. Entscheidender Vorteil: Es glotzt dir keiner rein. Anders als im Auto, wenn du als Fahrer versuchst, dich umzudrehen, um allen tief in die Augen zu schauen. Als wir Kadim noch nicht hatten, erklärte ich den Jungs auf genau diese Weise, worauf es ankommt. Wir saßen also nicht nur in der Siedlung auf dem Präsentierteller, ich verdrehte mir auch äußerst ungünstig das Kreuz.
„Lassen Sie mich noch das ein oder andere loswerden, auch wenn Sie uns vielleicht schon mal beehrt haben“, sagte ich. Am Blick erkannte ich, ob sie zum ersten Mal in diesem Auto saßen oder doch schon gedanklich in bereits Bekanntem versinken. „Nicht alle von Ihnen sind mehr die Jüngsten. Es knirscht und drückt also nicht nur in Ihrem Gebälk, auch unsere Damen haben vielleicht schon die ein oder andere Schramme, Lackschaden oder den ein oder anderen Achsenbruch erlitten oder stehen diesem deutlich näher als eine gelenkige Mittzwanzigerin. Sie steigen hier also nicht in einen Neuwagen oder einen jungen Gebrauchten, sie schlüpfen in einen Oldtimer. Ich erwarte nicht von Ihnen, dass Sie mir nach der Probefahrt einen Neuwagen auf dem Hof abstellen, aber einen gut in Schuss gehaltenen Oldtimer, wie er Ihnen anvertraut worden ist.“ Ich finde den Vergleich mit Autos passend. Da sitzen Männer vor dir. Das verstehen die eher, als wenn du denen mit Oberschenkelhalsbrüchen kommst. Oder mit verminderter Beckenelastizität. Dass man ein Auto nicht aus dem Kalten heraus in den roten Drehzahlbereich bringt, ist jedem klar. Deshalb stellen wir ja auch genügend Zeit zur Verfügung. Benutz das Autobeispiel, habe ich zu Kadim gesagt. Du musst erklären, was geht und was nicht. Nimm das Oldtimer-Beispiel. Ich glaube, er tut es nicht. Ich habe es ein paar Mal versucht, doch jedes Mal hat er nur die Stirn gerunzelt. Aber das Wichtigste bringt er rüber. Immer und jedes Mal wieder.
Ich betrete das Reihenhaus. Nach dem kleinen Eingangsbereich folgt sofort die Küchentür auf der linken Seite. Sie ist verschlossen, also ist Kadim noch bei seinen warmen Worten. Ich öffne die Tür, und neben seiner Stimme schlägt mir der Kaffeegeruch in die Nase. Ich schleiche mich rein, an den lauschenden Herren vorbei, und direkt neben Edith bleibe ich mit unwiderstehlichem Lächeln stehen. Sie versteht mich und reicht mir einen Becher Kaffee. Dann drehe ich mich wieder zu den Gästen, und meine Miene versteinert sich.
„Stopp heißt Stopp“, sagt Kadim. Er braucht keinen Hocker, um einen Kopf über seiner Zuhörerschaft zu thronen. Sein Blick trifft jeden. Zieht selbst mich in seinen Bann. Diese tiefe Stimme, die dunklen Augen. Zudem hat er ein Kreuz so breit wie Edith und ich zusammen – damit kaum in der Lage, diese Ansprache im Auto abzuhalten – und einen Türsteherblick, der seinesgleichen sucht. Erst durch Kadim haben Inge und ich verstanden, wie „Stopp heißt Stopp“ auch durch Körpersprache eindrucksvoll untermalt werden kann.
Edith räumt das Geschirr vom Vormittag in die Spülmaschine. „Jeder soll hier auf seine Kosten kommen, aber wie schon gesagt, benehmen Sie sich Ihrem und dem Alter der Damen entsprechend“, sagt Kadim. Noch immer huscht kein Lächeln über seine Lippen. Er ist Profi. „Für diejenigen von Ihnen, die heute zum ersten Mal hier sind: Sie werden gleich in den Aufenthaltsraum geleitet. Dort warten Sie. Mit Kaffee, Tee oder auch Kaltgetränken wird Sie unsere Edith, hier hinter Ihnen, versorgen.“
Alle drehen sich zu Edith. Sie lächelt freudestrahlend. „Sie haben auch die Gelegenheit, sich dort einen Überblick über unser Angebot zu verschaffen. Die Damen, die für Sie frei sind, werden sich bei Ihnen im Aufenthaltsbereich einfinden. Sie entscheiden, mit wem Sie die nächste Stunde verbringen werden. Nichts unter einer Stunde. Die Zeit beginnt, wenn sie auf dem Zimmer sind und endet mit Verlassen. Klar soweit?“ Ein einstimmiges Grummeln bildet sich in der kleinen Küche. „Gut, dann hole ich Sie in wenigen Sekunden ab.“
Kadim verlässt die Küche. Wie immer prüft er, ob alles im Wohnzimmer vorbereitet ist. Ob alles eingedeckt und nichts mehr von der letzten Runde zurückgeblieben ist. Diskretion steht für uns an oberster Stelle. Ordnung natürlich auch.
„Meine Herren“, richte ich nun das Wort an die fünf, „hat Ihnen unser Kadim von den Oldtimern erzählt?“ Mehr als ein unsicheres Gemurmel schlägt mir nicht entgegen. Ich nehme einen Schluck von meinem Kaffee. Ich bin nicht überrascht. Ich erzähle ihnen also meine Oldtimer-Geschichte. Eine Kurzversion. „Da Sie nun alle auch Kadim persönlich kennenlernen, seine Qualitäten begutachten konnten“, sage ich, „ist mir wichtig, Folgendes zu betonen: Alles, was Sie meinen Oldtimern antun, tut Ihnen im Anschluss auch Kadim an. Steigen Sie also ein und treten unangemessen auf die Tube, steigt Kadim bei Ihnen ein und tritt bei Ihnen unangemessen auf die Tube. Achten Sie also stets auf den Drehzahlbereich.“
Ich wünsche den Herren viel Spaß. Meine Drohung klingt auch weniger bedrohlich, als man jetzt meinen könnte. Würde dies Kadim zu jemandem sagen und man kennt ihn nicht, man würde sich vermutlich einnässen. Aber ich? Ich versuche, die Gäste mit einem zwinkernden Auge zu erreichen. Sie auf die bestehende Harmonie hinzuweisen. Die wir unbedingt erhalten wollen.
Ich wünsche meinen fünf richtig viel Spaß und übergebe an Kadim, der mich freundlicherweise zuerst durch den Türrahmen huschen lässt, bevor er ihn völlig vereinnahmt. Es knarzt über mir. Die drei von der vorherigen Tour kommen die Treppe aus dem Obergeschoss herunter. Ich weise wortlos den Weg in den Eingangsbereich. Der Aufenthaltsraum ist für sie tabu. Kein Kontakt zwischen den Gruppen. Nur innerhalb. Sie sehen zufrieden aus, still und in sich gekehrt, aber mit einem seichten Lächeln. Ich stehe mit ihnen in unserem Flur und schaue auf die Uhr. Es ist Abfahrtszeit. „Meine Herren“, sage ich, „ich darf Sie zum Auto geleiten. Unser Fahrer wartet schon. Ich hoffe, es war alles zu Ihrer Zufriedenheit?“ Natürlich weise ich mehrmals darauf hin, dass sie uns doch bitte bald wieder beehren mögen. Ich versuche, so wenig wie möglich als Bittsteller rüberzukommen.
An vieles musste ich mich erst gewöhnen. Kommst du nicht aus diesem Bereich oder hattest nie etwas mit diesem Geschäftsmodell zu tun, dann kannst du dir nichts, wirklich gar nichts gedanklich ausmalen. Es gibt Dinge, die treffen dich unvorbereitet. Was ist, wenn … Erst in der Situation erkennst du, dass ein solcher Was-ist-Fall eingetreten ist. Dass du mittendrin steckst. Welche Form von Smalltalk führst du mit deinen Mitarbeiterinnen? Andere überschreiten ihre Grenzen, darfst du das auch? Mit Sicherheit: nein. Aber welche Fragen gehen bereits zu weit? Fragst du: Und, wie war’s?
Du gehst mit drei Freiern im Schlepptau zu deinem Fahrer, aber worüber unterhältst du dich? Welche Form von Smalltalk führst du mit deinen Gästen? Und ja, es ist sehr gewöhnungsbedürftig. Gerade waren Sie noch in schweißtreibender Grenzüberschreitung mit deinen Mitarbeiterinnen am Machen, nun trotten sie befriedigt neben und hinter dir her. Gedanklich liegen sie für dich immer noch auf Inge oder verkrampfen sich hinter Maggi. Während also im Reihenhaus andauernde Routine herrscht, die Vorbereitungen für die nächste Runde laufen und sich die Typen neben dir bereits aufs Mittagessen freuen und überlegen, was denn heute auf dem Plan steht, laufen bei dir noch vergangene Bilder ab. Du bist noch mittendrin, dabei warst du gar nicht dabei.
Ich sage, dass das Wetter in den letzten Wochen recht stabil war, und erkundige mich, was denn heute auf dem Speiseplan steht. Holst du sie aus dem Heim ab, frag nach dem Speiseplan. Kohlroulade, so die beiden Älteren. Einer der beiden hält es aber für unwahrscheinlich, dass sie um diese Uhrzeit noch eine ordentliche, komplett mit Kohl ummantelte Roulade bekommen. Ein zerfledderter Rest entspricht wohl eher der Realität. Wie die Tiere, bestätigt der andere Alte. Er klopft mir auf die Schulter und sagt: „Gegen das, was uns gleich auf dem Teller erwartet, sind Ihre Mädels knackiges Gemüse, mein Junge.“
„So soll es sein“, sage ich. Vermute ich. An manche Gespräche gewöhnt man sich nur schwer. Zudem irritiert es selbst mich, wenn jemand meine Oldtimer als Mädels bezeichnet. Der Jüngere der drei, vielleicht Ende fünfzig, wird mit einem Bäcker am Bahnhof vorliebnehmen.
Wir setzen sie dort ab, wo wir sie eingesammelt haben. Dankbar nehme ich unseren Chauffeur wahr, der dieses Versprechen umsetzen wird. Der kurze Plausch zwischen Parkplatz und Reihenhaus hat ein Ende. Der Motor läuft. Der Fahrer wirft seine Kippe aus dem heruntergelassenen Fenster. Die vorletzte Fuhre rollt für diesen Nachmittag. Meine fünf wird er danach, in circa einer Stunde, wieder zurückfahren.
*
„Wir setzen sie dort ab, wo wir sie eingesammelt haben“, hatte ich zu Andi beim offiziellen Vorstellungsgespräch gesagt. Damit war seine Aufgabe klar umschrieben. Zu dem Zeitpunkt kannte ich Andi nur vom Arbeitsamt her. Nicht gut, aber zumindest so gut, wie sich zwei Menschen im Wartebereich einer Behörde kennenlernen können. Und übers Hörensagen.
Inge bat ihn herein, begrüßte ihn herzlich und führte ihn ins Wohnzimmer, wo ich ihn in Empfang nahm. Auch wenn es sein Vorstellungsgespräch war, so war mir die Anspannung sichtbar ins Gesicht geschrieben. Er machte einen coolen und unnahbaren Eindruck. Nichts Neues für mich. Vielleicht war ich deshalb auch aufgeregt. Wir saßen uns am Esstisch gegenüber, als Inge verschwand und den Kaffee aus der Küche holte. Ansonsten war alles akkurat eingedeckt.
„Hier ist es also?“, brach Andi das Schweigen. Es lastete ein Druck auf mir, als säße ich wieder auf dem Arbeitsamt.
„Was?“, fragte ich. Im ersten Moment verstand ich es nicht, obwohl es glasklar war.
„Hier macht ihr es also?“
„Nein“, sagte ich, „nicht hier. Ein paar Häuser weiter. Du kannst auch von der anderen Seite in die Siedlung fahren. Da ist so eine Sackgasse mit Parkplätzen und so.“
„Ein Wendehammer“, sagte Andi.
Inge kam mit dem Kaffee rein: „Ja, ein Wendehammer. Nehmen Sie Milch oder Zucker zu Ihrem Kaffee?“, fragte sie. Andi schüttelte den Kopf.
„Direkt am Wendehammer liegt das Reihenendhaus“, erklärte ich weiter.
„Und das ist es dann?“
Inge setzte sich neben mich. „Ja, kurze Fluchtwege, wenn Sie verstehen.“ Sie lächelte ihn verschmitzt, aber konzentriert an, ihre Blicke versuchten, in möglichst kurzer Zeit viel von ihm zu erfassen.
„Schnell rein, schnell wieder raus“, sagte Andi.
„Wir verstehen uns“, erwiderte Inge. „Und Sie wollen für uns arbeiten?“, legte sie unverblümt nach.
„Na, Sie kommen ja schnell zur Sache.“
„Schauen Sie mich an, in meinem Alter konzentriert man sich aufs Wesentliche“, sagte sie.
„Warum machen Sie das?“
„Warum sitzen Sie hier und wollen einen Job? Ich vermute mal, es ist bei Ihnen nicht anders als bei mir oder Jens, oder?“
„Ich sitze hier“, sagte Andi, „weil Jens meinte, Sie beide brauchen noch Unterstützung.“
Während sich bei mir innerlich der Wunsch ausbreitete, Andi die Stelle schmackhaft zu machen, verharrte Inge wie ein Fels in der Brandung. „Ja, wir benötigen Unterstützung. Sie sind aber wohl nicht nur hier, weil Sie ein herzensguter und hilfsbereiter Mensch sind. Nicht dass ich Ihnen das nicht auch unterstellen möchte, mein Junge“, sagte sie liebevoll lächelnd und versank mit ihrer Nase in der Kaffeetasse. „Ich mache das, was ich mache, auch nicht, weil ich ein herzensguter und hilfsbereiter Mensch bin.“
„Wir brauchen einen Fahrer“, warf ich ein. Während sich beide gewissermaßen abtasteten, war ich darum bemüht, hier und heute einen weiteren Fahrer zu bekommen. Egal wer sich nun bei wem bewerben sollte.
„Das, was ihr hier macht, ist komplett durchgeknallt, und das sage ich als herzensguter und hilfsbereiter Mensch“, sagte Andi. „Interessant, aber durchgeknallt.“
„Sie suchen einen Job, wir haben einen“, sagte sie.
„Was soll ich machen?“
Einsammeln, absetzen, zurückfahren.
Wenn du solch eine Sache beginnst, dann – so meine Meinung – kannst du froh sein, wenn du einen Partner hast. Wenn du dich nicht allein in dieses unbekannte Land vorwagen musst. Hier stellt sich nicht die Frage, ob du fällst. Du wirst. Wann du dir die Knie und die Fresse aufschlagen wirst, ist unterm Strich auch unwichtig. Stell dich einfach darauf ein. Sei dir immer gewiss, dass es dich in jeder Sekunde treffen wird. Der letztlich wichtige Punkt ist: Wer hilft dir hoch? Solange du fällst und wieder raufkommst, bist du noch im Spiel. Erst wenn du liegen bleibst, war’s das. Und die Schläge werden heftig, dass du nicht mehr ohne Hilfe hochkommst. Wenn du also einen Partner hast, dann zählt bedingungslose Loyalität und Vertrauen. Also:
Weiche deinem Buddy niemals von der Seite! Lockvogel und Fahrer bilden eine Einheit. Inge und ich bilden eine Einheit. Ich setze sie da ab, wo ich sie sehen kann. Und sie bleibt in meinem Sichtfeld. Jeder behält die Orientierung und Kontrolle der Situation. Setze ich sie vor dem Altersheim ab, dann verschwindet sie nicht und besorgt Hausbesuche. Egal wie günstig die Gelegenheit auch erscheinen mag. Während Inge also die einladende Dame im Eingangsbereich mimt, stehe ich zur Abfahrt bereit. Nur einen Wimpernschlag entfernt, bereit, vorzufahren. Und wir fahren auf jeden Fall gemeinsam ab. Niemand wird zurückgelassen.
Verlass dich nur auf die gemeinsame Planung! Entscheide nicht spontan aus der Situation heraus. Und niemals ohne den anderen. Wir haben feste Punkte, an denen wir aufsammeln. Es sind wenige und gut ausgewählte. Bei uns geht Nachhaltigkeit vor schnellem Erfolg.
Mittlerweile haben wir zwei feste Altersheime, einen guten Korridor am Hauptbahnhof, den ein oder anderen Bereich in zwei Fußgängerzonen. Wir erledigen das Geschäft an unseren Orten, nicht an denen der Gäste. Auch kennen wir mittlerweile die Gäste. Nicht immer persönlich, aber vom Typ her schon. Wir lassen uns nicht auf Abenteuer ein, auch wenn wir diese unseren Gästen verkaufen.
Wir bestimmen den Ort: Was behelfsmäßig mit Kikis Wohnmobil begann, gefolgt von einer Ferienwohnung, ist mittlerweile ein Reihenendhaus.
Wir bestimmen die Gäste: Wo wir anfangs auf jeden angewiesen waren, der einen Führerschein hatte, legen wir heute Wert auf Menschen, die Oldtimer zu schätzen wissen – um im Beispiel zu bleiben.
Halte Abstand! Und zwar zu denen, die nicht zu deinem Kreis gehören. Wir setzen sie dort ab, wo wir sie eingesammelt haben. Nicht weil wir Befriedigung und Beförderung in unserem Geschäftsmodell vereint sehen, sondern: Weil wir die Bewegung in diesem Spiel kontrollieren wollen. Gäste kommen nicht zu uns, wir holen sie zu uns. Und genauso schaffen wir auch wieder die Entfernung. Unsere Abfahrtszeiten sind bindend. Alles beginnt und endet mit der Fahrt. So ist es bis heute, und so war es auch am Anfang.
Meine erste Fahrt hieß Johann …
1
Hinterlassenschaften
Die Küche hatte sie in Ordnung gebracht. Schon vor Stunden, denn Ingeburg Theissen war seit ihrer frühesten Kindheit darauf getrimmt worden, ihre Sachen wegzuräumen. Hinterlass deinen Platz so, wie du ihn vorgefunden hast. Sie war zu einer Frau geworden, die ihre Angelegenheiten sofort erledigt. Die nichts auf die lange Bank schiebt und ihre Sachen selbst in Ordnung bringt. Ihrer Meinung nach hat sie sich damit zu einer guten Partie entwickelt. Ihrem Ewald musste es nie an irgendetwas mangeln. Den beiden Jungs schon gar nicht – und am wichtigsten: Keiner erstickte in seinem Kram. Niemals. Inge räumte die Sachen stets weg. Unverzüglich.
Sie hatte vor Stunden eine Scheibe Brot mit dem stinkenden Käse zubereitet, den ihr Edith im Vorbeigehen empfohlen hatte. Den sie dann gekauft hatte. So schlimm ist der gar nicht, und Edith hatte recht. Er schmeckte nicht so streng. Doch Inge bereute schon nach dem zweiten Bissen, dass sie nicht schneller am Vorgarten ihrer Nachbarin vorbeigehuscht war. Genügend Fahrtwind hätte ihr den Plausch mit Edith und diesen Genuss erspart. Vor allem aber den sich in der Küche nun penetrant ausbreitenden Käsegestank. Für Inge stand fest, dass sie dieses Zeug nicht im Wohnzimmer atmen lässt. Sie und ihr Brot würden mit der Küche vorliebnehmen. Auch wenn dies bedeutete, dass sie im Stehen neben der Spüle essen müsste und die Küche zum Sperrbezirk werden würde.
Stunden später streifte Inge mit den Fingerspitzen die verschlossene Küchentür von außen, bewegte sich ruhigen Schrittes zum Ende des Flures und stand vor der Haustür. Der Bewegungsmelder außen am Haus war aktiviert. Die meiste Zeit würde er der Nachbarskatze das Jagdrevier ausleuchten. In diesem Moment sprang das Außenlicht an. Der Wind hatte den Busch in ihrem Beet kräftig durchgeschüttelt. Selbst ein leichter Hauch genügte, um den Melder in helle Aufregung zu versetzen.
So wie die Haustür mit den vielen eingefassten braunen Glasquadraten einen verzerrten Blick auf anstehende Besucher erlaubte, so ließ der Eingangsbereich nun das Licht der Außenlampe hinein und legte es in rotbraunem Rautenmuster über Inge. Wie in einem Fischernetz gefangen, nur ohne Gezappel, verharrte sie im Vorflur. Sie lächelte über den Gedanken: Der Wind, der den Bewegungsmelder … Das Licht, das sich netzartig an ihren Körper … Es folgte kein weiterer Windstoß. Keine Katze. Das Licht erlosch vor ihrem Haus. Das kaum hörbare Klacken des Bewegungsmelders verriet, dass er wieder Ausschau hielt. Bereit für die nächste Runde.
Im Dunkel ihres Eingangs löste sie die Sicherheitskette, die sie jeden Abend kurz nach dem Abendbrot vorspannte. So auch vor einigen Stunden. Jetzt befreite sie die goldgelbe, schwere Kette aus der Aufgabe. Sie befreite das Haus aus der Sicherheit. Und sie befreite die nächsten Eintretenden von der Last, sich mühevoll Zutritt verschaffen zu müssen.
Hinterlass deinen Platz so, wie du ihn vorgefunden hast. Inge würde diese Angelegenheit nicht allein in Ordnung bringen können. Das war unmöglich, und doch störte es sie. Sie würde etwas zurücklassen. Irgendwer müsste hinter ihr aufräumen. Das war nicht ihre Art, also entschloss sich Inge, so viel wie möglich vorzubereiten. Auch wenn ihr Beitrag nur darin bestand, dass sie die Tür nicht verriegelte und kein Bolzenschneider zum Einsatz kommen müsste. Irgendwer würde ihr innerlich danken.
Die Zwischentür lehnte sie weit auf. Die Küchentür und geradewegs die Wohnzimmertür waren so aufgesperrt, dass ein unkundiger Besucher mit wenigen Kopfbewegungen einen umfassenden Überblick vom Erdgeschoss erlangen konnte.
Inge würde es nicht im Erdgeschoss machen. Die Küche war gerade mal zwei Jahre alt. Das Echtholzparkett im Wohnzimmer war geölt und schon einfachem Wasser schutzlos ausgeliefert. Inge wollte sich nicht im Traum ausmalen, was hier Blut, Urin, Stuhl oder auch nur Speichel anrichten könnten. Die neuen Hauseigentümer würden es ihr nicht verzeihen. Sie selbst würde es nicht. Und das Gäste-WC war zu klein. Inge war für ihre dreiundsiebzig Jahre sehr zierlich und auch biegsam geblieben, aber selbst für sie war der Weg in den ersten Stock zum Hauptbadezimmer die geringere sportliche Herausforderung. Das Erdgeschoss war also ausgeschlossen.
Sie wanderte die Treppe nach oben. Ihr Fliegengewicht löste nur einmal auf halber Höhe ein schwaches Knarren aus. Noch vor fünfzehn Jahren taperte ihr Ewald durch das Haus. Diese eine Stufe brüllte förmlich über alle drei Ebenen, wenn ihr Gatte seinen riesigen Treter ins Holz presste. Mit einem sanften Lächeln betrat Inge das erste Stockwerk. In ihrer Vorstellung machte die Treppenstufe auch heute noch einen gehörigen Lärm. Knirschte, als sei der Zusammenbruch nicht mehr weit. Beides gefiel ihr. Die Erinnerung daran und, dass es eben nur eine Erinnerung war.
Sie spürte wieder den Brief in ihrer Hand. Zwischen Daumen und Zeigefinger trug sie das entfaltete Schreiben. Ein regelmäßiges Rascheln und Knistern versicherte ihr, dass sie das Papier noch bei sich trug.
Vereinbaren Sie noch heute einen Termin mit mir!
Lassen Sie uns Ihre finanzielle Situation besprechen!
Und dann das Foto. Inge kannte diesen Mann gar nicht. Und er wollte mit ihr reden. Über Geld, natürlich. Das machen Bankmenschen so. Dieser Mensch auf dem Foto sah aber nicht aus, als würde er in ihrer Filiale am Marktplatz arbeiten, geschweige denn Ingeburg Theissen kennen – wenn sie ihn schon nicht kannte.
Ich freue mich auf Ihre Nachricht!
Ein Fotomodell im Anzug. Nur eine aufgedruckte und unleserliche Unterschrift darunter. Und das soll Meinke heißen? Wer zum Teufel heißt Meinke, dachte sich Inge, betrat ihr Schlafzimmer und legte das Schreiben auf den Stapel mit den anderen Meinke-Schreiben neben ihrem Kopfkissen und sich dazu.
Das Bett war in Ordnung. Es war alt. Man würde es wegschmeißen, so oder so. Zudem würde Inge auf einer Unterkonstruktion aus Federkern, einer Obermatratze sowie einer sehr saugfähigen Matratzenauflage liegen. Es würde einige Tage dauern, bis es das Laminat erreicht. Der gesamte Unterbau sah saugfähig aus. Und selbst wenn. Der Boden war alt und billig. Nicht dass sie es darauf ankommen lassen wollte, aber die neuen Eigentümer wären dankbar für einen Grund zum Austauschen. Inge zumindest wäre es.
Genau hier würde sie sterben. Auf ihrem saugfähigen Boxspringbett. Zusätzlich hatte sie das dicke Winterdaunenbettzeug bezogen. Die Wärme breitete sich unter ihrem Rücken aus. Den Kopf neben Meinkes Post gebettet, starrte sie an die Decke und überlegte. Hier fühlte es sich ordentlich an. Ordentlicher als im Erdgeschoss.
Der Leichenbestatter müsste innerlich Freudensprünge machen. Inge hatte stets auf ihr Gewicht geachtet. Er würde sich keinen Bruch heben. Das Bett war derart hoch, der Bestatter müsste sich nicht mal bücken oder in die Knie gehen, um sie aus dem Bett zu holen. Außer er wäre so ein Zwei-Meter-Hüne. Inge erinnerte sich an keinen Zwei-Meter-Bestatter. Nicht bei Thormählen. Vater und Sohn, wenn sie sich nicht täuschte. Die haben eine weitläufige Schaufensterfront, man sieht alles und jeden, dachte sie. Die machten bislang einen ordentlichen Eindruck und sind normal gewachsen.
Alles in allem bot das Schlafzimmer also nur Vorteile. Das Badezimmer war direkt nebenan. Was für denjenigen wichtig wäre, der vielleicht sauber machen müsste. Der Weg zum Wasser ist kurz. Wischwasser kann häufiger gewechselt werden. Der Boden wird schneller und gründlicher gereinigt. Wenn hier alles rausgerissen wird, dachte Inge, wäre das jedoch egal.
Und dann ist es so weit.
Die Tür ist verschlossen, aber ein einfach ausgerüsteter und durchschnittlich begabter Schlüsseldienst bekommt die Haustür im Nu auf. Zum Glück ist die Türkette nicht eingehängt, den Bolzenschneider hätten wir nämlich erst holen müssen – aus der Firma. Ein schneller Blick ins Erdgeschoss verrät, hier ist keiner. Ein verantwortungsvoller Bewohner würde auch unter keinen Umständen dieses Echtholzparkett in Gefahr bringen. Vielleicht sollten wir die Schuhe ausziehen. Und ist die Küche etwa neu? Schön.
Unten sieht alles in Ordnung aus. Es geht nach oben. Zwei Blicke, rechts und links. Wo sollte sie auch anders liegen als im flauschig saugfähigen Boxspringbett. Zum Glück ist nichts durchgesuppt. Für alle Fälle wäre aber ein Bad in der Nähe. Praktische Höhe. Familie Thormählen wird begeistert sein. Nie hatten sie schneller und beschwerdefreier das Haus eines Verstorbenen verlassen. Und das mit dem Sterben hat die gute Frau auch sehr clever angestellt. Sie starb sehr sauber. Kaum Blut, Urin, Stuhl oder Speichel. Als hätte sie Klarschiff gemacht, bevor wir kamen.
Schöne Vorstellung.
Tolle Frau, dachte Inge und ging immer und immer wieder den Weg vom Eingang zum Bett durch. Sie versetzte sich in den Besucher hinein. Sie wollte nichts übersehen. Jede Kleinigkeit berücksichtigt wissen. Einige Fragen blieben jedoch, egal wie häufig sie auch in Gedanken die Treppe hoch- und runterrannte:
Wer sollte sie finden? Alle zwei Wochen kommt der Bofrost-Mann. Wenn sie dem nicht aufmacht, versucht er sein Glück wieder in zwei Wochen. Irgendwann wird man sie dann von der Kundenliste streichen. Bedeutet also: Der Bofrost-Mann wird Inge nicht finden und vielleicht sogar seinen Job verlieren.
Die Nachbarn sind zwar neugierig, dann aber nicht neugierig genug, um nach dem Rechten zu sehen. Sie spionieren nur so lange, bis sie ein einigermaßen haltbares Gerücht gewittert haben. Keiner von denen wird klingeln und erleichtert feststellen, dass Inges Beitrag nicht mit der Türkette endete.
Sie könnte jemanden anrufen. Ihre Söhne vielleicht. Aber die sollten sich um ihre eigenen Familien kümmern. Da ist genügend Arbeit, bestätigte sich Inge mit einem energischen Kopfnicker. Mittlerweile hatte sie sich aufgesetzt und schaute aus dem Fenster ins Dunkel über die angrenzenden Reihenhausdächer. So dicht zusammengepfercht. Trotzdem kam Inge keine Antwort in den Sinn. Wer sollte mich finden?
Die zweite Frage war dagegen eher praktischer Natur. Sie hatte Vorstellungen und gewisse Anforderungen, auf die sie möglichst nicht verzichten wollte. Sauber sollte die Sache sein. Ohne umfangreichen Einsatz von Körperflüssigkeiten. Das war klar. Aber wie um alles in der Welt sollte sie sich umbringen?
Es gibt wohl tatsächlich Menschen, die befragen Sexarbeiterinnen von sechzig an aufwärts, dachte Inge, als ihr ein flüchtiger Blick über den Nachttisch die Titelstory des Auslandsreports wieder ins Gedächtnis rief. Südkoreanische Sexomas. Wer wohl einen weniger beneidenswerten Job hat? Die Omas oder die Journalisten? Die ganze Angelegenheit war deprimierend: Rechts von ihrem Kopfkissen lag die südkoreanische Antwort auf Altersarmut. Inge sah im Augenwinkel den nach oben gefalteten Zeitungsartikel mit zugehörigem Foto einer wenig einladenden alten Dame mit Kunststoffsonnenschirmmütze. Im Gespräch mit einem Mann. Es könnte auch ihr Bankberater – ihr Meinke – sein, den sie zufällig gerade vor einem Lebensmittelgeschäft trifft. Und sie besprechen unschuldig Finanzen. Wobei Inge bezweifelte, dass südkoreanische Bankangestellte so aussehen und es eine Möglichkeit gibt, Finanzen unschuldig zu besprechen. Links von ihrem Kopfkissen die besagte Fanpost ihres Meinkes, mit dem sie ganz sicher nicht ihre Finanzen besprechen würde. Unschuldig oder nicht. Mittendrin saß Inge mit aufgerichtetem Oberkörper auf dem Boxspringbett und wusste nicht, wie sie sich ordentlich umbringen sollte.
Unter solchen Voraussetzungen verging ihr die Lust. Die Lust, ein weiteres Mal in dieser Nacht den Weg vom Eingang hoch zu ihrer Endstation zurückzulegen. Weder gedanklich noch tatsächlich. Sie glaubte nicht, dass ihr auf diese Weise eine gute Idee käme. Meinke würde ihr das Haus wegnehmen. Die sind nicht blöd.
Je älter du wirst, desto mehr Vertrauenspersonen tummeln sich in deinem Umfeld. Nicht dass du ihnen das Vertrauen aussprechen willst, doch es bleibt dir nichts anderes übrig. Du kannst deine Sachen nicht mehr allein regeln. Nicht mehr selbst für Ordnung sorgen. Du musst vertrauen. Inge fand, dass etwas zu müssen und eine vertrauensvolle Beziehung keine passende Kombination darstellen. Ja, dieses Netz aus Müssen: Ihr Hausarzt kennt ihre Krankengeschichte, ihr Apotheker die dazugehörige Medikamentengeschichte. Ihr Bofrost-Mann weiß ganz genau, was er mitbringen muss und was er ihr nicht mal nach einem Schlaganfall versuchen sollte, anzudrehen. Der Postbote ist in ähnlicher Weise auf sie eingestellt. Genauso würde auch dieser Meinke über sie Bescheid wissen. Über ihre Finanzen. Die Höhe ihrer Rente. Die Höhe ihrer Fälligkeiten. Dass sie seit Jahren ihre Rente mit den gemeinsamen Ersparnissen aufgestockt hat, damit sie Arzt, Apotheker und Bofrost-Mann bezahlen kann. Damit der Postbote auch mal eine Tafel Schokolade bekommt. Inge stockte auf, um in diesem Netz weiter bestehen zu können. Zu dürfen.
Doch Meinke weiß alles. Das Aufstocken gehörte der Vergangenheit an. Schon seit Monaten war nichts mehr da, um es aufzustocken. Meinke hatte wohl begonnen, Inges Ausgaben und Einnahmen gegeneinanderzuhalten. Das war sein Job. Das Ergebnis war eine anwachsende rote Zahl. Wem wollte sie etwas vorlügen? Wie lange wollte sie Meinkes Briefe ignorieren?
Sie ließ sich kraftlos aufs Bett fallen und atmete laut aus. Sie atmete ein weiteres Mal laut aus. Mit weit geöffnetem Mund. Dabei entfloh ihr sogar unbeabsichtigt ein Ton. Für einen winzigen Augenblick überlegte sie, wann sie zum letzten Mal in einem Bett auf dem Rücken liegend laut ausgeatmet hatte. Inge dachte an die südkoreanischen Sexomas. Ob die stöhnen oder nur laut atmen?
Sie sprang auf, packte dabei das oberste Meinke-Schreiben und ging beschwingt die Treppe hinunter. Dann stand Inge wieder im Flur. Der Wind hatte soeben die Außenlampe aktiviert und ihr das leuchtende Fischernetz übergeworfen. Sie wartete ab, ohne zu zappeln, und eröffnete eine neue Runde. Vielleicht würde ihr dieses Mal eine ordentliche Lösung einfallen.
Als sie abermals mit Meinkes Post in der Hand vor ihrem Bett stand, war es Viertel vor zwei in der Nacht. Der Wecker vom Nachttisch zeigte es. Inge kniff beim Blick darauf die Augen zu, als wollte sie sagen: Ach, komm schon, jetzt stell dich nicht so an. Dann fiel ihr Augenmerk auf den Sexoma-Artikel. Er schien für sie dieselben Worte parat zu haben.
Inge stand vor ihrem Boxspringbett, zum dritten Mal in dieser Nacht, und sah sich selbst, wie sie auf dem Bett lag. Das war neu und die ersten zwei Male nicht geschehen. Sie starrte sich an. Egal von welcher Seite sie es betrachtete. Der einzige Unterschied: Nur eine Inge hielt den Meinke in der Hand. „Du könntest eine Rasierklinge nehmen“, sagte Inge, die auf dem Bett lag, zu Inge, die vor dem Bett stand. „Dann musst du aber so … und nicht so schneiden. Und du musst schnell schneiden. Und du musst dich konzentrieren, wenn du beide Arme aufschneiden willst.“
Inge konnte kaum glauben, was sie vor sich sah: Sie schaute sich selbst zu, wie sie sich die Pulsadern aufschnitt. „Ich bin ja nicht blöd“, sagte sie und verzog den Mund. Natürlich wusste sie, wie man eine Pulsader aufschneidet. Das weiß jeder halbgebildete Pubertierende. Das gehört in dem Alter zur Grundausstattung. „Abgesehen davon sagte ich doch: kein Blut. Schau dir doch mal die Sauerei an!“
„Aber das Bettzeug saugt gut. Vielleicht ist das Weiß nicht so passend. Sieht sehr direkt aus. Verschreckt vielleicht auf den ersten Blick.“ Beide bestaunten das ausquellende Blut und das Resultat auf dem Bettzeug.
„Und du musst viel trinken, ansonsten ist das Blut zu dick. Das verklebt dir die Adern, ehe genug draußen ist. Darüber hinaus: Viel trinken ist gesund.“
„Ich weiß“, sagte Inge. Ihr Blick missbilligte, was sie auf dem Bett ansehen musste. Die Arme waren passend dazu vor der Brust verschränkt. „So eine Schweinerei mache ich nicht.“ Du musst dies. Du musst das. Du musst jenes. Sie hörte sich wie ihre Mutter an. Das machte das blutverschmierte Bett um ein Vielfaches schlimmer.
„Okay, wie wär’s dann mit Tabletten. Schmerztabletten.“ Von der aufgeschnittenen und zittrigen Inge auf dem Bett war keine Spur mehr. Die Stoffe strahlten nie in einem unschuldigeren Weiß. Anstelle der Rasierklinge hielt sie nun eine Handvoll weißer Tabletten auf dem Schoß. Anstelle der Packung mit den Rasierklingen stand jetzt auf dem Nachttisch ein Glas mit Wasser. „Die hier und ein großer Schluck hinterher, und gute Nacht.“
Auf jeden Fall passen die Tabletten mit der Farbe zum Rest des Bettes. Sie blieb jedoch skeptisch. „Na, und wenn’s dann zu wenig sind, ist die Niere im Eimer. Dann rennen wir die uns noch verbleibende Zeit zur Dialyse. Und nicht nur dass man uns ins Irrenhaus einweisen wird, jeder wird dort wissen, dass wir unsere Angelegenheit nicht in Ordnung gebracht haben.“
„Du musst halt nur genug nehmen“, erwiderte Inge vom Bett aus, warf sich die Tablettenladung in den Mund und legte mit Wasser nach. Mit aufgeplusterten Wangen schaute sie auf Inge, die vor dem Bett noch immer die Arme verschränkt hielt. Sichtlich nicht überzeugt.
„Quatsch. Und du weißt ja auch, wie viel die Packung davon kostet, nicht?“
„Dann lass halt anschreiben, was sollen die machen, he?“ Inge grinste vom Bett aus.
„Gehen und Schulden hinterlassen?“ Sie schüttelte den Kopf.
„Du könntest dich erschießen.“
„Womit?“
„Mit der hier.“ Inge presste sich eine Pistole an die Schläfe.
„Wenn du jetzt abdrückst, trifft du aber auch die Wand. Blut und so befinden sich dann überall hier, Herrgott, über den ganzen Nachttisch und Boden verteilt. Einfach –“ Inge drückte ab. Es passierte, was sie beschrieben hatte. Dann sackte der leblose Körper auf dem Bett zusammen. Ihre Augen hefteten sich jedoch weiter an Inge, die vor dem Bett stand und den Kopf schüttelte. „Überall. Sag’ ich doch. Einfach überall, so wie im Fernsehen. Und das meiste läuft ins Bett. Nein. Allein schon der laute Knall. Und ich habe gar keine Waffe, also …“
„Dann halt nicht“, sagte Inge, saß auf dem Bett, als wäre nichts gewesen, und nahm einen Schluck vom Wasserglas. Sie überlegte. Beide überlegten. „Du könntest vom Dach springen.“
„Wie soll ich da hochkommen? Wie soll ich hier im Bett landen?“
„Du würdest im Beet landen. Ein erster Vorgeschmack auf Graberde. Vielleicht auch auf dem Gehweg.“
„Und dann sieht’s auch noch aus wie ein Unfall. So unfreiwillig. Aber wie gesagt, ich komm’ nicht aufs Dach. Zudem ist es wahrscheinlich gar nicht hoch genug. Wir brechen uns maximal die Hüfte. Nein danke.“
„Erhängen?“, warf Inge zögerlich vom Bett ein. Sie hielt ein Abschleppseil in der Hand, unternahm aber keine Anstalten, weiterzumachen. Sie schaute abwartend auf ihr Ebenbild am Bettrand.
„Ist das das Abschleppseil aus der Garage?“
„Ähm, ja, das hätten wir zumindest parat.“
„Ich frag’ jetzt nicht, wie ich das ohne Hilfe befestigen soll. Und vor allem, wo?“
„Weißt du, meine Liebe, ich versuche zumindest zu helfen. Aber du stehst nur da und findest an allem etwas auszusetzen. Wie ein Meinke. Dies nicht. Das nicht. Jenes nicht. Was soll das? Willst du jetzt, oder nicht?“
Inge schaute auf ihr Pendant, wie es bockig auf dem Bett saß. Von den ganzen abstrusen Szenen der letzten Minuten war nichts geblieben. Das einzig Ungewöhnliche war, dass Inge zweimal in diesem Zimmer war. Und so stand sie sich gegenüber: die Beine angezogen, krummer Rücken, zugekniffenes Gesicht. Das erinnerte sie daran, wie sie als kleines Kind immer gehockt hatte, wenn sie unsicher war. Unsicher darüber, wie es nun weitergehen wird. Wenn sie sich allein und hilflos fühlte. Etwas musste geschehen, und es würde auch etwas geschehen. So war es jetzt auch. Beiden war in diesem Zimmer klar, dass irgendetwas unaufhaltsam auf sie zukam. Sie wäre nicht überrascht, wenn dieser Meinke jetzt die Treppe hochstürmen, ins Schlafzimmer rennen, Inge packen und sie dann mit Anlauf aus dem Fenster werfen würde.
Beim Bersten der Scheibe würde sie dann entdecken, dass es nicht ganz für den Gehweg reicht und sie in ihrem eigenen Vorgarten verendet. Vielleicht würde er noch so etwas wie „Wer, bitte, traut sich denn, mit so ’nem Kontostand noch zu leben?“ schreien, während er ihr zufrieden hinterherschaute und seine Krawatte richtete. Konto leer, Leben leer. Natürlich würde ihre Bank niemals zu solch drastischen Mitteln greifen. Inge hätte es in diesem Moment aber nicht verwundert, und nachtragen würde sie es ihm auch nicht. Von seinem Standpunkt aus.
Sie schaute ihr Ebenbild an. Es wunderte sie, dass sich so viele Menschen das Leben nehmen, auf so einfallsreiche, aber doch zumindest effektive Weise. Sie jedoch stand jetzt hier, lief die Treppe mitten in der Nacht wund, sah sich immer wieder beim Sterben zu, diskutierte mit sich selbst und kam zu keinem Ergebnis. Wenn du mit dir selbst sprichst und hoffst, etwas Neues zu erfahren, dann ist dir nicht zu helfen. In diesem Moment erkannte sie, dass das, was sie hier nicht klären konnte, auf der anderen Seite Bände sprach. Es ging nicht darum, etwas Neues zu erfahren. Inge erfuhr, was bereits da war. Und zwar das Gegenteil von dem, was sie hier anstrebte.
„Ich will nicht sterben“, sagte sie. Sie schaute dabei noch immer angestrengt durch das Fenster, das den hohen Bogen zu ihrem Vorgarten einleiten könnte. „Ich will nicht sterben“, sagte sie zu ihrem Ebenbild auf dem Bett. „Ich muss nicht sterben.“
„Dann, meine Liebe, kann ich dir auch nicht helfen.“
2
Einsturzgefährdete Decken