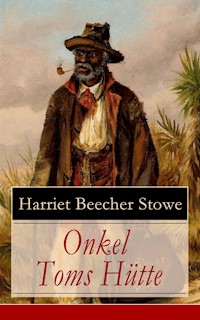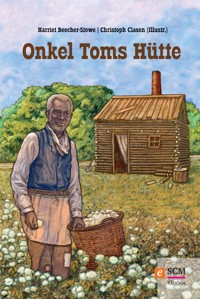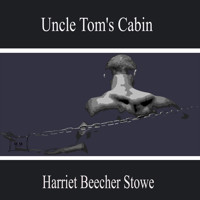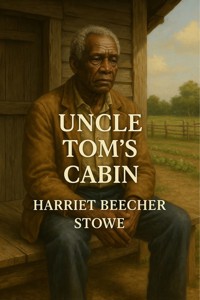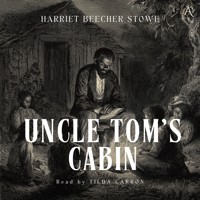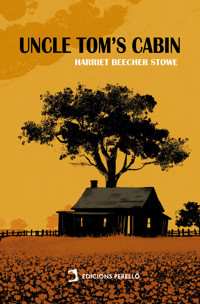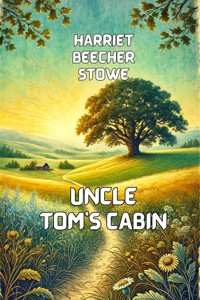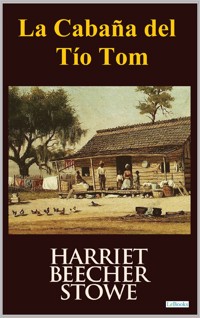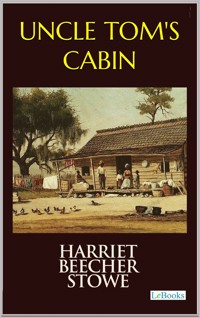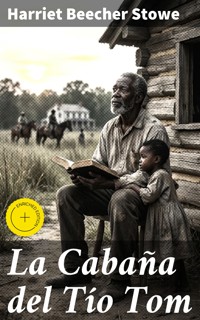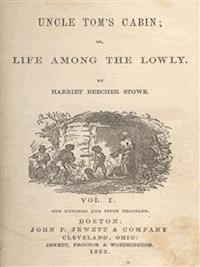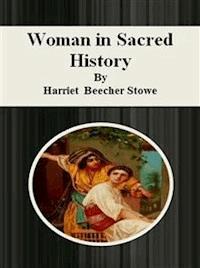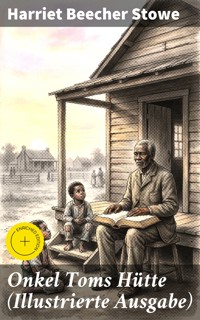
0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Harriet Beecher Stowes "Onkel Toms Hütte" ist ein wegweisendes Werk der amerikanischen Literatur, das die Schrecken der Sklaverei thematisiert und gleichzeitig die moralischen Dilemmata der damaligen Gesellschaft beleuchtet. In einem eindringlichen literarischen Stil, der sowohl emotionale Tiefe als auch sozialen Realismus verbindet, entfaltet das Buch die Geschichten von gefangenen Afroamerikanern. Durch die geschickte Verwendung von Dialogen und lebendigen Charakterisierungen gelingt es Stowe, die Leser in das Schicksal ihrer Protagonisten zu ziehen und sie zur Reflexion über die ethischen Fragen der Sklaverei zu bewegen. Harriet Beecher Stowe, eine prominente abolitionistische Schriftstellerin des 19. Jahrhunderts, wurde durch ihre persönlichen Erfahrungen und ihr Engagement für soziale Gerechtigkeit geprägt. Aufgewachsen in einem wohlhabenden, von religiösen Ansichten geprägten Umfeld, war Stowe ein vehementer Verfechter der Gleichheit und setzte sich zeitlebens für die Abschaffung der Sklaverei ein. Ihre Beobachtungen und Erlebnisse in einer Gesellschaft, die von Rassismus und Ungerechtigkeit geprägt war, sind die treibenden Kräfte hinter diesem berühmten Roman. "Onkel Toms Hütte" ist nicht nur ein literarisches Meisterwerk, sondern auch ein kraftvoller Aufruf zur Veränderung. Lesern, die sich für die Geschichte der Menschenrechte und die sozialen Themen ihrer Zeit interessieren, sei dieses Buch wärmstens empfohlen. Es fordert heraus, regt zur Diskussion an und lädt ein, über die Brüche und Möglichkeiten der Menschlichkeit nachzudenken. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Eine prägnante Einführung verortet die zeitlose Anziehungskraft und Themen des Werkes. - Die Synopsis skizziert die Haupthandlung und hebt wichtige Entwicklungen hervor, ohne entscheidende Wendungen zu verraten. - Ein ausführlicher historischer Kontext versetzt Sie in die Ereignisse und Einflüsse der Epoche, die das Schreiben geprägt haben. - Eine Autorenbiografie beleuchtet wichtige Stationen im Leben des Autors und vermittelt die persönlichen Einsichten hinter dem Text. - Eine gründliche Analyse seziert Symbole, Motive und Charakterentwicklungen, um tiefere Bedeutungen offenzulegen. - Reflexionsfragen laden Sie dazu ein, sich persönlich mit den Botschaften des Werkes auseinanderzusetzen und sie mit dem modernen Leben in Verbindung zu bringen. - Sorgfältig ausgewählte unvergessliche Zitate heben Momente literarischer Brillanz hervor. - Interaktive Fußnoten erklären ungewöhnliche Referenzen, historische Anspielungen und veraltete Ausdrücke für eine mühelose, besser informierte Lektüre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Onkel Toms Hütte (Illustrierte Ausgabe)
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Ein Mann hält eine Bibel, während um ihn herum die Ketten der Gesetze klirren. In dieser scharf geschnittenen Gegenüberstellung von Gewissen und Ordnung, Haus und Markt, Mitleid und Profit hallt die zentrale Spannung von Onkel Toms Hütte nach. Harriet Beecher Stowe führt ihre Lesenden in eine Welt, in der alltägliche Gesten von Freundlichkeit auf die Brutalität eines Systems prallen, das Menschen zu Ware macht. Der Roman entfaltet seine moralische Dringlichkeit nicht als abstrakte These, sondern als erfahrbare Wirklichkeit, die in Blicken, Wegen, Verträgen und Abschieden liegt. So beginnt ein Buch, das Gefühl als Kraft gesellschaftlicher Veränderung begreift.
Harriet Beecher Stowe veröffentlichte Onkel Toms Hütte 1851/52 zunächst als Fortsetzungsroman in der abolitionistischen Zeitung The National Era; 1852 erschien das Werk in Buchform. Entstanden ist es im Klima scharfer Auseinandersetzungen um die Sklaverei in den Vereinigten Staaten, insbesondere nach dem Fugitive Slave Act von 1850, der Flucht und Hilfe strafrechtlich verfolgte. Die Autorin, geprägt von religiöser Überzeugung und sozialem Engagement, wählte bewusst die Literatur als Medium öffentlicher Gewissensprüfung. Die vorliegende illustrierte Ausgabe reiht sich in eine lange Tradition visueller Begleitung des Texts ein und lädt dazu ein, Erzählung und Bild in ein aufmerksames Gespräch zu bringen.
Der Roman erzählt von den Lebenswegen versklavter Menschen und derjenigen, die an ihrem Schicksal beteiligt sind—als Besitzer, Händler, Mitmenschen, Gesetzesvertreter oder Helfende. Im Zentrum steht die Figur Onkel Tom, deren innere Stärke und religiöse Haltung durch verschiedene Räume und Verhältnisse hindurch geprüft werden. Stowe komponiert eine Folge von Begegnungen, Trennungen und Entscheidungen, die den moralischen Druck eines ökonomischen Systems sichtbar machen. Ohne sich in Programmatik zu verlieren, entfaltet der Text ein Netz von Beziehungen, in dem die Frage nach Menschlichkeit unablässig neu gestellt wird. Dabei bleibt der Blick stets auf konkrete Erfahrungen gerichtet.
Stowes Absicht war es, die Abstraktion des Begriffs Sklaverei in menschliche Nähe zu übersetzen. Angestoßen von politischen Entwicklungen ihrer Zeit, wollte sie die häusliche Sphäre—Gefühle, Fürsorge, Gewissen—als Ort gesellschaftlicher Kraft ausweisen. Der Roman appelliert an Mitgefühl, aber nicht sentimental um seiner selbst willen: Er will Verantwortung aufzeigen, die jede und jeder im Rahmen von Gesetz, Markt und Alltag trägt. Indem Stowe religiöse Motive mit rechtlichen und ökonomischen Fragen verschränkt, macht sie deutlich, dass Moral kein Rückzugsraum ist, sondern eine Praxis. Das Buch ist so als Intervention gedacht—nicht bloß als Abbildung einer Misslage.
Onkel Toms Hütte gilt als Klassiker, weil es die Grenzen der Literatur in den öffentlichen Raum hinein überschritten hat. Es war einer der großen Bestseller des 19. Jahrhunderts, wurde rasch übersetzt und breit diskutiert. Bühne und Lesekreise trugen die Geschichte weit über ihre Entstehungsorte hinaus. Zugleich hat das Werk Formen des gesellschaftlich engagierten Erzählens geprägt: den sozialen Roman, der Empathie und Analyse verbindet. Spätere Autorinnen und Autoren fanden hier ein Beispiel dafür, wie erzählte Gefühle politische Wahrnehmung schärfen können. Als literarisches Ereignis und als kulturelles Faktum hat das Buch Debatten verdichtet und Perspektiven verschoben.
Stowe nutzt die Mittel des sentimentalen und häuslichen Romans, ohne sich auf sie zu beschränken. Sie setzt auf anschauliche Szenen, klare Charakterführungen und pointierte Kontraste, um moralische Fragen zuzuspitzen. Pathos ist dabei Werkzeug der Erkenntnis: Die Emotionen öffnen den Blick für Strukturen, die sich hinter juristischen Formeln und Alltagsroutinen verbergen. Gleichzeitig durchziehen Beobachtungen über Arbeit, Eigentum und Mobilität den Text, sodass Empfindung und Gesellschaftsanalyse ineinandergreifen. Diese Verbindung, ergänzt durch eine direkte Leserinnen- und Leseransprache, macht die Erzählung zugänglich und dringlich. Sie erzeugt eine Spannung, die bis heute trägt.
Erzählerisch arbeitet der Roman mit einer Vielzahl von Schauplätzen und Stimmen. Das Wechselspiel zwischen unterschiedlichen Haushalten, Landschaften und Rechtsräumen zeigt, wie Bindungen und Zwänge sich verändern—und wie sie doch aufeinander bezogen sind. Figuren agieren an Knotenpunkten von Gesetz, Geld und Gewissen; ihre Entscheidungen sind eingebettet in Netzwerke von Abhängigkeit und Hilfe. Stowe setzt auf Spiegelungen und Kontraste: Härte und Fürsorge, Kommerz und Familie, Flucht und Bleiben. So entsteht ein Panorama, das nicht in Einzelfälle zerfällt, sondern die Logik eines Systems sichtbar macht, ohne die individuelle Würde der Menschen aus dem Blick zu verlieren.
Die Illustrationen dieser Ausgabe knüpfen an eine historische Rezeptionsspur an: Schon früh begleiteten Bilder den Text und prägten, wie Leserinnen und Leser Figuren und Räume imaginierten. Bild und Schrift stehen hier nicht in Konkurrenz, sondern verstärken einander. Die visuelle Dimension kann Nuancen von Nähe, Verletzlichkeit und Haltung sichtbar machen, die das Auge unmittelbar erfasst. Zugleich regen die Abbildungen dazu an, die eigenen Vorstellungen zu prüfen: Was wird hervorgehoben, was bleibt im Schatten? In der Wechselwirkung eröffnet sich ein erweitertes Lesen, das Stowes Anliegen—Empathie in Erkenntnis zu verwandeln—mit besonderer Eindringlichkeit unterstützt.
Im thematischen Kern stehen Freiheit und Unfreiheit, Gesetz und Moral, Familie und Markt. Das Buch zeigt, wie das Verlangen nach Sicherheit und Zusammenhalt mit Kräften kollidiert, die Menschen zu Dingen erklären. Es fragt, wie Glauben—als Haltung und als Sprache—die Erfahrung von Unrecht tragen und verwandeln kann. Es erkundet, was Solidarität bedeutet, wenn Hilfe riskant ist, und was Verantwortung heißt, wenn Wegschauen bequemer wäre. Wiederkehrende Motive wie Reise, Heim und Grenze strukturieren die Erzählung und führen vor, dass Bewegung nicht automatisch Befreiung bedeutet. So geraten Gefühle und Strukturen, persönliche Entscheidungen und institutionelle Gewalt in einen aufklärenden Dialog.
Die Wirkungsgeschichte ist vielgestaltig. Zeitgenössisch wurde das Buch als dringlicher moralischer Appell gelesen und fand begeisterte Zustimmung wie scharfen Widerspruch. In späteren Debatten wurde darauf hingewiesen, dass bestimmte Darstellungsweisen Stereotype verfestigen können; der Name der Hauptfigur erhielt im öffentlichen Sprachgebrauch Bedeutungen, die der Roman in dieser Eindeutigkeit nicht trägt. Gerade diese ambivalente Rezeption macht die Lektüre heute produktiv: Sie lädt dazu ein, Wirkung und Intention auseinanderzuhalten, historisch zu kontextualisieren und kritisch zu prüfen, wie Literatur Empathie lenkt. So bleibt der Text Gegenstand engagierter Auslegung statt bloßer Verehrung.
Literaturgeschichtlich hat Onkel Toms Hütte Maßstäbe gesetzt. Es zeigte, wie erzählerische Popularität und gesellschaftliche Relevanz sich nicht ausschließen, sondern einander befördern können. Der Roman wurde zu einem Referenzpunkt für Protest- und Reformliteratur, für sozialkritische Erzählweisen und für das Nachdenken über die politische Aufgabe von Fiktion. Auch transatlantisch wirkte er nach, indem Übersetzungen Debatten in unterschiedlichen kulturellen Kontexten anstießen. Autorinnen und Autoren nahmen Erzähltechniken, Figurenkonstellationen und das bewusste Zusammenspiel von Gefühl und Argument auf—mit Zustimmung, Widerspruch oder Neukodierung. In dieser produktiven Reibung liegt ein wesentlicher Grund seines klassischen Status.
Dieses Buch bleibt aktuell, weil es die Frage stellt, wie Menschen in ungerechten Ordnungen handeln und füreinander einstehen können. Es schärft den Blick für Strukturen, die Leid produzieren, und ruft dazu auf, Empathie in verantwortliches Tun zu überführen. Die illustrierte Ausgabe lädt dazu ein, den Text neu zu sehen und mit heutiger Erfahrung zu verknüpfen. Wer Onkel Toms Hütte liest, begegnet nicht nur einer historischen Anklage, sondern einer Erzählung über Würde, Gewissen und Gemeinschaft. Darin liegt seine dauerhafte Anziehungskraft: Es fordert, berührt und öffnet Räume der Imagination, in denen Gerechtigkeit denkbar wird.
Synopsis
Der Roman spielt in den Vereinigten Staaten vor dem Bürgerkrieg und entfaltet seine Handlung vor dem Hintergrund der legal verankerten Sklaverei. Im Mittelpunkt steht Onkel Tom, ein reifer, religiöser Sklave auf der Farm der Familie Shelby in Kentucky, der wegen seiner Zuverlässigkeit geachtet wird. Als die Shelbys in finanzielle Schwierigkeiten geraten, geraten Toms Zukunft und die seiner Mitmenschen in Gefahr. Parallel lernen wir Eliza kennen, eine junge versklavte Mutter, die um die Sicherheit ihres Sohnes Harry bangt. Die Ausgangslage verbindet persönliche Bindungen mit wirtschaftlichem Druck und etabliert die zentralen Konflikte zwischen familiärer Loyalität, Eigentumslogik und moralischer Verantwortung.
Ein Handelsmann unterbreitet Shelby ein Angebot, das die Schulden zu tilgen verspricht, jedoch den Verkauf von Tom und dem kleinen Harry verlangt. Diese Verhandlungen setzen die Handlung in Gang und trennen die Figuren vor eine schwierige Wahl. Eliza erfährt zufällig von dem Plan und ringt mit der Entscheidung zwischen Gehorsam und der Flucht in eine ungewisse Freiheit. Tom, der die Familie Shelby nicht kompromittieren will, entscheidet sich, sich zu fügen, um andere vor härteren Konsequenzen zu bewahren. Aus diesem Moment erwachsen zwei Handlungsstränge: die riskante Flucht der Mutter mit ihrem Kind und Toms Weg in den überregionalen Sklavenhandel.
Eliza verlässt in der Nacht das Anwesen und begibt sich auf eine gefährliche Reise gen Norden. Ihre Flucht führt sie über Straßen, Flüsse und durch winterliche Landschaften, verfolgt von Aufsehern und Vermittlern, die an ihrer Rückführung verdienen wollen. Unterwegs trifft sie auf Menschen, die aus religiösen, politischen oder persönlichen Gründen Hilfe leisten, darunter Mitglieder einer Quäkergemeinde. Die Szenen zeigen die Improvisation, den Mut und die Unsicherheit, mit denen Flüchtende rechnen mussten, ebenso wie das Risiko für diejenigen, die Unterstützung boten. Elizas Entschlossenheit prägt diesen Strang und verdeutlicht zugleich die juristischen und sozialen Hürden der Zeit.
Zur gleichen Zeit wird Tom den Mississippi hinab transportiert. An Bord knüpft er eine bedeutsame Bekanntschaft mit dem Mädchen Eva St. Clare, deren Empathie und Offenheit ihn beeindruckt. Ihr Vater, der wohlhabende Augustine St. Clare aus New Orleans, erwirbt Tom und nimmt ihn in seinen Haushalt auf. Dort erweitert sich das Figurenensemble um St. Clares Cousine Miss Ophelia aus Neuengland, die das Haus organisiert und eigene Vorurteile reflektiert. Die neue Umgebung verlagert die Perspektive von der Grenzregion in den urbanen Süden und zeigt die Widersprüche zwischen großbürgerlichem Lebensstil, gesetzlicher Ordnung und den alltäglichen Abhängigkeiten der versklavten Menschen.
Im Hause St. Clare übernimmt Tom verantwortungsvolle Aufgaben und gewinnt Vertrauen. Eva verkörpert eine kindliche Humanität, die in Gesprächen und Gesten die Sichtweisen der Erwachsenen beeinflusst. St. Clare formuliert ambivalente, intellektuell geprägte Positionen zur Sklaverei, schwankt zwischen Kritik und Bequemlichkeit und zeigt damit die Kluft zwischen Einsicht und Handlung. Miss Ophelia bemüht sich um praktische Reorganisation, wird dabei jedoch mit unbewussten Stereotypen konfrontiert. Durch Alltagsszenen, Unterricht und Auseinandersetzungen beleuchtet der Roman Gesetzeslage, religiöse Motive und soziale Hierarchien. Toms Glauben und sein Sinn für Gerechtigkeit dienen als Maßstab, an dem die Figuren ihr eigenes Verhalten prüfen.
Der zweite Handlungsstrang vertieft die Geschichte von Elizas Ehemann George Harris, einem begabten Arbeiter, dessen Fähigkeiten systematisch eingeschränkt werden. Seine Erfahrungen in einer Fabrik und auf einer Plantage veranschaulichen, wie Talent und Würde unter Zwangsarbeit eingehegt werden. George sucht, ähnlich wie Eliza, nach einem sicheren Weg in die Freiheit und nach einer Zukunft für seine Familie. Unterstützt von einem Netzwerk aus Mitstreitern, Geistlichen und Helfern, schreitet er Etappe um Etappe voran. Gesetzesverschärfungen erschweren die Lage, während Verfolger taktisch nachsetzen. Der Roman führt beide Fluchtlinien zusammen, ohne die konkreten Wendepunkte vorwegzunehmen.
Im Süden verändert ein schicksalhaftes Ereignis die Verhältnisse im Hause St. Clare und beendet Toms vergleichsweise stabile Situation. Er gerät weiter in den Tiefen Süden auf eine Plantage, deren Besitzer durch Härte und Kontrolle geprägt ist. Dort verschärfen sich die Bedingungen, und Tom steht vor Fragen nach Gehorsam, Verantwortung und Solidarität. Neue Figuren wie Cassy und Emmeline zeigen unterschiedliche Strategien des Überlebens im System der Sklaverei. Die Konflikte werden grundsätzlicher: Es geht um das Verhältnis zwischen Gesetz und Gewissen, um den Preis von Widerstand und um die Folgen, die moralische Entscheidungen in einem repressiven Umfeld nach sich ziehen.
Die parallelen Erzählstränge steuern auf Zuspitzungen zu. Für die Flüchtenden verdichten sich Verfolgung und Hoffnung, getragen von Gemeinschaft, Umsicht und improvisierter Taktik an Grenzen und Kontrollpunkten. Auf der Plantage verschärfen sich Druck und Erwartungen, während Gesten der Menschlichkeit unerwartete Kreise ziehen. Der Roman schildert Konfrontationen, in denen einzelne Figuren zwischen Pflicht, Angst und Mitgefühl wählen müssen. Entscheidungen fallen in Momenten hoher Unsicherheit und führen zu Konsequenzen, die die weitere Entwicklung prägen, ohne hier vorweggenommen zu werden. In beiden Linien wird deutlich, wie individuelle Handlungsspielräume entstehen und wie sie durch Mut, Glauben und Gelegenheit erweitert werden können.
Abschließend bündelt das Buch seine Themen zu einer klaren Botschaft: Es macht die menschlichen Kosten der Sklaverei sichtbar und zeigt, wie Institutionen, Gewohnheiten und Interessen Gewalt stabilisieren. Durch kontrastierte Schauplätze, Debatten und Familiengeschichten verbindet der Roman moralische Appelle, religiöse Motive und rechtliche Argumente. Die Figurenkonstellationen spiegeln unterschiedliche Haltungen im Norden und Süden, von Pragmatismus über Skepsis bis zu engagierter Hilfsbereitschaft. Zugleich betont die Erzählung die Bedeutung von Gewissen, Zusammenhalt und persönlicher Verantwortung. So vermittelt das Werk, in welcher Weise persönliche Beziehungen politische Ordnungen berühren, und lädt dazu ein, Freiheit, Würde und Recht als untrennbar zu begreifen.
Historischer Kontext
Onkel Toms Hütte spielt überwiegend in den 1840er und frühen 1850er Jahren in den Grenz- und Tiefsüdstaaten der USA. Zentrale Schauplätze sind ein Gut in Kentucky, freie Territorien in Ohio und die Plantagenwelt Louisianas. Diese Räume markieren die Konfliktlinie zwischen Sklaverei und Freiheit: Kentucky als Grenzstaat mit vielfältigen Bindungen nach Süden; Ohio als freier Staat mit restriktiven „Black Laws“; und Louisiana als Zentrum der Plantagenökonomie. Der Mississippi und seine Nebenflüsse verbinden diese Orte wirtschaftlich und sozial. Die Handlung ist damit in ein Netz aus Märkten, Flussverkehr, Rechtsräumen und kulturellen Milieus eingebettet, die die damalige amerikanische Gesellschaft prägten.
Die geographische Dramaturgie des Romans spiegelt historische Realitäten der Zeit: Fluchtwege über den zugefrorenen Ohio, Sklaventransporte per Flussschiff Richtung New Orleans, städtische Märkte und ländliche Plantagen. New Orleans fungiert als Drehscheibe des inneramerikanischen Sklavenhandels, während Quäkergemeinden in Ohio und Indiana Anlaufstellen der Fluchthilfe sind. Die Figur des Plantagenbesitzers in Louisiana verweist auf die Brutalität der Zucker- und Baumwollwirtschaft, während Haushalte in Kentucky die Familiendimension der Sklaverei zeigen. Diese Räume sind historisch präzise verortet und betonen, wie Recht, Ökonomie und Religion je nach Ort unterschiedliche Bedingungen für Versklavte schufen.
Die Expansion des „Cotton Kingdom“ prägte die USA zwischen 1793 (Erfindung der Cotton Gin durch Eli Whitney) und 1860. Mit der Ausdehnung nach Alabama, Mississippi und Louisiana stieg die Baumwollproduktion rasant; 1860 stammte der Großteil des Weltbaumwollexports aus den Südstaaten. Diese Ökonomie band Kapital, Landnahme, Banken und Transport in ein System, das Sklavenarbeit zentral machte. Im Roman ist die Nachfrage des Tiefen Südens nach Arbeitskräften Hintergrund für Verkäufe „flussabwärts“. Indem Figuren aus Grenzstaaten in die Baumwoll- und Zuckerregionen deportiert werden, zeigt das Buch, wie Marktkräfte Familien zerrissen und moralische Entscheidungen überrollten.
Nach dem Verbot des transatlantischen Sklavenhandels (US-Bundesgesetz von 1807, in Kraft ab 1808) entstand ein enormer inneramerikanischer Sklavenhandel. Zwischen 1820 und 1860 wurden schätzungsweise über eine Million Menschen gewaltsam aus dem oberen Süden in den tiefen Süden verlegt. New Orleans, Natchez und Memphis waren Hauptmärkte; Händler organisierten „coffles“ und Auktionen, die Familien systematisch trennten. Im Roman werden Verkäufe nach New Orleans, Auktionsszenen und die Zerstörung von Familienverbänden zentral inszeniert. Diese Darstellungen basieren auf zeitgenössischen Praktiken und verankern die Fiktion in den dokumentierten Mechanismen des Binnenhandels.
Die Zucker- und Baumwollplantagen Louisianas bildeten ein besonders gewaltsames Arbeitsregime, vor allem während der Zuckerernte (Mahlzeit) in den Parishes südlich von New Orleans. Hohe Arbeitsintensität, Tropenkrankheiten und Kapitaldruck führten zu überdurchschnittlicher Sterblichkeit. Der Red-River-Raum verband Baumschulen, Baumwollentkörnung und Dampfschifffahrt. Im Roman wird die Plantage eines besonders brutalen Besitzers in Louisiana als Endpunkt des „Verkaufs nach Süden“ gezeichnet. Diese Zuspitzung reflektiert Berichte über Gewalt, Überwachung und Isolierung auf abgelegenen Gütern des tiefen Südens, die in Reiseberichten, Gerichtsakten und Sklavennarrativen der 1830–1850er Jahre belegbar sind.
Der Kompromiss von 1850 reagierte auf Konflikte nach dem Mexikanisch-Amerikanischen Krieg (1846–1848): Kalifornien trat als Freistaat bei; das Sklavereigewerbe im District of Columbia wurde eingeschränkt; Texas’ Grenzen wurden geregelt. Kern der Südstaatenkonzession war jedoch ein verschärftes Bundesflüchtlingsgesetz. Diese Gesetzespakete sollten die Union stabilisieren, verschärften aber die Fronten. Der Roman entstand in unmittelbarer Resonanz auf diese Lage: Er schildert moralische Dilemmata freier Staaten, wenn Bundesrecht Sklavenjagden legitimiert, und zeigt Grenzräume, in denen persönliche, religiöse und gesetzliche Pflichten kollidieren.
Der Fugitive Slave Act von 1850 machte Fluchthilfe bundesweit strafbar, schuf US-Kommissare mit erweiterten Befugnissen und verweigerte Beschuldigten das Geschworenengericht sowie Zeugnisrechte. Geldanreize setzten auf Rückführung: Kommissare erhielten höhere Gebühren bei Feststellung einer „Eigentumsansprache“. Staaten wurden faktisch in die Durchsetzung privater Eigentumsansprüche einbezogen. Diese Bestimmungen sind der stärkste unmittelbare Auslöser des Romans. Szenen der Verfolgung, die Gefährdung freier Schwarzer und die Erpressbarkeit weißer Helfer spiegeln die rechtliche Architektur des Gesetzes, das Gewissenskonflikte in Kirchen, Familien und Gemeinden eskalierte.
Frühe Durchsetzungsfälle prägten die öffentliche Wahrnehmung: die Befreiung Shadrach Minkins’ aus US-Gewahrsam in Boston am 15. Februar 1851 und die Rückführung Thomas Sims’ im April 1851 unter Militärschutz. Solche Fälle veranschaulichten die föderale Durchgriffsmacht in freien Städten und provozierten Widerstand sowie Personal-Liberty-Gesetze in einigen Nordstaaten. Der Roman verarbeitet diese Spannung, indem er Flucht, Schutz in freien Territorien und die Reichweite bundesstaatlicher Eingriffe verknüpft. Elizas riskante Passage über den zugefrorenen Ohio steht für die Dringlichkeit, der staatlichen Zugriffsmacht zu entkommen, bevor juristische Mechanismen greifen.
Der Fugitive Slave Act traf auch freie Schwarze: Kidnapping nahm zu, Beweislasten lagen praktisch bei den Beschuldigten. Bereits Prigg v. Pennsylvania (1842) hatte Staatenrechte beschnitten; 1850 verschoben sich die Gewichte noch weiter. Die Angst vor Übergriffen und rechtlicher Entrechtung durchdrang schwarze Gemeinden im Norden. Der Roman betont diesen Druck, indem er zeigt, wie selbst in freien Räumen Unsicherheit herrscht und wie christliche Netzwerke versuchen gegenzuhalten. Die wiederholte Konfrontation mit „gesetzlich gedeckter“ Unmoral macht das Werk zu einer direkten Kritik an der juristischen Infrastruktur der Sklaverei und ihren bundesweiten Konsequenzen.
Das Netzwerk der Underground Railroad wuchs seit den 1820er Jahren, getragen von Quäkern, freien Schwarzen und evangelikalen Reformern. Knotenpunkte waren Cincinnati (Ohio), Ripley (Ohio) mit John Rankin, und Newport/Fountain City (Indiana) mit Levi Coffin, der ab 1847 in Cincinnati wirkte. Routen führten über Seenhäfen Richtung Kanada. Im Roman erscheinen Quäker als Helfer, Verstecke, „safe houses“ und koordinierte Transporte. Diese Darstellungen entsprechen dokumentierten Praktiken und spiegeln Stowes persönliche Kenntnis aus ihrer Zeit in Cincinnati (1832–1850), wo sie direkte Begegnungen mit Geflüchteten hatte und Berichte aus ersten Händen kannte.
Die abolitionistische Bewegung formierte sich institutionell mit der Gründung der American Anti-Slavery Society 1833; William Lloyd Garrisons Zeitung The Liberator erschien seit 1831. Öffentliche Petitionen, Vortragsreisen ehemaliger Versklavter und Frauenvereine verbreiteten die Botschaft. Transatlantische Verbindungen zur britischen Abschaffung (Slavery Abolition Act, 1833) lieferten moralische Vergleichsmaßstäbe. Stowe entstammte einem reformevangelikalen Milieu; ihr Vater Lyman Beecher war ein prominenter Prediger. Der Roman verdichtet die Argumente der Bewegung, indem er Gewissensappelle, Zeugnisse über Gewalt und den Vorrang christlicher Ethik vor Eigentumsrechten literarisch zu einem zugänglichen historischen Panorama verbindet.
Cincinnati war in den 1830er/1840er Jahren ein Brennpunkt: Grenzlage zu Kentucky, wirtschaftliche Verflechtung und wiederholte Unruhen. 1834 führten die Lane-Debatten am Lane Theological Seminary über Sklaverei und Emanzipation zur Abwanderung radikaler Studenten nach Oberlin. 1836 zerstörten Mobs die Druckerei James G. Birneys (The Philanthropist). 1841 kam es erneut zu rassistischen Ausschreitungen. Stowe lebte in dieser Stadt und erlebte Gewalt, Debatten und Fluchthilfe aus nächster Nähe. Der Roman spiegelt diese Erfahrungen, indem er soziale Spannungen, Mobgewalt und die Ambivalenz nördlicher Städte gegenüber Schwarzen realistisch und konkret nachzeichnet.
Das Supreme-Court-Urteil Prigg v. Pennsylvania (1842) erklärte staatliche Hindernisse gegen die Rückführung entflohener Sklaven teils verfassungswidrig und betonte die Bundeskompetenz. Gleichzeitig ließ es Raum für die Weigerung der Bundesstaaten, Ressourcen für die Vollstreckung bereitzustellen (Vorläufer des „anti-commandeering“). Dieses Spannungsfeld befeuerte den Konflikt zwischen Bundesrecht und Staatengesetzen, den der Kongress 1850 zugunsten einer schärferen Bundesdurchsetzung entschied. Der Roman reflektiert diese juristische Gemengelage, indem er Grenzsituationen auslotet, in denen Nachbarn, Polizisten und Richter vor moralisch-rechtlichen Paradoxien stehen, die aus widersprüchlichen Souveränitätsansprüchen resultieren.
Sklavennarrative prägten seit den 1830er Jahren das öffentliche Wissen: Frederick Douglass’ Narrative (1845) und Josiah Hensons Autobiographie (1849) lieferten detaillierte Berichte über Arbeit, Gewalt und Flucht. Hensons Lebensgeschichte, die Deportation nach Süden und die Familienzerreißung, bot Motive, die Stowe kannte. Sie sammelte zudem Berichte von Geflüchteten in Ohio und publizierte 1853 A Key to Uncle Tom’s Cabin als Dokumentationsband. Im Roman werden konkrete Praktiken – Auktionen, Kettenmärsche, Plantagenregime – mit erzählerischer Kraft verdichtet und stehen in enger Beziehung zu den belegten Erfahrungen, die diese Narrative verbreiteten.
Die Kolonisationsbewegung (American Colonization Society, 1816) propagierte die Auswanderung freier Schwarzer nach Afrika; 1822 entstand die Kolonie Liberia, 1847 erklärte sie ihre Unabhängigkeit. Befürworter sahen darin eine Lösung rassischer Konflikte, Kritiker erkannten eine Umgehung der Gleichberechtigung in den USA. Im Roman entscheidet sich George Harris nach der Flucht für den Weg nach Liberia. Diese Handlung verweist auf die zeitgenössische Debatte zwischen Gradualismus/Colonization und unmittelbarer Gleichberechtigung. Die Nennung konkreter Ziele und Wege verankert die Fiktion in realen Programmen, Vereinen und Häfen, über die Ausreisen in den 1840er/1850er Jahren organisiert wurden.
Das Buch fungiert als politische Anklage, indem es die Sklaverei als rechtlich gestütztes System moralischer Perversion offenlegt. Es kritisiert Bundesgesetzgebung, die Eigentum über Person stellt, und entlarvt die Selbstrechtfertigungen von Kirche, Staat und Markt. Durch Familienzerreißung, sexualisierte Gewalt, religiöse Heuchelei und ökonomischen Zwang werden strukturelle Ungerechtigkeiten sichtbar, nicht bloß individuelles Fehlverhalten. Indem Figuren in Grenzsituationen gestellt werden, zwingt der Text Leserinnen und Leser, zwischen Gesetzestreue und Gewissen zu wählen, und macht die politische Frage der Zeit – den Vorrang von Menschenrechten – als soziale Realität erfahrbar.
Zugleich beleuchtet das Werk die Verflechtung von Kapitalismus, Rassismus und Föderalismus: Plantagenkredite, Flusshandel und städtische Märkte bilden die materielle Grundlage der Sklaverei; Gerichte und Kommissare geben ihr juristische Form; Kirchen und Familien legitimieren oder widerstehen. Die Darstellung der Quäkerhilfe, der Komplizenschaft mancher Behörden und der Gewalt der Märkte richtet sich gegen Klassenprivilegien und die politische Macht der Sklavenhalteroligarchie. Damit wird der Roman zu einer Intervention in die öffentliche Sphäre seiner Zeit: Er verschiebt Empathie, stellt Loyalitäten infrage und fordert, soziale Normen und Gesetze nach ihrer Gerechtigkeit, nicht nach ihrer bloßen Legalität, zu beurteilen.
Autorenbiografie
Harriet Beecher Stowe (1811–1896) war eine amerikanische Autorin des 19. Jahrhunderts, deren Werk die Antisklaverei-Bewegung prägte und Debatten über Moral, Religion und Gesellschaft transatlantisch befeuerte. Bekannt wurde sie vor allem durch den Roman Onkel Toms Hütte, der in den Vereinigten Staaten und in Großbritannien enorme Reichweiten erzielte und das Genre des sentimentalen Reformromans popularisierte. Stowe verband erzählerische Empathie mit religiös begründeter Appellrhetorik und zielte darauf, öffentliche Meinung zu bewegen. Ihre Karriere umspannt Romane, Erzählungen, Essays, Reise- und Sachprosa, wobei sie Themen wie Gewissen, häusliche Tugend, religiöse Erweckung und die sozialen Realitäten Neuenglands und des amerikanischen Südens bearbeitete.
Geboren in Connecticut und ausgebildet in Neuengland, besuchte Stowe das Hartford Female Seminary, eine damals fortschrittliche Bildungsanstalt für Frauen, an der sie auch zeitweise unterrichtete. Ihr intellektuelles Umfeld war vom Protestantismus, den Erweckungsbewegungen und einem ausgeprägten Reformethos geprägt. Aufenthalte im Grenzraum zwischen freien und sklavenhaltenden Bundesstaaten, insbesondere in Cincinnati, schärften ihren Blick für die Widersprüche der Nation. Literarisch knüpfte sie an populäre Formen der Zeit an, darunter die häusliche Erzähltradition und den moralischen Appellroman, und sie rezipierte Berichte ehemals Versklavter sowie abolitionistische Dokumentationen, die ihre Recherchepraxis und ihre spätere Argumentationsweise sichtbar beeinflussten.
Stowe begann früh mit Zeitschriftenbeiträgen und Erzählungen, in denen sie lokale Sitten, religiöse Konflikte und Fragen der sozialen Gerechtigkeit auslotete. Ein erstes Buchprofil gewann sie mit The Mayflower; or, Sketches of Scenes and Characters among the Descendants of the Pilgrims (1843), das Neuengland-Themen in anekdotischer Form bündelte. Ihre Mitarbeit an periodischen Publikationen verschaffte ihr handwerkliche Sicherheit und ein Gespür für serielles Erzählen. In dieser Phase entwickelte sie die Verbindung von anschaulicher Alltagsschilderung, biblischer Symbolik und einem klaren moralischen Appell, die ihr Werk kennzeichnen sollte. Sie professionalisierte sich als Schriftstellerin, ohne den pädagogischen Anspruch und die religiöse Ausrichtung ihrer Prosa zu verlieren.
Der Durchbruch gelang mit Uncle Tom’s Cabin, das 1851/52 zunächst als Fortsetzungsroman in der abolitionistischen Wochenzeitung The National Era erschien und 1852 als Buch veröffentlicht wurde. Das Werk löste heftige Reaktionen aus: begeisterte Zustimmung bei Gegnern der Sklaverei und scharfe Ablehnung bei deren Befürwortern. Stowe reagierte 1853 mit A Key to Uncle Tom’s Cabin, einer quellengestützten Dokumentation, die ihre Darstellungen untermauerte. Lesereisen und öffentliche Vorträge, auch in Großbritannien, verstärkten die Verbreitung. Zeitgenössische Bühnenfassungen trugen zur Popularität bei, wobei die Autorin den moralischen Kern des Romans stets als Appell an Empathie, Verantwortung und christliche Nächstenliebe verstand.
Auf den Antisklavereiroman folgten Werke, die die Thematik vertieften oder andere Facetten der amerikanischen Gesellschaft beleuchteten. Dred: A Tale of the Great Dismal Swamp (1856) griff erneut die Gewaltstrukturen der Sklaverei auf und kombinierte Spannung mit politischer Argumentation. Mit The Minister’s Wooing (1859) wandte sie sich neuenglischer Religionsgeschichte und Alltagskultur zu. In The Pearl of Orr’s Island (1862) und Agnes of Sorrento (1862) verknüpfte sie Landschafts- und Frömmigkeitsmotive mit Fragen persönlicher Bewährung. Diese Bücher festigten ihren Ruf als Autorin, die populäre Formen für moralische und gesellschaftliche Selbstverständigungen zu nutzen verstand, ohne die narrative Anschaulichkeit preiszugeben.
In den Jahren nach dem Bürgerkrieg konzentrierte sich Stowe verstärkt auf Neuengland-Stoffe, Erzählzyklen und Haus- und Lebenslehre. Oldtown Folks (1869), Oldtown Fireside Stories (1872) und Poganuc People (späte 1870er-Jahre) verbinden Erinnerung, lokale Geschichte und Sittenbeobachtung. Mit The American Woman’s Home (1869), gemeinsam mit Catharine E. Beecher, entwarf sie ein einflussreiches Handbuch häuslicher Ökonomie und Erziehungsideen. Reise- und Landeskunde verband sie in Palmetto Leaves (1873), das Eindrücke aus Florida festhält. Ihre Stellungnahmen erreichten auch die literarische Öffentlichkeit, etwa mit Lady Byron Vindicated (1870), das eine internationale Debatte über Eheethik, Autorschaft und Wahrheitsanspruch biografischer Darstellung auslöste.
Stowes spätere Jahre waren von anhaltender publizistischer Aktivität, Reisen zwischen Neuengland und dem Süden sowie wachsender öffentlicher Verehrung, aber auch kritischer Lektüre geprägt. Sie starb 1896 in Hartford. Ihr Vermächtnis ist ambivalent produktiv: Uncle Tom’s Cabin bleibt ein Schlüsseldokument der antisklavereilichen Literatur und ein Katalysator politischer Diskussion, zugleich diskutiert die Forschung die Grenzen des sentimentalen Modells und problematische Stereotype. Viele ihrer Schriften sind weiterhin im Druck, Gegenstand universitärer Lehre und kulturhistorischer Ausstellungen. Stowe gilt als Beispiel dafür, wie populäre Prosa gesellschaftliche Debatten formen und langfristig literarische Traditionen beeinflussen kann.
Onkel Toms Hütte (Illustrierte Ausgabe)
1. Kapitel Ein Menschenfreund
Inhaltsverzeichnis
Spät nachmittags an einem kalten Februartage saßen zwei Gentlemen in einem gut ausmöblierten Speisesaal in der Stadt P. in Kentucky bei ihrem Weine. Bediente waren nicht anwesend, und die beiden Herren schienen mit dicht aneinander gerückten Stühlen etwas mit großem Interesse zu besprechen.
Wir haben bisher, um nicht umständlich zu sein, gesagt, zwei Gentlemen. Eine der beiden Personen schien jedoch bei genauerer Prüfung strenggenommen nicht unter diese Kategorie zu gehören. Es war ein kleiner, untersetzter Mann mit groben, nichtssagenden Zügen und dem prahlerischen und anspruchsvollen Wesen, das einem Niedrigstehenden eigen ist, der sich in der Welt emporzuarbeiten versucht. Er war sehr herausgeputzt und trug eine grell bunte Weste, ein blaues Halstuch mit großen gelben Tupfen und zu einer renommistischen Schleife geschlungen, die zu dem ganzen Aussehen des Mannes vortrefflich paßte. Die großen und gemeinen Hände waren reichlich mit Ringen besteckt, und mit einer schweren, goldenen Uhrkette mit einem ganzen Bündel großer Petschafte von allen möglichen Farben pflegte er im Eifer der Unterhaltung mit offenbarem Behagen zu spielen und zu klappern. In seiner Rede bot er ungeniert und mutvoll der Grammatik Trotz und verbrämte sie in geeigneten Zwischenräumen mit passenden Flüchen, welche niederzuschreiben uns selbst nicht der Wunsch, graphisch zu sein, vermögen wird.
Der andere, Mr. Shelby, hatte das Äußere eines Gentlemans, und die Anordnungen des Hauses und seine wirtschaftliche Einrichtung machten den Eindruck von Wohlhabenheit und sogar Reichtum. Wie wir schon vorhin sagten, beide waren in ein ernstes Gespräch vertieft.
»So würde ich die Sache abmachen«, sagte Mr. Shelby.
»Auf diese Weise kann ich das Geschäft nicht abschließen – es ist rein unmöglich, Mr. Shelby«, sagte der andere und hielt ein Glas Wein gegen das Licht.
»Ich sage Ihnen, Haley, Tom ist ein ganz ungewöhnlicher Kerl; er ist gewiß diese Summe überall wert – er ist ordentlich, ehrlich, geschickt und verwaltet meine Farm wie eine Uhr.«
»Sie meinen so ehrlich, wie Nigger[2] sind«, sagte Haley und schenkte sich ein Glas Branntwein ein.
»Nein, ich meine wirklich, Tom ist ein guter, ordentlicher, verständiger, frommer Bursche. Er lernte seine Religion vor vier Jahren bei einem Camp-Meeting[1]; und ich glaube, er hat sie wirklich gelernt. Ich habe ihm seitdem alles, was ich habe, anvertraut – Geld, Haus, Pferde, undhabe ihn frei im Lande herumgehen lassen und habe ihn stets treu und ordentlich gefunden.«
»Manche Leute glauben nicht, daß es fromme Nigger gibt, Shelby«, sagte Haley, »aber ich glaube es. Ich hatte einen Burschen in der letzten Partie, die ich nach Orleans brachte, den beten zu hören, war wahrhaftig so gut, als ob man in einem Meeting wäre; und er war ganz ruhig und sanft. Er brachte mir auch ein gut Stück Geld ein; denn ich kaufte ihn billig von einem Manne, der losschlagen mußte, und ich kriegte 600 für ihn. Ja, ich betrachte Religion für eine wertvolle Sache bei einem Nigger, wenn sie wirklich echt ist.«
»Nun, bei Tom ist sie echt, wenn sie jemals echt war«, war die Antwort.
»Letzten Herbst ließ ich ihn allein nach Cincinnati gehen, um für mich Geschäfte abzumachen und 500 Dollar zurückzubringen. ›Tom‹, sagte ich zu ihm, ›ich traue dir, weil ich glaube, du bist ein Christ – ich weiß, du wirst mich nicht hintergehen.‹ Und Tom kommt auch wirklich zurück – ich wußte, daß er das tun würde. Einige schlechte Kerle, hörte ich, sagten zu ihm: ›Tom, warum machst du dich nicht nach Kanada auf die Beine?‹ – ›Ach, Master hat mir Vertrauen geschenkt, und ich könnte es nicht!‹ Man hat mir alles erzählt. Es tut mir leid, Tom zu verkaufen, das gestehe ich[1q]. Sie sollten mit ihm den ganzen Rest der Schuld getilgt sein lassen; und Sie würden es, Haley, wenn Sie nur einen Funken Gewissen hätten.«
»Nun, ich habe genausoviel Gewissen, als ein Geschäftsmann vertragen kann – ein klein wenig, um darauf zu schwören, wissen Sie«, sagte der Handelsmann scherzend, »und dann bin ich bereit, alles, was man verständigerweise erlangen kann, zu tun, um Freunden gefällig zu sein; aber das hier ist ein bißchen zu viel verlangt – ein bißchen zu viel.«
Der Handelsmann seufzte nachdenklich und schenkte sich noch ein Glas Branntwein ein.
»Nun, Haley, was machen Sie denn für einen Vorschlag?« sagte Mr. Shelby nach einer gelegenen Pause im Gespräch.
»Können Sie denn nicht noch einen Jungen oder ein Mädchen zu Tom zugeben?«
»Hm! – Ich könnte keinen gut entbehren, um Ihnen die Wahrheit zu sagen, nur die äußerste Not bringt mich dazu, überhaupt zu verkaufen. Ich gebe ungern einen meiner Leute hin, das ist die Sache.«
Hier ging die Tür auf, und ein kleiner Quadroonknabe, zwischen 4 und 5 Jahre alt, trat ins Zimmer. Es lag in seiner Erscheinung etwas merkwürdig Schönes und Gewinnendes. Das schwarze, seidenweiche Haar wallte in glänzenden Locken um das runde Gesicht mit Grübchen in Kinn und Wangen, während ein paar große dunkle Augen voll Feuer und Sanftheit unter den vollen, langen Wimpern hervorsahen, wie er neugierig in das Zimmer lugte. Eine bunte, rot und gelb karierte Kutte, sorgfältig gearbeitet und hübsch gemacht, hob den dunklen und reichen Stil seiner Schönheit noch mehr hervor, und eine gewisse komische Miene von Sicherheit mit Verschämtheit verbunden zeigte, daß es ihm nicht ungewohnt war, von seinem Herrn gehätschelt und beachtet zu werden.
»Heda! Jim Crow!« sagte Mr. Shelby, indem er dem Knaben pfiff und ihm eine Weintraube zuwarf. »Hier nimm das!«
Mit aller Kraft seiner kleinen Beine lief das Kind nach der Traube, während sein Herr lachte.
»Komm zu mir, Jim Crow«, sagte er.
Das Kind kam zu ihm, und der Herr streichelte den Lockenkopf und griff ihm unter das Kinn.
»Nun, Jim, zeige diesem Herrn, wie du tanzen und singen kannst.«
Der Knabe fing an, eines der unter Negern üblichen wilden und grotesken Lieder mit einer vollen klaren Stimme zu singen und begleitete den Gesang mit vielen komischen Bewegungen der Hände, der Füße und des ganzen Körpers, wobei er mit der Musik auf das strengste Takt hielt.
»Bravo!« sagte Haley und warf ihm das Viertel einer Orange zu.
»Nun, Jim, zeige uns einmal, wie der alte Onkel Cudjoe geht, wenn er die Gicht hat«, sagte sein Herr.
Auf der Stelle nahmen die biegsamen Glieder des Kindes den Anschein von Gebrechlichkeit und Verkrüppelung an, wie es mit gekrümmtem Rücken und den Stock des Herrn mit der Hand im Zimmer herumhumpelte, das kindische Gesicht in kläglichem Jammer verzogen, und bald rechts, bald links spuckend, ganz wie ein alter Mann.
Beide Herren lachten hell auf.
»Nun, Jim«, sagte sein Herr, »zeige uns, wie der alte Älteste Robbins den Psalm vorsingt.«
Der Knabe zog sein rundes Gesichtchen zu einer schrecklichen Länge und fing an, eine Psalmenmelodie mit unzerstörbarem Ernst durch die Nase zu singen.
»Hurra! Bravo! Was für ein Blitzkerlchen!« sagte Haley. »Das Bürschchen ist ja prächtig. Ich will Ihnen was sagen«, sagte er und schlug Mr. Shelby auf die Schulter, »geben Sie das Kerlchen zu, und das Geschäft soll abgemacht sein. Das ist doch gewiß anständig, nicht wahr?«
In diesem Augenblick wurde die Tür leise geöffnet, und ein junges Quadroonweib, dem Anschein nach ungefähr 25 Jahre alt, trat ins Zimmer.
Man brauchte bloß das Kind und sie anzusehen, um in ihr sogleich die Mutter zu erkennen. Dasselbe große, volle, schwarze Auge mit den langen Wimpern, dasselbe seidenweiche, schwarze, lockige Haar. Ihre braunen Wangen röteten sich merklich, und die Glut wurde noch tiefer, als sie den Blick des Fremden in kecker und unverhohlener Bewunderung auf sich ruhen sah. Ihr Kleid saß wie angegossen und hob die schönen Verhältnisse ihrer Gestalt vortrefflich hervor. Eine kleine, schön geformte Hand und ein zierlicher Fuß waren Einzelheiten, welche dem raschen Auge des Handelsmannes, der gewöhnt war, mit einem Blick die Schönheiten einer vortrefflichen weiblichen Ware abzuschätzen, nicht entgingen.
»Nun, Elisa?« sagte ihr Herr, als sie stehen blieb und ihn zögernd anblickte.
»Ich suchte Harry, Sir, wenn Sie erlauben«, und der Knabe sprang auf sie zu und zeigte ihr die geschenkten Früchte, die er im Schoß seiner Kutte trug.
»Nun, so nimm ihn mit«, sagte Mr. Shelby, und sie entfernte sich rasch, das Kind auf dem Arm tragend.
»Beim Jupiter!« sagte der Handelsmann und wendete sich voll Bewunderung gegen ihn. »Das ist ein Stück Ware! Mit dem Mädchen können Sie jeden Tag in Orleans zum reichen Mann werden. Ich habe zu meiner Zeit mehr als tausend Dollar für Mädchen zahlen sehen, die nicht ein bißchen hübscher waren.«
»Ich mag an ihr nicht zum reichen Mann werden«, sagte Mr. Shelby trocken und entkorkte eine frische Flasche Wein, indem er den andern frug, wie das Getränk ihm schmecke, um dem Gespräch eine andere Richtung zu geben.
»Vortrefflich, Sir – prima Ware!« sagte der Handelsmann; dann schlug er wieder Shelby vertraulich auf die Schulter und setzte hinzu: »Wollen wir ein Geschäft mit dem Mädchen machen? Was soll ich dafür bieten? Was wollen Sie haben?«
»Mr. Haley, sie ist nicht zu verkaufen«, sagte Shelby, »meine Frau würde sie nicht für ihr Gewicht in Gold hingeben.«
»Ja, ja, das sagen die Weiber immer, weil sie nichts vom Rechnen verstehen. Man zeige ihnen nur, wieviel Uhren, Federn und Schmucksachen man für jemandes Gewicht in Gold kaufen kann, und das würde die Sache gleich anders machen, rechne ich.«
»Ich sage Ihnen, Haley, es kann nicht davon die Rede sein. Ich sage nein, und ich meine nein«, sagte Shelby mit Entschiedenheit.
»Nun, dann bekomme ich aber den Knaben, nicht wahr?« sagte der Handelsmann. »Sie müssen gestehen, daß ich ziemlich anständig für ihn geboten habe.«
»Aber was wollen Sie denn mit dem Kinde machen?« sagte Shelby.
»Nun, ich habe einen Freund, der sein Geschäft beginnen will und hübsche Knaben kaufen möchte, um sie für den Markt aufzuziehen. Ganz und gar ein Modeartikel – man verkauft sie als Bediente usw. an reiche Kerle, die hübsche Kerle bezahlen können. Es putzt ein großes vornehmes Haus, wenn so ein wirklich schöner Bursche die Tür öffnet und aufwartet. Sie werden gut bezahlt; und der kleine Teufel ist ein so komisches, musikalisches Kerlchen, daß er vortrefflich passen würde.«
»Ich möchte ihn lieber nicht verkaufen«, sagte Mr. Shelby gedankenvoll. »Die Sache ist, Sir, ich bin ein menschlicher Mann und kann es nicht über mich bringen, den Knaben seiner Mutter zu nehmen.«
»O wirklich – hm! Ja – das ist so eine Sache. Ich verstehe vollkommen. Es ist manchmal verwünscht eklig, mit Weibern durchzukommen. Wenn sie erst zu schreien und zu heulen anfangen, kann ich es nicht ausstehen. Das ist verwünscht eklig; aber wie ich die Sache einrichte, vermeide ich das gewöhnlich, Sir. Wenn Sie nun das Mädchen auf einen Tag oder eine Woche fortschickten? Da läßt sich die Sache ganz ruhig abmachen – und alles ist vorbei, wenn sie wiederkommt. Ihre Frau schenkt ihr dann noch ein Paar Ohrringe oder ein neues Kleid oder so was zur Entschädigung.«
»Ich fürchte, das geht nicht.«
»Ich sage Ihnen, es geht! Diese Leute sind nicht wie die Weißen, müssen Sie wissen; sie halten es aus, wenn man es nur recht anfangt. Sehen Sie«, sagte Haley und nahm eine aufrichtige und vertrauliche Miene an, »die Leute sagen, diese Art Handel mache die Menschen hartherzig; aber ich habe das nie gefunden. Die Sache ist, daß ich mich nie dazu bringen konnte, das Ding anzugreifen, wie es manche Burschen tun. Ich habe gesehen, wie einer Frau das Kind aus den Armen gerissen und verauktioniert wurde, während sie die ganze Zeit über jammerte und schrie wie verrückt; – sehr schlechte Politik – macht sie manchmal ganz untauglich zum Verkauf. Ich weiß von einem wirklich schönen Mädchen in Orleans, das durch so ein Verfahren ganz und gar ruiniert wurde. Der Mann, der das Weib kaufen wollte, wollte ihr Kind nicht haben, und sie war eine von der rechten, stürmischen Art, wenn ihr Blut einmal in der Hitze war. Ich sage Ihnen, sie drückte das Kind an ihre Brust und schwatzte und machte einen grauenhaften Lärm. Die Haut schauert mir noch, wenn ich daran denke; und als sie das Kind wegnahmen und sie einsperrten, wurde sie verrückt und starb in acht Tagen. Ein reiner Verlust von 1000 Dollar, Sir, bloß durch solche Behandlung. – Das ist die Sache. Es ist immer das beste, die Sache menschlich zu machen, so ist meine Erfahrung.«
Und der Handelsmann lehnte sich mit einer Miene tugendhafter Entschiedenheit in den Stuhl zurück und schlug die Arme über der Brust zusammen. Offenbar hielt er sich für einen zweiten Wilberforce.
Der Gegenstand schien den Herrn besonders zu interessieren, denn während Mr. Shelby nachdenklich eine Orange schälte, fing Haley mit schicklicher Bescheidenheit, aber als zwänge ihn die Macht der Wahrheit, noch ein paar Worte zu sagen, von neuem an:
»Es nimmt sich nicht gut aus, wenn sich ein Mann selber lobt; aber ich sage es nur, weil es die Wahrheit ist. Ich glaube, ich stehe in dem Ruf, die schönsten Herden Neger auf den Markt zu bringen – wenigstens hat man mir es gesagt, und gibt man es mir einmal zu, so muß es für alle hundertmal gelten –, und stets in gutem Zustand – dick und ansehnlich –, und es gehen mir so wenig zugrunde, als jedem andern Kaufmann in dem Geschäft, und ich schreibe das alles meiner Behandlung zu, Sir, und Menschlichkeit, Sir, möchte ich sagen, ist der große Pfeiler meiner Behandlung.«
Mr. Shelby wußte nicht, was er sagen sollte, und warf daher bloß ein »So?« ein.
»Man hatte mich wegen meiner Ideen ausgelacht und deshalb beredet. Sie sind nicht populär, und sie sind nicht gewöhnlich; aber ich habe an ihnen festgehalten, Sir, ich habe an ihnen festgehalten und habe mich wohl dabei befunden; ja, Sir, sie haben ihre Fahrt bezahlt, kann ich wohl sagen.« Und der Handelsmann lachte über seinen Witz.
Diese Beispiele von Menschlichkeit hatten etwas so Pikantes und Originelles, daß Mr. Shelby nicht umhin konnte, zur Gesellschaft mitzulachen. Vielleicht lachst Du auch, lieber Leser, aber Du weißt, daß heutzutage die Menschlichkeit in einer großen Verschiedenartigkeit seltsamer Gestalten erscheint, und daß menschliche Leute nie müde werden, Sonderbares zu sagen und zu tun.
Mr. Shelbys Lachen ermutigte den Handelsmann, fortzufahren.
»Es ist merkwürdig, aber ich könnte es niemals andern Leuten begreiflich machen. Da war der Tom Loker, mein alter Kompagnon in Natchez unten; der war ein gescheiter Kerl, der Tom, aber ein wahrer Teufel mit den Negern – aus Prinzip müssen Sie wissen, denn ein gutherzigerer Bursche ist nie geboren worden; es war sein System, Sir. Ich habe oft Tom Vorstellungen darüber gemacht. ›Aber, Tom‹, habe ich zu ihm gesagt, ›wenn deine Mädchen schreien und heulen, was nutzt es denn, wenn du ihnen eins über den Kopf gibst und mit der Peitsche unter ihnen herumfährst? 's ist lächerlich‹, sage ich, ›und nützt zu nichts. Ich sehe nicht ein, was ihr Heulen schaden soll?‹ sage ich. ›Es ist Natur, und wenn die Natur sich nicht auf die eine Weise Luft machen kann, so tut sie es auf eine andere; außerdem, Tom‹, sage ich, ›verdirbst du deine Mädchen damit; sie werden kränklich und melancholisch, und manchmal werden sie häßlich, vorzüglich gelbe Mädchen. Warum heiterst du sie nicht lieber auf und sprichst freundlich mit ihnen? Verlaß dich darauf, Tom, ein wenig Menschlichkeit bei passender Gelegenheit reicht viel weiter, als all dein Schimpfen und Prügeln, und es lohnt sich besser‹, sage ich, ›verlaß dich drauf.‹ Aber Tom konnte sich nicht daran gewöhnen, und er verdarb mir so viele Mädchen, daß ich mich von ihm trennen mußte, obgleich er ein gutherziger Kerl und ein tüchtiger Geschäftsmann war.«
»Und finden Sie, daß Ihre Art und Weise, das Geschäft zu machen, bessern Erfolg hat als die Toms?« fragte Mr. Shelby.
»Gewiß, Sir. Sehen Sie, wenn ich irgend kann, nehme ich mich mit den unangenehmen Auftritten, wie mit dem Verkaufen von Kindern und so, ein bißchen in acht, schicke die Mädchen aus dem Wege – aus den Augen, aus dem Sinn, wissen Sie ja –, und wenn es geschehen ist und nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, gewöhnen sie sich natürlich daran. Es ist nicht wie bei den weißen Leuten, die von Haus aus gewöhnt sind, zu erwarten, daß sie ihre Kinder und ihre Weiber behalten werden. Nigger, wissen Sie ja, die ordentlich erzogen sind, erwarten so etwas ganz und gar nicht; darum vertragen sie so etwas leichter.«
»Ich fürchte dann, die meinigen sind nicht ordentlich erzogen«, sagte Mr. Shelby.
»Wohl möglich. Hier in Kentucky verzieht man die Nigger. Sie meinen es gut mit ihnen, aber es ist im Grunde keine wirkliche Güte. Sehen Sie, gegen einen Nigger, der in der Welt herumgestoßen und an Tom und Dick und Gott weiß wen verkauft wird, ist es keine Güte, ihm Ideen und große Erwartungen beizubringen und ihn gut zu erziehen; denn er fühlt das Herumstoßen hernach nur um so tiefer. Ich will darauf wetten, Ihre Nigger würden ganz melancholisch sein an einem Ort, wo ein echter Neger aus den Plantagen singen und jauchzen würde, als wäre er besessen. Natürlich hält jedermann seine Verfahrensweise für die beste, Mr. Shelby, und ich glaube, ich behandle die Neger genausogut, als es der Mühe wert ist, sie zu behandeln.«
»Wohl dem, der mit sich zufrieden ist«, sagte Mr. Shelby mit einem leichten Achselzucken und einigen Empfindungen unangenehmer Art.
»Nun, was meinen Sie?« sagte Haley, nachdem sie beide eine Weile lang schweigend Nüsse gegessen hatten.
»Ich will mir die Sache überlegen und mit meiner Frau sprechen«, sagte Mr. Shelby. »Unterdessen, Haley, wenn Sie die Sache ruhig abgemacht wissen wollen, so ist es das beste, Sie lassen hier herum nicht bekannt werden, weshalb Sie da sind. Es wird sonst unter meinen Burschen ruchbar, und es wird dann nicht besonders leicht sein, einen meiner Kerle fortzuschaffen, das versichere ich Ihnen.«
»O gewiß werde ich mir nichts merken lassen. Aber ich sage Ihnen, ich habe verwünscht wenig Zeit und möchte so bald als möglich wissen, worauf ich mich verlassen kann«, sagte er, indem er aufstand und den Überrock anzog.
»Nun, so kommen Sie diesen Abend zwischen 6 und 7 wieder her, und Sie sollen Antwort haben«, sagte Mr. Shelby, und der Handelsmann entfernte sich grüßend.
»Ich wollte, ich hätte den Kerl die Treppe hinunterwerfen können mit seiner unverschämten Zuversicht«, sagte Mr. Shelby zu sich, als die Tür ordentlich zu war, »aber er weiß, wie sehr er mich in der Hand hat. Wenn mir jemand jemals gesagt hätte, daß ich Tom unten nach dem Süden an einen dieser Kerle verkaufen würde, so hätte ich gesagt: ›Ist dein Diener ein Hund, daß er das tun sollte?‹ Und jetzt muß es geschehn, soweit ich sehen kann. Und auch Elisas Kind! Ich weiß, ich werde darüber einigen Trödel mit meiner Frau haben, und auch wegen Tom. Das kommt von den Schulden – o weh! Der Kerl kennt seinen Vorteil und benutzt ihn aufs äußerste.«
Das Sklavenwesen in seiner mildesten Form ist wahrscheinlich im Staat Kentucky zu finden. Das allgemeine Vorherrschen von Kultursystemen von ruhiger und allmählicher Art, ohne das periodisch eintretende Bedürfnis, die Leute übermäßig zu beschäftigen, welches der landwirtschaftlichen Industrie der südlichen Distrikte eigen ist, macht die Arbeit des Negers zu einer gesunderen oder vernünftigeren, während der Herr, mit einem allmählicheren Erwerb zufrieden, nicht der Versuchung zur Hartherzigkeit ausgesetzt ist, welcher die schwache Menschennatur oft unterliegt, wo der Aussicht auf plötzlichen und raschen Gewinn kein schwereres Gewicht die Waage hält, als die Interessen der Hilflosen und Unbeschützten.
Mr. Shelby war ein Mann, wie man sie oft und stets gern findet, gutherzig und liebevoll und geneigt, seine ganze Umgebung mit freundlicher Nachsicht zu behandeln, und er hatte es nie an etwas fehlen lassen, was zum physischen Wohlsein der Neger auf seiner Besitzung beitragen konnte. Er hatte jedoch stark und unüberlegt spekuliert, war tief verschuldet, und auf ihn laufende Wechsel auf bedeutende Summen waren Haley in die Hände gekommen. Dies wird genügen, um das eben erzählte Gespräch zu erklären. Elisa hatte, während sie sich der Tür näherte, genug von der Unterhaltung gehört, um zu wissen, daß ein Handelsmann ihrem Herrn für jemanden ein Gebot mache.
Sie wäre gern an der Tür stehengeblieben, um zu horchen, als sie draußen war; aber ihre Herrin rief sie gerade, und sie mußte forteilen. Dennoch glaubte sie, den Handelsmann auf ihr Kind bieten gehört zu haben, konnte sie sich geirrt haben? Ihr Herz schwoll und bebte, und sie drückte den Kleinen unwillkürlich so fest an sich, daß er sie erstaunt ansah.
»Elisa, was fehlt dir heute?« sagte ihre Herrin, als sie den Wasserkrug und den Stickrahmen umgeworfen und ihrer Herrin zerstreut einen langen Nachtmantel anstatt des seidenen Kleides, das sie hatte holen sollen, dargereicht hatte.
Elisa schrak auf. »Ach, Missis!« sagte sie und erhob die Augen; dann stürzten ihre Tränen hervor und sie setzte sich auf einen Stuhl und fing an zu schluchzen.
»Aber Elisa, Kind! Was hast du?« sagte ihre Herrin.
»Ach, Missis, Missis!« sagte Elisa. »Ein Handelsmann spricht mit dem Herrn im Speisezimmer! Ich habe es gehört.«
»Nun, was schadet das, Närrchen?«
»Ach, Missis, glauben Sie wohl, daß der Herr meinen Harry verkaufen würde?« Und das arme Mädchen warf sich in einen Stuhl und schluchzte krampfhaft.
»Ihn verkaufen! Nein, du törichtes Mädchen! Du weißt, daß dein Herr niemals mit diesen Handelsleuten aus dem Süden Geschäfte macht und keinen seiner Leute verkauft, solange sie sich gut aufführen. Und wer soll denn deinen Harry kaufen? Meinst du denn, alle Welt ist so vernarrt in ihn wie du? Komm, beruhige dich und hake mir das Kleid zu. So, nun flechte mir das Haar in den hübschen Zopf, den du neulich gelernt hast, und horche nicht mehr an den Türen.«
»Also, Missis, Sie würden niemals Ihre Einwilligung geben, daß . . .«
»Unsinn, Kind! Natürlich würde ich es nicht. Warum sprichst du so? Ebensogut würde ich eins meiner Kinder verkaufen lassen. Aber wahrhaftig, Elisa, du wirst viel zu stolz auf den kleinen Burschen. Es darf nur einer die Nase zur Tür hereinstecken, so glaubst du gleich, er müsse ihn kaufen wollen.«
Wieder beruhigt durch den zuversichtlichen Ton ihrer Herrin setzte Elisa rasch und geschickt ihre Toilettendienste fort und lachte sich selbst aus wegen ihrer Furcht.
Mrs. Shelby war eine Frau von hoher geistiger und sittlicher Bildung. Neben der natürlichen Großmut und dem Edelsinn, welche oft die Frauen von Kentucky auszeichnen, besaß sie ein lebhaftes, sittliches, ein religiöses Gefühl und Grundsätze, die sie mit großer Energie und Geschicklichkeit in praktische Ausübung brachte. Ihr Gatte, der keine besondere Religiosität beanspruchte, hatte doch große Ehrfurcht vor der Konsequenz ihrer religiösen Überzeugung und hatte vielleicht ein wenig Scheu vor ihrer Meinung. Jedenfalls ließ er ihr ganz freie Hand in ihren wohlwollenden Bemühungen um das Wohlbehagen, den Unterricht und die Erziehung ihrer Leute, obgleich er selbst keinen tätigen Anteil daran nahm. Obgleich er nicht gerade an die Lehre von den überflüssigen guten Werken der Heiligen glaubte, so schien er doch im Grunde auf eine oder die andere Weise zu denken, daß seine Frau Frömmigkeit und Wohlwollen genug für zwei habe, und sich mit einer dunklen Hoffnung zu schmeicheln, durch ihren Einfluß an Eigenschaften, auf die er keinen besonderen Anspruch machte, in den Himmel zu gelangen.
Die schwerste Last auf seiner Seele nach seiner Unterredung mit dem Handelsmann war die unvermeidliche Notwendigkeit, seiner Gattin das besprochene Arrangement mitzuteilen und den Vorstellungen und dem Widerstand die Spitze zu bieten, die er schon voraussetzen konnte.
Mrs. Shelby, die von ihres Gatten Geldverlegenheit nicht das mindeste wußte und die nur die allgemeine Gutherzigkeit seines Charakters kannte, war in der vollständigen Ungläubigkeit, mit der sie Elisas Befürchtung aufnahm, ganz aufrichtig gewesen. Wirklich schenkte sie der ganzen Frage keinen einzigen Gedanken mehr; und da sie mit den Vorbereitungen zu einem Abendbesuch beschäftigt war, hatte sie die Sache bald vergessen.
2. Kapitel Der Gatte und Vater
Inhaltsverzeichnis
Mrs. Shelby war zum Besuch ausgefahren, und Elisa stand in der Veranda und sah etwas niedergeschlagen dem verschwindenden Wagen nach, als sie eine Hand auf ihrer Schulter fühlte. Sie drehte sich um, und ein helles Lächeln glänzte sofort in ihren schönen Augen.
»Georg, du bist's? Wie du mich erschreckt hast! Nun, es freut mich, daß du da bist! Missis ist für den Nachmittag ausgefahren: So komm mit in mein Stübchen, wir wollen den ganzen Nachmittag miteinander verbringen.«
Mit diesen Worten zog sie ihren Mann in ein nettes Zimmerchen, das auf die Veranda hinausging, und wo sie gewöhnlich im Bereich der Stimme ihrer Herrin mit Nähen beschäftigt saß.
»Wie froh ich bin! – Warum lächelst du nicht? – Und sieh nur Harry wie – er wächst!« Der Knabe blickte durch seine Locken scheu den Vater an und hielt sich am Rock seiner Mutter fest. »Ist er nicht wunderschön!« sagte Elisa, indem sie ihm die Locken aus dem Gesicht strich und ihn küßte.
»Ich wollte, er wäre nie geboren worden!« sagte George bitter. »Ich wollte, ich wäre selbst nie geboren worden!«
Überrascht und erschrocken setzte sich Elisa hin, legte ihren Kopf auf ihres Gatten Schultern und brach in Tränen aus.
»Ach, Elisa, es ist zu schlecht von mir, dir so weh zu tun, armes Mädchen!« sagte er zärtlich. »Es ist zu schlecht! O wie ich wünsche, ich hätte dich nie gesehen – du hättest glücklich sein können.«
»George, George! Wie kannst du so reden? Was ist Schreckliches geschehen, oder was soll geschehen? Gewiß sind wir sehr glücklich gewesen bis vor ganz kurzem.«
»Jawohl, liebes Weib«, sagte George. Dann nahm er sein Kind auf dieKnie, blickte ihm in die schönen, dunklen Augen und fuhr mit der Hand durch seine langen Locken.
»Ganz dein Gesicht, Elisa, und du bist die schönste Frau, die ich jemals gesehen habe, und die beste, die ich zu sehen wünsche; aber ach ich wünschte, ich hätte dich nie gesehen, und du nie mich!«
»Aber George, wie kannst du so sprechen!«
»Ja, Elisa, es ist alles Jammer, Jammer, Jammer! Mein Leben ist bitter wie Wermut; die Lebenskraft zehrt sich selbst auf in mir. Ich bin ein armes, elendes, unglückliches Packholz: Ich werde dich nur mit mir zu Boden ziehen, weiter nichts. Was nützt es, zu versuchen, etwas zu tun, etwas zu wissen, etwas zu werden? Was nützt es, zu leben? Ich wollte, ich wäre tot!«
»Aber das ist wirklich gottlos, lieber George! Ich weiß, wie dir der Verlust deiner Stelle in der Fabrik zu Herzen geht, und du hast einen harten Herrn; aber bitte, habe Geduld, und vielleicht kann etwas –«
»Geduld!« unterbrach er sie. »Habe ich nicht Geduld gehabt? Habe ich ein Wort gesagt, als er kam und ohne den geringsten Grund mich von einem Platze wegnahm, wo mich jedermann gut behandelte! Ich habe ihm jeden Cent meines Verdienstes gewissenhaft bezahlt, und alle sagen, daß ich ein tüchtiger Arbeiter war.«
»Ja, es ist schrecklich«, sagte Elisa, »aber trotz alledem ist er dein Herr, weißt du.«
»Mein Herr! Und wer hat ihn zu meinem Herrn gemacht? Das ist's, was ich wissen möchte – welches Recht hat er auf mich? Ich bin ein Mensch, so gut wie er; ich bin ein besserer Mensch als er; ich verstehe mehr als er; ich wirtschafte besser als er; ich kann besser lesen als er; ich schreibe eine bessere Hand; und ich habe das alles von selbst gelernt und schulde ihm keinen Dank – ich habe es wider seinen Willen gelernt; und welches Recht hat er nun, aus mir ein Packholz zu machen? – Mich von einer Arbeit zu entfernen, die ich verrichten kann, und zwar besser als er, und mich bei einer anzustellen, die jedes Stück Vieh verrichten kann? Er versucht es und sagt, er will meinen Stolz brechen und mich demütigen, und er gibt mir mit Absicht die gröbste und schlechteste und schmutzigste Arbeit.«
»Ach, George – George, du erschreckst mich! Ich habe dich noch nie so sprechen hören; ich fürchte, du gehst mit etwas Schrecklichem um. Ich wundere mich durchaus nicht über deine Empfindungen; aber ach, sei vorsichtig – sei es um meinetwillen, sei es um Harrys willen!«
»Ich bin vorsichtig gewesen und habe Geduld gehabt; aber es wird schlimmer und schlimmer – Fleisch und Blut können es nicht länger tragen. Er ergreift jede Gelegenheit, um mich zu beschimpfen und zu quälen. Ich glaubte, ich würde meine Arbeit verrichten und mich ruhig halten und einige Zeit übrigbehalten können, um außer den Arbeitsstunden zu lesen und zu lernen; aber je mehr er sieht, daß ich arbeiten kann, desto mehr bürdet er mir auf. Er sagt, obgleich ich nichts äußere, sehe er doch, daß ich den Teufel im Leib habe, und er wolle ihn mir austreiben; und zu seiner Zeit wird er herauskommen in einer Weise, die ihm nicht gefallen wird, oder ich irre mich gewaltig.«
»O Gott, was sollen wir anfangen?« sagte Elisa trauervoll.
»Erst gestern«, sagte George, »als ich eben Steine in einen Karren lud, stand der junge Master Tom da und klatschte mit der Peitsche so nahe beim Pferde, daß es scheute. Ich bat ihn, so freundlich ich konnte, es sein zu lassen, aber nun fing er erst recht an. Ich bat ihn noch einmal, und dann wendete er sich gegen mich und schlug mich. Ich hielt seine Hand fest, und dann schrie er und strampelte und lief zum Vater und sagte, ich hätte ihn geschlagen. Der kam voller Wut herbei und sagte, er wolle mir zeigen, wer der Herr sei; und er band mich an einen Baum und schnitt Ruten für den jungen Herrn ab und sagte ihm, er sollte mich schlagen, bis er müde sei; und er hat es getan. Wenn ich ihm dafür nicht noch einmal ein Denkzeichen gebe!« Und die Stirn des Jünglings verfinsterte sich, und in seinen Augen brannte eine Flamme, welche seine junge Gattin zittern machte. »Wer hat diesen Mann zu meinem Herrn gemacht – das will ich wissen«, sagte er.
»Ach«, sagte Elisa traurig, »ich habe immer geglaubt, ich müßte meinem Herrn und meiner Herrin gehorchen, sonst wäre ich keine gute Christin.«
»In deinem Fall ist doch noch einige Vernunft darin; sie haben dich auferzogen wie ein Kind – haben dich ernährt, gekleidet, gepflegt und unterrichtet, so daß du eine gute Erziehung hast – so haben sie doch Grund zu einem Anspruch auf dich. Aber mich haben sie geschlagen und gestoßen und beschimpft und im besten Falle mir selber überlassen; und was bin ich schuldig? Ich habe für meine Unterhaltung schon mehr als hundertmal bezahlt. Ich ertrage es nicht länger – nein gewiß nicht!« sagte er und ballte mit wilder Gebärde die Faust. Elisa zitterte und schwieg. Sie hatte ihren Gatten früher nie in dieser Stimmung gesehen; und ihre sanften Begriffe von Pflicht schienen sich vor einem solchen Sturm der Leidenschaft wie Binsen zu biegen.
»Du kennst ja den kleinen Carlo, den du mir geschenkt hast«, fuhr George fort. »Er war fast mein einziger Trost. Er schlief des Nachts bei mir und ging mir des Tags auf Schritt und Tritt nach und sah mich an, als ob er wüßte, wie es mir ums Herz war. Nun, neulich gab ich ihm ein paar Abfälle, die ich an der Küchentür aufgelesen hatte, und der Herr kam dazu und sagte, ich fütterte ihn auf seine Kosten, und er hätte das Geld nicht dazu, daß jeder Nigger sich seinen Hund halten könne, und befahl mir, ihm einen Stein an den Hals zu binden und ihn in den Teich zu werfen.«
»Aber George, das hast du doch nicht getan?«
»Ich – nein; aber er. Der Herr und Tom steinigten das arme Tier, wie es im Teiche zappelte. Das arme Tier! Es sah mich so traurig an, als wunderte es sich, daß ich es nicht rettete! Ich mußte mich auspeitschen lassen, weil ich es nicht selbst tun wollte, 's ist mir gleich; Master wird schon entdecken, daß ich nicht einer von denen bin, die das Auspeitschen zahm macht. Auch meine Zeit wird kommen, ehe er sich's versieht.«
»Was hast du im Sinn? Ach George! Tue nichts, was unrecht ist. Wenn du nur Gott vertraust und suchst recht zu tun, so wird er dich erlösen.«
»Ich bin nicht Christ wie du, Elisa; mein Herz ist voller Haß; ich kann nicht auf Gott vertraun. Warum läßt er es so sein?«
»Ach George, wir müssen glauben und vertrauen! Meine Herrin sagt,wenn alles mit uns schlechtgeht, so müssen wir glauben, daß Gott es zum allerbesten lenkt.«
»Das können wohl Leute sagen, die auf ihrem Sofa sitzen und in ihren Kutschen fahren; aber sie sollten nur in meiner Lage sein, und es würde ihnen härter ankommen. Ich wollte, ich könnte gut sein; aber mein Herz brennt und kann sich nicht mehr fügen. Du könntest es auch nicht an meiner Stelle; du wirst es jetzt nicht können, wenn ich dir alles sage, was ich zu sagen habe. Du weißt noch nicht alles.«
»Was hast du noch?«
»Nun, neulich hat Master gesagt, er sei ein Narr gewesen, daß er mich habe von der Plantage wegheiraten lassen; er hasse Mr. Shelby und sein ganzes Geschlecht, weil sie stolz sind und über ihn hinwegsehen, und ich wäre durch dich stolz geworden; und er sagt, er wolle mich nicht mehr hierher gehen lassen, sondern ich solle auf seiner Plantage ein Weib nehmen und dort wohnen. Anfangs schalt er und brummte das vor sich hin; aber gestern sagte er, ich müsse Mina heiraten und mit ihr in eine Hütte ziehen, sonst wolle er mich nach dem Süden verkaufen.«
»Aber du bist mir doch durch den Pfarrer angetraut, so gut, als ob du ein Weißer gewesen wärest!« sagte Elisa.
»Weißt du nicht, daß ein Sklave nicht heiraten kann? Dazu haben wir kein Gesetz hierzulande; ich kann dich nicht als Frau behalten, wenn es ihm einfällt, uns voneinander zu trennen. Deshalb wünsche ich, ich hätte dich nie gesehen; deshalb wünsche ich, ich wäre nie geboren; es wäre besser für uns beide – es wäre besser für dieses arme Kind, wenn es nicht geboren worden wäre. Alles, alles kann ihm noch widerfahren!«
»Ach! Aber Master ist so gut!«