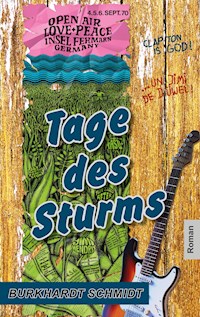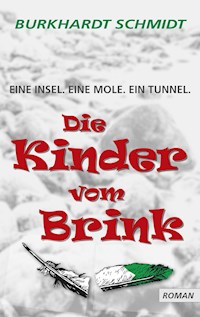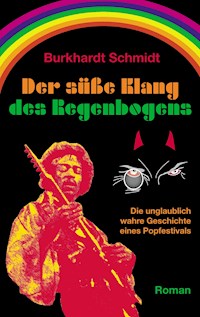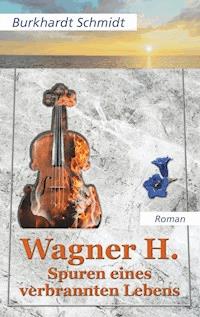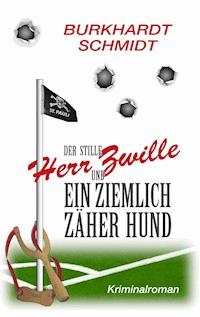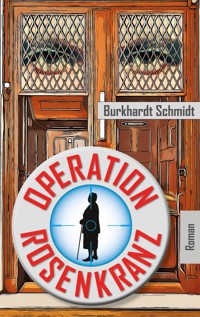
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wir schreiben das Jahr 2022. Das Schreckensregiment des Coronavirus ist beendet, an seine Stelle tritt ein neuer Tyrann. Wladimir Putin, russischer Diktator, überfällt die wehrlose Ukraine. Der deutsche Bundeskanzler spricht von einer Zeitenwende. Damit ist er nicht der Einzige. Auch die Bewohner eines Hauses im Hamburger Generalsviertel sehen sich einer neuen Herausforderung gegenüber. Ihnen wird mitgeteilt, dass ihre Wohnungen verkauft und in luxuriöse Appartements umgewandelt werden sollen. Da sie lange Jahre eine sehr geringe Miete gezahlt haben, gefällt ihnen das ganz und gar nicht. Die Hausgemeinschaft erarbeitet einen Plan zur Abwehr dieses Unterfangens. In Windeseile werden Unterkünfte für eine Handvoll ukrainischer Flüchtlinge in Dachboden und Keller gebaut, um so den Verkauf des Hauses zu erschweren. Ein täuschend echter Paternoster wird gefertigt und in das Erdgeschoss des altehrwürdigen Bürgerhauses platziert. Gutachter des Denkmalschutzamtes bescheinigen dem Haus prompt eine besondere Schutzwürdigkeit. Der Plan scheint aufzugehen. Jedoch - die designierten Käufer des Hauses bleiben skeptisch und versuchen mit allen Mitteln, den vermuteten Schwindel zu entlarven. Das Treiben der Bewohner wird vom Haus gegenüber mit Argusaugen verfolgt. Das eigentliche Ziel des interessierten Zuschauers René Asbahrs ist es, Hermine Grabert, hochbetagte Mieterin im Erdgeschoss des Verkaufobjekts, zu eliminieren. Sie hat zweifelsfrei während des Zweiten Weltkriegs im polnischen KZ Plaszow gewirkt und steht im Verdacht, dort als Leiterin des Frauenlagers Gräueltaten verübt zu haben. Asbahr ist entschlossen, Gerechtigkeit walten zu lassen. Er hat sich bewaffnet und wartet auf einen günstigen Zeitpunkt, die Alte zur Strecke zu bringen. Er gerät an Doktor Cohen, Zahnarzt, Jude und Graberts Nachbar. Im Wartezimmer seiner Praxis erlauscht Asbahr, dass die rüstige Greisin Cohen gebeten hat, sie in die Ukraine zu begleiten, um dort das Grab ihres früheren Geliebten aufzusuchen. Cohen erfährt, dass es sich bei dem ebenfalls um einen Juden gehandelt haben soll. Natalia Bondarenka, die zu den neu einquartierten ukrainischen Flüchtlingen gehört, entdeckt zufällig die Identität Hermine Graberts. So erfährt diese den Bestattungsort ihres damaligen Freundes. Asbahr erkennt seine Chance und folgt Grabert und Cohen nach Lemberg, um dort seinen mörderischen Plan in die Tat umsetzen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Buch
Wir schreiben das Jahr 2022. Das Schreckensregiment des Coronavirus ist beendet, an seine Stelle tritt ein neuer Tyrann. Wladimir Putin, russischer Diktator, überfällt die wehrlose Ukraine.
Der deutsche Bundeskanzler spricht von einer Zeitenwende.
Damit ist er nicht der Einzige. Auch die Bewohner eines Hauses im Hamburger Generalsviertel sehen sich einer neuen Herausforderung gegenüber. Ihnen wird mitgeteilt, dass ihre Wohnungen verkauft und in luxuriöse Appartements umgewandelt werden sollen. Da sie lange Jahre eine sehr geringe Miete gezahlt haben, gefällt ihnen das ganz und gar nicht.
Unter der Führung des Anwalts Hanno Meyer erarbeitet die Hausgemeinschaft einen Plan zur Abwehr dieses Unterfangens.
Man traut es sich kaum zu sagen, aber der Krieg im Osten Europas kommt so gesehen gerade recht. In Windeseile werden Unterkünfte für eine Handvoll ukrainischer Flüchtlinge in Dachboden und Keller gebaut, um so den Verkauf des Hauses zu erschweren. Als flankierende Maßnahme wird aus einem Stapel Bretter ein täuschend echter Paternoster gefertigt und in das Erdgeschoss des altehrwürdigen Bürgerhauses platziert.
Gutachter des Denkmalschutzamtes werden eingeladen, die dem Haus prompt eine besondere Schutzwürdigkeit bescheinigen.
Der Plan scheint aufzugehen.
Jedoch – die designierten Käufer des Hauses bleiben skeptisch und versuchen mit allen Mitteln, den vermuteten Schwindel zu entlarven.
Das emsige Treiben der Bewohner wird vom Haus gegenüber mit Argusaugen verfolgt. Das eigentliche Ziel des interessierten Zuschauers René Asbahrs ist es, Hermine Grabert, hochbetagte Mieterin im Erdgeschoss des Verkaufobjekts, zu eliminieren. Sie hat zweifelsfrei während des Zweiten Weltkriegs im polnischen KZ Plaszow gewirkt und steht im Verdacht, dort als Leiterin des Frauenlagers Gräueltaten verübt zu haben.
Die Genossen um den ehemaligen Hausbesetzer Asbahr sind entschlossen, Gerechtigkeit walten zu lassen, weil sie der deutschen Justiz nicht trauen. Asbahr hat sich bewaffnet und wartet auf einen günstigen Zeitpunkt, die Alte zur Strecke zu bringen.
Heftige Zahnschmerzen sorgen dafür, dass er an Doktor Cohen gerät, Zahnarzt, Jude und Graberts Nachbar. Im Wartezimmer seiner Praxis erlauscht Asbahr, dass die rüstige Greisin Cohen gebeten hat, sie nach Lemberg in den Westen der Ukraine zu begleiten, um dort das Grab ihres früheren Geliebten aufzusuchen. Zu seinem Erstaunen erfährt Cohen, dass es sich bei dem Toten ebenfalls um einen Juden gehandelt haben soll. Natalia Bondarenka, die zu den neu einquartierten ukrainischen Flüchtlingen gehört, entdeckt zufällig die Identität Hermine Graberts. So erfährt diese den Bestattungsort ihres damaligen Freundes.
Asbahr erkennt seine Chance und folgt Grabert und Cohen nach Lemberg.
Dort will er seinen mörderischen Plan in die Tat umsetzen.
Den ukrainischen Flüchtlingen ist es auch zu verdanken, dass die Hamburger Mieter in den Mauern ihres Hauses eine beklemmende Entdeckung machen …
Autor
Burkhardt Schmidt, Jahrgang 1954, lebt mit seiner Ehefrau auf der Insel Fehmarn. »Operation Rosenkranz« ist sein achter Roman.
An den kleinen Radioapparat
Du kleiner Kasten, den ich flüchtend trug
Daß seine Lampen mir auch nicht zerbrächen.
Besorgt vom Haus zum Schiff, vom Schiff zum Zug
Daß meine Feinde weiter zu mir sprächen.
An meinem Lager und zu meiner Pein
Der letzten nachts, der ersten in der Früh
Von ihren Siegen und von meiner Müh:
Versprich mir, nicht auf einmal stumm zu sein!
Text: Bertold Brecht
Musik: Hanns Eisler
SPIEGEL online - Meldung vom 8.4.2025
Die frühere KZ-Sekretärin Irmgard Furchner ist im Alter von 99 Jahren gestorben. Das haben das Landgericht Itzehoe und die Staatsanwaltschaft Itzehoe dem SPIEGEL bestätigt. Zuerst hatte der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag berichtet. Laut einem Sprecher der Staatsanwaltschaft Itzehoe starb Furchner bereits am 14. Januar 2025.
Furchner wurde Ende 2022 wegen Beihilfe zum Mord in 10.505 Fällen und wegen Beihilfe zum versuchten Mord in fünf Fällen verurteilt. Sie erhielt eine Jugendstrafe von zwei Jahren, ausgesetzt zur Bewährung. Furchner hatte zwischen Juni 1943 und April 1945 als Stenotypistin des Lagerkommandanten Paul Werner Hoppe gearbeitet – und damit nach Ansicht des Gerichts bei der systematischen Tötung Tausender Hilfe geleistet.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11: (1982)
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16: (1988)
Kapitel 17: (1988)
Kapitel 18: (1988)
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22: (2017)
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29: (2012)
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 1
23. Juli 1944
Levy, lieber Sohn,
nun ist schon wieder viel Zeit vergangen, seitdem Ludwig meinen letzten Brief in die Poststelle der Bahn gegeben hat und mit leeren Händen zurückkehrte.
Wie immer versucht er, uns Mut zuzusprechen. Das muß nicht heißen, sagt er, daß eurem Sohn etwas zugestoßen ist. Er hat bisher immer recht behalten, trotzdem werden unsere Sorgen nicht geringer. Ich hatte von Anfang an die Befürchtung, daß einmal etwas schiefgehen wird. Was für eine aberwitzige Idee, unseren Briefwechsel über die Post der Nazis abzuwickeln! Irgendwann müssen sie doch merken, daß eine Reichsbahn-Betriebsstelle Ost, Verwaltungsabteilung Krakau, aus einer Handvoll infiltrierter Männer besteht, die nichts anderes tun, als geschmuggelte Post weiterzuleiten.
Also – wieder keine Nachricht von unserem Sohn.
Wie Rebekka läßt sich auch deine Mutter ihre Enttäuschung nie anmerken. Wir alle hoffen, daß es dir gut geht und wir irgendwann wieder einen Brief von dir erhalten.
Levy, BBC meldet gerade, daß die Gegenoffensive der Roten Armee in vollem Gange sei und die Deutschen dabei wären, ein ganzes Heer zu verlieren. Auch der alliierte Feldzug im Westen komme endlich voran. Der Widerstand der Wehrmacht scheint zu erlahmen und wir sind voller Zuversicht, daß dieser schreckliche Krieg bald zu Ende sein wird.
Besonders die Meldung, daß die Russen Galizien zurückerobert haben und nun kurz vor Lemberg zu stehen scheinen, erfüllt uns mit Freude, aber auch mit Sorge. Hat die Reichsbahn am Ende gar »unsere« Poststelle aufgegeben? Das wäre für uns eine Katastrophe! Für mich wird es Zeit, die letzten Resultate nach London durchzugeben, und ich frage mich, ob ich klug handele, jetzt, wo der Sieg so nah ist. Warum alles aufs Spiel setzen? Wir müssen immer noch damit rechnen, daß man unsere Funksignale bemerkt.
Judith ermuntert mich, weiterzumachen. »Es ist zu wichtig, Aaron. Wir dürfen jetzt nicht aufhören!«
Deine Mutter ist mir eine große Stütze in diesen Tagen. Und auch unsere kleine Rebekka zeigt keine Angst. »Wenn sie was bemerkt hätten, Papa, wären wir schon lange verhaftet worden.« Sie ist in diesen wenigen Jahren so reif geworden. Eine Kindheit wie andere Mädchen ihres Alters hat sie nie erfahren dürfen. Das tut mir in der Seele weh, sie aber lächelt nur und sagt: »Es ist alles gut! Wir leben und haben einander.«
Werden wir Ludwig weiter vertrauen können? Er hat uns gesagt, daß die Gestapo Haus für Haus durchsucht und Widerständler am nächsten Baum aufgehängt werden. Mit einem Schild an der Brust: »Ich habe Juden geholfen. Ich bin ein feiger Verräter am deutschen Volk.« Seine Besuche in unserem Versteck! Die Botengänge! Ich bin nicht sicher, ob ich so einen Mut aufbringen würde. Was wäre, wenn man ihm auf die Schliche käme? Er hat schließlich auch eine Familie.
Was wäre, wenn die Polizisten in dieses Gebäude kämen? Ist unser Versteck sicher? Manchmal führen sie Spürhunde mit sich. Die würden uns sogar hinter den dicken Holzwänden wittern und uns den Schergen verraten. »Aber nein, Paps!«, lacht Rebekka. »Warum sollten sie wohl ihre eigene Behörde durchsuchen? Wir sind hier so sicher wie in Abrahams Schoß.«
Ich schaue zur Uhr. Es ist jetzt eine Minute vor zwei. Kurze Zeit später betätige ich den Schalter und zähle bis zwanzig. Unter mir rumpelt es vernehmlich. Hoffentlich ist er da! Dann drehe ich den Schalter zurück. Die Sekunden bis dahin treiben mir stets den Angstschweiß auf die Stirn. Zum Glück ist Harry bisher immer pünktlich gewesen.
Bisher ist alles gut gegangen und, ehrlich gesagt, wundert mich unser anhaltendes Glück. Was wäre, wenn einer der Beschäftigten um diese Zeit noch einmal ins Haus käme? Vielleicht, weil er was vergessen hätte?
»Das ist sehr unwahrscheinlich, Aaron«, versucht mich Ludwig zu beruhigen, wenn ich ihm gegenüber solche Zweifel äußere. »Die sind froh, wenn sie die Behörde am Abend verlassen können, glaub es mir.« Außerdem habe man ihm verraten, daß die Amtsstelle in Kürze aufgegeben und ihm das Haus wieder überlassen wird. »Stell dir vor, mein Freund, hier können bald wieder normale Mieter wohnen, und wenn der Krieg endlich vorbei ist, müßt ihr euch auch nicht mehr verstecken. Ich werde euch auf jeden Fall eine der Wohnungen überlassen. Von Bomben sind wir ja bisher zum Glück verschont geblieben.«
Er klingt optimistisch, mein alter Freund Ludwig. Und er tut so viel für uns! Dabei ist es wirklich gefährlich, Juden zu helfen, egal, wieviel die für Deutschland geleistet haben.
»Da bin ich.« Harry sieht zu mir herauf und lächelt. Dann wartet er, bis er ganz oben angekommen ist. Sofort macht er sich an die Arbeit und räumt die Sachen in den Raum. Zum Glück ist er sehr schlank. Schlank, aber kräftig. Und er weiß, wo die Waren ihren Platz haben und uns nicht stören.
Wie immer habe ich ein schlechtes Gewissen, weil Harry sich von mir nicht helfen läßt, aber er ist der Meinung, allein käme er besser zurecht. Schon wegen des geringen Platzes.
Wenn ich sehe, wie viele Wasserflaschen, Kartons, Kisten, Taschen und ähnliches in unser Versteck wandern, verstärkt das mein schlechtes Gewissen. Und das alles reicht nur für zwei Wochen!
Harry lädt zügig um, stets mit einem Lächeln auf den Lippen, ohne ein überflüssiges Wort. Er ist ein wahrer Freund und wir wissen, daß wir uns auf ihn verlassen können. Wie auch auf Ludwig, der die großartige Idee gehabt hatte, Harry als Hausmeister einzustellen.
Juden im Allgemeinen, so habe ich manchmal den Verdacht, haben nirgends auf der Welt viele Freunde; umso mehr freut es mich, wenn eine Handvoll Menschen auch in schwierigsten Zeiten zu uns steht. Ich wette, Sohn, du machst ähnliche Erfahrungen.
»Paps!«, mahnt Rebekka, als Harry schon an unserem kleinen Esstisch sitzt und ein Glas Wasser trinkt, »es ist gleich halb drei. Zeit für die Meldung.« Eigentlich bevorzugt Harry nach getaner Arbeit ein kühles Glas Bier, aber bei einem solch gefährlichen Unterfangen, sagt er, habe er lieber einen klaren Kopf. Ich finde das sehr nett von ihm, einfühlsam, denn ich weiß ja, daß ein Glas Bier seinem Kopf nicht schaden würde. Auch der Umstand, daß er dort am Tisch ein wenig Abstand zu uns hält, zeugt von seiner Rücksichtnahme, denn Harry riecht ziemlich streng. Er weiß das, nicht zuletzt, weil wir offen darüber geredet haben und wir ihm stets versichern, daß es uns nichts ausmacht. Schließlich kann er nichts dafür.
Sofort nach Rebekkas Worten gehe ich hinüber zum Radio, stelle es ab, drehe es um und löse die Rückwand. Deine Schwester lästert gern, denn sie hält diese Vorsichtsmaßnahme für ziemlich überflüssig. »Entweder sie kriegen uns beim Arsch oder nicht«, sagt sie und kassiert von ihrer Mutter Schelte für ihre Wortwahl.
Ich habe nicht viel Ahnung von Technik, aber die detaillierten Anweisungen der Londoner Zentrale, die mir zugespielt worden sind und auf zwei Seiten Papier passen, sind klar und verständlich abgefaßt.
Die Meldung, die ich vorher schon chiffriert habe, lege ich neben das kleine Gerät, das ich aus der Halterung im Radiogehäuse ziehe. Ludwig hat den Rundfunkempfänger so umgebaut, daß die Funkstation haargenau hinein paßt. Gelernt ist eben gelernt, sagt der Inhaber der Firma »Plath Technische Geräte«. Es verblüfft mich immer wieder, wie gelassen unsere Freunde in solchen Situationen bleiben. Haben sie denn überhaupt keine Angst?
Jeder Handgriff, den ich mache, erfolgt mit großer Sorgfalt und tunlichst geräuschlos. Während der Zeit, die wir hier oben in unserem Versteck verbringen, haben wir gelernt, uns leise zu verhalten, die Lautstärke jedes Schrittes zu bedenken. Deshalb vermeiden wir am Tage überflüssige Handlungen, beschränken uns auf das Allernotwendigste. Die Zeit vergeht mit Lesen, Schreiben, Malen und anderen Tätigkeiten, die unseren Geist in Bewegung halten. Außerdem vermittelt deine Mutter unserer Tochter den allernotwendigsten Lehrstoff, denn ihre letzte Unterrichtsstunde in der Schule ist schon lange her.
Auch an ihrem musikalischen Fortkommen wird Rebekka in diesen düsteren Zeiten gehindert. Sie eifert ihrem Vater nach und hat erstaunliche Fortschritte am Klavier erzielt. Ihre bevorzugten Komponisten sind Mozart, Beethoven und Händel. Sie leidet sehr darunter, dass ihr im Moment quasi die Hände gebunden sind.
Um die leere Zeit sinnvoll zu füllen, haben wir notgedrungen für Ersatz gesorgt. So betreiben wir ausgiebig Sport. Es ist ganz wichtig, auch unseren Körper in Schwung zu halten. Wir machen natürlich nur Übungen, die auf dem Fußboden keinen Lärm verursachen und uns nicht zu viel Luft kosten.
Schweren Herzens, aber mit Rücksicht auf unsere Tochter versagen wir uns der körperlichen Liebe. Wir denken dabei nicht an moralische Hemmnisse, sondern würden es schlicht als unfair gegenüber Rebekka empfinden.
Ein weiteres wichtiges Thema ist die Körperpflege unter Einhaltung der einfachsten Hygieneregeln. Anfangs heikel war die Verrichtung der Notdurft. Wir staunten selbst, wie schnell wir uns falscher Schamgefühle entledigten, wobei wir uns aber doch hinter ein gespanntes Laken zurückziehen. Ein Eimer mit Deckel nimmt auf, was wir den Tag über von uns geben. Die Versuchung war enorm gewesen, eine Etage tiefer eines der modernen WCs aufzusuchen, aber das Risiko schien uns einfach zu groß. Und so entsorgt der arme Harry unsere Hinterlassenschaften, nachdem er uns wie in jeder Nacht mit frischem Obst und Gemüse versorgt hat. Manchmal ist sogar ein fertig gebratenes Stück Fleisch darunter. Wo treibt der gute Harry die ganzen Lebensmittel nur immer auf?
Selbst wenn wir dafür ausgestattet wären – Kochen dürfen wir leider nicht. Auch wenn die Verlockung mitunter groß ist – die winzig kleine Luke über unseren Köpfen läßt uns gerade genug Luft zum Atmen. Mehr nicht.
An den heißen Sommertagen leiden wir besonders unter der stickigen Hitze und dem Mangel an Frischluft. Sehnlichst erwarten wir die Nacht.
Ich stelle das Radio jetzt auf die uns zugewiesene Frequenz ein und warte genau bis um halb drei, um die verschlüsselte Nachricht zu erhalten, die mich zum Senden auffordert. Dann schalte ich die Station ein und tippe die Zahlenreihen in die Morsetaste. Es ist wichtig, ruhig und gleichmäßig zu drücken, denn die atmosphärischen Störungen sind in manchen Nächten ganz erheblich, und es dürfen keine Fehler passieren oder Mißverständnisse aufkommen. Die Empfänger haben keine Möglichkeiten, Rückfragen zu stellen.
Ich hatte natürlich darauf hingewiesen, daß ich vom Morsen keine Ahnung habe. Macht nichts, sagte man mir, es gehe nur um Zahlenreihen, das würde ich ganz schnell lernen. Und so war es dann auch.
Um mich herum herrscht Grabesstille, alle wissen, daß auch das leiseste Geräusch mich aus der Konzentration reißen könnte. Dabei klopft mir das Herz bis zum Hals; manchmal denke ich, das muß sogar in London zu vernehmen sein.
Wie schon oft habe ich auch jetzt erhebliche Zweifel an den Botschaften, die ich als nüchterne Zahlen in den Äther funke. Anfangs habe ich gedacht, jemand würde sich einen schlechten Scherz erlauben, denn die Dossiers, die Julia in der Behörde zusammensammelt, sind so abenteuerlich, daß ich sie nicht für bare Münze halten mag. Die Transporte, zu denen die Menschen auf die Moorweide zusammengetrieben werden, sind laut den Begleitpapieren bestimmt für Orte, die uns schon öfter genannt worden waren – Litzmannstadt etwa, Riga, Theresienstadt und andere Städte, in denen es jüdische Ghettos gibt. Diese Transporte geschehen in aller Öffentlichkeit und sind längst keine Geheimnisse mehr.
Was unsere Verbündeten in England viel mehr interessiert, sind die Züge, die jüdische Bürger in Konzentrationslager bringen. Auch diese Einrichtungen gibt es schon lange Jahre, man wußte bisher aber nur, daß KZ ein anderer Name für Straf- oder Arbeitslager ist. Wie ich dir schon in meinem vorigen Brief geschrieben habe, gibt es seit einiger Zeit Gerüchte, die so ungeheuerlich sind, daß sie von den wenigsten Mitbürgern für bare Münze genommen werden. Von geplantem Massenmord durch die Nationalsozialisten ist die Rede, von systematischer Vernichtung ganzer Ethnien!
Nach Recherchen ausländischer Geheimdienste und Widerstandsgruppen gäbe es Todestransporte in solche Internierungslager, penibel geplant, generalstabsmäßig vorbereitet und umgesetzt, nach einem festen Fahrplan gewissermaßen.
Und genau das ist der Grund, warum im Londoner Exil lebende Widerständler mich nach meinem letzten Brief an dich auf geheimen Pfaden kontaktiert haben. Unser Versteck, hieß es dort, sei perfekt für ein zugegeben waghalsiges Unternehmen.
Ludwig Plath war es, der mir vor wenigen Monaten berichtete, daß verantwortliche Mitarbeiter der Reichsbahn sein Mehrfamilienhaus an der Mansteinstraße, inmitten einer Wohngegend gelegen, requirieren wollten.
Als Grund nannte man die Überlastung der DR-Dienstgebäude nahe dem Hauptbahnhof. Der Zugverkehr, der verstärkt militärischen Zwecken diene, habe zu massiven Ausweitungen der Verantwortlichkeiten der Reichsbahn geführt. Deshalb beginne man, zivile, möglichst zentral gelegene Unterkünfte vorübergehend als zusätzliche Arbeitsräume zu nutzen. Die Besitzer solcher Liegenschaften mögen sich solange nach Alternativen für ihre Mieter umschauen. Wer Einwände erhebt, solle bedenken, daß im Krieg von allen Deutschen Opfer gebracht werden müßten. Darüber hinaus allerdings plane man, den Betroffenen finanzielle Entschädigungen zu zahlen. Spätestens nach dem Krieg.
Wie du weißt, wurden Sarah, Rebekka und ich zu jener Zeit von Ludwigs Schwager auf seinem Bauernhof in der Lüneburger Heide versteckt gehalten, weit entfernt von Hamburg. Ludwig Plath selbst war es gewesen, der aus zuverlässiger Quelle erfuhr, daß es auch die Familie Rosenkranz auf die Deportationslisten geschafft hatte. Wir sollten dahin zurück, von wo man uns einst vertrieben hat, in die Ukraine. Natürlich konnte man ihm keinen Grund für diese Zwangsmaßnahme nennen, außer: »Wahrscheinlich, WEIL ihr Juden seid«, was mir einen Schauer über den Rücken jagte. »Was haben wir Falsches getan?«, antwortete ich. »Wir sind Deutsche wie andere Deutsche auch!« Auch wenn wir in der Ukraine geboren sind.
Ich habe allerdings die Vermutung, daß die Anordnung mit meinen regimekritischen Artikeln im »Eppendorfer Kurier« zu tun hat. Obwohl – so viel Aufregung um ein Lokalblatt mit ein paar tausend Lesern!
Wie Ludwig auf die Idee kam, uns genau in die Höhle des Löwen zu plazieren, wußte er später selbst nicht mehr. »Es war wohl eine verrückte Eingebung, wie sie einen nur in solchen Zeiten überkommt«, lachte er. Aber: So verrückt, wie sie auch war, sie paßte zu unserem »Auftrag«.
Ludwigs Schwager war es, der mich mit einem Vertreter der Londoner Exilgruppe zusammenbrachte. Dieser bat mich, in unserem eigenen Interesse mit ihnen zusammenzuarbeiten, Daten der neuen Dienststelle zu sammeln, auszuwerten, nach Wichtigkeit zu ordnen und sie nach England zu senden. Er würde mich noch genauer instruieren.
Anfangs weigerte ich mich strikt. Ich hielt Mister Jakow, mit diesem Namen hatte er sich mir vorgestellt, entgegen, auf diese Weise mich und meine Familie in Gefahr zu bringen.
Kalt lächelnd sah er mich an und sagte leise: »Gefahr? Von welcher Gefahr sprechen Sie, Herr Rosenkranz? Von der Gefahr, Ihr Leben um Stunden früher zu verlieren als Ihre jüdischen Mitbürger? Diese Gefahr meinen Sie?«
Ich konnte ihn nur ansehen und schweigen. Er hatte recht und zum ersten Mal begriff ich die ganze Tragweite der unrechtsstaatlichen Maßnahmen.
Und so erklärte ich mich bereit, nach Rücksprache mit deiner Mutter und Rebekka natürlich, dieses Wagnis einzugehen.
Jakow erklärte mir, daß die Risiken des geplanten Vorgehens trotz allem relativ überschaubar wären. Mit Ludwig Plath hätte ich einen zuverlässigen Verbündeten, der über zwei Vorzüge verfügte: Er ist der Besitzer des Hauses und niemand würde ihm den Zutritt zu seinem Anwesen verweigern. Zweitens: Er ist ein Fachmann in Sachen Technik.
Die Verantwortlichen der Reichsbahn trügen sich mit der Absicht, die vorhandenen Mieträume zu Dienststellen umzugestalten, wobei aufgrund der drängenden Zeit die Struktur der Räume unangetastet bleiben sollte.
Jakow zeigte mir, nach welchen Kriterien ich die Listen zu sortieren hätte. Es war einfach. Die Transporte in die Ghettos waren für ihn uninteressant, ich sollte nur die Namenslisten heraussuchen, die für die KZ gedacht waren. Am wichtigsten, so Jakow, seien die Namen Chelmno, Belzec, Majdanek, Sobibor und Treblinka. Am allerwichtigsten seien Hinweise auf ein Lager in der Nähe der polnischen Stadt Oświęcim. Auf Deutsch heiße dieser Ort Auschwitz, und Transporte dorthin landeten in der Regel am Ankunftsbahnhof Birkenau. Diese Namen müsse ich mir unbedingt merken. Dokumente, die diese Namen in zweifelsfreie Verbindung mit Angaben von Deportierten bringen, könnten später als Beweise für Kriegsverbrechen dienen.
Wie ich an diese Dokumente gelangen würde, fragte ich, und wer denn die geheimnisvolle Julia sei, die Zugang zu diesen Akten habe. Julia, und zum ersten Mal sah ich Jakow lächeln, sei Angestellte der örtlichen Dienststelle der Bahn und die Geliebte deren Leiters, die Ex-Geliebte vielmehr, und da sie dieses gewesen war und sich der Dienststellenleiter, August Wriedt mit Namen, einer anderen jungen Dame zugewandt hatte, sei sie nun aller der mit der Liebschaft verbundenen Privilegien verlustig gegangen und stinksauer auf August. Sie wolle sich an ihm rächen und sei bereit, mit den jüdischen Widerständlern zusammenzuarbeiten.
Um meinen Fragen zuvorzukommen, woher man von den erwähnten Vorgängen erfahren habe, sagte Jakow mir, es gäbe Mittel und Wege, so etwas zur Kenntnis zu bringen, und mehr müsse ich nicht wissen.
Wissen solle ich aber, daß, im Unterschied zu anderen Behörden, die Dokumente vergleichbarer Bedeutung gern als »Vertraulich«, »Geheim«, »Verschlußsache« oder gar »Geheime Reichssache« klassifizierten, dieses bei der Reichsbahn ziemlich nachlässig gehandhabt würde.
Dienstleister ist Dienstleister, sagt man sich dort, und warum sollte man in diesen Zeiten mit Dokumenten und Akten anders verfahren als üblich? Es gehe schlicht um Bahntransporte und ihre Passagiere – kein Grund, bewährte Pfade zu verlassen. (Nicht zuletzt dieser Laxheit ist es wohl auch zu verdanken, daß »unsere« Post in der Vergangenheit so reibungslos funktioniert hat, und ich bete, daß es so bleibt).
Es gäbe, so die Verantwortlichen bei der Bahn, nur ein Kriterium, bei dem das Unternehmen seit seiner Gründung keinen Spaß versteht: Das ist die Pünktlichkeit seiner Züge! Und das würde auch in Zukunft so bleiben.
An dieser Stelle, lieber Sohn, endet mein Brief. Er ist so lang ausgefallen, weil wir nicht wissen, ob die vorherigen dich erreicht haben und wann wir Antwort von dir erhalten. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, daß unsere Schreiben bei dir ankommen und wir uns eines nicht mehr fernen Tages in die Arme schließen können.
Sei herzlich von deiner Schwester und deiner Mutter gegrüßt.
Dein dich liebender Vater
Kapitel 2
Pfui Deibel!, denkt Günter Michaelis. Kaum, dass er das Treppenhaus betritt, schlägt ihm ein heftiger Gestank entgegen. Eine penetrante Ausdünstung dringt ihm in die Nase, eine von der Sorte, die dort haften bleibt, wenn man den Ort des Geschehens schon längst wieder verlassen hat.
Das halte ich nicht lange aus!, denkt er. Ich muss weiter! »Würden Sie mich bitte vorbeilassen?« Er atmet durch den Mund und tippt dem Mann in der zerschlissenen Lederjacke auf die Schulter.
Oft genug hat er solche Tage erlebt. Der muffige Geruch – so typisch für eine Menschenansammlung auf engsten Raum. Auch bei penibelster Hygiene – die Leute haben einen langen Anfahrweg durch die stehende Luft eines ungewöhnlich warmen Aprilmorgens hinter sich und stehen nun mit schweißfleckigen Hemden stundenlang im Treppenhaus.
»Wie werd ich denn?«, faucht es zurück aus dem speckigen alten Kleidungsstück, das erheblich zum betäubenden Aroma beiträgt. »Vordrängeln ist nicht! Stell dich hinten an, Kerl!«
Und doch – irgendwie riecht es heute anders, je weiter Michaelis nach oben kommt. Nicht nur nach Schweiß. Süßlich, faulig, so. Wie halten die Leute das nur aus?
»Nun lassen Sie ihn schon durch«, sagt eine junge Frau zwei Stufen unter ihnen. »Sie sehen doch: Das ist der Postbote.« Sie trägt eine Gesichtsmaske. Ich kann ja auch unmöglich der Einzige sein, der diesen Mief bemerkt, denkt Michaelis.
Ein unbestreitbarer Vorteil des Corona-Virus: Man kann sich verstecken. Sich tarnen. Keiner der Wartenden möchte als zimperlich gelten und sich über den deftigen Geruch beschweren. Brächte Minuspunkte bei Seiner Majestät. Dem Mann, der die begehrten Anträge in der Hand hält. Steht oben am Geländer und schaut hoheitsvoll auf die Schlange unter ihm. Das blütenweiße Hemd unter seinem hellen Anzug weist nicht den kleinsten Schweißfleck auf. Warum eigentlich nicht?
»Ja, klar!«, schimpft der Lederne von oben. »Und ich bring die Ostereier. Die Tricks kenn ich! Nix da!«
Was weiter auffällt: Kaum jemand hält sich am schmiedeeisernen Geländer der hölzernen Treppe fest, die sich elegant durch die Etagen windet. Man ist vorsichtig; die Angst sich anzustecken ist noch allgegenwärtig.
»Machen Sie sich doch nicht lächerlich«, weist ein alter Mann von noch weiter oberhalb den Lederjackenträger zurecht. »Der Herr trägt die Uniform eines Postbediensteten.« Er hält sich ein Taschentuch vor die Nase. Schnieft demonstrativ. Noch so eine Art, den Ausdünstungen zu entkommen. Und dem Virus zu entgehen. Gerade in seinem Alter.
Michaelis rückt dem Mann vor ihm näher. Der stärker werdende Duft nach altem Rindsleder kann den stechenden Geruch nicht überlagern, der durch das enge Treppenhaus zieht und penetranter wird, je höher der Postbote steigt.
»Pah! Uniform! Was besagt das schon?«, erwidert der Gescholtene. »Haben Sie nie den Hauptmann von Köpenick gelesen?«
»Aber ja! Den habe ich auch gesehen«, gibt ihm der Betagte zur Antwort.
»Tatsächlich? Für ganz so alt hätte ich Sie gar nicht gehalten!« Der Lederne erntet Lacher aus der Schlange, die sich dicht aneinander gedrängt die Treppe emporwindet. Der alte Mann beweist Humor und fällt in das Gelächter ein.
Auch Michaelis grinst. Solche Momente gibt’s dann halt auch. Irgendwann nach stundenlangem Stehen merkst du den Geruch nicht mehr, hast ihn ausgeblendet und schnappst begierig nach jeder Ablenkung.
Natürlich hätte er gern den Fahrstuhl genommen, um in das vierte Obergeschoss zu gelangen. Vorbei an den geduldig Wartenden. Aber dann hätte er diesen witzigen Spruch nicht mitgekriegt.
Zudem: Der Lift ist natürlich außer Betrieb. Wie immer bei solchen Terminen. Aus Versicherungsgründen, wie ein hingeschluderter Zettel an der Kabinentür behauptet. Lachhaft!
Der Ledermann macht jetzt auf gute Miene. »Im Ernst: Sind Sie nicht ein bisschen zu alt …«, fragt er den Mann hinter dem Taschentuch, »… um sich bei dieser Veranstaltung stundenlang die Beine in den Bauch zu stehen? Sie haben doch sicher eine Wohnung, oder?«
Michaelis hat sich inzwischen an ihm vorbeigezwängt. Der Blick um die Biegung der Treppe zeigt ihm jetzt eine geöffnete Wohnungstür und den Mann im hellen Anzug davor. Da wohnt doch die alte Frau Wegner. Nanu!
Der strenge Geruch verstärkt sich immer mehr.
»Ich ja«, antwortet der Senior geduldig, »aber meine Enkelin sucht. Ihr zweites Baby ist unterwegs, und sie … Warum zum Teufel sind Wohnungsbesichtigungen immer dann, wenn’s überhaupt nicht passt?«
»Das machen die mit Absicht!«, flucht ein junger Mann, der eine Stufe unter dem Alten steht. »Sie hoffen, dann gibt’s weniger Andrang. – Hey, ihr da unten!« Er beugt sich über das Geländer. »Macht doch mal die Haustür auf! Die Luft ist so scheiße hier. Merkt ihr das denn nicht?«
Er erhält keine Antwort, aber Michaelis spürt jetzt leichte Zugluft. In der Wohnung über ihm scheinen Fenster offen zu stehen. Das ändert aber nichts an dem fauligen Geruch.
»Weniger Andrang ist gut«, lacht die junge Frau. »Aber stimmt. Statt tausend sind wir nur fünfhundert.«
»Das kommt, weil heute Dienstag ist«, entgegnet der mit der Lederjacke grinsend. »Da ist Markt in der Isestraße. Sonst wären die anderen auch da.«
»Die kommen bestimmt noch dazu«, versichert der Junge kichernd.
Trotz der widrigen Umstände, denkt Michaelis – heute geht’s ja mal lustig zu. Ziemlich locker. Das hat er auch schon anders erlebt. Viel aggressiver. Ist irgendwo auch verständlich. Wer weiß, wie lange solche Leute schon stehen und warten. Ohne sich Illusionen zu machen, ohne Hoffnung. Lotto ist ergiebiger.
Apropos, denkt der Postbeamte, habt ihr genug Geld dabei? Ihr wisst doch: Wer am besten schmiert, kriegt die Hütte. Alle anderen sind chancenlos.
Immerhin: Frei atmen dürfen sie wieder (obwohl es heute nicht angebracht ist). Wenn auch streng genommen die Maskenpflicht für Hamburg noch einmal verlängert worden ist. Aber wen kümmert‘s?
Das ältere Pärchen, das in der offenen Eingangstür der Wohnung steht – es gehört zu den noch Maskierten. Und den noch Optimistischen. Voller Begeisterung richten die beiden sich ein. »Kuck ma, Manni! Im Flur. Da passt genau die Eichengarderobe hin. Die von Tante Lisbeth, die.« »Ja. Ich bau denn noch die kleine Lampe daneben. Die mittn grünen Schirm.« »Ach wat. Die passt doch da nicht! Da muss was Neues hin. Was in Rot.« »Meinst du? … Oder so. – Wird bestimmt schön.«
Zeit, wieder an sich selbst zu denken. Das Päckchen! Ein einziges verdammtes Päckchen! Päckchen? Mehr ein Paket. Von enormem Gewicht. Zudem unhandlich, weil länglich – und mit dem Schwerpunkt auf einer Schmalseite. Für René Asbahr im Fünften. Ausgerechnet! Der Mann ist wahrscheinlich wie üblich nicht zu Hause und ich kann das Scheißpaket wieder zum Auto schleppen.
Asbahr gehört zu denen, die darauf bestehen, ihre Post persönlich entgegenzunehmen. Auf keinen Fall dem Nachbarn aushändigen! Bei Abwesenheit bitte eine Karte einwerfen und die Sendung wieder mitnehmen.
An solchen Tagen zeigen sich die Schattenseiten dieses Berufs. Ganz oben in Michaelis‘ persönlichem Hassranking, weit vor kläffenden Kötern, vollgeparkten Straßen und Schneeball werfenden Kindern rangieren Wohnungsbesichtigungen in muffigen Treppenhäusern und Pakete in den fünften Stock.
Besichtigungen vor allem, wenn sie sich in einer der gefragtesten Gegenden Hamburgs abspielen, und dazu gehört sein Revier nun mal.
Generalsviertel! Nicht oft wird hier eine Wohnung frei, aber wenn, dann ist Terror! Zu Hunderten stehen sie, bis um die nächste Kurve, manchmal bis in den Eppendorfer Weg. Und nicht immer geht’s so friedlich zu wie heute.
Und dies ist die Mansteinstraße! Also nochmal eine Nummer begehrter! Die Leute, die sich seit morgens um sechs die Füße bis hoch in das was-weiß-ich-wievielte Geschoss platt stehen, kommen nicht nur aus Hamburg. Michaelis hat schon Autos aus Bremen, Hannover und von noch weiter entfernt gesehen. Parken rücksichtslos die Straße zu. An solchen Tagen, wenn er beim Einbiegen die Menschenschlange in der Ferne sieht, kann er sein Elektroauto gleich in die nächste freie Lücke rangieren, vorausgesetzt, er findet eine. Meistens schafft er es nicht mal bis in die Straße und kann die ganze Strecke bis zur Bismarck runterrennen. Oder noch einmal um drei Ecken fahren.
Also, er jedenfalls ist heilfroh, dass er sein Eigenheim schon längst abbezahlt hat.
Seit fast zwanzig Jahren schon »macht« er das Viertel und hat den städtebaulichen Werdegang in dieser Zeit verfolgen können. Begonnen hatte der radikale Wandel 2008 mit der Pleite der Lehman-Bank und der darauffolgenden Immobilienblase, die sich von den USA aus über die ganze Welt verbreitete. Seit jenen Tagen ist die Welt des Wohnens eine andere geworden. Und auch wenn sich die Märkte seitdem einigermaßen erholt haben – dieses Ereignis hat alles über den Haufen geworfen, was vorher Bestand hatte. Die Nachwirkungen sind immer noch spürbar.
Auch diese Gegend Hamburgs wurde damals von einer Spekulationswelle überrollt, in vielen Vorgärten standen die Schilder: »Appartement zu verkaufen«, »Hier entstehen Eigentumswohnungen«.
Viele Alteingesessene mussten das Feld räumen, Senioren, die seit Jahrzehnten hier gewohnt hatten, konnten sich nicht mehr halten, zahlungskräftige junge Paare und Familien, die lukrative Jobs in der Innenstadt hatten, rückten nach. Die Coronaepidemie, der Ukrainekrieg mit den sprunghaft steigenden Energiepreisen, die wieder anziehenden Zinsen, all dies macht es selbst gut betuchten Menschen schwer, eine angemessene Wohnstatt zu finden.
Selbst bauen kann sich eh niemand mehr leisten, daher hat der Run auf Mietwohnungen noch mal kräftig zugelegt.
Sein Beruf prädestiniert Michaelis, genaue Einblicke in diese Welt zu nehmen, die drastischen Veränderungen Tag für Tag zu erleben. Mehr als einmal ist er Zeuge geworden, wie Menschen mit verweinten Augen aus den Türen der schmucken Häuser kommen, den vollgepackten Transporter besteigen und ohne einen letzten Blick zurück ihre bisherige Heimat verlassen, Ziel unbekannt.
Den Nachrückern, denen, die mit argwöhnischen Blicken auf Konkurrenten schauen, die sich neben ihnen in den Treppenhäusern drängen, ist jedes Mittel recht, um eine der Wohnungen zu ergattern. Ein Hauen und Stechen, mitunter im wahrsten Sinne des Wortes, kennzeichnen die Besichtigungstermine, und die Makler, das Klemmbrett unter dem Arm, gerieren sich wie die Könige. Michaelis erlebt sie im Vorbeigehen, die Momente der Demütigungen, der Erniedrigungen.
Das Perverseste ist, wenn sie an solchen Tagen den Fahrstuhl abstellen! Offiziell aus Versicherungsgründen. Quatsch! In Wahrheit wollen sie, dass die Leute stundenlang auf der Stelle stehen, ans Geländer gelehnt, dass sie warten, sich geduldig zeigen. Um dann endlich aufzugeben. Ihre Zeit doch bitte nicht weiter nutzlos zu verplempern. Versuchen Sie es doch woanders. – Das siebt ihnen die Auswahl.
Behinderte, die auf den Fahrstuhl angewiesen sind – die ziehen doch hier nicht ein! Passen nicht in eine solch vornehme Gegend. Wenn die Hartnäckigen unter ihnen gegen den Rat, aber doch mit Hilfe wohlmeinender Mitmenschen die Handvoll Stufen hoch zur Haustür bewältigen, um dann ohnmächtig auf das Schild: »Vorübergehend außer Betrieb« zu schauen – es ist eine Schande!
Manchmal kann Michaelis nicht glauben, was er aufschnappt. Wie die Herren der Wohnungsvergabe Menschen hämisch auflaufen lassen, die sich verzweifelt um eine Unterkunft bemühen.
Und von denen einige sich den Mitbewerbern gegenüber nicht selten genauso verhalten.
Zur Überraschung des Postboten ist René Asbahr heute zu Hause und – nicht zu fassen! – er gibt ihm ein Trinkgeld. »Für die Male, die Sie vergeblich geklingelt haben.« Nuschelt bei diesen Worten etwas. Michaelis sieht die geschwollene Wange. »Ach, herrje! Zahn, was?« Asbahr nickt betrübt. Der Briefträger gibt sich mitfühlend und freut sich nun erst recht über den Botenlohn. Ist nett. Sowas passiert ihm nicht oft. Aus unerfindlichen Gründen denken die Leute immer, ein Zusteller dürfe kein Trinkgeld annehmen, aber das ist ein Irrtum.
Er stellt das Paket ab und fragt sich, was es wohl beinhalte. Asbahr registriert den neugierigen Blick. »Was sagen Sie denn dazu, dass die alte Oma Wegner von unten tot ist?«, fragt er, so schnell es die dicke Backe zulässt. »Ist das nicht traurig? So eine nette!«
»Was? Tot? Frau Wegner?«, entfährt es Michaelis. »Die hab ich doch neulich erst … ach, nee, ist doch schon ’n bisschen her.« Er atmet tief durch die Nase, seinen Blick zum Flur gewendet. »Ach, deshalb!«
»Der Geruch, meinen Sie«, sagt Asbahr und stellt sich vor den Karton. Dem Postboten kommt es vor, als versuche Asbahr von der Lieferung abzulenken. Michaelis nickt und schielt noch einmal zum Paket. »Ich hab schon ewig keine Post mehr für sie gehabt«, sagt er nachdenklich. Ein Aufkleber des Absenders fehlt. Keinerlei Hinweis. Der Zusteller ist erfahren genug, zu wissen: Dahinter steckt nicht immer ein Erotik-Versand. Bei diesem Gewicht schon gar nicht. Und dem länglichen Format der Verpackung. Gummipuppen sind lebensgroß, aber platzsparend zusammenzufalten. – Wobei … eine leistungsstarke Pumpe vielleicht? Für den ungeduldigen Anwender? »Und keiner hat irgendwas bemerkt?«
»Vorige Woche ist sie gefunden worden. Da lag sie aber schon einige Tage, sagt die Polizei. Einfach aus’m Sessel gekippt. Letzten Diens…, nee, warten Sie … Mittwoch war das. Ein Nachbar von ihr hat‘s mir erzählt. Als sie sie abgeholt haben, war ich gerade ein paar Tage auf einem Seminar. Das soll schon ganz merkwürdig gerochen haben im Haus.« Asbahr presst drei Finger fest auf die Wange. »Leichengeruch eben.«
»Mittwoch?« Günter Michaelis versteht die Welt nicht mehr. »Und da sind heute schon Bewerber im Haus?«
»Geht ratzfatz, nicht?«, nuschelt Asbahr. »Zwei Tage später war ein Unternehmen hier und hat die Bude in Windeseile leergeräumt. Angehörige hatte sie nicht mehr.«
»So schnell haben die die Wohnung renoviert? Das gibt’s ja gar nicht!«
»Renoviert?« Asbahr lacht kurz auf. »Der Nachbar sagte, da ist überhaupt nichts gemacht worden. Die wollen sofort neue Mieter haben. Der Makler meinte, den Geruch einer Toten kriegst du sowieso nicht so schnell raus. Hauptsache, die Maden sind entsorgt. Time is money, nä? Bloß kein Leerstand. Und fürs Renovieren sind die Nachmieter zuständig.« Er winkt ab. »Mit meiner Wohnung war es ja dasselbe. Erinnern Sie sich? Der alte Max Reining seinerzeit. Wurde zum Glück schon zwei Tage später gefunden. Die Bude stank noch nicht so schlimm.«
Er verrät dem Postboten natürlich nicht, dass er beim Tod seines Vormieters ein wenig nachgeholfen hat. Bei einem als herzkrank bekannten Mann reicht eine kleine Kapsel Zyankali und der Arzt stellt ohne viel Federlesens den Totenschein aus.
Die fünftausend Euro, die Asbahr beim Alten in einer Schublade fand, sorgten dafür, dass er das Bestechungsgeld für den Erwerb der Mietwohnung nicht aus eigener Tasche zahlen musste.
Win-win.
Max Reining hatte Nazis gehasst und hätte sein herbeigeführtes Ableben sicher nicht persönlich genommen.
Es zählt immer das große Ganze.
Es musste schon diese Wohnung sein – die Sicht nach gegenüber ist perfekt.
Nachdem Asbahrs Freund Kortas die Verbindung zwischen seiner früheren Lehrerin und der Leiterin des Frauenlagers in Plaszow offengelegt hatte, war es ein Leichtes, ihre Adresse herauszufinden. Es konnte nur Hamburg sein, die Stadt, in der sie den kleinen Klaus Kortas unterrichtet hatte.
Hamburg war der Ort, in dem sie jahrzehntelang unauffällig und unerkannt gewirkt hat. Bis heute.
Asbahr setzte nun alles dran, eine Wohnung in ihrer unmittelbaren Umgebung zu bekommen. Es gilt, sie zu beobachten. Sie müssen Gewissheit haben. Hundertprozentige Klarheit.
Ferner einen Standort, von dem aus man sie eventuell unter Feuer nehmen kann.
Asbahr bedankt sich noch einmal beim Postboten und schließt die Wohnungstür. Er schaut auf das Paket zu seinen Füßen. Wenn der Mann wüsste, denkt er, was er mir gerade geliefert hat.
Als Michaelis langsam die Treppe hinuntergeht, sieht er in die müden Gesichter der Wartenden. Auf einmal wird ihm schwindelig und er muss sich eine Weile an der Wand abstützen. Das hat nicht nur mit der schlechten Luft zu tun.
»Geht’s Ihnen nicht gut?«, fragt ihn der alte Mann, der inzwischen drei weitere Stufen geschafft hat, besorgt. »Sie sehen blass aus.«
»Na, tragen Sie mal so ein schweres Paket nach oben«, sagt die junge Frau unter ihm. »Der Herr ist ja auch nicht mehr der Jüngste.«
»Hallo?« Der Kerl, der ihn anfangs nicht vorbeilassen wollte und der jetzt die Lederjacke endlich ausgezogen hat, schüttelt den Kopf. »Sein Problem. Augen auf bei der Berufswahl.«
»Machen Sie sich keine Sorgen«, lächelt Michaelis und sein Blick auf den forschen Burschen verleiht ihm neue Kräfte. »Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Wohnungssuche. Irgendwann werden Sie bestimmt was finden.« Der andere sieht ihn grimmig an, macht aber bereitwillig Platz.
Kapitel 3
Nach einigen Briefen und Werbesendungen, die er in die Postkästen wirft, sieht Günter Michaelis, dass ihn an der nächsten Station seiner Route, dem Haus gegenüber dem eben besuchten, weiteres Ungemach erwartet.
Das Kopfschütteln der alten Frau, die gerade das Grundstück verlässt und dabei die schmiedeeiserne Pforte erbärmlich quietschend hinter sich zufallen hört sowie das nachfolgende Schimpfen quittiert er mit einem gequälten Lächeln. Rasch fischt er aus einem Stapel gleichartig gestalteter Briefumschläge den an Hermine Grabert adressierten heraus.
»Ja! Ja! Mach ich noch!«, äfft sie vor sich hin. »Geh ich gleich bei, sagt er immer. Der Quatschkopf!«
Zornfunkelnde Augen aus einem grimmigen, faltenreichen Gesicht verharren sekundenlang auf der eisernen Gartentür, die an einigen Stellen abgeplatzten Lack aufweist. In ihrem leichten Sommermantel, gestützt auf den Stock, die flachen, aber festen Schuhe in das Gehwegpflaster gestemmt, kommt sie Michaelis vor wie ein Racheengel.
Der Postbote räuspert sich, um ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. »Tach, Frau Grabert!«, ruft er mit aufgesetzter Fröhlichkeit, denn er hofft, sie überrumpeln zu können. Weder verspürt er Lust noch hat er die Zeit, ihren Schimpftiraden zu lauschen. »Ich habe ein Einschreiben für Sie.« Schnell schaut er auf die Rückseite des Umschlags. »Es ist von einer …«
Das Ablenkungsmanöver des Uniformierten verläuft im Sand. »Faul wie die Sünde, der Mann!«, unterbricht ihn die Greisin zischend und sieht ihn an, als sei er für den desolaten Zustand der Pforte im Speziellen und der Welt im Allgemeinen verantwortlich.
Michaelis weiß, dass Hermine Grabert ernstlich wütend ist, ein Zustand, in dem man ihr nicht gern begegnet. Ferner ahnt er das Objekt ihrer Verwünschungen, denn niemanden sonst betitelt sie mit einer solchen Anhäufung von Schimpfwörtern.
Dabei geht es ihr weniger um das Geräusch, das die metallenen Bänder der Pforte erzeugen. Sie kann es einfach nicht leiden, dass der Kleine General – und das passiert ihrer Ansicht nach viel zu oft – sie immer auf das nächste Mal vertröstet.
»Die Pforte! Jau! Ich weiß! Ich weiß!«, versucht Paul Knupper sie stets zu besänftigen. »Da muss ich auch noch bei.« Um mit gespielter Verzweiflung zu ergänzen: »Als wenn ich nicht genug um die Ohren hab!«
»Papperlapapp!«, schlägt sie dann mit dem Handstock auf das Pflaster des Gehwegs, durch dessen Fugen sich das Grün zwängt. »Wenn Ihnen die Arbeit zu viel ist, suchen Sie sich was anderes!«
Günter Michaelis selbst pflegt ein gutes Verhältnis zu dem ruhigen, in seinen Augen emsigen Hausmeister und kann Hermines ständige Verbalinjurien nicht nachvollziehen.
Wenn er miterleben muss, wie Knupper von der resoluten Alten zusammengefaltet wird, kommt Mitgefühl beim Postbediensteten auf – für sie scheinen die Pflichten des Fässilitti Mänätschä, wie sie die neudeutsche Bezeichnung für seinen Berufsstand genüsslich verhöhnt, schon Oberkante Erdgeschoss zu enden.
Naturgemäß fallen dort, zu ebener Erde, die meisten Arbeiten an – das Wirkungsfeld Knuppers erstreckt sich allerdings über alle fünf Etagen des prächtigen hanseatischen Bürgerhauses.
Sein Spitzname, der ihm irgendwann von Hermine Grabert verliehen worden ist, hat wohl selbst ihrer Ansicht nach weniger mit seinem Charakter oder Auftreten zu tun, sondern mit dem Stadtteil, in dessen Herzen das Gebäude liegt – das Generalsviertel. So benannt nach dem Teil Hamburgs, in dem die Straßen Namen historischer Militärführer tragen. Die Mansteinstraße ist eine von ihnen, ebenso waren die Generäle Moltke, Roon, Kottwitz und Gneisenau Namensgeber wie auch General Wrangel. Sie alle waren als militärisch Verantwortliche politisch umstritten, aber im Unterschied zu manch anderer historischen Gestalt unverdächtig genug geblieben, die Straßenschilder einer der attraktivsten Hamburger Wohnlagen schmücken zu dürfen.
Paul Knupper hat die ihm spöttisch verliehene Ehrenbezeichnung gelassen entgegengenommen. Immerhin, denkt er, hat unsere Beziehung ja wirklich den Charakter einer militärischen Auseinandersetzung und Hermine eignet sich durchaus als ebenbürtige Gegnerin.
»Post? Für mich? Nanu!« Die rüstige Greisin wechselt ihren Gehstock in die linke Hand und streckt Michaelis mit zweifelndem Blick die rechte entgegen. Ihre Konstitution und der immerwährende Ärger mit Knupper hat sie geistig in Schwung gehalten, und selbst im gesegneten Alter von 96 macht sie nicht den Eindruck, dass sich daran in nächster Zeit etwas ändern sollte.
Es ist anzunehmen, dass Hermine Grabert, hätte sie eine Familie, viele ihrer Angehörigen überleben würde. Nun, die Schatten, die auf ihrer Vergangenheit liegen, verbaten ihr Ehemann und Kinder lebenslang, was sie auch nicht bedauert. Für sie hat es nur die eine, die große Liebe in ihrem Leben gegeben und danach konnte nichts mehr kommen.
Hätte sie noch Verwandte, wären die nicht in der Lage, sie ausfindig zu machen. Die Spuren sind gründlich verwischt.
Auf familiäre oder anderer Leute Hilfe ist sie ohnehin nicht angewiesen. Sie macht ihre Erledigungen im Großen und Ganzen selbst. Ein Supermarkt mit Bäckerladen, ein großer Wochenmarkt, ihr Hausarzt (um den sie aus verschiedenen Gründen einen Bogen macht), die Sparkasse, all dies liegt in erreichbarer Nähe ihrer Wohnung. Den treuen Gehstock zur Seite, legt Hermine Grabert jeden Tag ihre Wegstrecke hin und zurück.
Das Einzige, was sie nach Möglichkeit vermeidet, sind Treppen (»Tja, Herr Doktor, wenn Sie irgendwann mal ‘n Fahrstuhl haben, komm‘ ich gern vorbei.«). Deshalb war sie damals froh gewesen, diese Erdgeschosswohnung bekommen zu haben. Eine schöne, eine große Wohnung, eigentlich viel zu groß, aber eine, die so günstig war und immer noch ist, dass Hermine das gesparte Geld statt in teure Mietzahlungen dazu verwenden konnte und kann, ihre Bleibe großzügig einzurichten.
»Eine Immobiliengesellschaft«, klärt Michaelis sie auf, als er ihr den Brief in die Hand drückt.
Skeptisch wendet die alte Dame den Umschlag mehrfach, hält ihn dicht vor die zusammengekniffenen Augen, um ihn dann wieder dem Postboten zu reichen. »Machen Sie mal auf!«, sagt sie knapp, »ich hab die Brille nicht dabei.« Auf ihrem Gesicht glaubt er den Anflug eines Lächelns zu erkennen. »Für den Wochenmarkt brauch ich die nicht.«
Die bräuchte sie aber, um das Einschreiben zu quittieren, denkt Michaelis. Eigentlich, denkt er, und bevor er lange überlegt, zack!, steht auch schon die Unterschrift auf der Liste. Macht er schon mal für Leute wie Hermine Grabert. Die auch brav wegguckt in dem Moment.
Michaelis ist klar, dass er heute sein Pensum kaum in der üblichen Zeit wird schaffen können, denn bei der Bitte um Öffnung der Post wird es Hermine nicht bewenden lassen.
»Immobilien? Wieso das?«, lautet ihre Aufforderung an den Postboten, ihr das Schreiben vorzulesen.
Der überfliegt die Zeilen zunächst in Windeseile, senkt dann das Blatt und sieht die alte Frau mit kummervollen Augen an. Innerlich verflucht er sich, dass er der Bitte Hermine Graberts gefolgt ist und nun zum Überbringer einer Hiobsbotschaft wird.
»Tja, Frau Grabert, das ist …« Er windet sich und hofft, dass irgendein Ereignis, jetzt, hier vor diesem Haus, vor dieser nicht geölten Gartenpforte, dass ihm irgendwas den Kopf aus der Schlinge ziehen möge. Ein plötzlicher Wetterumschwung vielleicht, mit Gewitter und Starkregen. Oder etwa, dass der Makler da gegenüber, der für heute seinen Job erledigt hat und gerade unter dem hämischen Beifall der sich auflösenden Menschenmenge in sein Auto steigt, Tschou-Tschou, den Hund des schwulen Gastwirts Dankwart Waller aus dem ersten Stock plattfahren würde.
Nicht, dass Michaelis etwas gegen Schwule hätte, Gott bewahre! Als leidgeprüfter Postbote geht es ihm eher um den Kläffer. Er oder ich! Friss oder werde gefressen! Auch wenn es sich nur um einen Pekinesen handelt, der sich im schlimmsten Fall in seine Schnürsenkel verbeißen könnte.
»Was ist denn nun?« Hermine Grabert scheint beim Blick in das Gesicht ihres Gegenübers nichts Gutes zu ahnen. »Erzählen Sie!«
Michaelis sieht ein, dass er in der Klemme sitzt. So rücksichtsvoll, wie es nur geht, erklärt er der alten Dame, was das Schreiben für sie bereithält.
Und das ist nichts Erfreuliches.
Kapitel 4
Aus der Höhe der fünften Etage schaut René Asbahr hinunter zu dem gegenüberliegenden weißen Haus, vor dessen Gartenpforte Charlotte Finn dem Postboten offenbar verständnislose Blicke zuwirft. Er scheint ihr einen Brief vorgelesen zu haben, und sie hat ständig den Kopf geschüttelt. Es werden keine guten Nachrichten sein.
Für einen Moment tut sie Asbahr sogar leid. Sobald aber sich die betagte Frau, die sich heute Hermine Grabert nennt, aus ihrer gramvoll gebückten Haltung zurück zu voller Größe aufrichtet, erfasst ihn wieder Abscheu. Packt ihn der Hass, der ihn in die Lage versetzen wird, sie zu töten.
Er ist sich sicher: Ich werde es tun! Egal, wie alt sie ist! Sie darf keines natürlichen Todes sterben. Das kann nicht sein! Ihr Leben lang ist sie unbehelligt geblieben. Sie muss bestraft werden!
Asbahr sieht zur Uhr. Viertel nach zehn. Gestern ist sie um halb zehn los. Unberechenbar, die Dame. Die Zeiten, die er penibel in seine Kladde einträgt, unterscheiden sich von Tag zu Tag. Erheblich. Von einer Frau, die jahrzehntelang ein Lehramt ausübte, sollte man erwarten dürfen, dass sie einem präzisen Zeitplan folgt, auch wenn sie schon lange in Pension ist. Macht sie aber nicht. An einigen Tagen scheint sie den Postboten abzufangen, an anderen holt sie die Briefe und Zeitungen aus dem Kasten. Immer so, wie es gerade in ihren Ablauf passt.
René Asbahr weiß, dass er vor einer schwierigen Aufgabe steht. Seine Bemühungen, ein Muster zu finden, einen geregelten Zeitplan, nach dem die Finn vorgeht – bisher hat sie alle Anstrengungen zunichte gemacht.
Erschwerend kommt hinzu, dass er nicht immer zuhause ist. Schließlich hat er einen Job in der kommunalen Verwaltung. Personalplanung. Seit einigen Jahren in Teilzeit. Der Bedarf an Personal ist stetig gestiegen, den Kommunen fehlt schlicht das Geld, welches einzustellen.
Asbahrs Tätigkeit konzentriert sich daher in erster Linie auf Fortbildungsveranstaltungen, Seminare, so was. Sich fit halten. Am Ball bleiben. Sich beruflich weiterentwickeln.
Seine Anwesenheit in der Behörde, gerade zur Hochzeit Covids, ist spürbar seltener geworden. Der bevorzugte Ort seiner Tätigkeiten war in dieser Phase das Homeoffice gewesen. Und danach wurde es auch nicht wieder wie vorher. Eher noch weniger. Was soll’s? Das Gehalt wird pünktlich überwiesen. Es wird allerdings nach und nach behutsam an den Aufwand angepasst, den er zu betreiben hat. Im Klartext: Das Einkommen schrumpft.
Wobei betont werden muss: Er sitzt nicht rum. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeiten hat sich nur verlagert. Mehr aufs Private.
Insgesamt muss man von einer leicht in Schieflage geratenen Work-Life-Balance sprechen.
Er hat also jetzt deutlich mehr Zeit, sich um Charlie zu kümmern.
Charlie. Diesen Spitznamen hatten ihre Spießgesellen in Plaszow ihr damals verpasst. Asbahr grinst höhnisch. Wie sind die auf den Namen gekommen? Charlie passt nicht zu dieser Greisin, die jetzt heftig gestikulierend vor dem Postboten steht. Dieser Name ist einfach … ungermanisch! Einer Nazigöre nicht angemessen. Feindesname. Wie Tommie. Wie Yankee.
Dem Zusteller da unten ist die Situation erkennbar unangenehm. Er duckt sich regelrecht unter ihren Worten, gleichwohl versucht er mit ruhigen Handbewegungen, Charlotte Finn, die wie fast alle anderen auch er nur als Hermine Grabert kennt, zu besänftigen.
Es ist ihr hohes Alter, das zu Kontroversen geführt hat. Der Beschluss in der Gruppe war nicht einstimmig gewesen. Ein paar Genossen waren der Meinung, man könne einen Menschen ihres Alters nicht mehr zur Rechenschaft ziehen. Jedenfalls nicht sie einfach umbringen. Es sei auch viel zu spät. Sie hätte gleich damals für ihre Sünden büßen müssen.
Die Mehrheit aber hatte, als die Wahrheit ans Licht kam, als klar wurde, welche Verbrechen diese Greisin in ihren jungen Jahren verübt hatte, dafür plädiert, sie zu bestrafen. Sie war ein Teil der Mordmaschinerie gewesen, ein nicht unwesentlicher. Zudem war ihnen irgendwann klar geworden, dass die Behörden schon ewig in Kenntnis ihrer Verfehlungen gewesen waren, es aber kein Gericht gab, das sie verurteilt hätte. Menschen wie sie wären ja nur Befehlen gefolgt.
Danach geriet sie in Vergessenheit. Ihre vermeintliche Schuldlosigkeit schützte sie vor strafrechtlicher Verfolgung.
Aber seit einigen Jahren ist alles anders. Seitdem ist die deutsche Justiz zu neuen Überlegungen gekommen, was den Umfang der Schuldfrage betrifft. Hätte sie jedenfalls kommen sollen. Es gibt inzwischen schließlich dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht.
Aber es passiert nichts. Keine Untersuchung, keine Festnahme, nichts. Die Mitverantwortlichen am millionenfachen Mord, die aus der zweiten Reihe, sie blieben unbehelligt. Bis heute.
Mit ein paar Ausnahmen, wie man den Medien entnehmen konnte.
Asbahr sieht auf das Paket zu seinen Füßen und für einen Moment wird ihm mulmig. Man hat ihn ausgewählt, weil er Mitglied im Sportschützenverein ist und seine ruhige Hand ihm schon diverse Preise verschafft hat. So gesehen würde er naturgemäß als einer der ersten in Verdacht geraten – des Risikos ist er sich bewusst und bereit, es einzugehen.
Er holt ein Messer aus der Küche und öffnet den Karton mit entschlossenen Schnitten. Das in mehrere handlichen Teile zerlegte Präzisionsgewehr mit dem silbrig schimmernden Lauf, dem mächtigen Zielfernrohr und dem fast ebenso langen Schalldämpfer lässt sein Herz hüpfen. Was für eine Meisterleistung der Waffenschmiedekunst!
Behutsam entnimmt er die Einzelteile und legt sie vorsichtig auf den Esstisch.
Fast liebevoll streicht seine Hand über den Schaft der Waffe. Irritiert stellt er fest, dass er aus Kunststoff gefertigt ist. Wie sich die Zeiten doch ändern, denkt er. Früher hat man solche Gegenstände aus bestem Holz gebaut. Na ja, so wird natürlich Gewicht gespart, sieht er ein.
Dann nimmt er das Trinkglas und spült die Schmerztablette herunter, die auf dem Tisch liegt.
Sein Leben und das seiner Freunde hatte viele Wege dicht am Abgrund bereitgehalten – vom Hausbesetzer in der Hafenstraße bis hin zum Unterstützer der RAF, deren Mitglieder sie Unterschlupf gewährten – der Grat zwischen rechtlich tolerierten Aktionen und dem Abgleiten in die Illegalität war stets schmal gewesen.
Viele ihrer Maßnahmen galten selbst in ihrem Kreis als nicht unumstritten – einige von ihnen erwiesen sich als gesetzestreuer, als sie es selbst vermutet hatten, und auch Asbahr hat sich bis dato nichts strafrechtlich Relevantes zuschulden kommen lassen. Ein paar Steine auf Polizisten geworfen, das ja. Ohne Erfolg. Er hatte schon als Kind kaum einmal eine Fensterscheibe getroffen. Später, als er zum ersten Mal eine Waffe in die Hand bekam, stellte er sich zu seiner eigenen Überraschung als vortrefflicher Schütze heraus.
In seinem Freundeskreis herrschte Konsens in der Überzeugung, es könne nicht sein, dass der Staat Hausbesetzer, die sich durch ihr Tun für die Schaffung günstigen Wohnraums einsetzen, als kriminell brandmarkt, NS-Tätern aber kein Haar krümmt.
Mitte der Neunziger – die Aufregung um die Hafenstraße hatte sich gelegt und der weitere Werdegang dieser Häuser war in halbwegs geordnete Bahnen geraten – hatten die Helden von einst sich auseinandergelebt und waren getrennte Wege gegangen.
Meyer, Dallmann und andere begannen ein bürgerliches Leben. Hanno Meyer wurde Anwalt. Anders als den Kollegen Schily, Mahler, Ströbele und Croissant wäre es ihm aber nie in den Sinn gekommen, Mitglieder der Rote-Armee-Fraktion vor Gericht zu verteidigen. Als er sein Staatsexamen ablegte, war die Hochzeit dieser Gruppe lange vorbei; die Sympathisanten, die den Aktivisten während der Vorgänge um die Hafenstrasse dort Unterschlupf gewährt hatten, verloren langsam ihre Sympathien für die kriminellen Akteure und Meyer fragte sich, was das alles für einen Sinn gehabt habe.
Jörg Dallmann schlug die Laufbahn eines Wissenschaftlers ein, wirkte später als Kunsthistoriker mit Schwerpunkt auf Architektur.
Asbahr, Kortas und ihre engsten Freunde hingegen waren nicht bereit, ihren revolutionären Idealen abzuschwören. Sie bildeten ihre eigene Fraktion und suchten nach neuen sinnvollen Aufgaben. Häuserkampf war passé, man verlegte sich auf den Kampf gegen nationalsozialistische Verbrecher, von denen es immer noch reichlich gab und die ein bürgerliches Leben in der Mitte des Staates führten.
Man wandte sich endgültig von der RAF ab, die inzwischen eher die Demokratie bekämpfte als deren Feinde, recherchierte in Chroniken aus der NS-Zeit, alten Zeitungen, Tagebüchern. Das Internet erleichterte später die Arbeit.
Ziel war es, die Täter und Mittäter zu entlarven und sie, im Unterschied zum Simon-Wiesenthal-Center, nicht der deutschen Gerichtsbarkeit auszuhändigen, der man nicht über den Weg traute, sondern Selbstjustiz zu üben und ein für alle Mal für Gerechtigkeit zu sorgen.
Um in die Nähe staatlich verwalteter Täterakten zu gelangen, begaben sich Asbahr und Freunde auf den »langen Marsch durch die Institutionen«, wie ihn Rudi Dutschke genannt hatte. Man sicherte sich Posten in den Schaltstellen von Politik und Wirtschaft.
Asbahr selbst nistete sich in der Kommunalverwaltung ein und sein unaufhaltsamer Aufstieg führte ihn in die Höhen eines Verwaltungsfachangestellten, Bereich Personalwesen. Dort erhoffte er sich Zugang zu einschlägigen Akten.
Wie Simon Wiesenthal, dem Nazijäger und unerschrockenen Kämpfer für die Gerechtigkeit, brauchten auch die Ex-Aktivisten aus der Hafenstraße viele Jahre, bis ihre Bemühungen auf diesem Felde zum Erfolg führten.
Als es soweit war, erstaunte es sie, wie sich große Weltgeschichte mitunter in nächster Nähe, quasi gleich um die Ecke, ereignen kann.
Klaus Kortas, leidenschaftlicher Sammler alter Schallplatten und als solcher auf sämtlichen Hamburger Flohmärkten unterwegs, klingelt eines Tages Sturm an der Haustür seines Freundes René Asbahr.
»Du wirst es nicht glauben! Ich habe eines dieser Monster ausfindig gemacht.« Kortas wedelt aufgeregt mit einer Plattenhülle. Als die erste Erregung sich gelegt hat und die Hülle zur Ruhe kommt, sieht René Asbahr, dass es sich um einen Tonträger in einem ungewöhnlichen Format handelt, auf dessen Verpackung seltsam anmutende Schriftzeichen gedruckt sind. Daneben das Porträt einer jungen attraktiven Frau. »Und …«, Kortas tippt mit dem Finger auf das Foto, »… ich kenne sie!!«
Der verblüffte Asbahr muss nicht lange auf eine Erklärung warten. »Diese Schellackplatte habe ich zufällig auf dem Flohmarkt an der Feldstraße gefunden«, berichtet sein Freund. »Sie ist kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in der Ukraine aufgenommen worden. Deshalb auch die kyrillischen Schriftzeichen. Es handelt sich um Chorgesänge. Ukrainische und deutsche Volksmusik.«
»Woher weißt du das?«, fragt Asbahr. »Sprichst du kyrillisch?«
Kortas schüttelt den Kopf. »Kyrillisch ist keine Sprache. – Der Verkäufer war ein Russe. Der hat mir erklärt, worum es sich handelt.«
»Und seit wann …«, staunt Asbahr, »… stehst du auf Volksmusik?«
»Tu ich ja nicht.« Kortas zeigt auf den Plattenumschlag. »Es war das Bild, das mir auffiel.«
»Aha. Und das Mädchen ist dir bekannt«, entgegnet Asbahr zweifelnd.
Unbeirrt nickt sein Freund. »Der Russe hatte keine Ahnung, was er da alles verhökert. Musik komplett verschiedener Stilrichtungen. Ganz vorn eine Scheibe von Whitney Houston. Dahinter eine LP von Doris Day. Ich habe gemerkt, dass der Typ Platten verkauft, die alle eine hübsche Frau auf dem Cover haben. Beim Durchblättern …«
»Hübsche Frau? Doris Day??«
Achselzucken. »Na, ja. Ansichtssache.« Lächeln. »Aber darum geht’s auch gar nicht.«
»Sondern?«
»Wie gesagt: Als ich eine Weile weitergeblättert habe, stoß ich irgendwann im Stapel auf diese Scheibe. Nicht zu fassen, welche Zufälle das Leben mitunter bereithält!« Wieder zeigt Kortas auf das Bild der jungen Künstlerin. »Ich kannte sie, da war sie älter. Deutlich älter.« Er atmet tief durch. »Ich hatte sie in Mathe. Vier Jahre lang.« Kortas nickt versonnen. »Sie war Lehrerin auf meiner Schule. Später Rektorin. Da hieß sie Hermine Grabert.«
»Deine Lehrerin. Ah ja.« Asbahr wirft ihm schelmische Blicke zu.
»Ich weiß«, antwortet Kortas. »Es ist schwer zu glauben. Aber ich bin ganz sicher.« Sein Blick fällt wieder auf das Foto. »Sie ist es.«
»Hm. – Da steht eine Zeile unter dem Bild«, bemerkt Asbahr. »Das wird ihr Name sein, oder?«
Kortas sieht seinen Freund an und nickt. »Aber eben kyrillisch. Ich habe den Verkäufer gebeten, mir den kompletten Text auf dem Cover zu übersetzen. Die Scheibe, meinte er, sei in Kiew in einem Tonstudio aufgenommen worden. Von einem ukrainischen Mädchenchor. Da war ich schon sicher, dass es sich um Hermine Grabert handelt …«
Asbahr ist irritiert. »Woher wusstest du das?«
»Ich kann mich dran erinnern, dass sie einmal im Unterricht erzählte, dass sie nach dem Krieg in der Ukraine war.« Kortas lächelt. »Sie hat sogar einige Brocken der Sprache losgelassen.« Er hebt die Schultern. »Wir waren damals natürlich zu jung, um sie zu fragen, was sie dort gemacht habe.«
»Verstehe.«
»Ja. Dann wurde ich wieder unsicher, weil der Russe sagte, der Name des Mädchens wäre mit Charlotte Finn angegeben«, sagt Kortas. »Ob er sicher sei, habe ich ihn gefragt. Absolut, meinte er.«
»Und?«
»Dann habe ich geforscht«, sagt Kortas. »Dieses Google ist wirklich ’ne feine Sache. Da findest du so ziemlich alles. Also – pass auf.«
»Ich lausche dir.«
»Zunächst habe ich den Namen eingegeben, wie er auf der Platte steht. Charlotte Finn.« Kortas macht eine hilflose Geste. »Tatsächlich mehrere Treffer. Aber keiner, der hinhaute. Dann hab ich …«, sagt er lächelnd und hebt bedeutsam den Zeigefinger, »… gedacht: versuch‘s mal andersrum und gib den Namen ein, unter dem du sie kennst: Hermine Grabert.« Er macht eine spannungsvolle Pause. »Und siehe da: Es gibt im Netz ein altes Jahrbuch einer Schule, auf der sie vorher war. In den Sechzigern. Alle Lehrer sind dort aufgeführt. Mit ihrem Lebenslauf.« Kortas senkt die Stimme zu einem nachdenklichen Flüstern. »Ich hatte angenommen, sie habe vielleicht inzwischen geheiratet und demzufolge einen anderen Nachnamen. Oder Charlotte Finn sei ihr Künstlername gewesen.«
»Du machst es spannend.«
»Es ist spannend, René!« Eindringlich sieht Kortas seinen alten Kampfgefährten an. »Ihr Lebenslauf beginnt 1926 und geht weiter bis 1940. Dann gibt es eine Lücke und wird 1946 mit dem Beginn ihrer Ausbildung fortgeführt. Studium, Referendariat und so weiter. Die fehlenden Jahre werden schlicht mit der Unterbrechung durch den Krieg erklärt.«
Asbahr lauscht jetzt aufmerksam. »Und weiter?«
»Immerhin wird in einem Nebensatz beschrieben, dass Hermine während des Kriegs eine Zeitlang im polnischen Krakau gearbeitet habe. Als Sekretärin. Ohne weitere Erklärung.«
»In Polen?«
Kortas nickt. »Nun habe ich mir den ausgefeilten Algorithmus von Google zunutze gemacht und die Stichworte nacheinander in das Suchfeld eingegeben. Bei Hermine Grabert bin ich nicht fündig geworden …«
»Lass mich raten«, sagt Asbahr. »Bei Eingabe von Charlotte Finn hast du einen Treffer gelandet.«
Kortas nickt heftig. »Das kann man wohl sagen. Bei der Kombination Finn – Krakau – Sekretärin finde ich ein Dokument aus dem Jahr 1943. Einen Bericht über eine Weihnachtsfeier. Nicht zu fassen! Nahe Krakau gab es ein Konzentrationslager namens Plaszow. Auch in der Hölle wird Weihnachten gefeiert, René! Auf einer Abbildung siehst du die Lagermannschaft. Vom Kommandanten bis zum einfachen Angestellten. Mit ihren Namen. Und, ganz vorn, eine Weihnachtsmütze auf dem Kopf: Charlotte Finn. In der Bildunterschrift steht weiter: ›Leiterin des Lagerchors. Von ihren Kameraden Charlie genannt.‹ Was sagst du jetzt?«
»Damit hast du vielleicht bewiesen«, entgegnet Asbahr, »dass die junge Dame im KZ gearbeitet und später eine Platte aufgenommen hat. Was hat das aber mit deiner … äh … Lehrerin zu tun?«
»Warte ab«, sagt Kortas. »Jetzt kommt’s! In dem Jahrbuch ihrer Schule stand, dass Charlotte Finn nach dem Krieg in die Ukraine gegangen ist. Genauso, wie sie es uns als Lehrerin damals erzählt hat. Dort hat sie mit ein paar Mädchen aus dem KZ offensichtlich Konzerte gegeben und später in Kiew diese Platte aufgenommen. Der Chor hatte sich den Namen ›Nachtigallen Galiziens‹ gegeben.«
»Sehr hübsch.«