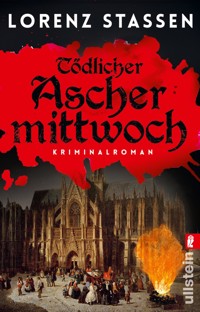Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
»Wo Zorn und Rache heiraten, wird die Grausamkeit geboren …« In der Vergangenheit hat Nicholas Meller sich in der Polizei eher Feinde gemacht – immerhin war er lange Zeit die beste Adresse für Kölns Kleinkriminelle, bevor er zum Staranwalt der Reichen und Zwielichtigen aufstieg. Umso überraschender, dass ausgerechnet sein alter Rivale nun seine Dienste in Anspruch nimmt: Der Hauptkommissar Rongen wird des Mordes angeklagt. Angeblich soll er einen unbewaffneten Mann erschossen haben – der Hauptverdächtige in einer Reihe eiskalter Polizistenmorde. Auf der Suche nach der Wahrheit verstrickt Meller sich immer tiefer in ein Netz aus Korruption und Gewalt – und die Fäden führen zu dem ungelösten Mordfall der Prostituierten Ivana und zu seinen eigenen Deals mit der russischen Mafia … Perfide Psychospannung von Drehbuchautor Lorenz Stassen – das Finale der atemlosen Thriller-Reihe wird Fans von Steve Cavanagh fesseln!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
In der Vergangenheit hat Nicholas Meller sich in der Polizei eher Feinde gemacht – immerhin war er lange Zeit die beste Adresse für Kölns Kleinkriminelle, bevor er zum Staranwalt der Reichen und Zwielichtigen aufstieg. Umso überraschender, dass ausgerechnet sein alter Rivale nun seine Dienste in Anspruch nimmt: Der Hauptkommissar Rongen wird des Mordes angeklagt. Angeblich soll er einen unbewaffneten Mann erschossen haben – der Hauptverdächtige in einer Reihe eiskalter Polizistenmorde. Auf der Suche nach der Wahrheit verstrickt Meller sich immer tiefer in ein Netz aus Korruption und Gewalt – und die Fäden führen zu dem ungelösten Mordfall der Prostituierten Ivana und zu seinen eigenen Deals mit der russischen Mafia …
eBook-Neuausgabe Juli 2025
Dieses Buch erschien bereits 2020 Heyne.
Copyright © der Originalausgabe 2020 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28,81673 München
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Olga_C, U-Design, Nataly Fox, Oleg Krugliak
eBook-Herstellung: dotbooks GmbH unter Verwendung von IGP (lj)
ISBN 978-3-98952-976-2
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Lorenz Stassen
Opferfluss
Thriller
Für Malin
Wo Zorn und Rache heiraten,
wird die Grausamkeit geboren.
Russisches Sprichwort
Frühsommer 2018
Ivana starrte an die Decke. Auf dem Rücken liegend, die Beine um seinen Körper geschlungen. Das Bett gab kaum Geräusche von sich, er dafür umso mehr. Die Matratze war weich, federte jeden seiner Stöße ab. Er fand in keinen Rhythmus, der sie auch nur annähernd stimulierte. Sie spürte seinen Penis in sich, mehr nicht. Er war klein. Seine Bewegungen wirkten unbeholfen wie die eines Teenagers. Dass sie es mit einem blutigen Anfänger in Sachen käuflicher Liebe zu tun hatte, war ihr sofort klar gewesen, als die Hoteltür aufschwang und seine Augen leicht verschämt ihrem Blick auswichen. Die verschwitzte Hand, die er zum Gruß reichte, seine gespielte Galanterie, als er ihr aus dem Mantel half. All das waren eindeutige Signale, die sich nun bestätigten.
Wie so oft hatte Ivana sich für das rote Cocktailkleid entschieden, schwarze Nylons, silberne Designerschuhe mit hohen Absätzen und einen fast durchsichtigen schwarzen Seidenschal. Ihr praller Hintern kam in dem enganliegenden Kleid gut zur Geltung. Oben herum hatte sie weniger zu bieten. Viele Kunden schätzten gerade das an ihr. Eine zierliche Frau mit einem gewaltigen Arsch, den sie gekonnt zum Einsatz brachte. Ihr Anblick hatte ihn noch nervöser werden lassen, das erste Glas Champagner leerte er beinahe in einem Zug. Ivana übernahm das Reden. Er hörte nicht zu, das verrieten seine Augen, die nervös hin und her zuckten. Zeit verging. Zeit bedeutete Geld.
Jetzt wurde sein Keuchen lauter. Zum Höhepunkt bäumte er sich auf. Schweiß perlte von seiner Stirn, tropfte auf ihre kleinen Brüste. Dann war es vollbracht. Endlich. Jemand wie er würde es kein zweites Mal schaffen, seine Erektion ließ nach, als er noch in ihr steckte. Schwer atmend drehte er sich auf den Rücken.
Ivana erledigte die Formalitäten. Das Kondom wickelte sie in ein Taschentuch, verschwand damit ins Badezimmer, schloss die Tür hinter sich ab. Sie warf das feuchte Taschentuch mitsamt Kondom in die Toilette, sah in den Spiegel. Ihr Make-up hatte kaum gelitten. Sie nahm ein Handtuch vom Haken, hielt es kurz unter den Wasserhahn und machte sich zwischen den Beinen sauber. Dann holte sie ihr Smartphone aus dem goldenen Louis-Vuitton-Täschchen. Eine Sprachnachricht war eingegangen, sie hörte sie ab.
Anderthalb Stunden später ging Ivana wieder durch einen Hotelkorridor. Am Türknauf von Zimmer 419 hing das rote Schild Bitte nicht stören. Ivana klopfte zaghaft. Es dauerte. Nichts tat sich. Sie klopfte noch mal, etwas energischer, fast zeitgleich schwang die Zimmertür auf. Ein bekanntes Gesicht stand vor ihr. Sie wusste nicht seinen Namen. Er war Stammkunde, nicht bei ihr, aber bei anderen Frauen. Sie hatte ihn schon mehrfach im Haupthaus gesehen, wie das Bordell genannt wurde, Ivanas offizieller Arbeitsplatz. Ein Bordell ohne Rotlicht. Eine Adresse, die nur Eingeweihte kannten. Bekannt für seine Diskretion, was eine ganz besondere Kundschaft anlockte.
Seine Hand, die er ihr zur Begrüßung reichte, war nicht verschwitzt. Sie trat ein. Die Tür fiel hinter ihr ins Schloss, und sie hörte, wie er den Riegel betätigte.
Ivana wusste von ihren Kolleginnen, dass er Alkoholiker war und nur selten eine Erektion bekam. Ob der Alkohol schuld daran war oder ob er trank, weil er keinen mehr hochkriegte, wusste sie nicht.
Er machte keine Anstalten, ihr aus dem Mantel zu helfen, also zog sie ihn selbst aus, legte ihn über eine Stuhllehne. Er griff nach dem Geld, das neben dem Fernseher auf dem Tisch lag. »Na los. Hier. Steck es ein.« Sein Befehlston war herabwürdigend.
Fünf hellgrüne Scheine. Ivana ließ die Hunderter in ihrer Handtasche verschwinden. Er griff zu einer Bierflasche, die auf dem Nachttisch stand, trank den letzten Schluck, rülpste laut, bevor er fragte, ob sie auch etwas trinken möchte. Ivana verneinte. Sie legte den schwarzen Seidenschal ab. »Lass uns anfangen. Wie möchtest du es?«
»Wie möchtest du es«, äffte er sie nach, fand sich witzig dabei. »Tja. Wir könnten ein bisschen reden. Meine Freundin hat mich verlassen. Ich möchte ... einfach nur ...«Er prustete los vor Lachen, öffnete den kleinen Kühlschrank, holte eine Flasche Bier heraus.
Ein Blick aufs Etikett. »Fuck!«
Ivana zuckte zusammen.
»Alkoholfrei! Fuck. Haben die noch nicht mal zwei Pullen richtiges Bier in ihrer scheiß Minibar?« Er stellte die Flasche zurück, holte zwei kleine Schnapsfläschchen heraus. Jack Daniels und Gordons Dry Gin. Er öffnete den Gin, kippte ihn herunter, gierig wie ein Verdurstender in der Wüste.
Er machte einen nervösen Eindruck, aber nicht so wie der letzte Freier. Dieser Mann verbarg etwas, wollte eine Fassade aufrechterhalten. Er war muskulös, nicht viel größer als sie, trug ein weißes T-Shirt mit einer roten Aufschrift. Der Name einer Band, die Ivana nicht kannte. Seine O-Beine steckten in einer dunkelblauen Röhrenjeans. Er war ein Typ, der ihr unter normalen Umständen durchaus gefallen könnte. Im nüchternen Zustand, gut riechend, nicht rülpsend. Ivana hatte im Laufe der Jahre einen Instinkt für Gefahren entwickelt, was sie bisher vor Schlimmerem bewahrt hatte. Sie nahm das Geld aus ihrer Handtasche, legte es auf den Tisch neben den Fernseher, um dann stumm ihren Mantel vom Stuhl zu nehmen.
»Hey«, blaffte er sie an. »Was wird das?«
»Ich gehe.«
Er machte keine Anstalten, sie aufzuhalten, nahm stattdessen die Jack-Daniel’s-Flasche zwischen seine Lippen, warf den Kopf nach hinten. Die braunrote Flüssigkeit gluckerte in seinen Mund. Da hörte sie hinter sich ein Geräusch, fuhr herum. Licht fiel in den schmalen Korridor, der zur Zimmertür führte. Ein weiterer Mann trat aus dem Bad, versperrte ihr den Weg. Sein Gesicht erkannte sie nicht. Zählte er auch zu den Stammgästen? Warum hatte er sich im Bad versteckt? Jetzt fingen Ivanas Hände an zu schwitzen. Sie versuchte, selbstsicher zu klingen. »Was soll das? Ein Dreier war nicht abgemacht.«
»Mein Freund hat es dir doch schon gesagt, hörst du nicht zu?« Er hatte eine sonore Stimme, war groß, schlank, etwas älter als der Trinker. Die dunklen Haare auf einen Millimeter gestutzt. Seine Augen machten Ivana Angst.
»Wir wollen nur reden.« Er griff nach ihrem Mantel, den sie in der Hand hielt, pfefferte ihn auf den Boden.
Ivana wich instinktiv einen Schritt zurück, noch einen, bis sie die Alkoholfahne hinter sich roch. Der Trinker schlang seine Arme um sie, die Hände wanderten zu ihren kleinen Brüsten hinauf. Sie zuckte zusammen. Er griff zu, so fest, dass es wehtat. Ivana konzentrierte sich darauf, nicht in Panik zu geraten. Nur keine Panik. Langsam atmete sie ein und aus.
»Die Kleine zittert«, sagte der Trinker. »Ist dir etwa kalt?«
»Wer seid ihr?« Sie blaffte den Mann vor sich an. Er schien hier das Sagen zu haben.
»Tu nicht so, als ob du uns nicht kennst.«
»Ihn ja, sein Gesicht. Aber eure Namen nicht.«
»Namen sind Schall und Rauch«, hauchte der Trinker ihr ins Ohr.
Ivana fasste seine Hände, befreite sich aus dem brutalen Griff. »Ihr wisst, was passiert, wenn ihr mich nicht gehen lasst.«
Der Ältere verzog keine Miene. »So, was denn?«
»Renata weiß, dass ich hier bin. Morosows Leute reißen euch die Eier ab und stecken sie euch in den Hals. Wenn ihr Glück habt, vielleicht lassen sie sich für euch auch was Neues einfallen.«
Die Worte schienen Wirkung zu zeigen. Der Trinker wandte sich wieder der Minibar zu, genehmigte sich noch ein Fläschchen. Diesmal einen klaren Schnaps.
Ivana holte tief Luft.
»Setz dich.« Der Ältere deutete auf den Sessel, der neben einem Beistelltisch stand. Sie folgte der Aufforderung, presste die Schenkel zusammen, zog das Cocktailkleid so weit wie möglich herunter.
Der Mann sah auf sie herab. »Du wirst es vielleicht nicht glauben, aber Morosow hat uns geschickt. Redet mit ihr, hat er gesagt. Bringt sie zur Räson. Genau das waren seine Worte.«
»Nein.« Ivana sprang auf, gewann an Selbstsicherheit. Sie wusste, dass das nicht sein konnte. In ihren hohen Schuhen war sie fast so groß wie der Mann. »Wenn Morosow ein Problem mit mir hätte, würde er nicht zwei Clowns wie euch schicken.«
Die Ohrfeige traf sie wie aus dem Nichts. Ivanas Kopf schnellte zur Seite, sie drohte das Gleichgewicht zu verlieren, stützte sich an der Sessellehne ab. Ihre linke Wange fühlte sich zuerst taub an, dann folgte der brennende Schmerz. Das Pfeifen im Ohr. Sie schmeckte Blut, fasste sich an den Mund. Ihre Unterlippe war aufgeplatzt.
»Morosow ist der Meinung, dass die Angelegenheit eine persönliche Sache sei – nur zwischen uns.«
»Was denn für eine Angelegenheit?« Sie war sich keiner Schuld bewusst. Die Gedanken in ihrem Kopf spielten Pingpong. Nein, es gab nichts, was sie falsch gemacht hatte. Der Trinker packte sie brutal an den Haaren, warf sie aufs Bett. Er griff ihre Fußgelenke, zog ihren Körper so weit zurück, dass ihre Hüften auf der Bettkante lagen. Er drehte sie auf den Bauch, schob das Cocktailkleid nach oben, zerriss ihren Slip. Für einen kurzen Moment keimte die Hoffnung auf, dass es sich um ein Rollenspiel handeln könnte. Manche Männer machte das geil. Vor allem solche, die keine Erektion mehr bekamen. Ivana ließ es geschehen. Er zog seinen Ledergürtel aus den Schlaufen. Faltete ihn einmal, holte aus. Beim ersten Schlag zuckte Ivana zusammen, gab keinen Laut von sich, griff nach dem Kopfkissen, vergrub ihr Gesicht darin. Der zweite Schlag war umso härter, der dritte, der vierte. Pobacken und Oberschenkel. Beim fünften Schlag schrie sie auf. Er drückte ihren Kopf fest ins Kissen. Nein, kein Rollenspiel. Sechs, sieben, acht. Die Schläge folgten kurz aufeinander. Ivana schrie ins Kopfkissen. Ihre Beine strampelten. Endlich hörte er auf.
Der Ältere stand wie unbeteiligt daneben. Jetzt kam er einen Schritt näher ans Bett heran. »Was hast du deinem Romeo über uns erzählt?«
Ivanas Lidschatten hatte auf dem Kissen schwarze Spuren hinterlassen. »Nichts«, wimmerte sie. »Ich habe nichts erzählt.« Ivana sah ihn flehend an, Tränen liefen ihr über die Wangen. Ihr Po, ihre Schenkel brannten wie Feuer.
»Aha, du hast also nichts erzählt. Weißt aber genau, wen ich mit Romeo meine?«
»Was sollte ich ihm erzählt haben? Ich kenne noch nicht mal eure Namen.«
Der Mann kam noch einen Schritt näher, beugte sich über sie. »Scheißegal, ob du unsere Namen weißt. Er kennt sie. Also, was hast du ihm erzählt?«
Ivana musste sich eine Geschichte einfallen lassen. Schnell. Eine gute Geschichte. Zu spät. Der Ältere packte sie an den Haaren, bis ihr Kopf weit nach hinten gestreckt war. Die Ohrfeige traf sie ebenso hart wie unvermittelt, ihr Kopf flog zur Seite. Der Schmerz schoss wie ein Stromschlag durch ihren Schädel. Ivana fasste an die Stelle, wo der Ältere ihr ein Büschel Haare herausgerissen hatte. Ihr blieb die Luft weg, sie konnte nicht schreien. Übelkeit überkam sie, Ivana musste würgen. Das Bild verschwamm vor ihren Augen. Nur noch schemenhaft sah sie den Trinker, wie er nach der leeren Bierflasche griff. Sie lag immer noch auf dem Bauch, er verschränkte ihre Arme auf dem Rücken, hielt sie an den Handgelenken fest.
»Wir dürfen alles mit dir machen, hat Morosow gesagt.« Der Trinker lachte. »Wir haben seine Erlaubnis.«
Ivana spürte, wie er sich zwischen ihre gespreizten Beine stellte. Etwas Kaltes strich über ihre Pobacken. Sie wusste, dass es die Bierflasche war.
»Nein!« Sie schrie noch lauter. »Nein!«
Er lachte lauter. »Oh doch. Ich weiß, wie du es magst. Und wenn du uns nicht sagst, was wir hören wollen, schiebe ich sie dir bis zum Anschlag in dein Arschloch.«
Sie spürte, wie das kalte Glas zwischen ihre Pobacken glitt.
»Ich sage euch alles«, schrie sie.
»Das tust du ganz bestimmt.« Er hörte nicht auf, er war ein Sadist. Sie spürte den Flaschenhals. Zentimeter um Zentimeter drang er in sie ein. Ivana versuchte, nicht zu verkrampfen. Unmöglich. Der Schmerz war unerträglich. Aber der Trinker war nur auf die Flasche fixiert, nicht auf ihre Handgelenke. Sein Griff ließ nach. Es war ihre Chance. Mit einer ruckartigen Bewegung schnellte Ivana herum, zog das linke Bein an, trat zu. Ivana vernahm, wie die Luft aus seinen Lungen entwich. Der Trinker sackte auf die Knie, fasste sich zwischen die Beine. Sie griff nach der Flasche, zog sie heraus, sah den Älteren vor sich, schlug zu. Mit aller Kraft. Die Flasche zerbarst nicht, aber sie hatte gut getroffen. Er hielt sich die Hände vors Gesicht.
Ivana kam auf die Beine, der Fluchtweg zur Tür war frei. Sie hatte die Klinke bereits in der Hand, als ihr Peiniger sie von hinten packte. Diesmal schlug der Mann mit der Faust zu. Mehrmals knackte es in ihrem Schädel. Blut schoss aus der Nase. Blind vor Schmerz, hielt Ivana schützend die Hände vors Gesicht. Die nächsten Schläge spürte sie nicht mehr.
Erst auf dem Bett liegend, kam Ivana wieder zu sich. Das Laken blutverschmiert. Nur verschwommen sah sie den Trinker, der immer noch wimmernd am Boden kniete, die Hände zwischen den Beinen. Der Mann, den sie mit der Flasche getroffen hatte, drehte Ivanas Kopf herum. Sie spuckte ihm ins Gesicht. Angewidert wich er zurück, wischte sich Blut und Rotze weg. Ivana fing an zu schreien. Ein Kreischen, so laut, dass es selbst durch die schallgedämmten Wände dringen würde. Sie schrie um ihr Leben. Bis sich zwei Hände um ihren Hals legten. Ivanas Kreischen verstummte, sie sah in sein blutverschmiertes Gesicht. Der pure Hass spiegelte sich in seinen Augen wider.
»Du verdammte Drecksnutte«, zischte er. »Du Drecksfotze.«
Ivana griff nach seinen Handgelenken. Ihr Körper bäumte sich auf, die Beine zappelten. Da vernahm sie ein Geräusch, das nicht von außen kam. Nicht aus diesem Zimmer. Er hatte das Knacken auch vernommen. Sie spürte, wie er die Hände von ihrem Hals nahm. Ivana schnappte nach Luft. Es fühlte sich an, als habe sie etwas verschluckt. Wie ein Korken, der ihr im Hals steckte. Sie versuchte zu husten, aber ihre Lungen waren leer. Mit beiden Händen fasste sie an ihren Hals. Eine Lücke, sie ertastete mit ihren Fingern eine Lücke. Der Mann starrte auf sie herab. Fassungslos. Er hob beide Hände, um ihr zu zeigen, dass er sie nicht mehr würgte. Ivanas Zwerchfell verkrampfte sich. Mit aller Kraft versuchte ihr Körper, Luft einzusaugen.
»Was ist mit ihr?« Der Trinker war auf die Beine gekommen.
»Der Kehlkopf ... gebrochen.«
»Und jetzt?«
Ivana wand sich hin und her, ihre Beine traten im Überlebenskampf um sich. Sie gab nicht auf, versuchte, Luft zu holen.
»Kann man denn nichts machen?«, schrie der Trinker.
»Dann mach doch.«
Ivana riss voller Entsetzen die Augen auf. Ihr ganzer Körper zuckte.
»Scheiße, Scheiße, Scheiße«, fluchte der Alkoholiker.
Ivana starrte in das blutverschmierte Gesicht des Mannes. Ihr Blut. Er versuchte zu helfen, drückte auf dem Hals herum. Doch dann legte sich ein Schleier auf alles. Es wurde dunkler und dunkler im Zimmer und schließlich schwarz. Sie konnte die beiden nicht mehr sehen, hörte nur noch ihre Stimmen, dann verstummten diese auch.
Ivana lag vor ihnen auf dem Bett, atmete nicht mehr, die Muskeln erschlafft. Ihre Arme waren ausgestreckt wie Jesus am Kreuz. Ihr Gesicht eine Kraterlandschaft. Überall Blut. Der Trinker riss sich vom Anblick los, ging zur Minibar, nahm die letzte Flasche heraus, leerte sie in einem Zug.
Die beiden Männer sahen sich stumm an.
Sie hatten gelogen.
Morosow hatte ihnen nie eine Erlaubnis erteilt.
Kapitel 1
Dezember 2019
Er war stehen geblieben. Um zu hören, anstatt zu sehen. In der Dunkelheit bildete der Wald ein bizarres Gewirr aus Stämmen, Ästen, Zweigen, von ein wenig Mondlicht erhellt. Der Boden eine schwarze Masse. Es hatte aufgehört zu regnen, aber das Wasser tropfte noch von den Ästen. Der Flüchtige konnte nicht weit sein. Unmöglich. Hatte er sich versteckt? In der Hoffnung, dass sein Verfolger an ihm vorbeilaufen würde? Ein Geräusch. Ruckartig fuhr Thomas Rongen herum, rutschte beinahe aus, fing sich wieder. Nichts. Nur die Schattenrisse der Bäume und Äste. Allmählich machte die Kälte sich bemerkbar, kroch langsam von unten die Beine hinauf. Seine Schuhe waren durchweicht. Der Zeigefinger ruhte neben dem Abzug seiner Walther P99. Mit angewinkelten Armen hielt er die Pistole im Anschlag, den Lauf zum Boden gerichtet.
Rongen hielt den Atem an. Ein Gedanke durchzuckte ihn. Befand sich eine Patrone im Lauf? Er war aus dem Auto ausgestiegen, hatte er da die Pistole durchgeladen? Er musste es überprüfen.
Mit der linken Hand fasste er an den Metallschlitten, zog ihn vorsichtig ein Stück zurück. Er konnte die Patrone nicht sehen, noch ein Stück, dann war das Messing im schwachen Mondlicht zu erkennen. Beruhigt ließ er den Schlitten wieder nach vorne gleiten, beim Einrasten gab es das typische Geräusch. Im selben Moment vernahm er etwas neben sich, sah nach rechts, riss die Waffe hoch. Sein Blick schweifte umher. Bewegte sich da was? Zwischen den Bäumen?
»25-14 von Arnold, kommen«, ertönte es aus dem Funkgerät, das er an seinem Gürtel trug. Mit der linken Hand schaltete er es stumm. Da vernahm er ein Knacken. Im Dickicht, eine Gestalt huschte vorbei, verschwand wieder in der Dunkelheit. Rongen setzte sich in Bewegung, lief in die Richtung, in die der Schatten gelaufen war. Den Lauf der Waffe zum Boden gerichtet.
In diesem Moment hörte er etwas, das wie Sirenen klang. Es waren Sirenen. Rongen hatte längst Orientierung und Zeitgefühl verloren, wusste nicht mehr, wie weit er sich von seinem Auto entfernt hatte.
Jetzt sah er den Flüchtigen direkt vor sich, keine zehn Meter. Die Sirenen wurden lauter. Und: Rotoren. Sie schickten ihm einen Hubschrauber.
Das war es! Sie hatten ihn. Der Flüchtige konnte nicht mehr entkommen. Das Rattern der Rotoren würde ihm die Ausweglosigkeit seiner Situation verdeutlichen. Trotzdem rannte der Mann weiter, änderte wieder den Kurs, lief noch tiefer in den Wald hinein, suchte den Schutz der Dunkelheit. Es war seine letzte Chance. Die Scheinwerfer des Helikopters, wenn sie ihr Ziel einmal erfasst hätten, würden nicht mehr von ihm ablassen. Er wäre ein greller, leuchtender Punkt. Wie eine reife Frucht am Baum, die man nur noch pflücken müsste. Aber noch war es nicht so weit. Noch war Rongen der Einzige, der Sichtkontakt zu ihm hatte.
»Bleiben Sie stehen, Brenner! Es hat keinen Zweck mehr!«
Sie hatten seinen Namen, eine Adresse, ein Fahndungsfoto.
Er war eingekreist von Einsatzkräften, sie kamen von überall. Der Klang der Sirenen wurde lauter, ebenso das Rattern der Rotoren. Vereinzelt flackerte bereits Blaulicht durch das Dickicht, so nah waren die Kollegen schon. Rongen könnte stehen bleiben, sein Funkgerät wieder einschalten, auf die Verstärkung warten.
Nein. Er war seinem Ziel so nah. Er konnte jetzt nicht einfach stehen bleiben.
Er sah Brenner erst, als er direkt vor ihm stand. Rongen riss die Pistole hoch, den Finger am Abzug. Durchgeladen. Entsichert. Das Mondlicht erhellte das Gesicht des Mannes. Rongen sah ihn jetzt klar und deutlich. Frank Brenner, der beschlossen hatte, nicht mehr weiterzurennen. Ihre Blicke trafen sich.
Langsam hob Brenner den rechten Arm. In seiner Hand hielt er eine Pistole.
Kapitel 2
Meine Mutter konnte sehr gut kochen. Und sie war eine perfekte Gastgeberin. Sie überließ nichts dem Zufall, angefangen von der bestickten Tischdecke, über die Anzahl der Gläser, die Temperatur der Getränke und die Farbe der Servietten. Auch die passende Hintergrundmusik, dem Anlass entsprechend meist klassische Klavierstücke, durfte nicht fehlen. Der schwarz lackierte Bösendorfer-Flügel im Wohnzimmer bildete nicht nur den Mittelpunkt des Raumes, das Instrument hatte das Leben meiner Mutter geprägt. Vielleicht war sie deshalb so unnachgiebig als Lehrerin. Alte russische Schule, meist von Erfolg gekrönt. Wie untalentiert ein Schüler oder eine Schülerin auch sein mochte, sie konnte jedem das Musizieren beibringen. Alles nur eine Frage von Fleiß und Willenskraft. Die Eltern der Kinder waren begeistert von ihr, denn Frau Meller machte auch jeden Mangel an guter Erziehung wett.
Lediglich einen Schüler hatte sie irgendwann vergrault, obwohl er talentiert zu sein schien: mich. Sie hatte mir bis heute nicht verziehen, dass ich schnelle Läufe lieber auf dem Fußballplatz einstudierte als auf der Klaviatur.
Wie immer hatte meine Mutter alles perfekt geplant, die kleine familiäre Zusammenkunft war ein wichtiges Ereignis, aber für gute Stimmung konnte sie nicht sorgen. Ein Gespräch wollte nicht recht in Gang kommen. Was an Nina lag, die mit uns am Tisch saß. Sie hatte eine Behinderung. Seit der Geburt fehlte ihr der rechte Arm. Ich hatte mich so sehr an den Anblick gewöhnt, dass ich mir eine Nina mit zwei Armen gar nicht mehr vorstellen konnte. Für die meisten, die sie zum ersten Mal sahen, löste der Makel Irritationen aus. Bei mir war es am Anfang nicht anders gewesen. Ich erinnerte mich noch gut an unsere erste Begegnung, bei der ich mich wie ein Trottel benommen hatte. Nina war sehr schön. Ihre blonden Haare trug sie schulterlang, ihr Lächeln war zauberhaft. Auch deshalb, wegen ihrer Schönheit, war der fehlende Arm wie ein furchtbar schiefer Ton in einer ansonsten perfekten Melodie.
Meine drei Jahre ältere Schwester Anna saß Nina gegenüber und neben ihr Gregori, ihr Ehemann. Genau wie ich war Anna in Westsibirien aufgewachsen. In Tomsk, unser beider Geburtsstadt, hatte es keine behinderten Menschen gegeben. Zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Eine Behinderung war schließlich eine Abweichung von der Norm, und im real existierenden Sozialismus sollten alle Menschen gleich sein. Wenn man nie mit einer solchen Spielart der Natur konfrontiert worden war, lernte man auch nicht, respektvoll mit Behinderten umzugehen. Aus diesem Grund dürfte man es den Leuten eigentlich nicht krummnehmen, wenn sie komisch reagierten. Ich tat es trotzdem, es war, als ob ich Nina beschützen müsste.
Anna und Gregori sahen Nina heute zum ersten Mal. Für sie war der fehlende Arm offensichtlich wie der berühmte rosa Elefant, je mehr sie sich bemühten, nicht an ihn zu denken, umso mehr taten sie es. Ich wusste, dass Nina wesentlich lockerer damit umgehen konnte als ich. Sie hatte von früh auf gelernt, mit komischen Blicken umzugehen. Ich nicht. Die Reaktion meiner Mutter ärgerte mich noch immer. Sie hatte Nina den Handschlag verweigert, anstatt sich herabzulassen, ihr die Linke zu geben.
Dies war vor einer halben Stunde gewesen, und seitdem war meine Mutter vor allem in der Küche beschäftigt, von wo aus sie sich jetzt lautstark meldete. »Du könntest doch was auf dem Klavier spielen.«
Anna war gemeint.
»Nein«, gab sie schroff zurück. Die Musik würde den Rest des Abends aus den Lautsprecherboxen kommen.
Gregori hatte die Gabel ergriffen und pikste sich damit auf den Handrücken und bestaunte das entstehende Muster. Bis Anna ihm das Besteck aus der Hand nahm und es wieder an seinen Platz legte. Gregori schwieg die meiste Zeit, Anna redete dafür umso mehr. Im Gegensatz zu uns war er kein Russlanddeutscher. Seine Vorfahren stammten von der Krim, über deren Annexion durch Putin er sich immer noch freute. Er war ein Fan des russischen Präsidenten. Gregori arbeitete als Programmierer. Was genau er machte, erzählte er mir jedes Mal, und ich vergaß es jedes Mal wieder. Anna war Leiterin eines Kindergartens. Das Geschrei dort genügte ihr offenbar, jedenfalls wollte sie selbst keinen Nachwuchs. Mit Gregori war sie sich einig darüber. Eigentlich waren die beiden sich immer einig, weil er nie etwas sagte.
Anna machte einen Anlauf und wandte sich an Nina. »Nicholas sagte, du bist bei der Polizei?«
Jetzt starrte Gregori sie an, leicht verdutzt. Ihm fehlte die Fantasie, sich Nina in Uniform vorzustellen – mit nur einem Arm.
»Ja«, antwortete Nina. »Aber nicht im Vollzugsdienst, sondern als Juristin in der Behörde. Ein Bürojob.«
Gregori verstand und sah schnell wieder woandershin. Der rosa Elefant irritierte ihn zu sehr.
»Klingt interessant«, fuhr Anna fort. »Erzähl mal. Also, wenn du darüber reden darfst.«
Für meine Schwester gab es nichts Schlimmeres, als mit einer fremden Person schweigend am Tisch zu sitzen. Dass sie mit ihren Fragen aufdringlich wirkte, entging ihr.
»Es ist ... wie soll ich sagen«, Nina überlegte kurz, »ich stehe noch ganz am Anfang, arbeite erst seit drei Monaten da. Es ist alles noch ziemlich neu.«
»Und könntest du da auch Karriere machen?«
Nina nickte.
»Polizeipräsidentin?«, bohrte Anna nach.
»Vielleicht.« Nina lachte und sah mich an. »Warum eigentlich nicht?«
Da kam meine Mutter aus der Küche und brachte die kalten Vorspeisen. Gefüllte Teigtaschen, die man »Piroschki« nannte, und eine Schüssel Oliviersalat.
»Sollen wir dir helfen?«, fragte Anna und wäre beinahe schon aufgestanden.
»Nein«, fuhr meine Mutter sie an. »Keiner von euch betritt die Küche, bis wir gegessen haben.«
Sie verschwand wieder, holte den Kaviar, den ich mitgebracht hatte. Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk von meinem Freund Pjotr Iowanowitsch. Zu den Fischeiern servierte meine Mutter »Oladji«. Man könnte auch sagen: Pfannkuchen auf Russisch.
Wir fingen an zu essen. Nina brauchte keinerlei Hilfe. Jede Speise ließ sich mit einer Hand verzehren, kein Zufall, denn meine Mutter war eben eine gute Gastgeberin. Sie hatte die Speisefolge auf Nina abgestimmt, denn nichts war meiner Mutter unangenehmer als eine wie auch immer geartete peinliche Situation. Dass sie mit der Verweigerung des Handschlags für die größte Peinlichkeit an diesem Abend gesorgt hatte, schien ihr entgangen zu sein.
Nachdem wir den Hauptgang und den Nachtisch verzehrt hatten und die Reste in Plastikschüsseln verpackt waren, brachte ich meiner Mutter die Teller in die Küche. Nina unterhielt sich angeregt mit meiner Schwester. Gregori saß in Gedanken versunken am Tisch, trank sein Bier. Er war ein sehr genügsamer Mensch. Anna hatte mit ihm den Richtigen gefunden, die beiden passten perfekt zusammen.
Ich stellte die Teller auf die Spüle und wollte zurückgehen, da spürte ich die Hand meiner Mutter am Arm. Ihr Blick verriet, was sie wollte.
»Bringst du sie an Weihnachten auch mit?«
»Nein«, sagte ich. »Nina fährt zu ihren Eltern.«
Eigentlich feierten wir nicht groß Weihnachten. Früher, als wir noch Kinder waren, da schon, aber mittlerweile war das Fest auf ein gemeinsames Mittagessen am ersten Weihnachtsfeiertag zusammengeschrumpft. Wir ließen auch die Geschenke weg. Die Frage meiner Mutter hatte einen anderen Grund, als zu erfahren, für wie viele Personen sie kochen sollte.
»Seid ihr denn jetzt zusammen oder nicht?«
Ich machte ihr keinen Vorwurf, dass sie neugierig war. Die chronische Neugier hatte ich von ihr geerbt.
»Mal so, mal so«, antwortete ich.
»Und im Moment?«
Ich wusste, dass sie mit Nina als Schwiegertochter nicht glücklich wäre.
»Hast du ein Problem mit ihrer Behinderung?«
»Ich?« Sie flüsterte. »Nein. Ich wundere mich nur, dass du auf so etwas stehst.«
Ich musste schlucken. Einen Moment überlegte ich, etwas zu erwidern. Aber ich ließ es lieber, der Abend könnte sonst hässlich enden.
»Sollen wir was mitnehmen?«
Sie sah mich verwundert an. »Wollt ihr etwa schon gehen?«
»Ich glaube, Nina würde noch bleiben. Aber ich fahre jetzt und lasse sie bestimmt nicht allein bei dir.«
Meine Mutter sah mich an, als hätte ich mit einem Hammer auf die Klaviatur geschlagen.
»Du weißt genau, wie ich das gemeint habe«, sagte sie rechtfertigend. »Aber du musst mir ja jedes Wort im Mund herumdrehen.«
»Nein, ich weiß nicht, wie du das gemeint hast.«
Ich verließ die Küche.
Den Beutel mit den Essensbehältern stellte ich in den Kofferraum, sodass er während der Fahrt nicht umfallen konnte. Es war kalt draußen, um den Gefrierpunkt. Nina war schon eingestiegen. Ich rieb mir die Hände, setzte mich dann hinters Lenkrad und startete per Knopfdruck den Motor meines Aston Martin.
»Wo soll es hingehen?«, fragte ich.
»Zuerst sagst du mir, weshalb wir so plötzlich aufgebrochen sind.«
»Ich hatte keine Lust mehr. Wärst du noch gerne geblieben?« Nina sah mich an. »Was hat deine Mutter gesagt?«
»Nicht viel. Ich wäre am liebsten gleich nach der Begrüßung wieder verschwunden.«
»Nicholas.« Ihre Stimme klang streng. »Du hast die falsche Einstellung zu dem Thema, das habe ich dir schon tausendmal gesagt. Es bringt nichts, jemanden zu verurteilen, der nicht mit meiner Behinderung umgehen kann. Damit machst du vor allem mir das Leben schwer.«
»Warum hat sie dir nicht die linke Hand gegeben? Was sollte das?«
»Weil sie irritiert war und nichts falsch machen wollte. Ich finde deine Schwester übrigens sehr nett. Und ihren Mann auch, wenn er nicht gerade mit dem Besteck rumspielt.«
Wir lachten beide.
»Ja, er ist ein feiner Kerl.«
Wir sagten einen Moment nichts, lauschten dem Motor, der bei der Kälte wummerte.
»Das Essen war wirklich lecker«, brach Nina schließlich das Schweigen.
»Ja. Kochen kann sie.«
»War dein Vater dick?«
»Nein. Gertenschlank. Liegt in der Familie. Wir können essen bis zum Umfallen und nehmen nicht zu.«
»Wann ist er gestorben?«
Ich sah sie irritiert an. »Wieso fragst du danach?«
»Hatte deine Mutter nie einen anderen nach ihm?«
»Nicht, dass ich wüsste.« Ich mochte das Thema nicht. »Also, wo soll es jetzt hingehen? Nach Hause?«
Nina sah auf die Uhr, dann zu mir. »Um diese Zeit kriege ich noch kein Auge zu.«
Kapitel 3
Das Klingeln von Ninas Handy, das auf dem Nachttisch lag, riss mich aus dem Schlaf. Als Nina sich nicht rührte, stupste ich sie an.
»Hey, es klingelt bei dir.«
Verschlafen richtete Nina sich auf, zeigte mir ihren schönen Rücken. Sie hatte wie immer nackt geschlafen. Das tat sie auch im Winter. Ihr war viel seltener kalt als mir, weswegen sie mich oft als Memme bezeichnete.
Nina sah aufs Display, bevor sie das Gespräch annahm. »Vonhoegen.«
Nina lauschte.
»Oje«, hörte ich sie schließlich sagen. »Ja, ich beeile mich. Bis gleich.«
Sie beendete das Telefonat. Dann sprang sie aus dem Bett. Ich sah ihr nach. »Was ist los?«
»Darf ich nicht sagen.«
Sie verschwand im Badezimmer, machte die Tür hinter sich zu. Nina arbeitete im Polizeipräsidium, aber erst seit drei Monaten. Deshalb war sie bisher noch nicht mit so wichtigen Dingen betraut, dass man sie morgens aus dem Bett klingelte.
Ich schwang meine Beine über die Bettkante. Im selben Moment schoss mir ein stechender Schmerz durch die Lendenwirbel. Ich erhob mich langsam, darauf bedacht, keine falsche Bewegung zu machen. Dann überstreckte ich die Wirbelsäule ein wenig. Es knackte. Der Winter kündigte sich an. Immer wenn es kalt wurde, rebellierte meine Rückenmuskulatur und erinnerte mich daran, dass ich älter wurde.
»Soll ich dir einen Tee machen?«
»Ja, bitte«, drang es durch die geschlossene Tür, bevor das Rauschen der Dusche einsetzte.
Eine Viertelstunde später erschien Nina fertig angezogen in der Küche, die ohne eine Trennwand ans Wohnzimmer grenzte. Ich war erst vor vier Wochen hier eingezogen, aber es stand kein einziger Karton mehr herum. Im Gegensatz zu unserer letzten gemeinsamen Wohnung, in der wir beide nie richtig angekommen waren. Nina war inzwischen bei einer Freundin aus Studienzeiten eingezogen. Seitdem wir nicht zusammenwohnten, verstanden wir uns wieder gut. Was war das für eine Beziehung? Ich wusste es selbst nicht. Nina meinte, eine moderne On/Off-Beziehung. Allerdings stand der Schalter bei mir immer auf »On«. Nina hatte noch feuchte Haare und sah so verdammt sexy aus.
Ich überlegte noch immer, weshalb Nina aus dem Präsidium angerufen worden war. Ich hatte unterdessen sogar im Internet nachgeschaut, ob eine »Eilmeldung« vorlag. Fehlanzeige. Trotzdem äußerte ich meine Vermutung, als ich Nina die Teetasse reichte. »Ist noch ein Polizist ermordet worden?«
»Nein«, antwortete sie knapp. »Zum Glück nicht.« Sie trank einen Schluck. »Aber es gibt um zwölf Uhr eine Pressekonferenz. Deswegen soll ich früher kommen.«
»Hat die Pressekonferenz mit den Polizeimorden zu tun?«, bohrte ich weiter.
Nina antwortete nicht, stellte die Tasse ab, sah auf die Uhr.
Dann nahm sie ihre Handtasche, kontrollierte, ob alles Wichtige drin war.
Vor zwei Wochen wurde ein Polizeikommissar während einer routinemäßigen Geschwindigkeitsüberwachung erschossen. Zuerst glaubte man, dass es sich bei dem Täter um einen Autofahrer handelte, der um jeden Preis die SD-Karte mit den Bildern an sich bringen wollte. Doch fünf Tage danach geschah ein zweiter Mord. Das Opfer war wieder ein Polizeibeamter. Er hatte schon Dienstschluss gehabt, trug aber noch seine Uniformjacke. Der Verdacht wurde konkret, dass beide Taten von ein und demselben Mann verübt worden waren. Dann kam es zu einer dritten Tat: Ein Zivilbeamter der Kripo war auf dem Parkplatz einer Diskothek aus nächster Nähe angeschossen worden. Er überlebte schwer verletzt, musste notoperiert werden, lag seitdem im künstlichen Koma. Die Mordserie erschütterte nicht nur Köln, sie war bundesweit in den Medien.
Nina trank einen letzten Schluck Tee.
»Wann sehen wir uns wieder?«, fragte ich.
»Kann ich noch nicht sagen. Ich ruf dich an.«
Sie gab mir einen flüchtigen Kuss. Kurz darauf war sie verschwunden.
Ich hatte keine Termine heute Morgen, konnte mir also Zeit lassen. Ich stand da, starrte in meine Tasse, während aus dem Radio Ed Sheeran plärrte. Mein Gesicht spiegelte sich auf der schwarzen Oberfläche des Kaffees. Ich musste mir eingestehen, dass Nina im Moment eine bessere Figur abgab als ich. Sie hatte alles unter Kontrolle, ihren Job, ihr Leben – und irgendwie auch mich.
Kapitel 4
An der Tür unserer Kanzlei hing ein neues Messingschild. Über den Namen Meller & Tewes war ein Logo eingraviert. Julie, meine Kollegin und neue Partnerin in der Kanzlei, hatte das vorgeschlagen, damit wir uns durch das Logo auf Visitenkarten von anderen Kanzleien ein wenig abhoben. Es war schlicht gehalten, verband die Anfangsbuchstaben unserer Nachnamen Meller & Tewes. Ich fand, der Grafiker hatte es gut hingekriegt.
Unser Empfangsbereich war hell, das Licht fiel durch große Fenster. Bei strahlendem Sonnenschein kam ich mir manchmal vor wie in einem Gewächshaus. Unsere Büroleiterin Astrid Zollinger hatte für Pflanzen gesorgt. Mir war es fast schon zu viel, aber das Grün schien eine beruhigende Wirkung auf unsere Mandanten zu haben. Einen Strafverteidiger zu konsultieren war vergleichbar mit einem Besuch beim Zahnarzt. Die meisten Menschen waren verunsichert, verstört, manche aufgebracht, weil sie sich zu Unrecht beschuldigt fühlten. Oder sie waren Opfer einer Straftat geworden und würden als Nebenkläger vor Gericht auftreten. Es kam nie einer zu uns, weil er im Lotto gewonnen hatte.
Astrid Zollinger saß an ihrem Schreibtisch hinter einem Tresen aus USM-Haller-Elementen. Sie erhob sich von ihrem Platz, als ich eintrat. Sie sah mich über den Rand ihrer Brille hinweg an. Kein gutes Zeichen. Ich bekam ein schlechtes Gewissen.
»Habe ich wieder einen Termin vergessen?«
»Nein«, sagte sie und konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. »Heute nicht.«
Bevor sie etwas sagen konnte, musste ich etwas Dringendes loswerden. »Ich bräuchte zeitnah einen Termin bei Ihrem Mann ...«
Dr. Zollinger war Orthopäde, und der stechende Schmerz am Morgen war ein deutliches Warnsignal.
»Der Rücken wieder?«, fragte sie.
Ich nickte.
»Sie sollten sich eine Yogamatte zulegen und jeden Tag eine halbe Stunde Gymnastik machen. Dann können Sie sich den Besuch bei meinem Mann sparen.«
»Danke. Ich hätte lieber eine Spritze.«
Sie zuckte mit den Schultern. »Ich muss ihn nur anrufen. Aber jetzt haben Sie keine Zeit, ein Mandant wartet auf Sie.«
»Ich dachte, ich hätte keinen Termin.«
»Ein Überraschungsbesuch. Ein alter Bekannter.«
Ich sah sie fragend an. »Machen Sie es nicht so spannend.«
»Hauptkommissar Rongen.«
»Thomas Rongen?« Ich verstand nicht. »Wo ist er? In meinem Büro?«
»Nein. Konferenzraum. Frau Tewes ist bei ihm.«
Ich ließ meinen Mantel an. Auf dem Weg zum Konferenzraum überlegte ich fieberhaft, weshalb er hier sein könnte. Hatte es womöglich etwas mit dem Anruf zu tun, den Nina heute Morgen erhalten hatte?
Als ich den Konferenzraum betrat, drehte Rongen sich zu mir um, erhob sich. Julie saß am Kopfende des Konferenztisches, um den herum acht Stühle standen. Sie hatte vor sich einen Block und schrieb.
»Guten Morgen.« Ich gab Rongen die Hand, hob verwundert die Augenbrauen.
»Morgen«, erwiderte er müde, sein Händedruck war schlaff. Insgesamt machte Rongen einen erschöpften Eindruck. Er trug eine helle Jeans und gelbe Caterpillar-Schuhe. Der Geruch von Deodorant lag in der Luft. Ersatz für mangelnde Körperhygiene, vermutete ich. Womöglich kam er direkt von einem Einsatz. Ich zog den Mantel aus, legte ihn über eine Stuhllehne, den Aktenkoffer auf den Tisch. Julie begrüßte mich mit einem kurzen Kopfnicken. »Morgen.«
Rongen setzte sich wieder, ich nahm auf der anderen Seite des Tisches Platz. »Was führt Sie zu uns?«
»Fangen wir am besten noch mal von vorne an«, schlug Julie vor.
Rongen nickte. Er musste sich sammeln, die Gedanken in seinem Kopf zurückspulen. Schließlich begann er mit einem tiefen Seufzer. »Ich habe letzte Nacht jemanden erschossen.«
Ich sah ihn an, wartete darauf, dass er weitersprach. Als er es nicht tat, sagte ich: »Im Dienst nehme ich an?«
Rongen sah zum Fenster. Die Jalousien waren zur Hälfte heruntergelassen. Ein schöner Wintertag. Die Sonne fiel in Streifen herein, beleuchtete unsere Regalwand aus dunklem Holz mit den juristischen Nachschlagewerken. Rongen schien ganz in Gedanken versunken. So hatte ich ihn noch nie erlebt.
Julie sah auf ihren Notizblock. Sie wusste bereits mehr als ich.
Rongen wandte sich zu ihr um. »Erzählen Sie es ihm.«
»Ich möchte es lieber von Ihnen hören«, erwiderte ich. »Wir haben alle Zeit der Welt.«
Julie nickte. Sie sah es offensichtlich genauso. Bei einer Aussage ging es nicht allein um Fakten, sondern auch darum, wie der Mandant sie darstellte. Die Stimme eines Zeugen konnte eine Lüge entlarven oder die Aufrichtigkeit unterstreichen. Es gab kein Patentrezept, nichts, was sich diesbezüglich an der Universität erlernen ließ.
Rongen holte tief Luft, dann begann er endlich zu reden. »Sie haben bestimmt von den Polizistenmorden gehört. Gestern, da ... also, ich gehöre zur Sonderkommission ›Melaten‹, die nach dem ersten Mord an dem Kollegen Ulf Schmiege gebildet wurde. Gestern wollten wir einen Verdächtigen observieren.«
Rongen machte wieder eine Pause.
Ich konnte meine Neugier nicht im Zaum halten. »Sie haben den Verdächtigen erschossen?«
Er nickte. »Im Königsforst. Es war dunkel ... Es war Notwehr.«
Ich sah zu Julie, die kurz die Augenbrauen hob. Ein Zeichen, dass an dieser Darstellung irgendwas nicht stimmte oder sie unvollständig war.
Ich sah Rongen an. »Wie hieß der Verdächtige?«
»Frank Brenner. Vorbestraft wegen Drogendelikten. Vor drei Monaten nach einer fünfjährigen Haftstrafe entlassen. Er geriet in den Fokus der Ermittlungen, weil er mit zwei der Kollegen, also zwei der drei Opfer, in der Vergangenheit zu tun hatte.«
Ich unterbrach ihn. »Wie kam es zu dem Schusswechsel?«
Rongen schüttelte den Kopf. »Es gab keinen Schusswechsel.
Nur ich habe geschossen.« Er richtete sich in seinem Stuhl auf. »Wir waren vor dem Mietshaus, wo Brenner wohnt, wussten aber nicht, ob er da war. Mein Kollege ist ausgestiegen, wollte nachsehen, ob sein Wagen da ist. Ein zweites Team hatte sich in einer Nebenstraße postiert. Plötzlich fuhr Brenner mit seinem Wagen aus einer der Garagen neben dem Haus. Er hatte meinen Kollegen gesehen, Verdacht geschöpft. Er gab Gas. Ich nahm die Verfolgung allein auf, in der Hoffnung, dass er mich nicht bemerkt hatte. Brenner fuhr zuerst ganz normal, er fühlte sich anscheinend sicher, aber dann plötzlich gab er Gas. Ich blieb an ihm dran, das zweite Observationsteam kam nicht nach. Ist im Verkehr stecken geblieben. Egal. Brenner wusste, dass wir hinter ihm her waren. Bis zu diesem Zeitpunkt lag noch kein ausreichender Tatverdacht für eine Festnahme vor, aber dass er abhauen wollte, war ein Indiz. Ich blieb also an ihm dran, hatte als Einziger Sichtkontakt. Er fuhr die Bensberger Straße stadtauswärts. Die führt durch den Königsforst. Er bog auf einem Wanderparkplatz ab, stieg aus, rannte zu Fuß in den Wald. Ich habe ihn verfolgt. Im Wald ist es dann passiert.« Rongen machte eine Pause, holte wieder tief Luft. »Es war stockdunkel. Da stand er plötzlich vor mir. Als ob er auf mich gewartet hätte. Da wusste ich noch nicht, warum.«
»Warum was?« Ich verstand nicht.
»Warum er stehen geblieben war.«
»Und warum ist er stehen geblieben?« Ich sah Rongen ratlos an.
»Vor ihm war ein Abgrund. Er konnte nicht weiter. Er sah mich an, hob den rechten Arm. Er hatte eine Pistole.«
»Sie haben geschossen?«
»Ja.«
»Er hat keinen Schuss abgefeuert?«
»Nein.«
»War es eine scharfe Waffe?«
»Das weiß ich nicht.«
Ich glaubte, mich verhört zu haben. Wie konnte darüber Unklarheit herrschen, ob die Waffe des Mannes echt gewesen war? »Wie? Sie wissen es nicht?«
»Die Waffe ist weg«, antwortete Julie. »Verschwunden.«
Rongen wich meinem fragenden Blick aus, starrte vor sich auf die Tischplatte, wo er die Hände wie zum Gebet gefaltet hatte. »Sie war nicht mehr da, als meine Kollegen am Tatort eintrafen.«
Ich stieß einen leisen Pfiff aus. Wenn das stimmte, dann saß Rongen wirklich in der Klemme. Ich tastete mich behutsam vor. »Sie haben die Waffe gesehen – in seiner Hand?«
Rongen nickte. »Kein Irrtum. So wie ich Sie beide jetzt hier vor mir sehe. Ich bin mir absolut sicher.«
»Aber wie ist das möglich? Ich meine ...«
Julie schnitt mir das Wort ab, wandte sich Rongen zu. »Sie haben etwas Wichtiges ausgelassen. Die Freundin, die mit im Wagen saß.«
Rongen nickte. Er sah mich an. »Brenner hatte eine Beifahrerin, eine junge Frau. Sie ist auch in den Wald gerannt, in eine andere Richtung. Ich bin an ihm drangeblieben.«
»Hätte diese Frau die Chance gehabt, die Waffe an sich zu nehmen, ohne dass Sie es merken?«
»Ja, definitiv.«
Das war immerhin ein Hoffnungsschimmer.
Rongen fuhr in seiner Erzählung fort. »Brenner ist den Abhang runtergerollt, nachdem ich ihn getroffen hatte. Ich schätze mal, so zehn Meter tief. Ich konnte sehen, wie er da unten lag, sich nicht mehr rührte, ich ... ich hatte auf seinen Kopf gezielt. Er konnte nicht mehr fliehen. Also habe ich mich zuerst darum gekümmert, dass die Kollegen nachrückten. Es kreiste sogar ein Hubschrauber in der Luft.«
»Wie lange hat es gedauert, bis die Verstärkung da war?«
»Weiß nicht mehr. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Fünf Minuten vielleicht. Auf keinen Fall länger.«
»Und dann?«
»Als die Kollegen eintrafen, haben die sich um alles gekümmert. So sind die Vorschriften, ich musste mich raushalten. Es kam die Bestätigung, dass Frank Brenner tot war. Und dann kam Jochen zu mir, ein Kollege, er gehörte zum zweiten Observationsteam. Jochen Lanz, Oberkommissar. Er fragte mich, wieso ich geschossen habe? Ich sah ihn an und verstand nicht, wie er das meinte: Warum? Dann hat er gesagt, dass da keine Pistole sei. Sie haben alles abgesucht. Im Umkreis von hundert Metern. Nichts.«
Julie und ich sahen uns an. Keiner von uns sagte ein Wort.
»Sie glauben mir nicht?«
»Doch«, erwiderte ich schnell. »Aber dass wir Ihnen glauben, löst nicht das Problem. Sie kennen das Spiel doch.«
Rongen schluckte. Ja, er kannte es. Normalerweise saß er auf der anderen Seite des Tisches.
Ich fragte weiter. »Was geschah dann?«
»Wir sind ins Präsidium gefahren.«
Ich sah ihn verwundert an. »Sie wurden zu dem Fall bereits vernommen?« Ich hatte lauter gesprochen als beabsichtigt.
»Nein. Beruhigen Sie sich. Wir haben nur geredet. Und abgewartet. In der Hoffnung, dass die Frau und die Waffe gefunden werden. Es wurde eine Großfahndung nach ihr eingeleitet.«
»Haben Sie den Kollegen irgendwas erzählt?«
»Nur den Tathergang beschrieben, aus meiner Sicht.«
»War ein Anwalt dabei?«
»Nein, aber mir wurde gesagt, dass die Gewerkschaft in solchen Fällen einen Anwalt stellt. Ich habe abgelehnt.«
Ein Fehler. Viele Mandanten glaubten, dass das Hinzuziehen eines Anwaltes bereits ein Schuldeingeständnis sei. Rongen war ein Profi, er hätte es besser wissen müssen.
Er fing an, sich zu rechtfertigen. »Ich bin nach Hause gefahren. Ich habe nachgedacht.« Er sah mich an. »Und überlegt, welcher Anwalt, mit dem ich in meiner beruflichen Laufbahn je zu tun hatte, mich von allen am meisten Nerven gekostet hat. Das waren eindeutig Sie, Herr Meller.«
Julie grinste. »Das kann ich gut verstehen.«
Jetzt lächelte auch der Kommissar. Zum ersten Mal während dieses Gesprächs wirkte er wieder wie der Rongen, den ich kannte. Er und ich hatten in der Vergangenheit einige Probleme miteinander gehabt. Seine Erklärung, weshalb er mich ausgesucht hatte, war in gewisser Hinsicht ein Kompliment.
Ich ging auf seinen kleinen Scherz nicht ein. »Hatten Sie während der Verfolgung eine Taschenlampe dabei?«
Er schüttelte den Kopf. »Ich weiß, was Sie jetzt denken. Dass ich mich geirrt habe, dass da keine Pistole war. Ich habe mich nicht geirrt. Ich habe sie gesehen. In seiner Hand. Und Brenner hat auf mich gezielt.« Er schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. »Hätte ich warten sollen, dass er zuerst abdrückt?«
Julie schaltete sich ein. »Gibt es einen Anhaltspunkt, wer die Frau war? Einen Namen? Vielleicht eine Adresse?«
Wieder schüttelte er den Kopf. »Nein. Nicht mal ein Gesicht.«
»Wurde Brenners Wagen auf Spuren untersucht?«, hakte ich nach.
»Natürlich, ja. Da waren auch viele Fingerabdrücke im Wagen, aber nur die von Brenner waren im Computer gespeichert.«
»Was ist mit den Kollegen vom Observationsteam? Haben die die Frau gesehen?«
»Auch nicht, nein.« Rongen seufzte. »Als Brenner mit dem Wagen aus der Garage fuhr, hat der Kollege sich schnell weggedreht, um nicht erkannt zu werden. Er hat die Frau nicht gesehen, nein.«
Julie sah gedankenverloren auf ihre Notizen. »Sie standen doch sicher mit der Zentrale in Funkkontakt.« Jetzt sah sie auf. »Haben Sie die Frau in einem Funkspruch erwähnt?«
»Nein«, rief er wütend aus, wobei nicht klar war, ob sein Ärger unseren Fragen galt oder seinem Versäumnis. »Erst als die Kollegen eintrafen, nach dem Schuss, da ... da habe ich zum ersten Mal von ihr gesprochen.«
Ich warf Julie einen kurzen Blick zu. Das reichte mir, um zu wissen, dass sie ähnliche Gedanken hatte wie ich. Rongens Geschichte klang erfunden, als ob er sich die Frau ausgedacht hatte, um das Fehlen der Waffe zu erklären. Er könnte sich die Pistole auch eingebildet haben. Es war dunkel, er stand unter Stress. Wenn es keine Waffe gab, war die Notwehr schwer zu erklären. Schwer, aber nicht unmöglich. Es gab im Gesetz den sogenannten »Erlaubnistatbestandsirrtum«, der auch dann eine Notwehr rechtfertigte, wenn derjenige, der schießt, lediglich in dem festen Glauben handelt, dass der andere bewaffnet sei, auch wenn dies sich später als Irrtum herausstellt. Bei dieser Argumentation würden wir uns allerdings auf dünnem Eis bewegen. Ein Staatsanwalt wäre eher geneigt, von fahrlässiger Tötung auszugehen, vielleicht sogar Totschlag. Erschwerend kam hinzu, dass Frank Brenner unter Verdacht stand, Polizisten eiskalt ermordet zu haben. Wenn man Rongen unterstellen würde, dass er den Tod der Kollegen rächen wollte, hätte er ein Motiv gehabt. Dann könnte es sogar auf eine Mordanklage hinauslaufen. Rache war immer ein starkes Motiv.
Ich selbst war mir nicht sicher, ob ich seine Geschichte glauben sollte. Für den Moment musste ich es. Aber selbst wenn es die Pistole und eine Frau, die sie an sich gebracht hatte, gab, standen wir vor einem weiteren großen Problem. Denn wenn man die Frau finden würde, was würde sie aussagen? Wenn sie behaupten würde, dass Rongen ihren Freund eiskalt erschossen habe, dann stand Aussage gegen Aussage.
Die Frau zu finden reichte nicht. Wir brauchten Brenners Waffe.
Kapitel 5
Es war zwar Mittwoch, fühlte sich aber an wie ein Montag. Zu einem Montagmorgen gehörte der Tratsch auf dem Korridor. Je nachdem, was am Wochenende so los gewesen war, variierte der Geräuschpegel. Heute wurde Kirmeslautstärke erreicht, ohne Musik. Die Nachricht von den Ereignissen im Königsforst letzte Nacht hatte sich wie ein Lauffeuer im Präsidium verbreitet. Vor dem Kopierraum in der vierten Etage in Haus eins, in dem die Netzwerkdrucker standen, fand eine kleine Versammlung statt. Zu den Kollegen, die Nina den Weg versperrten, gehörte auch Oliver.