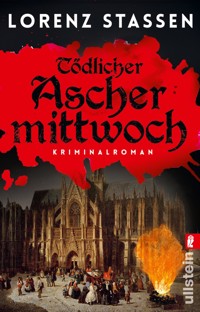10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein brutales Verbrechen überschattet die Karnevalszeit Köln im Januar 1823: Die ganze Stadt ist in Aufruhr, mitten in den Vorbereitungen zum ersten Rosenmontagsumzug wird eine übel zugerichtete Leiche aus dem Rhein geborgen. Schnell gibt es einen Verdächtigen: den brutalen Zuhälter Arthur Schmoor. Die Tat scheint aufgeklärt, die Karnevalisten atmen auf, denn der geplante Rosenmontagszug hat hartnäckige Widersacher, die nur nach einem Grund suchen, diesen zu verhindern. Doch der aus Berlin stammende Kriminalkommissar Gustav Zabel glaubt nicht an eine einfache Lösung. Als ehemaliger preußischer Soldat liebt er Gründlichkeit, auch wenn er damit in seiner neuen Heimat überall aneckt. Er ist sich sicher: Der wahre Mörder ist noch auf freiem Fuß. Für Gustav Zabel beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, damit der lang erwartete Karnevalsumzug nicht in einer Katastrophe endet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Rosenmontag
Der Autor
LORENZ STASSEN, geboren 1969, wuchs in Solingen auf und wurde zunächst Chemielaborant. Er wechselte ins Film- und Fernsehgeschäft und arbeitet seit 1997 als freischaffender Drehbuchautor und Schriftsteller. Lorenz Stassen lebt in Köln und ist Mitglied bei den »Roten Funken«.
Lorenz Stassen
Rosenmontag
Kriminalroman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage Oktober 20222. Auflage 2023© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2022Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © (Illustration) F. Schilberz © GRUPPE Köln, Hans G. Scheib (Fotograf)Autorenfoto: © privatE-Book-Konvertierung powered by pepyrusAlle rechte vorbehalten.Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.ISBN 978-3-2837-2834-8
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
Vorwort
3. Januar 1823
Vollmond
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Anhang
Nachwort & Danksagung
Glossar
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Vorwort
Vorwort
Dies ist ein historischer Kriminalroman. Die Geschichte spielt im Winter des Jahres 1822/1823 in Köln und basiert zum Teil auf realen Ereignissen, wie sie sich zur damaligen Zeit abgespielt haben – oder haben könnten. Der erste Maskenumzug, der heute als Rosenmontagszug geläufig ist, fand am 10. Februar 1823 statt.
Historische Personen und Ereignisse werden am Ende des Buches in einem Glossar vorgestellt. Einige Charaktere in diesem Buch haben es sich nicht nehmen lassen, hin und wieder in Kölscher Sproch zu reden, stets darauf bedacht, dass auch Nicht-Kölner sie gut verstehen können. Der Autor hingegen hat es sich nicht nehmen lassen, auf Basis seiner Recherchen die eine oder andere Behauptung aufzustellen, wie der erste Rosenmontagszug »tatsächlich« zustande kam.
Die Geschichte ist wie in jedem Roman fiktiv.
Köln, im August 2022
3. Januar 1823
Der Köder dümpelte ruhig im Spiegelbild des Mondes. Nichts tat sich. Lambert hob den Blick und schaute zum Himmel, der Mond war nicht mehr ganz so rund wie noch zu Weihnachten. Seit Beginn des Jahres schien es jede Nacht immer kälter zu werden. Lambert freute sich auf zu Hause, auf den Ofen, den er anmachen würde, und auf seine Frau, die die ganze Nacht in der Kälte eines ungeheizten Zimmers geschlafen hatte, da sie Kohlen sparen mussten. Sein Atem dampfte in der Luft, er blies in die Hände, bewegte die Finger, um sie warm zu halten. Von Minute zu Minute schien es heller zu werden. Auf einem der Boote im Wasser flackerte eine Öllampe auf. Bald würden die Besatzungen an Deck kommen, und spätestens dann müsste er weg sein. Es war verboten, im Sicherheitshafen die Angel auszuwerfen, wie so vieles andere auch verboten war, seitdem die Preußen am Rhein das Sagen hatten.
Lambert zog an der Rute und fischte den Köder aus dem Wasser, ohne dass etwas Nahrhaftes daran gewesen wäre. Die Ausbeute der Nacht könnte spärlicher kaum sein, nur ein Flussbarsch und eine kleine Brasse lagen beide steif gefroren neben seinen Füßen auf dem Boden. Lambert hoffte, dass der miese Fang dieser Nacht nicht ein schlechtes Vorzeichen für das neue Jahr bedeutete.
Sein Blick schweifte umher, er war nicht der Einzige, der im Schutz der Dunkelheit für etwas zu essen sorgte. Dass es den Leuten schlecht ging, lag an den Preußen. Er hasste das arrogante Volk aus dem Osten, auch wenn er persönlich noch nie einem Vertreter begegnet war. Lambert fror so sehr, dass er kaum noch seine Finger spürte. Wenn es noch länger so kalt bliebe, würde der Rhein im Hafen zufrieren, dann müsste er sich eine andere Stelle suchen. Der Sicherheitshafen lag außerhalb der Stadtmauer, was es gefährlicher machte, die Nacht hier zu verbringen. Dafür tummelten sich im Hafenbecken mehr Fische, weil sie mit der Strömung hineingezogen wurden und dort blieben. Lambert sah zu den Booten, ob sich etwas an Deck tat. Die Rheinschiffer mochten keine Konkurrenz, sie wollten auch Beute machen und mit niemandem teilen. Gleichzeitig boten sie Lambert auch einen gewissen Schutz, denn nur besonders dreiste Räuber wagten sich nah an die Boote heran. Die Schiffer machten kurzen Prozess mit ihnen, schlugen so lange auf sie ein, bis sie sich nicht mehr rührten. Angler wurden ebenfalls nicht verschont, aber nicht ganz so hart angegangen. Bisher hatte Lambert immer Glück gehabt, weder Räuber noch Schiffer hatten ihn je zu fassen gekriegt.
Der Nachthimmel änderte seine Farbe, war nicht mehr ganz so schwarz, und die Sterne am Firmament dünnten aus. Gleichzeitig flackerten immer mehr Kerzenlichter oder Öllampen hinter den Fenstern der Boote auf, es war Zeit zu verschwinden. Lambert packte seine Sachen, als er im Mondlicht etwas aus dem Wasser ragen sah. Ein Stück Holz? Eine Planke? Hatte eines der Schiffe etwas verloren? Lambert sah seine Chance, doch noch einen guten Fang zu machen. Wenn es ein Gegenstand war, der an Deck eines Schiffes gehörte, würde der Kapitän vielleicht ein paar Silbergroschen springen lassen, vielleicht sogar einen ganzen Thaler. Er warf die Angel noch mal aus. Daneben. Beim dritten Wurf verfing sich der Haken, Lambert zog an der Rute und spürte sofort, dass es kein Stück Holz war. Viel zu schwer, viel zu träge. Was war es dann? Lambert wollte sich vergewissern. Ein Mensch vielleicht? So manche Bootsbesatzung verlor einen der ihren, weil er unbemerkt von Bord ging. Oder ein Trinker, der nach einer durchzechten Nacht nicht mehr nach Hause fand? Vielleicht hatte er ja nicht sein ganzes Geld versoffen, und es könnten noch ein paar Silbergroschen in den Taschen sein, dachte sich Lambert.
Mit aller Kraft zog er an der Rute und fand Gewissheit, es war ein Mensch. Der Rücken des Mannes ragte über die Wasseroberfläche hinaus, das Gesicht blieb untergetaucht, während er sich langsam in Lamberts Richtung bewegte. Hinter den Fenstern der Boote flackerten immer mehr Kerzen und Öllampen auf. Lambert musste sich beeilen, der Tote schwamm jetzt direkt am steil abfallenden Ufer. Die Kleidung verriet, dass es sich nicht um einen Seemann handelte. Lambert tat sich schwer damit, ihn herauszuziehen, die mit Wasser vollgesogene Kleidung machte den Leichnam noch schwerer, und er bekam nasse Füße. Lambert zerrte an dem Körper, bis er halb aus dem Wasser war, löste zuerst den Angelhaken, der sich im Mantel verfangen hatte. Dann, ein heftiger Ruck, und er drehte den Toten, das Licht des Vollmondes erhellte dessen schneeweißes Gesicht. Statt der Augen klafften zwei tiefe, dunkle Löcher in dem Schädel.
Lambert schreckte zurück, taumelte, keuchte, krümmte sich zusammen und musste sich schließlich übergeben. Galle und Speichel trieften aus seinem geöffneten Mund, tropften auf die Schuhe. Er sah noch mal hin, obwohl sich das Bild längst in sein Gedächtnis eingebrannt hatte. Das Gesicht des Toten war zerstört worden, die Haut so weiß wie die Knochen, die aus der Haut ragten. Seine Lippen waren zerfetzt, dazu die Löcher anstelle der Augen. Das war kein Gesicht, es war eine dämonische Fratze, einer Maske gleich, wie es sie gab, um Leute zu erschrecken. Der Mann konnte nicht einfach nur von Bord gefallen sein – man hatte mit aller Kraft und brutaler Gewalt auf ihn eingeschlagen. Und Lambert war sich sicher, dass Fäuste allein nicht ein solches Ausmaß an Verletzungen verursachen konnten.
Er atmete tief durch, schaute nicht mehr zur Leiche. Da vernahm er ein Geräusch hinter sich und fuhr herum.
»Heda«, ertönte eine Stimme aus dem Halbdunkel. »Was tust du da?«
Lambert konnte nur den Umriss seines Gegenübers erkennen, es trug einen dunklen Mantel und einen Schlapphut, der einen Schatten auf sein Gesicht warf. Und da war noch etwas, in der nur mäßig erhellten Nacht glänzte Metall. Der Mann hielt einen Enterhaken in seiner Hand.
Vollmond
Sieben Tage zuvor
Kapitel 1
Das Klappern der Hufe hallte von den Hauswänden wider. Gustav Zabel ritt in gemächlichem Tempo durch die schmalen Gässchen. Laternen sorgten für ein klein wenig Helligkeit, ihr flackerndes Licht spiegelte sich auf dem Kopfsteinpflaster. Während Dampfschwaden aus den zahllosen Misthaufen entwichen und sich in der kalten Luft auflösten, blieb der fürchterliche Gestank zurück. An manchen Stellen türmte sich der Unrat bis zum ersten Stockwerk hinauf oder sogar höher, wodurch die engen Gassen noch schmaler wurden. Die Gegend rund um den Freihafen glich einem Labyrinth, von dem es hieß, dass des Nachts nicht jeder lebend hier herausfand. In zahllosen verwinkelten Wegen und Nischen zwischen den Häusern harrten im Dunkeln die Räuber aus, darauf wartend, ein willfähriges Opfer zu finden. Zabel trug zivile Kleidung, aber als ehemaliger Soldat machte er sich wenig Sorgen. Der Säbel an seinem Gürtel wäre jedem Angreifer eine Warnung, deshalb hatte er den langen Mantel zurückgeschlagen, sodass jeder die Waffe sehen konnte.
Zabel kam im Trab aus einer Gasse auf den Heumarkt. Für die Händler und Bauern aus dem Umland begann der letzte Samstag des Jahres 1822. Sie trafen mit ihren Fuhrwerken ein und errichteten die Stände, um die städtische Bevölkerung mit Nahrung zu versorgen. Die Feiertage zur Geburt Christi waren gerade vorbei.
Zabel ritt auf einem Haflinger mit goldbraunem Fell und heller Mähne. Diese Rasse war kleiner als so manch andere, was in den Gässchen Kölns von Vorteil war. Seine Liebe zu Pferden währte schon lange, seit seiner Kindheit, weshalb man ihn beim Militär in die Kavallerie erhoben hatte. Der Krieg gehörte zum Glück der Vergangenheit an. Der neue Feind, den es nun zu bekämpfen galt, war das Verbrechen. Die Habgier, der Hass, die Boshaftigkeit. Und diese Gegner waren nicht so leicht zu stellen wie einst die Soldaten Napoleons, die wenigstens von Angesicht zu Angesicht in der Schlacht gekämpft hatten.
Wenn die Häuser ihn nicht verdeckten, spendete der Vollmond mehr Licht als alle Laternen der Stadt zusammen. Gegen den Nachthimmel trat die dunkle Silhouette des Doms hervor. Zumindest das, was in den letzten sechs Jahrhunderten von der Kathedrale fertiggestellt worden war. Nicht allzu viel, fand Zabel. Aus Sicht eines Preußen, der in Potsdam und Berlin an nicht annähernd so alte, dafür aber bewohnbare Schlösser gewöhnt war, sah der Dom für einen großen Wallfahrtsort eher beschämend aus. Die halb fertigen Türme des Doms wirkten wie verfallene Säulen eines antiken Bauwerks, die vor sich hin bröckelten, gekrönt von einem alten Baukran, der seit Jahrhunderten über der steinernen Kirche emporragte und den man zum Glück nicht von jeder Seite sehen konnte. Zwischen Türmen und Chor des Doms klaffte eine tiefe Baulücke. Die Franzosen hatten die Kirche sogar als Pferdestall missbraucht, eine Ohrfeige für jeden Katholiken, aber nach viel mehr sah das Mittelschiff nicht aus. Ein trauriger Anblick. Seinem Haflinger schien es ähnlich zu gehen, das Pferd ließ den Kopf hängen.
Neben einer massiven Holztür wartete der Bote des Domkapitels. Zabel schwang sich aus dem Sattel und hielt dem Geistlichen die Zügel hin. »Wo ist er?«
Der Kaplan Johannes Schulte zeigte zu der massiven Holztür, die nur angelehnt war. Eine halbe Stunde zuvor hatte er an die Wohnungstür des Kommissars gehämmert und ihn geweckt, um ihm voller Aufregung mitzuteilen, dass jemand in die Schatzkammer eingebrochen war. Zabel hatte den Kaplan zurück zum Dom geschickt mit der Anweisung, niemand solle etwas unternehmen, bis die weltliche Obrigkeit in Gestalt seiner Person eintreffe.
»Der Kapitularvikar wartet drinnen auf Sie«, antwortete Schulte und hielt die Zügel fest.
Zabel seufzte. »Was hatte ich Ihnen eben gesagt?«
»Dass niemand etwas unternehmen solle«, antwortete der Kaplan unterwürfig. »Aber er ist doch der …«
Zabel schnitt ihm das Wort ab. »Und wenn er seine Heiligkeit der Papst wäre, selbst dann sollte er sich an weltliche Regeln halten.«
Zabel drückte gegen die Tür, die knarrend aufging. Erschrocken fuhr der Vikar herum und atmete auf, als er Zabel erblickte. »Dank sei Gott, da sind Sie ja endlich.«
Zabel nahm einen unangenehmen Geruch wahr. Es schien ganz danach, dass jemand an Blähungen litt. Oder lag es an den alten, modrigen Mauern, die ihn umgaben? Der Raum war klein und das einzige Fenster zerschlagen, die Scherben lagen auf dem Boden verteilt.
Vor Zabel stand Martin Wilhelm Fonk. Er war eine imposante Erscheinung, trug eine hermelingefütterte purpurrote Fellmütze, die seine Halbglatze vor der Kälte schützte. Zabel hatte sich von seiner Frau erklären lassen, was es mit Fonk als Kapitularvikar auf sich hatte. Das Erzbistum Köln war noch im Aufbau, und Fonk würde in naher Zukunft zum Dompropst ernannt werden, weshalb ihn mancher auch schon so bezeichnete. Offiziell aber war er der Candidatus Designatus. Er hatte in diesem Jahr seinen siebzigsten Geburtstag gefeiert, und man wusste allgemein, dass er den geistlichen Dingen ebenso zugetan war wie den weltlichen. Gutes Essen und reichlich Wein hinterließen Spuren, die sich unter seinem schwarzen Mantel abzeichneten. Zabel bemerkte, dass die Hände des Dompropstes zitterten, vielleicht lag es an der Kälte, Handschuhe hatte er in der Eile anscheinend vergessen. Zabel streifte seine ab.
Fonk drückte die Außentür zu und sagte mit leiser Stimme: »Es ist schon wieder passiert.« Sein zittriger Finger deutete auf das zerbrochene Bleiglasfenster, durch das der Einbrecher in den Vorraum gelangt war.
Zabel sah ihn fragend an. »Schon wieder?«
»Erst vor zwei Jahren. Da hat ein Deserteur sich am Schrein der Heiligen Drei Könige vergangen.«
»Was ist mit dem Mann geschehen?«
»Er wurde verurteilt, zu hundert Hieben und zehn Jahren Festungshaft.«
»Dann kann er es schon mal nicht gewesen sein.« Zabels Blick schweifte durch den kahlen Vorraum, der nur aus Mauerwerk bestand und als Eintrittspforte zur Schatzkammer diente. »Haben Sie irgendetwas angefasst?«
Fonk sah ihn irritiert an. »Wieso?«
Zabel sparte sich die Antwort, holte einen Bleistift sowie einen in Leder gebundenen Block aus seiner Manteltasche. Er war vor zwei Jahren von Berlin nach Köln versetzt worden mit dem Auftrag, das Berliner Polizeireglement von 1811 in der Rheinprovinz anzuwenden. In Preußen hatte die Polizei bereits einige Fortschritte in der Verbrecherjagd erzielt.
»Die Unversehrtheit eines Einbruchortes erweist sich oftmals als hilfreich, wenn man später bei einem Verhör den Lügner von einem unterscheiden will, der die Wahrheit spricht.«
Fonk verstand. »Über so etwas habe ich noch nie nachgedacht.«
Zabel lächelte ihn an. »Warum auch? So hat jeder seine Bestimmung.«
Der Dompropst sagte demütig: »Ich hoffe, ich habe Ihnen jetzt nicht die Arbeit schwerer gemacht, als sie tatsächlich schon ist?«
Zabel schüttelte den Kopf, klappte seinen Block auf und begann. Das Zeichnen hatte er sich selbst beigebracht und im Laufe der Jahre stetig verfeinert. Mittlerweile war eine Leidenschaft daraus geworden. Am liebsten zeichnete er seine Frau bei alltäglichen Dingen wie Kochen oder bei Handarbeiten, was Eva sehr gerne tat. Erst seitdem er sie kennen- und lieben gelernt hatte, war Zabel auch als Mensch in Köln angekommen. Vor der Hochzeit hatte er noch mit anderen Soldaten in einer Kaserne gewohnt. Das Militär unterstützte die Polizei, insbesondere, wenn es zu Unruhen auf den Straßen kam. Mit den Soldaten hatte Zabel sich besser verstanden als mit seinen Kölner Kollegen, was wohl an seinen preußischen Tugenden lag, die Zabel im Blut steckten und mit denen die Kölner nicht gut umgehen konnten. Vor zwei Jahren hatte Zabel, ohne zu widersprechen, den Posten in Köln angenommen, auch wenn er lieber in seiner Heimat geblieben wäre. Die ersten Monate in der Rheinprovinz waren von Einsamkeit geprägt gewesen. Bis seine Frau Eva ihn ins gesellschaftliche Leben der Stadt eingeführt hatte.
Zabel schaute von seiner Zeichnung auf. Durch das zerbrochene Fenster gelangte man nur in den Vorraum der Schatzkammer. Der Dieb hatte erst noch ein weiteres Hindernis überwinden müssen. Zabel sah zur massiven Tür aus dunklem Holz mit reich geschnitzten Verzierungen, die in die eigentliche Schatzkammer führte und ebenfalls nur angelehnt war.
Fonk beobachtete den Kommissar bei seiner Arbeit, sagte aber nichts, was Zabel nur gelegen kam. Er wollte sich konzentrieren, ging von der ersten Tür auf die zweite zu und notierte sich die Entfernung in Metern. Als ehemaliger Soldat war er befähigt, jeden Schritt exakt gleich zu machen, und konnte so den Raum schnell in seiner Größe erfassen. Dann gab er der zweiten Tür einen leichten Stoß, die quietschend aufschwang. Als Erstes fiel ihm der Eisenbeschlag des Riegels ins Auge, er war aus der Wand herausgerissen und lag auf dem Boden. Es musste einiges an Kraft aufgewendet worden sein, um die zweite Tür zur Domschatzkammer aufzubrechen. Zabel sah sich das Holz an, es war nicht gesplittert. Dies deutete womöglich darauf hin, dass sich ein sehr kräftiger, schwerer Mann gegen die Tür geworfen und sie aufgestoßen haben könnte. Zabel notierte sich das.
Er blätterte eine Seite in seinem Block weiter, schaute sich den Raum an, schritt ihn ab und zeichnete den Grundriss. Er notierte sich genau die Stelle, wo der Beschlag auf dem Boden lag. Sein Blick wanderte langsam umher. In dunklen Holzschränken, in deren Türen Bleiverglasungen eingefasst waren, befanden sich die sakralen Schätze wie vergoldete Kelche, Monstranzen und Reliquiengefäße. Eine schwere Kette sicherte die Türen. In einem anderen Schrank hingen Messgewänder, aber sowohl für die Kirchenschätze als auch für die jahrhundertealten Gewänder hatte sich der Einbrecher nicht interessiert. Nur ein schmaler Schrank, der völlig unscheinbar wirkte, war aufgebrochen worden. Vor diesem lag gesplittertes Holz auf dem Boden verstreut. Auch diese Stelle verzeichnete Zabel in seinem Grundriss. Er öffnete die Tür und sah hinein. Der Schrank war leer.
»Darin befand sich das Vortragekreuz«, sagte Fonk, der ihm auf leisen Sohlen gefolgt war.
»Ein Vortragekreuz?«
Der Dompropst nickte. »Aus reinem Silber. Wenn man es einschmilzt, bekommt man dafür bestimmt tausend Thaler.«
»Und was wurde noch gestohlen?«
»Das Kreuz. Reicht das denn nicht?« Fonk klang empört.
Zabel war Protestant, kannte sich aber gut genug mit den Ritualen der Katholiken aus. Diese Stadt war einst von den Römern gegründet worden, und viele Geistliche würden es gerne sehen, wenn auch heute noch Rom das Sagen hätte. Aber was Napoleon im letzten Jahrhundert begonnen hatte, setzten die Preußen fort: Religionsfreiheit. Protestanten, Hugenotten und alle anderen durften nun hier leben und ihre Geschäfte betreiben. Juden sogar schon länger. Die Preußen bestanden darauf, dass jeder nach seiner Fasson leben sollte, solange sich die Bürger an die Gesetze hielten und ihre Abgaben entrichteten.
Um den Geistlichen aus der Reserve zu locken, stellte Zabel sich unwissend. »Wozu dient das Vortragekreuz?«
Der Dompropst seufzte. »Es wird beim Einzug in die Kirche und bei Prozessionen vorneweg getragen. Und es ist aus purem Silber. Also von beträchtlichem Wert.«
»Wann brauchen Sie es das nächste Mal?«
»Na, morgen. Am Sonntag, beim Hochamt.«
Erst jetzt bemerkte Zabel das Stück Papier, das auf dem Schrankboden lag. Er ging in die Hocke, nahm es und faltete es auseinander, dann kam er wieder auf die Beine.
»Sie irren«, sagte er zu dem Geistlichen, »der Täter will das Kreuz nicht einschmelzen.«
»Was?« Die Verwunderung stand in Fonks Gesicht geschrieben. »Woher wissen Sie das?«
Zabel hielt ihm das Papier hin. »Lesen Sie selbst.«
Der Geistliche nahm es entgegen und hielt es so weit wie möglich von seinen Augen entfernt, um die Schrift entziffern zu können. Nach und nach öffnete sich sein Mund immer weiter, Zabel nahm schlechten Geruch wahr.
»Der Einbrecher will das Kreuz zurückgeben?« Fonk schaute entsetzt zu Zabel. »Gegen einen Obolus?«
Der Kommissar nickte. »Tausend Thaler. Genauso viel, wie Sie geschätzt haben.«
Der Dompropst verstand nicht. Obwohl die Sünde ihn tagtäglich umgab, schien er sich mit den Auswirkungen derselben wenig auszukennen. »Was hat das zu bedeuten?«
»Ich würde sagen, dass der Dieb sich mit den Schätzen der Kirche gut auskennt. Sehr gut sogar. Das Vortragekreuz hat einen materiellen Wert von tausend Thalern, erwähnten Sie gerade. Wenn man es einschmilzt und das Silber verkauft. Ich nehme an, der ideelle Wert aus Sicht der Kirche dürfte weitaus höher liegen, oder?«
Der Dompropst nickte und schien allmählich zu verstehen.
Zabel fuhr fort: »Er verkauft Ihnen den Wert des Silbers und spart sich selbst Kosten und Mühe.« Mit einem leicht ironischen Lächeln auf den Lippen kombinierte er weiter: »Ich würde behaupten, wir suchen nach einem Kaufmann, der gut rechnen kann, aber ansonsten in seinem Beruf versagt hat.«
»Woher wissen Sie so was?«
Er schaute den Dompropst an. »Na, sonst hätte der Dieb es wohl nicht nötig, die Kirche zu bestehlen. Oder?«
Zabels Gedankengänge schienen dem Geistlichen etwas zu schnell zu gehen.
»Darf ich?« Zabel nahm ihm das Papier aus der Hand und steckte es zwischen die Seiten seines Blocks. »Wer hat den Einbruch entdeckt?«
»Ich. Nachdem Kaplan Schulte mich gerufen hatte. Er war an der Schatzkammer vorbeigegangen und sah das kaputte Fenster. Also kam ich mit dem Schlüssel, und dann … dann habe ich ihn sofort losgeschickt, dass er die Polizei holen solle.«
»Der Kaplan hat keinen Schlüssel?«
Fonk schüttelte den Kopf.
»Nur Sie? Sonst niemand?«
Er nickte. Allmählich verstand der Dompropst, in welche Richtung die Fragen gingen. »Wollen Sie damit etwas andeuten?«
Zabel ließ den Block in seiner Manteltasche verschwinden. »Ich ermittle nur. Dazu gehören solche Fragen.«
Der Geistliche schien ihm das nicht zu glauben und wirkte leicht gereizt.
Zabel nahm keine Rücksicht auf Befindlichkeiten, wandte sich ab und schritt zur Tür. Es war zu früh am Morgen und zu früh in der Ermittlung, um jetzt weitere Fragen zu stellen, aber Zabel störte sich daran, dass auf dem Schreiben des Erpressers dieselbe Zahl geschrieben stand, wie sie der Dompropst ausgesprochen hatte.
»Was werden Sie jetzt unternehmen?«, fragte Fonk.
Zabel blieb an der Tür stehen und drehte sich zu ihm um. »Warten.«
»Worauf?«
»Auf die nächste Nachricht des Täters. Schließlich muss er uns mitteilen, wie Sie ihm das Geld übergeben sollen, damit er das Kreuz zurückbringt. Davon steht noch nichts auf dem Papier.«
Der Dompropst schien allmählich die Gedankengänge des Kommissars zu verstehen und lächelte.
Zabel fuhr fort: »Sie sollten schon mal alles Notwendige veranlassen und das Erpressergeld oder den Finderlohn, wie immer man es nennen will, bereithalten.«
»Tausend Thaler?« Fonk war offenkundig entsetzt.
»Machen Sie sich keine Sorgen«, erwiderte Zabel sofort, »Sie kriegen das Geld zurück.«
Ein Schimmer der Hoffnung huschte über das Gesicht des Geistlichen, und er sah ihn erneut fragend an.
Zabel war selbstsicher. »Glauben Sie etwa, wir lassen ihn davonkommen? Mit Gottes Hilfe werden wir das Kreuz in den Schoß der Kirche zurückführen.«
Der Dompropst bekreuzigte sich andächtig.
»Der Einbrecher wird sich bestimmt bei Ihnen melden. Aber Sie werden sich auf nichts einlassen, auf kein Angebot, ohne sich vorher an mich zu wenden. Egal, wie verlockend das Angebot auch klingen mag.«
Zabel ging weiter in den Vorraum, blieb plötzlich stehen und drehte sich unversehens um. Der Dompropst war ihm gefolgt.
»Bitte erklären Sie mir noch eines«, sagte Zabel. »Ich bin Protestant. Das Sakrament der Beichte ist mir deshalb nur in groben Zügen bekannt.«
»Eines der wichtigsten Sakramente«, betonte Fonk. Auf einmal war er in seinem Element und wirkte hellwach. »Ein Sakrament, das Luther abgeschafft hat.«
Zabel war nicht an einer theologischen Unterweisung interessiert. »Wenn er beichten würde, wäre es Ihnen nicht erlaubt, mir davon zu erzählen, oder?«
»Wen meinen Sie? Wer soll beichten?«
»Der Einbrecher.«
Fonk verstand nicht. »Er beichtet?«
Zabel nickte. »Genau das verlangt die katholische Kirche doch von ihren Sündern, oder?«
Der Dompropst nickte. »Ja.«
»Also«, fuhr Zabel fort, »wenn er sich in der Beichte an Sie wenden würde, dann dürften Sie nicht mit mir reden, oder?«
Der Gesichtsausdruck Fonks bekam fast etwas Ermahnendes, als hätte er einen Schüler vor sich stehen. »Das Beichtgeheimnis ist absolut und steht über allem. Es stimmt, was Sie sagen. Wenn der Einbrecher das tun würde, dürfte ich Ihnen noch nicht einmal sagen, dass er bei mir war und gebeichtet hat.«
Zabel nahm es zur Kenntnis. »Ich hoffe, dass ich mich irre und der Einbrecher nicht so gut über die Sakramente Bescheid weiß.«
Mit diesen Worten verabschiedete er sich und ließ den Dompropst mit seinen noch vorhandenen Schätzen zurück.
Kapitel 2
Die Sonne schien grell in Zabels Gesicht und wirkte der Kälte entgegen. Trotz strahlend blauem Himmel war immer noch schwach der Vollmond zu erkennen. Zabel brachte den Haflinger in den nahe gelegenen Stall zurück und kümmerte sich selbst um das Stroh. Dies war ihm ein persönliches Anliegen, er betrachtete die Tiere nicht nur als Fortbewegungsmittel. Der Polizeibehörde standen immer ausreichend Pferde zur Verfügung, ebenso zwei Wagen, um längere Strecken zurücklegen zu können oder Gefangene zu transportieren.
Zabel verließ den Stall und schritt zum Präsidium. Am Eingang grüßte ihn ein Polizeisergeant. Er trug einen blauen zugeknöpften Rock, den Säbel an der linken Seite und einen Dreispitz auf dem Kopf. In dieser Uniform gingen etwa vierzehn von ihnen jeden Tag durch die Stadt, um für die Sicherheit der Bürger zu sorgen.
Zabel grüßte zurück, sein Respekt gegenüber den Sergeanten ging nicht weit über kollegiales Verhalten hinaus. Die meisten von ihnen rekrutierten sich aus ehemaligen Soldaten, die den Militärdienst aus unterschiedlichen Gründen vorzeitig beenden mussten. Zabel hatte im Laufe der Zeit feststellen müssen, dass besonderer Mut und Einsatzbereitschaft eher selten dazugehörten.
Das Berliner Polizeireglement schrieb jedem Beamten vor, Uniform zu tragen, außer wenn diese hinderlich bei der Ausübung des Dienstes war wie im Falle von Zabel und den anderen Kommissaren. Sie mussten sich unters Volk mischen können, um an Informationen zu gelangen, und manchmal war sogar der Säbel dabei hinderlich, weshalb Zabel im Dienst über seinem Rock einen langen dunklen Mantel trug, der die Waffe verdeckte.
Das Polizeipräsidium hatte die besten Jahre hinter sich und spiegelte in gewisser Weise den Zustand der Behörde wider. An einigen Stellen bröckelte der Putz von den Wänden, darunter kam das Mauerwerk zum Vorschein. Die düsteren Fenster enthielten mehr Blei als Glas, weshalb es im Eingangsbereich nie richtig hell wurde. Zabel stapfte die knarrenden Treppenstufen hinauf. Nur langsam wurden seine Füße etwas wärmer.
Im zweiten Stockwerk waren die vier Kommissare Kölns auf zwei Bureaus verteilt. Zabel betrat seine Amtsstube, ließ den Mantel an, hängte nur den Hut an den Haken und setzte sich an seinen Schreibtisch. Draußen verdeckten die Äste der Bäume die Sicht, sonst hätte Zabel bis zu seiner Wohnung auf der anderen Seite des Neumarktes blicken können. Evas Wohnung, um genau zu sein, denn seine Frau hatte Vermögen, nicht er. Sie war die Tochter eines Fabrikanten aus Ratingen bei Düsseldorf, aber im Gegensatz zu Zabel hatte sie sich sehr schnell am Rhein eingelebt und betrachtete Köln als ihre neue Heimat. Zabel fühlte noch nicht so, in ihm steckte zu sehr ein Preuße.
Der kleine Schreibtisch war aus Eichenholz, hatte rechts und links vier Schubladen, die durch eine schmale Tischplatte miteinander verbunden waren. Den Abstand der Schubladen hatte man gerade breit genug gewählt, sodass Zabels Beine dazwischenpassten. Ihn fröstelte es immer noch. Obwohl der kleine Kohleofen Tag und Nacht brannte, schaffte er es im Winter nicht, für ausreichend Wärme zu sorgen.
Zabel teilte sich die karge Amtsstube mit Fritz Bartmann, der noch nicht da war. Seit vier Generationen lebte die Familie Bartmann schon am Rhein, und die Tradition verlangte es, dass er den Namen in Köln nicht aussterben ließ. Er hatte drei Söhne und eine Tochter, aber aus den Gesprächen mit dem Kollegen ging hervor, dass die Anzahl den Eltern noch nicht genug erschien. Womöglich war dies ein Grund, weshalb Bartmann oft zu spät kam. Seine Ausreden lauteten immer gleich, dass er bereits auf der Straße zu tun gehabt habe und deshalb aufgehalten worden sei. Die Berichte zu solchen Einsätzen ließen dann so lange auf sich warten, bis sie vergessen wurden. Manches nahm man in Köln nicht ganz so genau wie in Berlin.
Zabel zog die Taschenuhr aus seiner Weste und schaute drauf. Es war halb neun. Die Uhr an der Wand zeigte fünf Minuten später an. Eine von beiden ging also nicht ganz richtig. Er nahm den Block aus seiner Manteltasche, legte ihn auf den Tisch und schlug ihn auf. Während er über den Fall nachdachte, starrte er zu dem verlassenen Schreibtisch seines Kollegen vor sich.
Zabel wusste, dass Bartmann beim Knobeln verloren hatte und sich deshalb das Bureau mit dem Preußen teilen musste. Eine Tür weiter saßen die Kommissare Conrad Görres und Konstantin Scheer, mit denen Zabel äußerst wenig zu tun hatte. Man sah sich auf dem Flur und an manchen Tagen, wenn Bartmanns Frau sie mit einer warmen Mahlzeit überraschte. Luise Bartmann konnte ausgezeichnete Eintöpfe kochen, jeweils mit dem, was auf dem Markt gerade billig zu haben war. Dann gab jeder einen Obolus dazu, und sie aßen gemeinsam im großen Vernehmungsraum am Ende des Korridors. In solchen Momenten bekam Zabel die viel beschworene Kölner Gastfreundschaft zu spüren. Zwist und Ärger waren dann wie fortgeblasen. Leider schaffte es keiner der Männer, egal, ob Rheinländer oder Preuße, über das gemeinsame Mittagessen hinaus Vertrautheit herzustellen. Treue von Berufs wegen schien das Einzige zu sein, was sie nach immerhin zwei Jahren verband.
Ein Grund dafür residierte zwei Stockwerke über ihnen, der Polizeipräsident Karl Philipp von Struensee, ebenfalls ein Preuße. Er war bei den Kölner Bürgern verhasst, und seine Unbeliebtheit färbte auch auf Zabel ab. Die ersten Monate in Köln waren daher äußerst schwierig gewesen, auch weil Zabel mit preußischer Disziplin versucht hatte, das Berliner Polizeireglement durchzusetzen. Mit gewissen Widerständen sei zu rechnen, hatten ihm die Vorgesetzten in Berlin mitgeteilt. Damit umzugehen gehöre zum Auftrag. Redlicherweise verschwieg man ihm nicht, wie stur und unbelehrbar die Kölner sein konnten. Aber das größte Problem war eben Karl Philipp von Struensee. Man hatte ihn vor fünf Jahren gegen den Willen der Bevölkerung und des damaligen Oberbürgermeisters von Mylius an die Spitze der Behörde gesetzt, um die Polizeiangelegenheiten von den Stadtgeschäften zu trennen. Zabel saß vom ersten Tag an zwischen den Stühlen, und in einem schwachen Moment, als er gerade mal drei Wochen in Köln verweilt hatte, hatte er in die Heimat geschrieben, um über eine Rückversetzung zu bitten. Als Antwort hatte er einen Formbrief bekommen, dass dem nicht stattgegeben werde.
Zabel sah wieder auf die Zeichnungen vor sich, nahm das Briefchen des Täters hervor, das zwischen den Seiten steckte, und sah es sich an. Die Handschrift des Täters war geschwungen und gut lesbar, mit Tinte zu Papier gebracht. Zabel ließ der Gedanke nicht los, dass bei diesem Einbruch und dem Motiv des Täters irgendetwas nicht stimmte. Die Wortwahl ließ auf einen eher gebildeten Täter schließen und nicht auf einen gewöhnlichen Einbrecher: »Das Kreuz gehört der Kirche – und auch dorthin zurück. Dabei wäre ich Ihnen gerne behilflich gegen Zahlung einer Summe von tausend Thalern.«
Tausend Thaler, der Wert des Silbers, genau wie der baldige Dompropst es gesagt hatte. Allein das erschien Zabel verdächtig, woher wusste der Einbrecher so gut Bescheid? Solche Vermutungen, die man als Beschuldigung auffassen könnte und die womöglich einen dunklen Schatten auf das Domkapitel warfen, sollte der Kommissar mit äußerster Vorsicht aussprechen. Zabel könnte sich Ärger einhandeln und dies ausnahmsweise mal nicht mit seinem obersten Vorgesetzten, denn Karl Philipp von Struensee war auch kein Freund der Kirche.
Zabel faltete das Papier wieder zusammen und ließ es in der obersten Schublade verschwinden. Er zog den warmen Mantel aus und hängte ihn an den Haken neben der Tür, den Säbel daneben. Allmählich hatte Zabel sich an die Temperatur im Bureau gewöhnt, außerdem trug er noch einen blauen Gehrock über der gelben Weste und dem Hemd mit Stehkragen. Die helle Hose rundete das Bild ab. Eva mochte die Kombination sehr, sie behauptete, dass diese aus Goethes berühmten Leiden des jungen Werthers stammte, ein sehr bekanntes Buch, das Zabel nicht gelesen hatte. Er war nicht so begeistert von Literatur wie seine Frau.
Da stapfte Fritz Bartmann ins Büro. »Guten Morgen, Herr von Zabel!«
»Guten Morgen!«
Bartmann erlaubte sich die Anrede nur, wenn er guter Laune war und das Eis am Morgen brechen wollte. Zabel nahm es mit Humor, auch wenn der Kollege ihn damit in die Nähe des Polizeipräsidenten rückte.
Er schaute zur Uhr an der Wand. »Oh, schon so spät?«
Zabel grinste. »Die geht vor. Sie sind absolut pünktlich.«
Bartmann grinste zurück. »Un Se sind ne miserable Lügner.«
Zabel bemerkte, dass Bartmann nicht alle Knöpfe seiner Hose zugemacht hatte, und wies ihn mit einem Fingerzeig darauf hin.
Bartmann sah an sich herab. »Oh. Isch han mich schon jewundert, warum et drusse so kalt es.«
Jetzt lachte Zabel. Einer der Vorzüge Bartmanns war sein Humor, gute Manieren schienen ihm dagegen eher fremd zu sein. Er konnte Hochdeutsch sprechen, sofern ihm daran gelegen war, dass Zabel ihn verstand. Zu Beginn ihrer Zusammenarbeit hatte Bartmann wenig Rücksicht auf den Kollegen aus Berlin genommen und einfach drauflosgeredet, mittlerweile drückte es seinen Respekt aus, wenn er sich mit seiner kölschen Sproch zurücknahm.
Bartmann deutete auf die Zeichnung, der Block lag offen auf dem Schreibtisch. »Wat es dat?«
»Mein Dienst fing heute schon sehr früh an«, sagte Zabel. »Ein Kaplan hat mich aus dem Bett gerufen. Ein silbernes Vortragekreuz wurde geklaut.«
»Aus welcher Kirche?«
»Domschatzkammer.«
Bartmann sah ihn verblüfft an. »Es nit wohr?«
Zabel nickte. »Vor über zwei Jahren soll so etwas schon mal passiert sein, wissen Sie etwas darüber?«
Bartmann nickte und nahm hinter seinem Schreibtisch Platz. »Na sicher. Dat hat damals für jroßen Buhei jesorgt. ’Ne Deserteur un Landsmann vun Ihnen wollt sing Fluchtkasse opflecke. Se han ihn zu hundert Hieben verurteilt un zehn Johr Kerkerhaft. Ävver dat Beste: Die mussten ihm de Prügelstrafe en drei Tranchen verpassen, sonst hätte er de Klopperei nit überlebt.« Bartmann lachte.
Als militärischer Gefangener dürfte der Deserteur nicht im Zuchthaus der Stadt untergebracht sein, vermutete Zabel. Vor der Säkularisation war das Zuchthaus ein Clarissenkloster gewesen, und die Bauweise erschien nicht ausreichend für die Inhaftierung von solchen Subjekten. Die Gefährlichen brachte man entweder im Gereons-Thor unter oder auch in einem der neu gebauten und von Soldaten bewachten Forts des äußeren Verteidigungsrings der Stadt. Die Auslagerung von Gefangenen hatte auch den Vorteil, dass, wenn einem doch die Flucht gelänge, er nicht versuchen würde, in die Stadt zurückzukommen, und somit wäre das Problem zumindest für die Kölner gelöst.
»Ganz schön hart die Strafe für einen Einbruch«, bemerkte Zabel.
Bartmann schüttelte den Kopf. »Dat is kein Enbruch. Dat is en Sakrileg. Jotteslästerung.«
Zabel dachte darüber nach, wie die heilige katholische Kirche wohl mit jemandem umginge, der ihr Nest beschmutzte. Sollte Zabel in diese Richtung ermitteln, war von Anfang an Vorsicht geboten.
»Isch schlage vör, m’r maache en Rund hück Naach.«
Zabel verstand nicht. »Eine Runde?«
»En d’r Unterwelt. Da weed ordentlich jeschwaad drövver.«
»Was wird da?«
Bartmann gab sich etwas mehr Mühe, deutlicher zu sprechen. »Na, geredet. Diskutiert und so.« Er seufzte. »Et weed allmählich Zick, dat Sie unsere Sproch he lernen. Villeich weiß ener unger däm kriminell Völckche, wer dat war. Oder hät wat jehört.«
»Keine Einwände«, sagte Zabel. »Würde es was ausmachen, wenn ich nicht mitkomme?«
»Dat wollt isch jerade vorschlagen.«
In mancher Hinsicht verstanden die beiden sich auf Anhieb. Die Vorstellung, nachts durch verrauchte Spelunken zu ziehen und Besoffene zu befragen, war Zabel zuwider, aber in dieser Kunst schien Bartmann genau der Richtige zu sein.
Da klopfte jemand an den Türrahmen. Ein Polizeisergeant stand vor dem Bureau.
»Kommissar Zabel. Unten vor dem Gebäude wartet jemand auf Sie, der Sie sprechen möchte.«
»Wer?«
»Der Mann wollte seinen Namen nicht nennen. Aber er sah aus wie ein Kutscher.«
Zabel erhob sich aus seinem Stuhl, schaute aus dem Fenster und erblickte den Zweispänner, der vor dem Gebäude stand, erkannte das Gefährt sofort. Er zog den Mantel an und schnallte den Säbel um.
Bartmann deutete auf den Block mit der Zeichnung. »Darf isch m’r dat ens ansehen?«
»Sicher«, sagte Zabel und verließ das Büro.
Kapitel 3
Zabel trat hinaus auf die Straße, wo der offene Zweispänner stand. Hinter dem Kutscher im Wagen saß Marcus DuMont. Er faltete die heutige Ausgabe der Kölnischen Zeitung zusammen, die er nicht nur mitgebracht hatte, sondern deren Verleger er auch war, und ließ sie in der Manteltasche verschwinden.
»Gustav«, begrüßte er ihn.
Zabel stieg in die Kutsche, und sie gaben sich die Hand.
»Marcus. Was führt dich her?«
»Ich war zufällig in der Gegend«, sagte DuMont mit einem ironischen Grinsen. Beide wussten, dass Zufälle im Leben des Verlegers eher rar gesät waren.
DuMont gab dem Kutscher ein Zeichen. Das Gefährt setzte sich ratternd in Bewegung, durch den Fahrtwind wurde der unangenehme Geruch der Misthaufen verweht.
Marcus DuMont war zehn Jahre älter als Zabel und einen Kopf kleiner. Er legte größten Wert auf standesgemäße Kleidung. DuMont hatte einen ausgezeichneten Schneider, der nur die besten Stoffe verarbeitete, was auch einem modisch nicht so versierten Kommissar ins Auge fiel. Schwarzer Gehrock mit gleichfarbiger Weste, weißes Hemd mit hohem Stehkragen und goldenen abnehmbaren Manschetten. Ein dunkelroter Plastron schützte seinen Hals vor der Kälte, ebenso der dunkelbraune Fellkragen an seinem tadellos geschnittenen Mantel. Auf dem Kopf trug er einen Zylinder.
Der Verleger gehörte zu Evas Freundeskreis, weshalb er vor anderthalb Jahren auch zu ihrer Hochzeit eingeladen gewesen war. An diesem Tag hatten Zabel und er sich das Du angeboten, allen Widerständen zum Trotz, denn beruflich standen sie auf unterschiedlichen Seiten. Die Presse wurde zensiert, und dafür zuständig war der Polizeipräsident Karl Philipp von Struensee. Er zählte zu den größten Gegnern der Kölnischen Zeitung, was aber den Kommissar nicht davon abhielt, mit DuMont Freundschaft zu schließen. Zabel bewunderte den Verleger, denn er verfügte über ein schier endloses Wissen.
Zabel hatte nie die Aussicht auf ein Studium gehabt, sein Vater war Kutscher gewesen und seine Mutter Bedienstete in gutem Haus. Dort hatten die beiden sich kennengelernt. Nach der Heirat kümmerte sich die Ehefrau um die drei Kinder und arbeitete nebenher als Näherin. Zabels Schwester Josefine lebte immer noch in Berlin, sein jüngerer Bruder Anton war in der Völkerschlacht bei Leipzig gefallen, im Alter von nur siebzehn Jahren. Genauso alt war Zabel gewesen, als er pflichtgemäß in den Militärdienst eingetreten war und fünf Jahre diente. Seine Liebe zum Vaterland hatte sich erst im Krieg entwickelt, denn der Feind band die Soldaten zusammen, und nur so hatte Zabel den nötigen Schneid gewonnen, todesmutig in die Schlacht zu reiten. Eine Kameradschaft, wie man sie im Kriege erlebte, hatte er nirgendwo sonst erfahren.