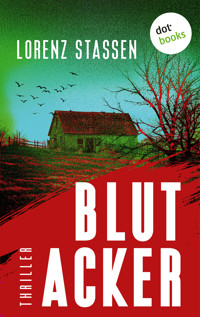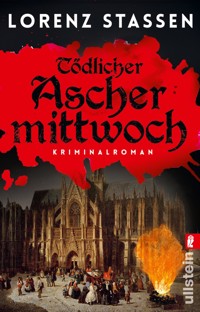
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der Karneval ist vorüber. Nun wird abgerechnet. Der Karneval ist vorbei. In der letzten Nacht wird eine große Strohpuppe verbrannt, die für die Sünden steht, die während der närrischen Tage begangen wurden. Im Morgengrauen danach wird Gustav Zabel aus dem Bett geholt. Denn auf dem Platz vor einer Kirche liegen nicht die verkohlten Überreste der Strohpuppe, sondern die eines Menschen. Der Leiche fehlt die rechte Hand, und Zabel weiß daher sofort, wer der Tote ist. Halb Köln hat ein Motiv, den Mann umzubringen. Doch bald führt eine Spur hinein in die Kölner Oberschicht, und Zabel muss gegen seine eigenen Freunde ermitteln. Bis noch eine Leiche auftaucht und Zabel alles in Frage stellen muss, was er zu wissen glaubt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Tödlicher Aschermittwoch
Der Autor
LORENZ STASSEN, geboren 1969, wuchs in Solingen auf und wurde zunächst Chemielaborant. Er wechselte ins Film- und Fernsehgeschäft und arbeitet seit 1997 als freischaffender Drehbuchautor und Schriftsteller. Lorenz Stassen lebt in Köln und ist Mitglied bei den »Roten Funken«.Von Lorenz Stassen ist in unserem Haus bereits erschienen:Rosenmontag
Lorenz Stassen
Tödlicher Aschermittwoch
Kriminalroman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage November 2023© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2023Titelabbildung: © akg-images (Kölner Dom, Feuer); © National Museums Liverpool / Bridgeman Images (Scheiterhaufen); FinePic®, München (Blutfleck, Struktur)Autorenfoto: © privatE-Book powered by pepyrusAlle Rechte vorbehalten.Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.ISBN 978-3-8437-3079-2
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
VORWORT
Köln 1825
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
KAPITEL 31
KAPITEL 32
KAPITEL 33
KAPITEL 34
KAPITEL 35
KAPITEL 36
KAPITEL 37
KAPITEL 38
KAPITEL 39
KAPITEL 40
KAPITEL 41
KAPITEL 42
KAPITEL 43
KAPITEL 44
KAPITEL 45
KAPITEL 46
KAPITEL 47
KAPITEL 48
EPILOG
GLOSSAR
ZITATE
DANKSAGUNG
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
VORWORT
VORWORT
Das neunzehnte Jahrhundert begann für die Bürger Kölns mit einem großen Umbruch. Die französischen Truppen hatten die Stadt 1814 verlassen, und auf dem Wiener Kongress im darauffolgenden Jahr wurde das Rheinland den Preußen zugesprochen. Somit stand Köln unter Königlich Preußischer Verwaltung.
Die Industrielle Revolution veränderte das Leben der Menschen im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts nachhaltig. Der technische Fortschritt nahm rasant an Fahrt auf, die moderne Naturwissenschaft gewann an Einfluss, wohingegen die Kirchen an Deutungshoheit verloren. Die Epoche der Romantik, eine Form der Rückbesinnung auf das Innere des Menschen, seine Gefühle und seine Beziehung zur Natur, spiegelte sich in der Kunst wie auch in der allgemeinen Lebenshaltung wider und wurde von Novalis so beschrieben: dem Gemeinen einen hohen Sinn geben, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein.
Naturwissenschaft, Glaube, technischer Fortschritt, aber auch Aberglaube, Spiritismus und Okkultismus vermengten sich in dieser Zeit.
Wegen der französischen revolutionären Bewegungen hatten die preußischen Machthaber Sorge, sie könnten die Kontrolle über das Volk verlieren, weshalb restriktive Maßnahmen an der Tagesordnung waren. Die Presse wurde zensiert und sogenannte Demagogen verfolgt. Mit diesem Begriff denunzierte man meist Freidenker, Künstler, Intellektuelle und Professoren, einige wurden mit Berufsverbot belegt, verließen das Land oder kamen sogar ins Gefängnis.
In Köln war es 1823 gelungen, trotz aller Skepsis der Preußen den Karneval zu etablieren. Das Fest entwickelte sich zu einem Synonym für Selbstbehauptung und Identität in Erinnerung an die große Zeit der unabhängigen freien Reichsstadt Köln. Trotz Kontrolle und Zensur fand man hier Gelegenheit, sich über die preußische Obrigkeit lustig zu machen oder gar bürgerliche Freiheiten einzufordern.
Die Geschichte in diesem Roman ist frei erfunden. Viele Ereignisse basieren aber auf wahren Begebenheiten, die meisten Charaktere sind fiktiv. Historische Figuren, die in dieser Zeit gelebt haben, werden am Ende des Buches in einem Glossar vorgestellt. Textstellen, die direkt von den damaligen Zeitzeugen stammen, sind kursiv gedruckt, und die Zitate werden am Ende den jeweiligen Verfassern zugeordnet.
Köln, im Juli 2023
Köln 1825
Die Wucht des Schlages dröhnte in seinem Kopf nach. Er schaute wieder nach vorne zu seinem Peiniger, der die rechte Hand schüttelte, weil sie offensichtlich schmerzte.
Noch mehr Blut tropfte aus Mund und Nase, trotzdem rang Arthur Schmoor sich ein Lächeln ab. Der Mann, der vor ihm stand, war ein Unbekannter, er hatte ihn noch nie zuvor gesehen und fand, dass er viel zu gut gekleidet war für einen Schläger, wie es sie damals gab.
Der Peiniger griff in die Tasche seines schwarzen Mantels mit Fellkragen und holte eine Münze hervor, hielt sie hoch. »Von wem hast du die?«
»Ist vom Himmel gefallen.«
Wieder traf ihn ein heftiger Faustschlag am Kinn, und sein Kopf schleuderte nach links. Er meinte, etwas in seinem Schädel knacken gehört zu haben.
Der Mann vor ihm wog die Münze in seiner Hand, dann ließ er sie wieder in seiner Rocktasche verschwinden.
»Wieso bist du zurückgekommen?«
Arthur keuchte. Die Schläge ins Gesicht setzten ihm mehr zu, als er sich eingestehen wollte. Lange würde er nicht mehr durchhalten, sein Puls raste, und ihm wurde übel. Sie hatten seine Arme hinter dem Rücken an den Stuhl gefesselt, so fest, dass sich die Finger der linken Hand allmählich taub anfühlten.
Arthur sah zu seinem Gegenüber auf. »War das etwa alles? Mehr hast du nicht drauf? Glaubst du, so kriegst du was von mir zu hören?«
Der Mann ballte die Faust erneut und schlug zu. Der erste Treffer erwischte Schmoor wieder am rechten Kinn und ließ den Kopf zur Seite schnellen, der zweite Schlag folgte, als er nach vorne sah, frontal auf die Nase, was das Blut spritzen ließ, als hätte die Faust in einen nassen Schwamm geboxt.
Angewidert trat der Peiniger einen Schritt zurück, zog ein weißes Tuch aus seiner Manteltasche, das sich rot färbte, als er seine Hand damit säuberte. Auch sein Mantel und der herausragende weiße Stehkragen des Hemdes hatten Blutspritzer abgekriegt.
Arthur spürte, dass sich ein weiterer Zahn aus dem Kiefer löste. Er spuckte ihn auf den Boden und rang sich ein Lächeln ab.
Das blutverschmierte Tuch von sich schmeißend, ballte der Mann erneut die Faust, überlegte es sich aber anders. Vielleicht wollte er nicht noch mehr Spritzer abkriegen, dachte Schmoor und grinste. Er drehte den Kopf, um hinter sich zu sehen. Dort stand noch einer, der nichts sagte. Es waren mehrere Männer, die ihn hierher verschleppt hatten. Den Fremden, der am Tor der Halle stand, kannte Arthur auch nicht. Sein Mantel war dunkelbraun.
Schmoor drehte den Kopf, schaute nach vorne zu seinem Peiniger. »Schaffe jemanden her, der etwas zu sagen hat. Du weißt, wen ich meine.«
Der Mann packte Arthur am Kiefer, dass es schmerzte. Er kam mit seinem Gesicht so nah, dass Arthur den feuchten Atem roch. »Nein, weiß ich nicht. Mit wem möchtest du reden?«
»Rabanus«, zischte Arthur.
Es trat ein Moment der Stille ein. Nur das Atmen seines Peinigers war zu hören.
»Woher hast du diesen Namen?«
Schmoor flüsterte. »Bring Rabanus her, dann sage ich euch alles.«
Der Mann ließ ihn los, rückte seinen Mantel zurecht, bevor er an Schmoor vorbei zu seinem Komplizen schritt. Die beiden entfernten sich in den dunklen Teil der Halle, so weit, dass Arthur sie nicht hören konnte.
Das war seine Chance. Er rutschte auf dem Stuhl hin und her, tat so, als ob er von Schmerzen geplagt sei. Die beiden Tölpel hatten etwas Wichtiges übersehen, oder sie hatten zu wenig Seil dabeigehabt. Auf jeden Fall nicht genug, um jemanden ordentlich zu fesseln, dem die rechte Hand fehlte. Arthur bewegte den Stumpf hin und her, spürte, wie der Arm an den Seilen entlangschürfte. Dann hatte er es geschafft, der Stumpf war frei. In dem Moment hörte er die Schritte der Männer, die näher kamen. Arthur legte den freien Arm wieder eng an den Körper an.
Der Eine bezog seine Position am Tor, während der Schläger sich breitbeinig vor Arthur stellte.
»Wir werden jemanden holen. Aber erst beantwortest du uns noch ein paar Fragen. Woher hast du die Münze?«
Arthur beugte sich nach vorne und würgte, als müsste er sich jeden Moment übergeben. Instinktiv wich der Mann einen Schritt zurück und vergrößerte den Abstand. Arthurs Oberkörper schnellte mit einem Ruck hoch, und er kam auf die Beine. Sein linker Arm war immer noch an den Stuhl gefesselt, den er jetzt auf dem Kopf seines Gegenübers zertrümmerte. Der Mann ging zu Boden, und Arthur trat mit voller Wucht gegen seinen Schädel.
Dann drehte Schmoor sich um zu dem Komplizen, der am Tor stand. Der junge Kerl war so schockiert, dass er nicht wusste, wie ihm geschah.
Es gab zwei Arten von Männern, das wusste Schmoor aus Erfahrung. Die, die im Moment der Bedrohung instinktiv reagierten, nicht darüber nachdachten, was richtig oder falsch sein könnte. Und die, die zur Salzsäule erstarrten, unfähig zu handeln.
Schmoor hielt die Überreste des zerbrochenen Stuhls in der Hand wie einen Knüppel. Ein zerborstener Knüppel, an dessen Ende die Holzfasern wie spitze Stacheln hervorstachen. Schmoor ging auf den Mann zu, der ihm jetzt den Rücken zudrehte und versuchte, den Riegel des Tors zu öffnen. Schmoor trat ihm mit dem Fuß ins Kreuz. Der Mann knallte krachend gegen das Tor, er drehte sich herum, hielt schützend die Hände vors Gesicht. Schmoor konnte es kaum glauben, mit was für einem Feigling er es zu tun hatte. Die Stoffhose seines Gegners verdunkelte sich an den Beinen.
Einen Moment dachte Schmoor darüber nach, ihn am Leben zu lassen. Durfte er einen Halbwüchsigen einfach so kaltmachen? Ja. Warum sollte er ihn verschonen? Schmoor rammte ihm die zerfaserte Spitze des Stuhlbeins in den Bauch. Der Junge starrte ihn entsetzt an. Ein markerschütternder Schrei hielt Schmoor nicht davon ab, den Pflock tiefer und noch tiefer in den Körper hineinzutreiben. Dann zog er das Stuhlbein mit einem Ruck heraus, und der Junge brach zusammen. Schmoor sah auf ihn herab, wie er zitternd auf dem staubigen Boden lag und mit den Händen seine herausquellenden Gedärme zurückhielt. Die Blutlache um ihn herum breitete sich schnell aus, das Geschrei ließ nach, er verlor zuerst an Kraft, dann das Bewusstsein.
Dann wurde es ganz still.
Arthur hörte hinter sich ein Stöhnen, drehte sich um. Sein Peiniger lag noch immer auf dem Boden, kam wieder zu Bewusstsein. Schmoor betrachtete den blutigen Holzpflock in seiner Hand, an dem noch ein paar Innereien hingen. Er klemmte das Holz unter seinen rechten Arm und zog mit aller Kraft seine linke Hand zwischen den Seilen hervor, ließ den zerfaserten Knüppel fallen.
Dann schritt Arthur zu seinem Peiniger, packte ihn an den Haaren, beförderte ihn auf die Beine, drückte ihn gegen einen Stützpfosten. Den rechten Stumpf presste Arthur gegen den Hals, schnitt dem Mann die Luft ab. Nicht ganz, er sollte noch atmen können und die letzten Sekunden seines erbärmlichen Daseins bei vollem Bewusstsein miterleben.
»Du hättest deinen Chef holen sollen. So, wie ich es dir gesagt habe.«
»Ich … hole ihn«, röchelte er.
Schmoor sah ihm in die Augen, wusste, was der Mann sich durch diese Lüge erhoffte, und schüttelte den Kopf. »Ich habe eine bessere Idee. Du sagst mir, wo ich ihn finde. Wo ist Rabanus? Sag es, und ich verschone dein Leben.«
Die Lippen des Mannes liefen bereits blau an, Arthur lockerte den Griff, damit er reden konnte.
»Du bist …« Er keuchte. »Du bist ein toter Mann.«
»Nein«, Schmoor lächelte. »Ich werde bald ein reicher Mann sein. Und dann räche ich mich. Ich werde keinen davonkommen lassen.« Er holte tief Luft, füllte seine Lungen, bevor er laut schrie: »Die Rache ist mein!«
Seine Stimme hallte von den Backsteinwänden wider.
»Rabanus …« Ihm versagte die Stimme. »Sein Gesicht wird das Letzte sein, das du auf dieser Welt sehen wirst. Bevor er dich umbringt.«
Arthur begriff, dass dieses Gespräch zu nichts führen würde. Er legte sanft die linke Hand auf das Gesicht des Mannes und drückte zu. Seine Finger, die sich immer noch etwas taub anfühlten, gruben sich tiefer und tiefer in die Augenhöhlen. Der Mann schrie, versuchte es zumindest, aber Schmoor drückte seinen Stumpf noch fester gegen die Kehle. Dann spürte er, wie die Augäpfel unter dem Druck nachgaben und zerplatzten. Erst der linke, dann der rechte.
Arthur genoss den Moment.
Dann trat er einen Schritt zurück, der Mann sackte wie ein nasser Sack auf den Boden, schrie aus Leibeskräften, hielt sich die Hände vors Gesicht, schrie noch lauter, während zwischen seinen Fingern ein wenig Blut und helle Flüssigkeit hervorquollen. Er robbte über den Boden, bis die Kraft nachließ und nur noch ein Wimmern zu hören war. Schmoor beugte sich zu dem Erblindeten, griff in dessen Manteltasche und nahm die Münze wieder an sich.
Arthurs rechte Hand, die nicht mehr da war, schmerzte und erinnerte ihn daran, weshalb er zurückgekommen war. Rache. Zwei Jahre lang hatte er an nichts anderes denken können. Er würde niemanden verschonen, nicht die alten, nicht die neuen Feinde. Arthur betrachtete seinen Stumpf. Derjenige, der ihm das angetan hatte, ahnte noch nichts davon. Aber auch auf ihn wartete Nemesis.
Schmoor trat nah an den am Boden Liegenden heran, hob sein Bein, bevor er mit einem Tritt den Schädel seines Opfers zerquetschte.
KAPITEL 1
Zweiundsiebzig Kronleuchter und eine Unzahl an den Wänden angebrachter Lampen verbreiteten Tageshelle in dem ungeheuer großen Saale des Gürzenich. Gustav Zabel schätzte, dass mindestens tausend, vielleicht sogar noch viel mehr Gäste den Saal füllten, und draußen im Foyer standen mindestens genauso viele. Alle waren bunt kostümiert, trugen venezianische Masken vor dem Gesicht, in einer Vielfalt, die ihresgleichen suchte, der Fantasie schienen keine Grenzen gesetzt zu sein. Manche Masken bedeckten nur die Augen, andere das halbe Gesicht, und manche hatten extrem lange Nasen, was besonders auffällig und lustig aussah.
Von allen Seiten ertönten lautes Lachen und ausgelassene Freude. Im kölnischen Volksdialekt vorgebracht, klang das Komische oft noch komischer, auch wenn es einem Fremden zugleich unverständlich blieb.
Gustav Zabel schob sich durch die Menge, auf der Suche nach seiner Frau. Wenn die Leute mit ihm Blickkontakt aufnahmen, lächelte er sie stets an. Das Orchester auf der Bühne bestand aus dreißig Musikern, und sie animierten beinahe jeden zur Bewegung, sei es, dass man im Takt schunkelte, oder tanzte.
Eva war nur schwer auszumachen in dem Getümmel. Die venezianischen Masken verfremdeten die Gäste, manchen bis zur Unkenntlichkeit. Aber nicht alle. Zabel erblickte seinen Vorgesetzten, den Polizeipräsidenten Karl Philipp von Struensee, dessen Maske nur seine Augen bedeckte. Statt eines Kostüms trug er seine beste Uniform, als ob er auch beim Karneval die Staatsmacht repräsentieren wollte. Ihm schien wirklich jeder Sinn für Humor und Geselligkeit zu fehlen, und mit diesem Auftreten blamierte er hier am Rhein die Preußen eher, als dass jemand Respekt vor ihm hätte. Von Struensee bemerkte Zabel, ihre Blicke trafen sich für einen kurzen Moment, dann wandte der Polizeipräsident sich ab und verschwand im Getümmel. Eine Geste, die nicht misszuverstehen war. Es hatte sich in den letzten zwei Jahren, seit dem ersten Rosenmontagszug, nichts zwischen ihnen geändert. Von Struensee war heute Abend zwar anwesend, weil er es für nötig hielt, sich auf gesellschaftlichem Parkett zu zeigen, aber eigentlich gehörte er zu den entschiedenen Gegnern des Frohsinns. Diese Gegner hatten am heutigen Tag eine krachende Niederlage erlebt. Das Motto der Feierlichkeiten hätte passender nicht sein können:
Der Sieg der Freude.
Entsprechend hatten sich beim großen Maskenzug vier voneinander getrennte Gruppen auf den Neumarkt zubewegt, um sich dort zu vereinen.
Die erste Gruppe war der Kölner Zug gewesen, angeführt von einem Mitglied des Festordnenden Komitees in Verkleidung einer berühmten historischen Figur: Jan von Werth. Der Legende nach war Jan ein einfacher Knecht gewesen, der sich in die Dienstmagd Griet verliebt hatte. Die aber erhoffte sich eine bessere Partie und wies ihn zurück. Jan war daraufhin in den Dreißigjährigen Krieg gezogen und kehrte als General nach Köln zurück. Auf einem Markt begegnete er seiner einst großen Liebe wieder und soll gesagt haben: »Griet, wer es getan hätte.« Und sie antwortete: »Jan, wer es gewusst hätte.«
Zabel mochte diese Legende, weil er etwas Ähnliches selbst erlebt hatte. Im Alter von siebzehn Jahren hatte er als Soldat an den Befreiungskriegen gegen Napoleon teilgenommen, und bei seiner Rückkehr war die Frau, für die er so sehr geschwärmt hatte, vergeben gewesen. Im Nachhinein hatte er dem Schicksal gedankt.
Die zweite Gruppe des Umzugs war den »Feinden« gewidmet und bestand symbolisch aus denjenigen, die der hemmungslosen Freude im Weg standen. Der Polizeipräsident Karl Philipp von Struensee hätte sich ihnen anschließen können, dachte Zabel.
Dem Kölner Zug waren die Befreundeten aus Venedig zu Hilfe gekommen, und schließlich hatte auch der vierte Zug den Neumarkt erreicht. Er bestand aus den Vermittelnden, die am Ende alle zusammen vereinten. Lediglich die Figur des Held Carneval fehlte dieses Mal, denn man wollte eine Wiederholung des Geleisteten vermeiden. Die offizielle Erklärung des Festordnenden Komitees lautete, dass Held Carneval sich in Venedig aufhielte, da er beim Umzug im Jahr zuvor die Prinzessin Venetia an seiner Seite gehabt hatte, damals verkörpert durch einen Mann, den Festordner Salomon Oppenheim. Dieses Jahr, so hatte das Festordnende Komitee beschlossen, stattete Held Carneval einen Gegenbesuch ab, weshalb er nicht anwesend sein könne. Natürlich waren solche Verlautbarungen nur Teil des Mummenschanzes. Um das zu verstehen, musste man wohl am Rhein geboren sein, Zabel war noch weit davon entfernt.
Da entdeckte er seine Frau. Eva hatte den Saal verlassen und stand im Foyer direkt unter einem der vielen Kronleuchter, der ihr gelbes Kleid leuchten ließ. Sie war mit einer Frau in ein Gespräch vertieft, beide trugen Masken, die nur die Augen bedeckten. Die Frau war ganz in Schwarz gekleidet, ein Kostüm, das an eine Hexe erinnerte. Sie redete sehr laut, um die Musik zu übertönen, und Zabel trat an die beiden heran.
»Mein Sohn reißt im Moment an meinem Nervenkostüm. Haben Sie Kinder?«
Eva ging über die Frage hinweg und wandte sich Gustav zu. »Darf ich vorstellen, mein Ehemann. Gustav Zabel, er ist Kommissar.«
»Oh«, sagte die Frau voller Erstaunen. »Ein Kommissar, sehr interessant. Ich bin Schriftstellerin.«
»Johanna Schopenhauer«, stellte Eva sie vor.
Zabel gab ihr galant einen Handkuss.
»Und wieso zerrt Ihr Sohn an Ihren Nerven? Ich hoffe, er stellt nichts Schlimmes an.«
»Kommt darauf an, was man als schlimm bezeichnet. Arthur ist Ende dreißig und immer noch sehr anstrengend. Seit vier Jahren lebt er in Berlin und zieht bereits zum dritten Mal um.«
»Was macht er beruflich?«
»Er schreibt auch, allerdings philosophische Texte, die kaum einer lesen mag. Deshalb hat er sich auch mit seinem Verleger überworfen, was dem Erfolg seiner Bücher nicht gerade dienlich ist.« Ihr Blick schweifte zum Saal. »Vielleicht hätte ich ihn mit hierherbringen sollen. Eine so ausgelassene Stimmung würde ihm mal ganz guttun, und er käme vielleicht auf andere Gedanken.«
»Ja«, schaltete sich Eva ein und schaute stolz zu ihrem Mann auf. »Der rheinische Frohsinn kann wahre Wunder bewirken, wie man an meinem Gustav sieht. Er stammt aus Berlin, ein waschechter Preuße, und er konnte dem allen hier zunächst auch nichts abgewinnen, aber jetzt: Sehen Sie ihn an.«
Zabel trug die rot-weiße Uniform der ehemaligen Kölner Stadtsoldaten, die im Volksmund Rote Funken genannt wurden. Johanna Schopenhauer musterte ihn von den Stiefeln bis hinauf bis zum Dreispitz. »Die Kleidung steht Ihnen ausgezeichnet. Dürfen Sie so etwas als preußischer Beamter überhaupt tragen?«
»Nur heute, da es keine Uniform ist, sondern ein Kostüm. Dann kommt es wieder in den Schrank. Bis nächstes Jahr.«
»Mir ist zu Ohren gekommen, dass solche Uniformen im Karneval eine Verballhornung des preußischen Militärs bedeuten. Wie kommt es, dass die Preußen sich so etwas gefallen lassen?«
»Nicht jeder ist begeistert darüber. Aber wir haben auch prominente Fürsprecher.«
»Ich hörte davon. Sogar der liebe Goethe hat erst kürzlich ein paar Zeilen über den Karneval verfasst.«
Eva nickte eifrig. »Leider konnten wir den Dichterfürsten noch nicht dazu bewegen, mit uns zu feiern.«
»Ist das Ihr erster Maskenzug, den Sie miterleben?«, fragte Zabel.
»Ja. Und so Gott will, nicht mein letzter. Ich bin gespannt auf morgen. Auch dann soll es in allen Straßen von Masken nur so wimmeln.«
Eva nickte zustimmend. »Der Karneval endet erst am Aschermittwoch. Sie sollten morgen Abend zum Dom kommen. Da wird der Nubbel verbrannt.«
»Der was?«
»Eine Strohpuppe«, fuhr Eva fort. »Der Nubbel steht sinnbildlich für alle Verfehlungen der Feiernden und muss für unsere Sünden bezahlen. Mit förmlichem Leichengeleite trägt man die Puppe auf einer Bahre durch die Stadt und verbrennt dieselbe auf einem Platze.«
»Das klingt ja mittelalterlich«, sagte Schopenhauer. »Und ein wenig gruselig. Wo findet dieses Spektakel denn statt?«
»An einigen Orten. Wir werden auf dem Platz vor dem Dom sein und danach noch den Tag bei Heinrich von Wittgenstein ausklingen lassen«, antwortete Zabel.
»Von Wittgenstein? Der Präsident des Festordnenden Komitees?«
»Und unser Trauzeuge«, fügte Eva hinzu.
»Sie sind hiermit herzlich eingeladen zu kommen«, sagte Zabel. »Er wohnt in der Trankgasse Nummer sechs, an der Nordseite des Doms.«
Johanna lächelte. »Dann werde ich da sein.«
In dem Moment trat ein Mann in einem venezianischen Kostüm an sie heran. Es hatte nicht den Anschein, dass Johanna Schopenhauer ihn kannte. Wie viele andere Gäste war er in Schwarz gekleidet, trug eine weiße Perücke und einen Dreispitz mit bunten Federn. Seine Maske hatte eine extrem lange Nase, mit der er Leute auf Abstand halten konnte. Er verneigte sich vor Frau Schopenhauer. »Dürfte ich die Dame um den nächsten Tanz bitten?«
Sie hob den Arm und reichte ihm die Hand, die er dankend annahm.
Johanna verabschiedete sich mit einem Lächeln. »Wir sehen uns morgen. Ich wünsche Ihnen noch viel Vergnügen.«
Sie reichte ihr Glas einem Diener, der ebenfalls eine Maske trug, und verschwand mit ihrem Tanzpartner in den Saal.
Zabel schaute ihnen hinterher. »Ich frage mich, wie er mit so einer Nase tanzen will?«
»Wenn er sie über ihre Schulter hält. Intimere Begegnungen dürften allerdings schwierig werden.«
Da trat der Diener mit dem Tablett an sie heran, und sie stellten ihre Champagnergläser ab. Zabel wollte gerade zu einem gefüllten greifen, da hielt Eva ihn zurück.
»Lass uns auch in den Saal gehen.«
Sie nahm seine Hand und entführte ihn.
Auf dem Weg in Richtung der Tanzfläche kam es vor ihnen plötzlich zu einem Tumult. Mehrere Männer, die im Kreis standen, lachten laut, und dann löste sich einer aus der Menge, es war Karl Philipp von Struensee. Wutentbrannt ging er davon. Zabel meinte, auf der Uniform des Polizeipräsidenten ein paar Rotweinflecken gesehen zu haben. Die Leute, mit denen Struensee aneinandergeraten war, amüsierten sich prächtig. Eva und Zabel kamen näher, und Gustav sah ein leeres Weinglas in der Hand des befreundeten Apothekers Albertus Neureck, der auch zum Festordnenden Komitee zählte.
Er wandte sich Zabel zu. »Es war nur ein Versehen. Dein Vorgesetzter hat mich angerempelt.«
Wieder fingen einige an zu lachen, und Zabel wusste, dass es anders abgelaufen sein musste.
»Heute siegt die Freude«, sagte Neureck laut und hob das leere Rotweinglas. »Überall die Miesepeter, die dem Frohsinn im Wege stehen.«
Eva zog Zabel am Arm. »Komm, lass uns tanzen.«
Da entdeckte er jemanden in der Menge und zögerte. »Würde es dir etwas ausmachen, wenn ich eben den Prinzen Friedrich von Preußen begrüße?«
»Vielleicht suche ich mir lieber einen anderen«, sagte sie schnippisch.
Zabel wendete sich der Gruppe Männer zu. »Meine Frau möchte tanzen, und ich bin …«
Bevor er weiterreden konnte, hatte Albertus Neureck das leere Rotweinglas einem anderen gereicht und fasste galant Evas Hand. »Darf ich bitten.«
Sie lächelte, und der Apotheker geleitete sie auf die Tanzfläche.
Zabel ging auf Prinz Friedrich von Preußen zu. Als Verkleidung trug er die Abendgarderobe aus Zeiten von Louis Seize vor der Französischen Revolution: knielange dunkle Hose, weiße Strümpfe, Rüschenhemd und Gehrock und eine weiße Perücke auf dem Kopf. Dazu hatte er eine schwarze Maske auf, die nur seine Augen verdeckte.
Als Zabel vor Seiner Königlichen Hoheit stand, musterte der Prinz ihn von den Stiefeln bis zu dem Dreispitz mit Federbusch.
Zabel verneigte sich kurz. »Eure Königliche Hoheit.«
Er nickte, und seine Stimme klang mahnend. »Ich meine, mal ein Versprechen von Ihnen gehört zu haben, dass Sie so eine Uniform nie tragen wollten.«
»Es handelt sich nur um ein Kostüm.«
»Ein Kostüm, das hoffentlich nicht allzu sehr auf den Menschen abfärbt«, erwiderte Friedrich von Preußen und schmunzelte. Sein Oberlippenbart ragte bis weit über die Wangen hinaus, wie es vor allem in adeligen Kreisen Mode war.
»Schön, Sie zu sehen«, sagte der Prinz. »Wo ist Ihre Frau?«
»Sie hat sich für einen besseren Tänzer als mich entschieden.«
Friedrich grinste. »Meine ebenso.«
In Momenten wie diesem konnte der Prinz seine Herkunft vergessen und war ganz Mensch. Das spürte Zabel, sie kannten sich schon lange, über acht Jahre. Erstmalig begegnet waren sie sich bei einer Ordensverleihung. Zabel hatte für seine Arbeit als Kommissar den Roten Adler bekommen, weil er zusammen mit Kollegen einen feigen Mordanschlag auf König Friedrich Wilhelm den Dritten hatte vereiteln können. Bei dieser Gelegenheit hatte er den Prinzen kennengelernt, der mittlerweile in Düsseldorf weilte und die vierzehnte Infanteriedivision kommandierte.
Friedrich deutete zu der Gruppe Männer. »Was war da eben los?«
»Einer von ihnen ist mit dem Polizeipräsidenten zusammengestoßen und hat dabei sein Glas Rotwein verschüttet. Auf die Uniform.«
»Mit Absicht?«
»Das wird noch zu klären sein. Aber ich kann Ihnen versichern, falls es absichtlich geschehen ist, wird dies Konsequenzen haben.«
»Welcher Art?«
»Der Mann, dem dieses Missgeschick passiert ist, gehört zum Festordnenden Komitee. Sogar zum Kleinen Rat. Der Präsident Heinrich von Wittgenstein wird es nicht auf sich beruhen lassen, wenn es mit Absicht geschehen ist.«
»Das gehört sich auch so.« Er sah Zabel in die Augen. »Sie kennen meine Meinung zu Ihrem Vorgesetzten. Aber das Motto Sieg der Freude schließt mit ein, dass alle ihre Freude haben sollen. Auch ein Karl Philipp von Struensee.«
»Genau so sehe ich es auch.«
Da trat ein Diener mit einem Tablett an sie heran. Sie nahmen jeder ein gefülltes Champagnerglas und stießen an.
»Auf einen sehr gelungenen Abend«, sagte Prinz Friedrich und grinste. »Zumindest für die meisten von uns.«
Jetzt mussten sie beide lachen.
KAPITEL 2
Das Feuer prasselte. Die Funken stiegen hinauf und wurden vom Winde verweht, tummelten sich mit den Sternen am Himmel, bevor sie endgültig in der Dunkelheit verglühten. Die Flammen hatten von der Strohpuppe nur noch ein Häufchen Asche übrig gelassen, weshalb die Wärme des Feuers spürbar nachließ. Eva und Zabel waren nicht mehr kostümiert, trugen nur noch ihre venezianischen Masken, die sie jetzt abnahmen. Der Fastelovend war vorbei. Am elften November, vierzig Tage vor der Heiligen Nacht, würde erneut gefeiert werden, aber nur einen Tag lang. Erst im neuen Jahr ginge es dann weiter.
Fast alle Umstehenden lösten ihre Masken von den Gesichtern, und die Leute waren wieder zu erkennen. Zabel machte in der Menge einen Freund aus: Everhard von Groote. Sie gingen aufeinander zu, kannten sich durch das Festordnende Komitee.
Von Groote schien ohne Begleitung zu sein. »Freut mich, euch zu treffen.« Er begrüßte erst Eva standesgemäß mit einem Handkuss, dann tauschten die Männer einen festen Händedruck aus.
»Ist deine Frau zu Hause geblieben?«, fragte Zabel.
»Nein, sie konnte sich aber nicht für das Feuer erwärmen und ist der Meinung, man müsse nicht jeden Unsinn mitmachen. Sie wartet bei von Wittgenstein. Ihr kommt doch auch dahin?«
»Natürlich«, sagte Eva sofort. »Hat Franziska euren Sohn dabei?«
Von Groote nickte stolz. Zabel und Eva hatten den Eltern bereits zu ihrem vierten Kind und dritten Sohn gratuliert, der wenige Tage vor dem Maskenzug das Licht der Welt erblickt hatte.
Die drei entfernten sich vom prasselnden Feuer und gingen um den Dom herum zur Nordseite der Kathedrale, während Everhard erzählte. Die Geburt war sehr schnell verlaufen, seine Frau Franziska hatte nicht lange in den Wehen gelegen.
Heinrich von Wittgenstein wohnte direkt gegenüber der Kathedrale. An der Haustür stand ein Mann im Frack und mit Zylinder auf dem Kopf, der sie begrüßte und einließ. Die Wohnung lag im ersten Stock, in der Beletage, und man konnte vom Wohnzimmer aus auf den Dom schauen. Zabel fand, dass die Bauruine im Licht des Vollmondes etwas Dämonisches hatte, und der Schein des Feuers war noch hinter dem Turm in den Wolken zu sehen.
Rund fünfzig Gäste hatten sich im Haus von Wittgenstein eingefunden. Zabel kannte die meisten vom Sehen und auch viele mit Namen. Mit denen aus dem Festordnenden Komitee war er sogar per Du. Zabels Blick wanderte umher auf der Suche nach dem Apotheker Albertus Neureck, der sich normalerweise keine Feier entgehen ließ. Er war nirgendwo zu sehen. Zabel machte sich einen eigenen Reim darauf. Womöglich war das verschüttete Rotweinglas beim Maskenball kein Fauxpas gewesen, sondern Ausdruck der Missbilligung gegenüber dem Polizeipräsidenten. Heinrich von Wittgenstein duldete keine Leute mit schlechten Manieren um sich, und Zabel vermutete, dass Albertus Neureck wegen des verschütteten Rotweinglases jetzt nicht mehr zum engsten Freundeskreis des Gastgebers gehörte.
Franziska von Kempis kam auf sie zu. Man sah ihr nicht an, dass sie erst vor ein paar Tagen ein Kind zur Welt gebracht hatte. Franziska war eine zierliche Person, die blonden Haare hatte sie hochgesteckt, und ihre blauen Augen leuchteten, wenn sie einen ansah. Sie begrüßte alle, aber Eva ganz besonders herzlich. Es war ihr erstes Aufeinandertreffen seit der Niederkunft, und die Frauen tuschelten sofort und verschwanden ins Nebenzimmer, um sich den kleinen Cornelius Joseph Hubertus von Groote anzusehen, über den ein Kindermädchen wachte.
Gustav und Everhard blieben zurück, bekamen von einem Bediensteten jeder ein Glas Champagner gereicht. Die beiden hatten sich in den letzten zwei Jahren besser kennengelernt, und sie verband eine Gemeinsamkeit. Everhard von Groote war als Freiwilliger bei den Befreiungskriegen dabei gewesen und hatte, genau wie Zabel, unter Generalfeldmarschall Gebhard Leberecht von Blücher gedient. Nach der siegreichen Schlacht bei Waterloo, die von Groote verpasst hatte, schickte der Generalfeldmarschall ihn nach Paris, um gestohlene Kunstgüter zurückzuholen. Von Groote war bei dieser Mission sehr erfolgreich gewesen, und die Stadt Köln verdankte ihm, dass das berühmte Gemälde von Peter Paul Rubens Die Kreuzigung Petri heute wieder an seinem angestammten Platz in der Kirche Sankt Peter hing.
Zabel bemerkte, dass Heinrich von Wittgenstein mit Johanna Schopenhauer diskutierte, und augenscheinlich war sie von dem Gastgeber mehr als begeistert. Von Wittgenstein war zwar Junggeselle, aber Zabel kannte den Geschmack seines Freundes. Johanna Schopenhauer entsprach dem eher nicht.
Von Wittgenstein beendete das Gespräch mit ihr, um sich an alle Gäste zu wenden, er schlug mit einem Silberlöffel an sein halb gefülltes Weinglas. Die Gespräche verstummten allmählich, bis es ganz still wurde.
»Liebe Gäste. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid und mit mir den Fastelovend ausklingen lasst.« Er machte eine rhetorische Pause. »Zuallererst möchte ich an all die erinnern, die leider nicht mehr unter uns weilen. Mein Lehrer und Mentor Ferdinand Franz Wallraf, Erzbürger der Stadt Köln, ist letztes Jahr im Alter von fünfundsiebzig Jahren von uns gegangen. Er hat ein erfülltes Leben gehabt. Mein guter Freund Christian Samuel Schier dagegen ist viel zu jung gestorben, er wurde nur dreiunddreißig Jahre alt. Kurz vor Weihnachten haben wir unseren Freund auf Melaten beigesetzt. Nah an dem Grab meiner Familie, wir werden uns also irgendwann wiedersehen, daran glaube ich fest.«
Von Wittgenstein erhob sein Glas. Alle anderen machten es ihm nach. »Alle Jläser huh. Kumm, mer drinke uch met denne, die im Himmel sin.« Von Wittgenstein schaute nach oben zur Zimmerdecke.
Die Gäste nahmen alle einen großen Schluck.
»Nun zu dem Maskenzug. Mir hat das alles wieder große Freude bereitet, auch der anschließende Ball im Gürzenich. Wie wichtig diese Veranstaltung ist, wissen viele gar nicht. Durch diesen Ball können wir das ganze Spektakel bezahlen, und es bleibt noch viel für die Notleidenden der Stadt übrig.«
Tosender Applaus setzte ein und Bravorufe. Von Wittgenstein genoss die Begeisterung, hob die Hände, damit er wieder zu Wort kam.
»Es gab kein einziges freies Zimmer mehr in der Stadt. Die Herbergen waren überfüllt, und die Wirte haben Wohnungen anmieten müssen, um alle Gäste unterzubringen. Vierzigtausend, schätzen wir, haben am Wegesrand gestanden, von den Fenstern und sogar den Dächern haben sie zugeschaut. Und kein Geringerer als Johann Wolfgang von Goethe hat uns mit einem Gedicht beschenkt, das dem diesjährigen Motto nicht besser entsprechen könnte.« Wittgenstein holte tief Luft und rezitierte:
»Dass am Rhein, dem vielbeschwommenen,Mummenschaar sich zum GefechtRüstet, gegen angekommenenFeind zu sichern altes Recht.«
Die Gäste applaudierten, aber von Wittgenstein war noch nicht fertig, hob wieder die Hand. »Es geht noch weiter, denn Goethe hat uns in seinem Gedicht auch alle ermahnt:
Löblich wird ein tolles Streben,wenn es kurz ist und mit Sinn.«
Wieder stimmten die Gäste mit Applaus zu, aber das Klatschen war diesmal etwas verhaltener, als würde den meisten erst jetzt bewusst werden, dass mit dem Feuer und dem letzten Umtrunk der Karneval ein Ende nahm.
Von Wittgenstein fuhr mit seiner Rede fort. »Wir haben dem Fastelovend nicht nur ein neues Gewand geschenkt, nein, wir alle miteinander haben dem Fest auch einen neuen Sinn verliehen. Das spüren die Menschen. Sie kamen von überall her. Und nicht nur das. Andere Städte ziehen nach.« Er machte wieder eine rhetorische Pause, länger als beim letzten Mal, bevor er seufzte: »Düsseldorf.«
Ein Raunen ging durch die Menge, und von Wittgenstein konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. »Ja, es ist passiert. Montag, der vierzehnte Februar 1825, ist zu einem historischen Tag geworden, denn da haben auch unsere Nachbarn in Düsseldorf den Karneval für sich entdeckt. Aber wir müssen uns keine Sorgen machen wegen der Konkurrenz, denn obwohl in Düsseldorf der erste Maskenzug stattfand, hat es Prinz Friedrich von Preußen vorgezogen, zu uns nach Köln zu kommen, um im Gürzenich zu feiern.«
Die Gäste applaudierten, lauter als je zuvor.
Von Wittgenstein schrie gegen das Klatschen und Grölen an. »Mancher aus dem Hochadel ist zu einem Anhänger des Karnevals geworden, und ich darf Ihnen verkünden, dass Prinz Friedrich von Preußen zusammen mit seiner Prinzessin auch im nächsten Jahr eingeladen ist und die beiden bereits zugesagt haben. Der Weg von Düsseldorf nach Köln ist sehr, sehr weit, wie wir alle wissen, aber er möchte die Reise trotzdem auf sich nehmen.«
Die Gäste lachten und jubelten. Zabel hatte sich mal erklären lassen, dass die Rivalität zwischen den beiden Städten am Rhein eine lange Tradition hatte und die Wurzeln bis zur Schlacht von Worringen im Jahre 1288 zurückreichten. Der Sieg damals war quasi ein Auslöser, dass Düsseldorf sich entwickeln und zu einer Konkurrenz für Köln werden konnte. Die viel beschworene »Feindschaft« wurde im Laufe der Zeit aber eher folkloristisch zelebriert.
Von Wittgenstein erkämpfte sich erneut das Wort gegen die Lautstärke. »Am Aschermittwoch, meine lieben Gäste, ist nicht alles vorbei.« Es wurde etwas ruhiger, die meisten wollten doch hören, was der Gastgeber zu sagen hatte. »Nur die Permanenz hört auf. Ab heute werden die Früchte geerntet, das Geld gezählt, und es geht eine große Spende an die Armenverwaltung. Wir blicken vorausschauend ins nächste Jahr. Lassen wir den Fastelovend heute Abend friedvoll ausklingen, aber nächste Woche erwarte ich die Herren des Kleinen Rates bei unserer nächsten Sitzung des Festordnenden Komitees. Zur gewohnten Zeit, am gewohnten Ort. Es gibt viel zu besprechen. Nun aber wünsche ich allen einen schönen Ausklang.«
Die Gäste applaudierten, trotz einer gewissen Wehmut, die zu spüren war. Zabel hingegen hatte genug vom Feiern und freute sich, dass morgen das normale Leben wieder begann.
Johanna Schopenhauer kam auf Gustav zu, von Groote hatte sich zwischenzeitlich zu seiner Frau Franziska nach nebenan begeben.
»Es freut mich, Sie wiederzutreffen«, begrüßte Frau Schopenhauer ihn. Sie roch nach Qualm, offensichtlich hatte sie zu nahe am Feuer gestanden.
»Ich hoffe, der Karneval hat Ihnen viel Freude bereitet.«
»Ja. Ich habe großen Gefallen am Brauchtum gefunden. Es führt die Menschen zusammen und lässt uns alle für einen Moment die Realität vergessen. So etwas habe ich bisher nur hier am Rhein erlebt.«
»Bleiben Sie noch länger?«
Johanna seufzte. »Nein. Ich fahre morgen nach Berlin und werde meinem Sohn einen Besuch abstatten.«
»Der Philosoph?«
Sie nickte. »Auch er lebt in einer anderen Realität. Mit dem Unterschied, dass diese nicht am Aschermittwoch endet.« Und mit einem weiteren Seufzer fügte sie hinzu. »Ich hoffe nur, dass aus dem Jungen irgendwann mal etwas werden wird.«
Die beiden hoben ihre Gläser und stießen an.
Der Abend nahm seinen gewohnten Lauf. Es wurde immer lauter, je mehr die Gäste getrunken hatten. Eva fand Gefallen daran, sie war sogar eine der Lautesten. Zabel zog es vor, in den Eingangsbereich zu gehen, wo Gleichgesinnte waren, die eine gepflegte Konversation bevorzugten, ohne sich anschreien zu müssen.
Everhard von Groote musste leider gehen. Seine Frau trug den Jungen auf dem Arm, machte aber nicht den Eindruck, dass sie schon wegwollte. In einem Nebensatz glaubte Zabel herauszuhören, dass Everhard die treibende Kraft für den Aufbruch war. Sie verabschiedeten sich von den Umstehenden, und von Groote nutzte die Gelegenheit, Gustav noch jemandem vorzustellen.
»Ihr kennt euch vielleicht«, sagte Everhard. »Franz Rothamel. Er ist ein neues Mitglied im Kleinen Rat.«
Gustav reichte ihm die Hand. »Gustav Zabel. Herzlich willkommen.«
»Danke.« Rothamel erwiderte den Händedruck. Er war eine stämmige Person mit einem deutlichen Bauchansatz, seine dunklen Koteletten betonten die breite Gesichtsform.
»Was hat Sie zu uns geführt?«, fragte Zabel.
Rothamel hatte eine angenehm sonore Stimme. »Ich war zuerst im Großen Rat. Aber von Wittgenstein meinte, dass ich zu wichtig sei, um dort zu versauern.« Er unterstrich seine Worte mit einem Grinsen.
Everhard klopfte ihm zum Abschied auf die breiten Schultern. »An Selbstbewusstsein fehlt es unserem Freund zumindest nicht.«
Everhard gab Zabel die Hand, dann setzte er sich seinen Hut auf und verließ mit seiner Frau, dem Neugeborenen und seinem Kindermädchen die Feier.
Zabel wandte sich Rothamel zu. »Was machen Sie beruflich?«
»Ich bin Kaufmann. Handele mit allem, was es wert ist, gehandelt zu werden.« Er strich sich beiläufig mit der Hand durch das zurückgekämmte dunkle Haar. »Aber sagen Sie, sind nicht alle Mitglieder des Kleinen Rates per Du miteinander?«
Zabel nickte, gab ihm noch mal die Hand. »Gustav.«
»Franz. Du bist der Kommissar aus Berlin, richtig?«
Zabel nickte.
»Sind deine Dienstherren damit einverstanden, wenn du in einer anderen Uniform als der preußischen herumläufst?«
»Solange ich das nur an Karneval mache.«
»Hörst du gern Musik?«
Der Themenwechsel kam Zabel etwas zu plötzlich, und er musste kurz überlegen. »Wenn sie nicht zu laut ist, ja. Warum fragst du?«
»Nur so.« Er schmunzelte, als wollte er mit der Frage etwas bezwecken, aber nicht den Grund verraten. »Du kanntest Christian Samuel Schier?«
»Ja. Er hat das erste Karnevalslied gedichtet. Es erscheint mir immer noch unwirklich, dass er nicht mehr unter uns weilt. Wir waren Freunde.« Zabel zögerte. »Und Kameraden.«
»Habt ihr zusammen gegen die Franzosen gekämpft?«
»Nicht in derselben Einheit, aber in derselben Schlacht. Kennengelernt haben wir uns aber erst hier in Köln.«
»Ach, hier bist du«, ertönte Evas Stimme neben Zabel, sie wirkte schon etwas beschwipst.
»Darf ich vorstellen, meine Frau Eva. Franz Rothamel. Neues Mitglied des Festordnenden Komitees.«
»Freut mich sehr, Sie kennenzulernen.« Eva reichte ihm ihre Hand, und er verneigte sich, um ihr galant einen Kuss auf den Handrücken zu geben.
»Mich freut es auch.«
»Leider muss ich meinen Mann kurz entführen.« Sie schaute zu Zabel. »Ich möchte dir jemanden vorstellen.«
Gustav schaute zu Rothamel. »Wir sehen uns später.«
»Spätestens morgen beim Fischessen.«
Zabel hatte fast vergessen, dass der Karneval an Aschermittwoch doch noch nicht ganz vorbei war. Den Kölnern fiel immer wieder ein Grund zum Feiern ein, vor allem den Mitgliedern des Festordnenden Komitees.
Eva nahm Gustav am Arm und führte ihn zurück ins Wohnzimmer, während sie ihm laut ins Ohr sprach. »Ich habe jemanden kennengelernt, der mit Grundstücken handelt. Von ihm könnten wir vielleicht eine Parzelle kaufen, einen Garten, den wir uns schon immer gewünscht haben.«
Zabel nickte. Der Wunsch nach einem Garten innerhalb der Stadtmauern schwelte schon lange in Eva. Ihm dagegen war das nicht so wichtig, aber er heuchelte ihr zuliebe Interesse.
KAPITEL 3
Friedhelm Krohn schlich durch die dunklen, menschenleeren Gassen. Schon in der Früh war er aufgestanden, um sein kleines Zimmer, das eher einer Abstellkammer glich, zu verlassen. Er streifte durch die winterliche Kälte auf der Suche nach etwas, das andere vielleicht in der letzten Nacht verloren hatten. Betrunkene gaben meist nicht acht auf ihre Habseligkeiten, und am letzten Tag des Karnevals gab es viele, die nicht mehr bei Sinnen waren. Krohn hatte an dem Spaß nicht teilhaben können, dafür fehlten ihm die nötigen Thaler. Er war auf Almosen angewiesen, musste sehen, wie er durchkam. Wenigstens konnte er sich zu den Glücklichen schätzen, die ein Dach über dem Kopf hatten. Krohn wusste, dass er und viele andere vom Karneval profitieren würden, da die Einnahmen auch der Armenverwaltung zugutekamen, trotzdem überkam ihn oft die blanke Wut, wenn er die Wohlhabenden sah, wie sie sich verlustierten und ausgelassen feierten. Sollten sie ihr Hab und Gut auf dem Nachhauseweg ruhig verlieren, er würde da sein und es finden und bestimmt nicht zurückgeben. Letztes Jahr hatte er fette Beute gemacht, eine Brieftasche, prall gefüllt. In der Börse hatte sich auch ein Zettel mit dem Namen und der Adresse des Besitzers befunden. Krohn hätte sich einen Finderlohn einstreichen können, hatte es aber vorgezogen, sie zu leeren und dann wegzuwerfen. Sollte er bei seinem Streifzug einem Polizisten begegnen, der wissen wollte, was er in seinem Beutel bei sich trug, würde Krohn natürlich behaupten, auf dem Weg zum Präsidium zu sein, um die Fundsachen abzugeben. Das Aufheben von Gegenständen war nicht verboten. Noch nicht. Wer konnte schon wissen, was sich die Preußen noch alles einfallen ließen, um die Kölner Bürger zu drangsalieren.
An diesem Morgen hatte Friedhelm noch nicht viel Glück gehabt. Eine goldschimmernde Haarklammer, die aber nicht aus Gold war. Eine kleine Tasche aus Leder, die anscheinend zu einem Kostüm gehört hatte, doch außer einer Dose mit weißem Puder enthielt sie nichts.
Vor allem Pferdemist und anderer Unrat säumten das Kopfsteinpflaster. Er näherte sich der Kirche Sankt Gregorius im Elend, im Volksmund wurde sie nur Elendskirche genannt. Sie befand sich auf einer kleinen Anhöhe, und die aufgehende Sonne im Osten ließ die Kirchturmspitze in rötlichen Farben am Morgenhimmel erleuchten. Friedhelm blieb stehen, um den Anblick zu genießen, aber im selben Moment kam auch das schlechte Gewissen in ihm auf. Der leuchtende Kirchturm in der Morgensonne hatte etwas Ermahnendes, als wolle Gott ihm ein Zeichen senden, dass er davon ablassen solle, die Habseligkeiten anderer zu suchen, um sie zu behalten. Friedhelm riss sich los von dem Bild, ging weiter, denn er hatte genug von ihm, dem Gott, der sich auch nicht um ihn kümmerte. Kein bisschen. Ohne eigenes Verschulden war er in Not geraten, wer half ihm? Niemand. Nein, er würde die Gelegenheit nicht verstreichen lassen, und vielleicht würde er doch noch etwas finden.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: