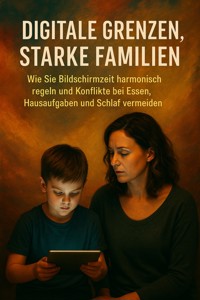36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Diplomarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich BWL - Controlling, Note: 1,8, FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Berlin früher Fachhochschule, Veranstaltung: Immobiliencontrolling, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Geschäftsprozesse in Immobilienunternehmen werden immer komplexer und zeichnen sich durch eine starke Ausrichtung auf Kennzahlen aus. Zugleich fordern Entscheidungsträger oft sehr kurzfristig einen aussagekräftigen Überblick über die wirtschaftliche Situation des betreuten Immobilienportfolios. Unabhängig davon, ob es sich um Bestandsimmobilien, Miet- oder Kaufobjekte handelt, muss es dem Unternehmen möglich sein, auf Anhieb umfassende Informationen über den bestehenden aktuellen Zustand ihrer Immobilien zu erhalten. Tatsache ist jedoch, dass häufig keine ausreichende Möglichkeit zur Performancemessung mittels einheitlicher Kennzahlen besteht. Sofern es weiterhin an einer intelligenten Verknüpfung von Informationen zur Flächennutzung und zu Mietverträgen, über Nebenkosten und Subventionen, zur Optimierung von Dienstleistungsverträgen oder zu Marktindizes fehlt, sind Immobilienkennzahlen weder ortsbezogen, noch regional oder weltweit konsistent. Das Controlling in Immobilienunternehmen muss sich stetig aktuellen Marktentwicklungen anpassen. Hinzu kommt, dass sich die Datenbasis aus internen und externen Daten kontinuierlich vergrößert, was die Anforderungen an die Transparenz und die Rationalität von Managemententscheidungen in Immobilienunternehmen weiter steigert und die Unterstützung des Immobilienmanagements mit umfassenden Systemen erforderlich macht. Die damit gesteigerten Anforderungen, die Investoren und auch Eigentümer an die Bewirtschaftung ihrer Immobilien und das Berichtswesen sowie die Performancemessung stellen, bringt das Immobiliencontrolling an seine Grenzen. Diese Arbeit betrachtet Unternehmen, die Immobilien und deren Bewirtschaftung als Massenproblem verstehen. Unternehmen, die umfangreich Immobilien besitzen, Immobilien mittel- und langfristig betreiben und den Immobilienbestand unternehmerisch führen. Die Arbeitshypothese lautet: Immobilienunternehmen brauchen ein funktionierendes Controlling, um die Finanzierung, Bewirtschaftung und Betreuung der Immobilien optimal gewährleisten und unterstützen zu können. Ein funktionierendes Immobilienmanagement muss mit Hilfe eines Immobiliencontrollings und der darin angewandten Planungs- und Kontrollinstrumente in der Lage sein, eine Performancemessung auf Einzelobjekt- und Portfolioebene vorzunehmen und so eine optimale Steuerung der Immobilie im Interesse des Eigentümers bzw. des Investors zu gewährleisten. ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Formelverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Zielsetzung
1.3 Vorgehensweise
2 Grundlagen Immobilien
2.1 Begriff der Immobilie
2.2 Nutzungsorientierte Systematisierung von Immobilien
2.3 Besonderheiten der Immobilie als Wirtschaftsgut
2.4 Lebenszyklusbetrachtung von Immobilien
3 Immobilienunternehmen
3.1 Gegenstand und Aufgabe
3.2 Ziele von Immobilienunternehmen
4 Controlling
4.1 Definition und Kernaufgaben allgemein
4.2 Immobiliencontrolling
4.2.1 Gegenstand und Definition des Immobiliencontrollings
4.2.2 Mindestanforderungen an ein Immobiliencontrolling
4.2.3 Immobilieninformationssystem
4.2.4 Immobiliencontrolling in der Nutzungsphase
4.2.5 Instrumente
5 Problembereiche - Herausforderungen
5.1 Immobiliendaten – Erfolgsfaktor Datenverarbeitung
5.2 Bereichsübergreifende Anwendung – Schnittstellenmanagement
5.2.1 Zentrale versus dezentrale Organisation
5.2.2 Reporting und Berichtswesen
5.3 Planungshorizont und Prognoseanforderungen
5.4 Performancemessung und Risikoabbildung
5.5 Konfliktpotenzial durch verschiedene Interessengruppen
5.6 Optimierung betrieblicher Immobilienprozesse
5.6.1 Integration vorhandener Instrumente
5.6.2 Schaffung einer übersichtlichen, konsistenten Kennzahlenstruktur
5.6.3 Zielgruppenspezifische Informationsversorgung
6 Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
Internetquellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Nutzungsorientierte Systematisierung von Immobilien
Abbildung 2: Heterogenität von Immobilien
Abbildung 3: Immobilienlebenszyklus
Abbildung 4: Leistungsbereiche des Gebäudemanagements im Überblick
Abbildung 5: Zielsystem des Immobilienmanagements
Abbildung 6: Definition des Immobiliencontrollings
Abbildung 7: Ziele der Gebäudeinstandhaltung
Abbildung 8: Kennzahlenkategorien
Abbildung 9: Immobilienwirtschaftlich angepasstes DuPont-Kennzahlensystem
Abbildung 10: Ausschnitt aus der Kennzahlenpyramide für Betriebskosten
Abbildung 11: Analyse der Kostenarten
Abbildung 12: Geschäftsverteilungsplan Immobilienunternehmen
Abbildung 13: Grundfragen eines Berichtswesens
Abbildung 14: Beispiel Standardbericht
Abbildung 15: Beispielbericht auf Objektebene
Abbildung 16: Indikatoren als Grundlage einer Prognose
Abbildung 17: Businessplan einer Immobilie über 10 Jahre
Abbildung 18: Allgemeine Immobilienbilanz
Abbildung 19: Interessengruppen am Immobilienmarkt
Formelverzeichnis
Formel 1: Mietzinsausfallquote
Formel 2: Betriebskostenquote
Formel 3: Mieterfluktuation
Formel 4: Leerstandsrate
Formel 5: Beschwerden
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
Die Geschäftsprozesse in Immobilienunternehmen werden immer komplexer und zeichnen sich durch eine starke Ausrichtung auf Kennzahlen aus. Zugleich fordern Entscheidungsträger oft sehr kurzfristig einen aussagekräftigen Überblick über die wirtschaftliche Situation des betreuten Immobilienportfolios.[1] Unabhängig davon, ob es sich um Bestandsimmobilien, Miet- oder Kaufobjekte handelt, muss es dem Unternehmen möglich sein, auf Anhieb umfassende Informationen über den bestehenden aktuellen Zustand ihrer Immobilien zu erhalten. Tatsache ist jedoch, dass häufig keine ausreichende Möglichkeit zur Performancemessung mittels einheitlicher Kennzahlen besteht. Sofern es weiterhin an einer intelligenten Verknüpfung von Informationen zur Flächennutzung und zu Mietverträgen, über Nebenkosten und Subventionen, zur Optimierung von Dienstleistungsverträgen oder zu Marktindizes fehlt, sind Immobilienkennzahlen weder ortsbezogen, noch regional oder weltweit konsistent.[2] Das Controlling in Immobilienunternehmen muss sich stetig aktuellen Marktentwicklungen anpassen.[3]
Hinzu kommt, dass sich die Datenbasis aus internen und externen Daten kontinuierlich vergrößert, was die Anforderungen an die Transparenz und die Rationalität von Managemententscheidungen in Immobilienunternehmen weiter steigert und die Unterstützung des Immobilienmanagements mit umfassenden Systemen erforderlich macht.[4]
Die damit gesteigerten Anforderungen, die Investoren und auch Eigentümer an die Bewirtschaftung ihrer Immobilien und das Berichtswesen sowie die Performancemessung stellen, bringt das Immobiliencontrolling an seine Grenzen.
1.2 Zielsetzung
Diese Arbeit betrachtet Unternehmen, die Immobilien und deren Bewirtschaftung als Massenproblem verstehen. Unternehmen, die umfangreich Immobilien besitzen, Immobilien mittel- und langfristig betreiben und den Immobilienbestand unternehmerisch führen.
Die Arbeitshypothese lautet:
Immobilienunternehmen brauchen ein funktionierendes Controlling, um die Finanzierung, Bewirtschaftung und Betreuung der Immobilien optimal gewährleisten und unterstützen zu können.Ein funktionierendes Immobilienmanagement muss mit Hilfe eines Immobiliencontrollings und der darin angewandten Planungs- und Kon-trollinstrumente in der Lage sein, eine Performancemessung auf Einzelobjekt- und Portfolioebene vorzunehmen und so eine optimale Steuerung der Immobilie im Interesse des Eigentümers bzw. des Investors zu gewährleisten.
Vor diesem Hintergrund werden die aktuellen Herausforderungen für Immobilienunternehmen im Bereich des Controllings untersucht und kritisch hinterfragt, um daraus Lösungsansätze abzuleiten und einen Anstoß zur Optimierung des Controllings geben zu können.
1.3 Vorgehensweise
Diese Arbeit ist in drei Bereiche gegliedert. An diese Einleitung schließt sich eine Erörterung der Grundlagen der Immobilienwirtschaft an, auf denen diese Arbeit basiert. Dazu erfolgt eine Definition des Begriffs Immobilien mit seinen verschiedenen Ausprägungen sowie anschließend eine Darstellung der Besonderheiten von Immobilien, die die Bewirtschaftung sowie den Umgang mit Immobilien als Investitionsgut für Immobilienunternehmen vor die zu untersuchenden Herausforderungen stellt. Im Weiteren erfolgt eine Abhandlung über Immobilienunternehmen, wobei ihr Gegenstand, die Aufgabenbereiche und die Ziele von Unternehmen der Immobilienbranche erläutert werden. Darauf aufbauend wird im zweiten Bereich eine kurze Einführung in das allgemeine Controlling gegeben, um im Weiteren aufzuzeigen, wie die Zielerreichung von Immobilienunternehmen durch ein spezielles Immobiliencontrolling unterstützt werden kann. Dazu werden die grundlegenden Inhalte und Aufgaben des Immobiliencontrollings sowie einige Instrumente unter Erläuterung ihrer jeweiligen Anwendung dargestellt. Im Hauptteil dieser Arbeit werden dann die sich ergebenden Herausforderungen im Bereich der Immobilienbewirtschaftung während der Nutzungsphase untersucht und anschließend Lösungsansätze formuliert. Die Arbeit endet mit einer Schlussbetrachtung, die die gesammelten Erkenntnisse zusammenfassend darstellt.
2 Grundlagen Immobilien
2.1 Begriff der Immobilie
Der Begriff „Immobilie“ weist im wissenschaftlichen, wie auch im umgangssprachlichen Bereich, eine vielfältige Bedeutung auf und ist darin mit stark differenziertem Inhalt belegt.[5] Häufig wird in der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur in physische, rechtliche, wirtschaftliche und soziale Inhalte des Immobilienbegriffs unterschieden.[6]
Bei der Betrachtung der physischen Dimension beschränkt sich die Definition allein auf die materiellen Eigenschaften der Immobilie. Diese stellen die bestimmenden Merkmale der Immobilie dar, wie Wände, Böden, Decken und Dächer, welche auf einem Teil der Erdoberfläche errichtet wurden und ein Segment des darüber liegenden Luftraumes künstlich abgrenzen. Die Immobilie ist damit als dreidimensionales Objekt zu verstehen, das Flächen und Räume erzeugt, indem „außen“ und „innen“ durch eine materielle Barriere getrennt werden.[7] Diese auf die Gebäudestrukturen beschränkte Definition des Immobilienbegriffs, lässt jedoch Grund und Boden, wie auch den Nutzen unberücksichtigt.[8]
Aus juristischer Sicht wird der Begriff „Immobilie“ weitaus differenzierter betrachtet. Eine universelle Legaldefinition für die „Immobilie“ lässt sich in Deutschland nicht finden, vielmehr ist das Wort „Immobilie“ in keiner wichtigen Gesetzespassage, insbesondere nicht im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), zu finden.[9] Das BGB beschränkt sich hierbei auf die Definition der Begriffe „Grundstück“ und „Gebäude“. So heißt es in § 94 BGB: „Zu den wesentlichen Bestandteilen eines Grundstücks gehören die mit dem Grund und Boden fest verbundenen Sachen, insbesondere Gebäude, sowie die Erzeugnisse des Grundstücks, solange sie mit dem Boden zusammen hängen. … Zu den wesentlichen Bestandteilen eines Gebäudes gehören die zur Herstellung des Gebäudes eingefügten Sachen.“[10]Ebenso gehören Rechte, die mit dem Eigentum an einem Grundstück verbunden sind, zu den Bestandteilen des Grundstücks.[11]Das Steuerrecht ordnet Grundstücke, Gebäude, Gebäudeteile sowie grundstücksgleiche Rechte den unbeweglichen Vermögensgegenständen zu.[12] Weiterhin lassen die §§ 68 ff. des Bewertungsgesetzes (BewG), §§ 5 und 6 der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) und § 1 des Erbbaurechtsgesetzes (ErbbauRG) eine Definition des Immobilienbegriffs aus juristischer Sicht zu. Allen gemein ist die zwingende Verbindung von Gebäude und Grundstück.[13]
Der ökonomische Immobilienbegriff lässt sich wiederum aus zwei Blickwinkeln betrachten. Investitionstheoretisch stellen Immobilien Kapitalanlagen und Sachvermögen dar. Der produktionstheoretische Gedanke hingegen fasst die Immobilie als Produktionsfaktor.[14] Bei beiden Betrachtungsweisen liegt der wirtschaftliche Charakter einer Immobilie nicht in ihrer Produktion, sondern ergibt sich aus ihrer Nutzung. Entscheidend für die Werthaltigkeit einer Immobilie sind dabei nicht die historischen Herstellkosten, sondern in welchem Maße eine Nachfrage durch die Marktteilnehmer nach den angebotenen Nutzungsmöglichkeiten besteht.[15]
Als zentrale Inhalte des investitionstheoretischen Immobilienbegriffs lassen sich in Anlehnung an GRAASKAMP „der abgeschlossene Raum, die Nutzenstiftung dieses Raumes und die zeitliche Dimensionierung der Nutzung“ beschreiben.[16] Das Verfügungsrecht über den abgeschlossenen Raum, erlaubt dem Eigentümer das Nutzungsrecht für eine bestimmte Zeit unter Gewinnerzielung einem Dritten zu überlassen, der daraus einen Nutzen stiftet. Die Höhe der Mietzahlungen bzw. des Nutzungsentgeltes ist dabei nicht konstant, sondern unterliegt Marktschwankungen. Weiterhin können sich im Zeitablauf die Attraktivität der Immobilie und das Nutzungspotenzial ändern. Durch Abnutzung und technische Veralterung kommt es zu Wertminderungen des Gebäudes oder aus einem Anstieg der Bodenpreise sowie aus Mobilitätsschranken der Mieter können sich Wertsteigerungen ergeben.[17]
Der produktionstheoretische Immobilienbegriff umfasst Unternehmensimmobilien als Betriebsmittel, die für den Leistungserstellungsprozess des Unternehmens benötigt werden.[18] Als Produktionsfaktoren dienen sie der Produktion anderer Güter und stellen damit das quantitative und qualitative Potenzial zur Leistungserstellung dar.[19]
Ein letzter Gesichtspunkt, der der Vollständigkeit halber erwähnt sei, ist der soziale Immobilienbegriff. Jede Immobilie oder jedes Immobilienprojekt beeinflusst das Umfeld und dessen interne sowie externe Bezugsgruppen. Unabhängig davon, ob neue Immobilienprojekte umgesetzt werden oder Bestandsimmobilien bau- oder nutzungsrechtlich umgestaltet werden sollen, führen derartige Entscheidungen bei den Bezugsgruppen oder auch Stakeholdern[20] aufgrund des unmittelbaren Interesses oder einer mittelbaren Verbindung zu positiven oder negativen Reaktionen. Interne Stakeholder sind dabei beispielsweise Eigentümer, Mieter oder Nutzer, wohingegen die Öffentlichkeit bzw. die Gesellschaft als externe Bezugsgruppen zu verstehen sind. Aufgrund der Tatsache, dass die jeweilige Immobilie für die Öffentlichkeit einen Umweltfaktor darstellt, sind die Interessen vielseitig. Im Fokus stehen dabei der Schutz und die Verbesserung von Lebens- und Wohnqualität.[21] Ein weiterer Aspekt kann bei dieser Betrachtungsweise Artikel 13 des Grundgesetzes sein, der in Deutschland die Unverletzlichkeit der Wohnung deklariert und damit die Privatsphäre der Bürger innerhalb ihres Wohnraumes schützt.[22]
2.2 Nutzungsorientierte Systematisierung von Immobilien