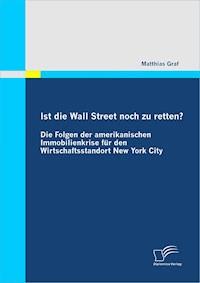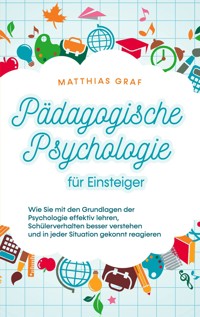
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Mithilfe dieses Buches sollen Sie als Leser einen Überblick über die Welt der pädagogischen Psychologie bekommen. Allgemeine Einblicke in die Welt der Psychologie sowie spezifische Informationen werden hier vermittelt. Zu Beginn werden die wichtigsten Begrifflichkeiten bestimmt und dann wird näher auf die Entwicklung und ihre wichtigsten Punkte eingegangen, bevor verschiedene lerntheoretische Konzeptionen und die psychosoziale Konzeption von Erikson dargestellt werden. Hierbei spielen auch Verhaltensauffälligkeiten eine enorm wichtige Rolle. Anschließend werden einige Interventionsmöglichkeiten dargestellt, um pädagogische Handlungen zu verbessern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 50
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alle Ratschläge in diesem Buch wurden sorgfältig erwogen und geprüft. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden. Eine Haftung des Autors beziehungsweise des Verlags für jegliche Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist daher ausgeschlossen.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
INHALT
Was Sie in diesem Buch erwartet
Begriffsbestimmungen
Psychologie
Pädagogische Psychologie
Inhalte der pädagogischen Psychologie
Lerntheoretische Konzeptionen
Klassische Konditionierung
Operante Konditionierung
Beobachtungslernen
Psychosoziales Konzept von Erik Erikson
Die Entwicklung
Der endogenistische Ansatz
Der exogenistische Ansatz
Erweiterung des Entwicklungsbegriffs
Entwicklung als Sozialisation
Entwicklung des Selbstkonzepts
Entwicklung von Verhaltensauffälligkeiten
Verhaltensauffälligkeiten
Begriffsverständnis
Verhalten
„Normales“ Verhalten
Auffälliges Verhalten
Externalisierende Störungen des Schulalters
Hyperkinetische Störungen
Störungen des Sozialverhaltens
Internalisierende Störungen
Emotionale Störungen des Kindesalters
Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit und Jugend
Ursachen
Interne Risikofaktoren
Externe Risikofaktoren
Schutzfaktoren
Interne Schutzfaktoren
Externe Schutzfaktoren
Intervention
Problemspezifisches Vorgehen
Prävention
Alters- und störungsübergreifende Maßnahmen
Zusammenfassung
Was Sie in diesem Buch erwartet
Mithilfe dieses Buches sollen Sie als Leser einen Überblick über die Welt der pädagogischen Psychologie bekommen. Allgemeine Einblicke in die Welt der Psychologie sowie spezifische Informationen werden hier vermittelt. Zu Beginn werden die wichtigsten Begrifflichkeiten bestimmt und dann wird näher auf die Entwicklung und ihre wichtigsten Punkte eingegangen, bevor verschiedene lerntheoretische Konzeptionen und die psychosoziale Konzeption von Erikson dargestellt werden.
Hierbei spielen auch Verhaltensauffälligkeiten eine enorm wichtige Rolle. Anschließend werden einige Interventionsmöglichkeiten dargestellt, um pädagogische Handlungen zu verbessern.
Begriffsbestimmungen
Um den Kontext zu verstehen, müssen zuerst die Begriffe der pädagogischen Psychologie und der allgemeinen Psychologie erläutert werden.
PSYCHOLOGIE
Die wohl meistverbreitete Definition von Psychologie ist: „Psychologie ist die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten des Menschen.“ Damit gemeint ist, dass die Psychologie verschiedene Modelle nutzt, um zu verstehen, wie Menschen ticken und warum sie bestimmtes Verhalten zeigen.
PÄDAGOGISCHE PSYCHOLOGIE
Die pädagogische Psychologie ist ein Teilbereich der Psychologie und beschäftigt sich mit dem menschlichen Erleben und Verhalten in Bildungs-und Erziehungssituationen. Hiermit lassen sich Verhaltensmuster beim Lernen und Auswirkungen von psychologischen Faktoren auf Erziehungs- und Sozialisationsprozesse besser verstehen.
Die pädagogische Psychologie versucht mithilfe der Beschreibung und Erklärung von Erziehungs-, Sozialisations- und Unterrichtsprozessen, bestimmte pädagogische Handlungen zu optimieren. Thematisch ist die pädagogische Psychologie stark mit der Pädagogik und der Entwicklungs- und Persönlichkeitspsychologie verknüpft. Doch die pädagogische Psychologie beschäftigt sich nicht ausschließlich mit dem schulischen Kontext, sondern auch mit außerschulischen Kontexten.
Inhalte der pädagogischen Psychologie
Nach Reynolds und Miller (2003) gibt es fünf Hauptaspekte der pädagogischpsychologischen Forschung. Als einen Aspekt sehen sie Lernen, Lehren und Entwicklung. Ein weiterer Aspekt beschreibt die soziokulturellen und interpersonalen Prozesse und Bedingungen des Lernens. Des Weiteren beschreiben sie individuelle Unterschiede zwischen den Lernenden. Auch das Lernen und Lehren in unterschiedlichen Inhaltsbereichen zählen sie zu den wichtigsten Inhalten. Zuletzt nennen sie Lehrerbildung und Bildungsplanung als wichtigen Bestandteil der pädagogischen Psychologie. Es lässt sich zusammenfassen, dass sich alle Inhalte der pädagogischen Psychologie mit dem Lernen und Lehren beschreiben lassen.
LERNTHEORETISCHE KONZEPTIONEN
In der Lerntheorie wird Entwicklung vorrangig als exogen gesteuert angesehen, was bedeutet, dass die Umwelt einen viel größeren Einfluss auf die Entwicklung hat als die biologischen Anlagen. Am wichtigsten sind hierbei die Lernerfahrungen mit der Umgebung. Die drei bedeutsamsten Lernformen sind hierbei die klassische und die operante Konditionierung sowie das Beobachtungslernen.
Klassische Konditionierung
Die klassische Konditionierung beschreibt die Koppelung von einer bereits bestehenden Reiz-Reaktions-Verbindung mit einem neuen Auslösereiz. Ein zu Beginn neutraler Reiz wird mehrmals mit dem anfänglichen Auslösereiz gekoppelt, woraufhin dann der Reiz die gleiche Reaktion auslöst. Als Beispiel kann hier eine Babyflasche als unkonditionierter Reiz gesehen werden, da bei ihrem Anblick beim Baby eine Saugreaktion ausgelöst wird. Wird nun ein neutraler Reiz, wie ein bestimmter Ton, mit dem ursprünglichen Auslösereiz gekoppelt, indem der Ton zeitnah zur Darbietung der Flasche erklingt, wird der neutrale Reiz zu einem konditionierten Reiz, welcher die konditionierte Reaktion, die Saugreaktion, ebenfalls auslöst.
Operante Konditionierung
Im Gegensatz zur klassischen Konditionierung gibt es beim operanten Konditionieren noch keine Reiz-Reaktion. Ein Individuum zeigt ein Verhalten, welches durch bestimmte Reaktionen, wie beispielsweise Belohnungen, aus der Umgebung verstärkt oder durch Konsequenzen bestraft wird. Aufgrund der Verstärkung zeigt das Individuum dieses Verhalten in Zukunft häufiger, um die Verstärkung erneut zu erhalten. Eine Verstärkung kann entweder kontinuierlich oder aber auch intermittierend erfolgen. Bei einer kontinuierlichen Verstärkung handelt es sich um eine Verstärkung, die immer sofort nach dem Auftreten des Zielverhaltens erfolgt.
Im Gegensatz dazu erfolgt die Verstärkung bei einer intermittierenden Verstärkung nur unregelmäßig und zufällig nach dem Auftreten des Zielverhaltens. Es lassen sich zwei Verstärkerformen unterscheiden: die primäre und die sekundäre Verstärkung. Primäre Verstärkungen finden unmittelbar statt. Sie können durch Süßigkeiten oder Lob erfolgen, wohingegen die sekundäre Verstärkung als Ersatz für primäre Verstärkungen dient. So kann beispielsweise Geld als sekundärer Verstärker dienen, um sich primäre Verstärker wie Süßigkeiten zu kaufen. Außer der positiven Verstärkung, bei der nach dem gezeigten Verhalten eine positive Konsequenz folgt, gibt es auch die negative Verstärkung, bei welcher auf das gezeigte Verhalten eine unangenehme Konsequenz ausbleibt.
Wie es bei der Verstärkung eine positive und eine negative Option gibt, gibt es diese auch bei der Bestrafung. Eine positive Bestrafung erfolgt, indem eine unangenehme Konsequenz eintritt. Dahingegen bleibt bei einer negativen Bestrafung eine angenehme Konsequenz aus. „Positiv“ bedeutet beim operanten Konditionieren also nicht etwa „gut“, sondern lediglich, dass eine Konsequenz, also entweder eine Belohnung oder eine Bestrafung, eintritt. „Negativ“ bedeutet in diesem Fall folglich das Ausbleiben einer bestimmten Konsequenz, also einer Belohnung oder eben auch einer Bestrafung.