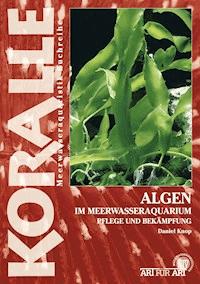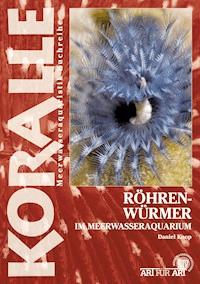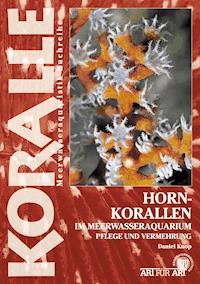9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wortschein Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein neuartiges Virus breitet sich in rasanter Geschwindigkeit aus. Die Welt steht am Rand des Abgrunds, während Krankenhäuser überquellen und Wissenschaftler fieberhaft nach einem Ausweg suchen. Im Zentrum der Katastrophe: Dr. Jakob Stein, Virologe und Wahrheitssucher wider Willen. Als er entdeckt, dass ein Pharmakonzern das Virus manipuliert hat, gerät er ins Visier mächtiger Gegner. Verleumdung, Hetzkampagnen und digitale Meinungskontrolle machen ihn zum Sündenbock – bis Stein alles verliert: seine Freiheit, seinen Ruf, beinahe sein Leben. Doch während draußen Menschen sterben, kämpft er um das, was wirklich zählt: Integrität, Verantwortung – und die Macht der Wahrheit. Ein hochaktueller Medizin-Thriller über Wissenschaft und Moral, über Verrat, Mut und die Kraft des Einzelnen, wenn die Welt ins Wanken gerät.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
PANDEMIE
DER PREIS DER WAHRHEIT
DANIEL KNOP
THRILLER
ISBN (Hardcover): 978-3-912028-24-9ISBN (E-Book): 978-3-912028-26-3
1. Auflage Oktober 2025
Covergestaltung: Nele Schütz Design, München
Lektorat: Michaela Neidl, Wien
Copyright © 2025 Wortschein Verlag
E-Mail-Adresse des Verlags: [email protected]
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Verlags vervielfältigt, in einem Datenabrufsystem gespeichert oder in irgendeiner Form oder mit irgendeinem Mittel – elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnungen oder auf andere Weise – übertragen werden, außer in Form von kurzen Zitaten, die in kritischen Artikeln oder Rezensionen eingebunden sind.
Der Inhalt dieses Werks ist frei erfunden. Alle Personen, Dialoge, Ereignisse sowie die dargestellten politischen Abläufe und Entscheidungen sind literarische Konstruktionen und nicht als Abbild tatsächlicher Prozesse oder Verantwortlichkeiten zu verstehen.
Reale Orte, Institutionen und Einrichtungen – darunter Städte, Behörden, Kliniken, Gefängnisse, Zeitungen oder andere Organisationen – erscheinen ausschließlich als atmosphärische Kulisse. Auch die wiedergegebenen Zeitungsberichte sind fiktiv und nicht in realen Medien erschienen.
Für Rosa
Prolog
Die Weinstube gehörte zu den ältesten in der Heidelberger Altstadt – ein Ort, an dem die Vergangenheit atmete und die Gegenwart für einen Augenblick innehielt. Mächtige Sandsteinmauern und dunkle Holzbalken schlossen den Raum ein wie ein Gewölbe, erfüllt vom schweren Duft nach Eiche und einem Hauch vergorener Süße. In den tiefen Fensternischen flackerten Kerzen, ihre Flammen zitterten, sobald ein Stoß kühler Abendluft durch die Ritzen drang. Draußen peitschte der Regen über das Kopfsteinpflaster, drinnen lagerte die Wärme wie ein weiches Tuch über den Gästen.
Jakob saß mit seinen Kollegen Paul und Martin am Tisch in der hintersten Ecke.
Der Spätburgunder in seinem Glas war tiefrot, doch er hatte kaum daran genippt, drehte das Glas, als könne er seine Gedanken dadurch ordnen.
Paul beugte sich vor, prostete ihm zu:
»H5N1, Vogelgrippe; das richtige Biest für dich. Ich wette, Whitmore hat dich längst angerufen.« Er grinste breit, hatte die Ärmel lässig hochgekrempelt. Früher hatten er und Jakob auf Madagaskar Flughunde gefangen, immer auf der Jagd nach neuen Viren. Heute war Paul Stratege bei einem Pharmariesen – und trug sein Selbstbewusstsein so selbstverständlich wie einen Maßanzug.
Jakob zuckte mit den Schultern, ließ den Wein im Glas weiter kreisen. »Sie wollen mich im Team.«
Er versuchte, beiläufig zu klingen, doch in seinem Magen zog sich alles zusammen.
Martin, der Jüngste, frisch habilitiert, sah von seinem Notizbuch auf.
»Worum genau geht’s?«
Jakob rieb sich die Stirn. »Die Verträglichkeit ist das Problem. Der Impfstoff steckt in einer Sackgasse – sie brauchen eine neue Richtung. Zwei Wochen geben sie mir.«
Paul ließ das Glas sinken. »Klingt doch perfekt für dich. Du hast immer an gefährlichen Viren gearbeitet – damals Nipah, später Covid. Warum zögerst du?«
Jakob hob den Blick, das Kerzenlicht spiegelte sich in seinem Glas. »Weil ich Whitmore kenne.«
Martin zog die Brauen hoch. »Misstraust du ihm?«
Jakob schüttelte langsam den Kopf. »Ich kenne ihn, seinen Ehrgeiz, seine Art, jede Leitplanke aus dem Weg zu räumen, wenn sie ihm nicht in den Kram passt. Vor zehn Jahren haben wir schon zusammen an Impfstoffen gearbeitet. Seine mehr als grenzwertigen Tierversuche haben mir damals schon Bauchschmerzen bereitet. Ehrgeiz wird bei ihm zu Visionen und Visionen zu Geschäftsmodellen. Und heute hat er noch mehr Macht als damals.«
Paul zuckte die Achseln, ließ den Wein träge kreisen. »Du redest von ihm wie von Blofeld aus dem James-Bond-Film. Whitmore ist Unternehmer. Ohne Leute wie ihn keine neuen Impfstoffe, kein Tempo. Ohne Risiko kein Fortschritt.« Seine Stimme war lässig, doch in seinen Augen lag der Schatten einer finsteren Ahnung.
Jakob roch an seinem Wein, nahm einen kleinen Schluck, schmeckte kaum etwas. »Irgendwann sucht die Forschung nicht mehr nach Wahrheit – sie dient nur noch dazu, Produkte zu entwickeln.«
Paul lehnte sich vor, die Ellbogen auf dem Tisch. »Forschung, die sich nicht rechnet, bleibt Spielerei für Akademiker, so ist es eben. Oder willst du weiter pipettieren, bis die nächste Pandemie vorbei ist?«
Jakob blickte auf den Tisch, sein Finger fuhr eine Spirale auf das Holz. Wissen ohne Haltung ist leer, hörte er die Stimme seines Vaters. Er sah Paul an, dann Martin.
»Irgendwann verschwimmt die Grenze zwischen Heilen und Verkaufen. Dann weißt du nicht mehr, warum du angefangen hast.«
Martin klappte sein Notizbuch zu, lehnte sich zurück.
»Wenn wir die Vogelgrippe stoppen können, bevor sie mutiert, sind wir es der Menschheit dann nicht schuldig?«
Seine Stimme war ruhig, aber darunter lag eine Spannung, die selbst Paul kurz innehalten ließ.
Jakob schwieg einen Moment, dann sagte er leise:
»Vielleicht. Aber wenn jemand mit dem Feuer spielt, will ich nicht daneben stehen – nicht wieder, nicht blind.«
Er blickte auf die flackernde Kerze.
»Ich war in Wuhan. Ganz am Anfang, bevor das Militär alles dichtgemacht hat.«
Stille. Nur das Knistern des Dochts.
»Ich habe gesehen, was passiert, wenn du zu spät bist. Wenn keiner hinschaut, weil alle glauben, die anderen machen das schon. Zwanzig Millionen Tote später will es keiner gewesen sein.«
Sein Blick wanderte von Paul zu Martin.
»Wenn es wieder passiert, und ich hätte es verhindern können – damit könnte ich nicht leben. Nicht noch einmal. Dafür habe ich diesen Beruf nicht gewählt.« Er dachte kurz an seine Schwester, an ihre Kinder, an die Patienten aus der Pandemie.
Martin beugte sich vor: »Dann sei dabei und pass auf, dass nichts schiefläuft. Das ist die einzige echte Option.«
Paul lachte leise, nickte und nahm einen Schluck Wein: »Jakob, geh in die Höhle des Löwen und trag die Fackel.« Sein Grinsen wurde fast ernst. »Aber pass gut auf, dass du nicht selbst Feuer fängst.«
Jakob sah ihn lange an, trank nachdenklich einen Schluck, atmete tief durch. Da veränderte sich etwas in seinem Gesicht, wie ein Entschluss, der Gestalt annahm. Langsam hob er sein Glas.
»Auf die Fackelträger«, sagte er leise. Der Satz klang entschlossener, als er sich anfühlte.
»Also fliegst du?« Paul grinste.
»Ich fliege.« Die Entscheidung lag jetzt offen im Raum.
Paul lachte und Martin griff nach seinem Glas, mit schmalem Lächeln. »Auf die, die Licht ins Dunkel bringen – und rechtzeitig den Stecker ziehen.«
Die Gläser stießen zusammen, ein leises Klingen in der warmen Nische.
Draußen trommelte der Regen ans Fenster. Jakob hielt das Glas einen Moment länger fest, hatte das Gefühl, dass ab jetzt nichts mehr so sein würde wie zuvor.
1
Die Altstadt lag still unter den Laternen; das Pflaster glänzte vom Regen. Jakob verließ die Weinstube als Letzter. Er war Anfang fünfzig, schmal, einsfünfundsiebzig groß; das Haar kurz, an den Schläfen bereits grau, der Vollbart sauber getrimmt. Hinter randlosen Gläsern wirkten seine Augen wach, trotz des langen Abends. Die Jacke stand offen über einem schlichten Hemd, dazu Jeans und unauffällige Schuhe – einer, der sich nicht über Kleidung definierte. Das Gespräch mit Paul und Martin arbeitete in ihm nach. Er schlenderte durch die engen Gassen, den Kragen hochgeschlagen, versuchte, seine Gedanken abzuschütteln. Vor einer Bäckerei blieb er kurz stehen, prüfte sein Spiegelbild in der dunklen Scheibe: müde, ein Hauch älter, als er sich fühlen wollte. Er grinste kurz – ein Versuch, sich selbst zu versichern, dass alles halb so wild war.
Zu Hause warf er Jacke und Tasche auf einen Stuhl, stieß sich den Fuß an der Kante des Couchtischs und fluchte leise. Der Alltag war nicht aus Filmstoff gemacht. Auf dem Schreibtisch: Papiere, Laborprotokolle, ein halb aufgeklapptes Dossier von Whitmore. Das Logo sah aus wie das Siegel eines Geheimbunds – oder war das nur der Wein von vorhin?
Jakob griff nach dem Koffer, der seit Wochen halb gepackt im Flur stand, sortierte zwei Hemden, ein Notizbuch, steckte dann doch noch ein Taschenmesser dazu. Irgendwas zum Festhalten. Zum dritten Mal kontrollierte er seinen Reisepass. Routine wie Zähneputzen; wenn man ehrlich war, ein kleines Ritual gegen die Angst.
Das Handy vibrierte. Ellen. Ihr Name leuchtete auf dem Display, und er musste lächeln.
»Ich hab schon auf deinen Anruf gewartet.«
»Dachte ich mir«, kam es zurück. »Gibt’s noch Tee oder hast du schon alles kalt werden lassen?«
»Steht neben mir, schmeckt wie Spülwasser.«
»Typisch. Jakob, du bist der einzige Mensch, der Tee zubereiten kann, der schon vor dem Trinken tot ist.«
Er lachte leise. »Ich fliege übermorgen. Die Entscheidung ist gefallen.«
»Klar, war ja nicht anders zu erwarten.«
Sie machte eine kurze Pause, dann, ein bisschen ernster: »Du weißt, dass du dich auf dünnem Eis bewegst, oder?«
»Eis? Das ist eher ein Balanceakt auf nassem Linoleum.«
Sie lachte. »Immerhin bist du gelenkig. Pass auf dich auf, ja?«
»Ich geb mir Mühe. Whitmore hat alles organisiert. Sogar Business Class. Ich nehme an, er will mich bei Laune halten.«
»Vorsicht, sonst hält er dich bald an der Leine. Und: Denk dran, da drüben spielen sie nicht fair.«
»Ich weiß, worauf ich mich einlasse.«
»Sicher? Oder sagst du das nur?« Kurze Pause. »Ich kenn dich. Du wirfst dich immer in die Bresche, auch wenn niemand darum bittet.«
»Ich kann nicht anders. Aber vielleicht ist das ein Fehler.«
»Oder das, was dich ausmacht.« Ellen schwieg. Dann, fast zärtlich: »Versprich mir eins: Wenn du schon nach New York fliegst, sieh dir wenigstens ein bisschen was von der Stadt an. Geh in den Central Park. Atme durch. Du kannst nicht immer die Welt retten.«
Ein müdes Lächeln. »Ich werde es versuchen.«
»Versprechen, Jakob.«
Er zögerte. »Ich verspreche, dass ich es versuche.«
»Hoffnungslos. Darum hab ich mich ja von dir scheiden lassen …«
Dann, beinahe flüsternd: »Jakob, wenn etwas schiefgeht, ruf mich an. Bevor du irgendwas unterschreibst. Vergiss nicht: Ich bin nicht nur dein Lieblingsproblem. Ich bin auch immer auf deiner Seite.«
»Versprochen. Wenn ich das Gefühl hab, ich werde Teil von etwas, das ich nicht mehr steuern kann, dann meld ich mich.«
Er legte das Handy zur Seite. Die Stille im Zimmer fühlte sich jetzt anders an als zuvor.
Zwei Tage später ging Jakob durch die Abflughalle des Frankfurter Flughafens und zog seinen Koffer hinter sich her. Die Gänge waren voller Menschen, doch die Atmosphäre blieb gedämpft – geschäftig, aber ruhig. Lautsprecherdurchsagen verschwammen zu einem unverständlichen Hintergrundrauschen. Überall hasteten Menschen an ihm vorbei, jeder in seiner eigenen Geschichte gefangen.
Ihm selbst war, als liefe sein Leben für einen Moment auf Standby, während ringsum alles raste. An der Sicherheitskontrolle legte er seinen Laptop und die Dokumentenmappe in die Plastikwannen. Der Sicherheitsbeamte musterte ihn nur flüchtig, dann wanderte Jakobs Blick weiter, ins Unbestimmte. Alles fühlte sich plötzlich surreal an. Er fragte sich, ob die Mitarbeiter hier überhaupt wahrnahmen, dass jeder Abschied anders roch – oder ob sie irgendwann abstumpften, weil die Geschichten der Reisenden immer gleich begannen und endeten.
Als die Stimme der Durchsage ihn in die Wirklichkeit zurückholte, griff er nach seinem Pass.
»Flug LH 501 nach New York, letzter Aufruf – flight LH 501 to New York, final boarding call.«
Jakob atmete tief durch. Jetzt gab es kein Zurück mehr.
Im Flugzeug suchte er seinen Platz am Gang. Fenstersitze interessierten ihn nicht. Am Gang zu sitzen bedeutete für ihn Bewegungsfreiheit, Kontrolle, auch wenn das ein bisschen albern war. Wahrscheinlich war das ein Rest Fluchtinstinkt aus Kindertagen – immer lieber am Rand, falls es ernst wurde.
Die Maschine hob ab. Er spürte das Zittern des Fliegers, das dumpfe Dröhnen der Turbinen. Für einen Moment ließ er die Augen geschlossen. In seinem Kopf hallte ein Satz nach: »Wir brauchen dich, Jakob.«
Er versuchte, sich auf das Buch zu konzentrieren, das auf seinen Knien lag: »Virale Genom-Editierung: Werkzeuge, Methoden, Konsequenzen.« Er las einen Absatz, aber die Worte perlten an ihm ab. Typisch, dachte er. Viren konnte er ordnen, aber nicht die eigene Unsicherheit. Dafür gab es kein Schema.
»Bist du ein Wissenschaftler?«
Jakob drehte den Kopf nach rechts. Ein kleines, dunkelhäutiges Mädchen mit großen, braunen Augen sah ihn an – vielleicht acht Jahre alt, die Haare zu zwei Büscheln gebunden wie Micky-Maus-Ohren. Sie hielt sich an der Armlehne fest und musterte ihn neugierig.
»Ja, das bin ich.« Jakob lächelte. »Wie kommst du darauf?«
»Weil du so aussiehst.« Das Mädchen nickte ernst. »Mein Papa ist auch Wissenschaftler. Der liest auch immer Bücher und macht beim Nachdenken so Falten auf der Stirn.«
Jakob zog unwillkürlich die Stirn kraus. Vielleicht lag es einfach daran, dass Wissenschaftler nie genug schliefen. Aber sie wusste wohl, wovon sie sprach.
»Eine nachdenkliche Stirn?«
Das Mädchen demonstrierte es, zog ihre Augenbrauen zusammen, und Jakob musste lachen.
»Das hast du ziemlich gut beobachtet. Du musst mir deinen Papa mal vorstellen.«
»Er ist nicht hier. Er ist zu Hause in New York.«
Jakob sah zu der Frau, die neben ihr saß – offenbar die Mutter. Sie hatte ebenfalls dunkelbraune Haut, ein sehr schönes Gesicht und das gleiche krause, schwarze Haar. Um den Hals trug sie eine goldene Halskette mit einem kleinen Kreuz daran. Ihre Augen waren geschlossen, und sie wirkte, als hätte ihr der Flugzeugstart Beschwerden bereitet.
»Und was macht dein Papa für eine Wissenschaft?«
»Mein Papa erforscht Pflanzen. Und du?«
»Viren«, sagte er und zuckte mit den Schultern.
Das Mädchen verzog das Gesicht. »Mag ich nicht.«
Jakob musste grinsen. Inzwischen kam er mit Viren besser zurecht als mit den meisten Menschen. Er setzte zum Erklären an, wie faszinierend Viren sein konnten – aber das Mädchen war schon wieder bei seiner Puppe.
Ihm selbst fehlte diese Fähigkeit, die Dinge einfach stehenzulassen. Bei ihm musste alles analysiert, auseinandergenommen, hinterfragt werden.
Einige Buchseiten später war das Mädchen eingeschlafen, als das Flugzeug plötzlich ruckelte. Jakob spürte das abrupte Absinken in der Magengegend, wie in einem Fahrstuhl, der ruckartig nach unten saust.
Das Mädchen klammerte sich an seine Armlehne, schlug kurz die Augen auf.
»Was war das?«
»Turbulenzen«, erklärte Jakob ruhig. »So etwas passiert manchmal, wenn das Flugzeug durch unterschiedliche Luftströme fliegt.«
»Ist das gefährlich?«
»Nein, überhaupt nicht. Flugzeuge sind dafür gebaut.«
Ein zweites, stärkeres Rucken ließ die Kabine erzittern. Die Mutter öffnete die Augen, sah sich erschrocken um.
»Alles in Ordnung?« fragte Jakob.
»Mir wird schnell übel beim Fliegen.« Sie presste eine Hand auf ihren Bauch, sah ihn kurz an.
Die Lichter flackerten kurz, eine Durchsage folgte:
»Bitte bleiben Sie angeschnallt. Wir durchfliegen eine kurze Zone mit Turbulenzen.«
Jakob legte beruhigend die Hand auf die des Mädchens. »Wir fallen nicht, das fühlt sich nur so an. Wie auf einer Achterbahn.« Insgeheim dachte er, dass auch wissenschaftliche Karrieren so verliefen – mal ein Aufstieg, dann ein freier Fall, immer mit dem Risiko für Übelkeit.
Das Mädchen nickte zögernd, aber die Augen blieben groß.
Jakob griff nach der Wasserflasche, reichte sie der Mutter. »Hier, das hilft manchmal.«
»Vielen Dank.« Sie nahm einen Schluck, versuchte ein Lächeln.
»Es tut mir leid, wenn wir Sie gestört haben.«
»Kein Problem«, sagte Jakob. »In einem Flugzeug sitzen wir schließlich alle im selben Boot.«
Jakob zwang sich zu einem Lächeln, spürte aber, wie sehr Nähe ihn immer noch anstrengte.
Später, als das Mädchen eingeschlafen war, blickte Jakob in die Dunkelheit der Kabine. Die Sitze um ihn waren ruhig, die meisten Passagiere versunken in Filme oder Schlaf. Nur das Klappern eines Besteckwagens in der Ferne erinnerte daran, dass noch jemand wach war. Man hörte das Husten eines älteren Mannes zwei Reihen weiter hinten. Ein Kind schrie in der Economy, dann wieder Stille.
Fliegen, dachte er, sollte irgendwann Routine werden. Aber jedes Mal, wenn die Welt draußen nur noch aus Lichtpunkten bestand, fühlte er sich wie ein Statist, der nicht sicher war, ob er im richtigen Film gelandet war.
Er fragte sich, ob irgendetwas von dem, was ihn hierher trieb, wirklich einen Unterschied machte – oder ob es am Ende nur ein weiteres Kapitel war im endlosen Versuch, die Welt zu begreifen.
Als der Pilot den Sinkflug ankündigte, spürte Jakob eine Mischung aus Erleichterung und Anspannung. In der Ferne zeichnete sich New York ab, eine Stadt, die keine Ruhe kannte. Was ihn in New York erwartete, lag im Dämmerlicht. Aber diesmal ahnte er, dass er nicht der Einzige war, der etwas zu verlieren hatte.
2
Jakob trat ans Fenster. Unten zog das Straßenleben still vorbei, als gehörte es zu einer anderen Welt. Er war in der Whitmore Research Residence untergebracht, einem glatten, makellosen Wohnkomplex für Gastwissenschaftler, Doktoranden, Projektleute auf Zeit. Funktional, steril, lautlos. Einer jener Orte, die einen mit jeder Faser daran erinnerten, dass man nur vorübergehend hier war.
Geschlafen hatte er kaum, war früh aufgewacht. Der Morgen tastete sich langsam über New York City, ein schimmernder Schleier aus Gold und Grau. Die Dämmerung wich dem Tag, und mit jedem Sonnenstrahl, der sich zwischen den Hochhäusern hindurchschob, wurde die Stadt lebendiger.
Unter ihm entfaltete sich Manhattan als Mosaik aus Glas, Stahl und Bewegung. Der Central Park lag dunkel und still in der Ferne, ein Rechteck der Ruhe zwischen den senkrechten Linien. Doch schon jetzt füllten sich die Straßen.
Jogger in grellen Sportoutfits zogen an dampfenden Gullydeckeln vorbei. Lieferwagen drängten sich hupend durch enge Fahrbahnen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite öffnete ein Kaffee-Kiosk die Klappe. Dampfender Espresso rann in Pappbecher, während Büroangestellte geduldig warteten.
Jakob öffnete das Fenster einen Spalt. Sofort schlug ihm der typische Geruch der Stadt entgegen: warmer Asphalt, Abgase, die würzige Note frisch gerösteter Bagels. Eine Mischung aus Versprechen und Erschöpfung.
Das rhythmische Klackern von Absätzen auf dem Bürgersteig verschmolz mit dem dumpfen Rattern der U-Bahn, die unsichtbar unter der Erde fuhr. In der Ferne heulte eine Sirene, kurz, eindringlich, wie ein Echo aus einem anderen Leben.
Eine Frau im orangefarbenen Hosenanzug überquerte die Straße, den Blick fest auf ihr Smartphone geheftet. Daneben schob ein Straßenverkäufer seinen Hotdog-Stand an den Bordstein. Aus dem brodelnden Wasser stiegen Dampfwolken.
In einem Café mit bodentiefen Fenstern saß ein älterer Mann, zerzaustes Haar, die Stirn über die New York Times gebeugt. An den Nachbartischen diskutierten Studenten mit Laptops, laut, energiegeladen, als ließe sich die Welt mit Worten reparieren.
Jakobs Blick glitt weiter, über eine endlose Schlange gelber Taxis, die Stoßstange an Stoßstange die Fifth Avenue entlangkrochen. New York verlangte Bewegung. Rastlos. Atemlos. Und irgendwo dazwischen sollte er eine Antwort finden.
Er atmete tief durch.
Die Morgensonne spiegelte sich in der Glasfassade des gegenüberliegenden Hochhauses, warf helle Reflexe in sein Zimmer.
Das war New York. Unnachgiebig, fordernd, aber auch faszinierend.
Heute würden Antworten kommen – oder neue Fragen.
Er duschte, schlüpfte in seinen dunklen Anzug, notierte ein paar Gedanken in sein Notizbuch, griff nach dem alufarbenen Aktenkoffer und machte sich auf den Weg zum Hauptgebäude.
Der Empfang war repräsentativ, aber unaufdringlich. Keine grellen Logos, kein Lärm, sondern Eleganz in Glas und gebürstetem Stahl. Ein großzügiger Empfangsbereich öffnete sich hinter automatischen Türen, in sanftes Licht getaucht. Die Luft roch nach Zitrus und feinem Holz.
Hinter dem weißen, geschwungenen Tresen saß eine junge Frau – dunkelhäutig, elegant gekleidet, mit zurückgebundenem Haar und aufmerksamem Blick. Sie schenkte den Eintretenden ein offenes, professionelles Lächeln, das selbst den angespanntesten Besucher kurz entwaffnete.
Ihr Namensschild blinkte dezent auf dem Jackett: Whitmore Pharmaceuticals – Welcome.
Neben der Rezeption standen frische Blumen in klaren Glasvasen, auf dem polierten Boden spiegelten sich die Bewegungen der Ankommenden.
Ein junger Assistent kam hinzu, Headset am Ohr, Tablet in der Hand. Er nickte der Rezeptionistin freundlich zu und wandte sich dann Jakob mit diskreter Höflichkeit zu. Alles wirkte geübt, durchdacht – und doch warm.
»Der CEO ist gleich bei Ihnen«, sagte er, mit einem Tonfall, der keine Fragen zuließ.
Jakob spürte die Kühle des Orts wie einen Luftzug im Nacken. Alles hier war durchgetaktet – kein Raum für Zufall, keine Spur von Öffentlichkeit. Eine Welt der Kontrolle, wie sie nur hinter Glasfassaden existierte.
Er führte Jakob durch eine Zwischentür, die sich lautlos öffnete. Der Raum dahinter war riesig – nicht Büro, eher ein Bühnenbild. Ein großer Schreibtisch aus Glas, makellos. Kein Papier, nur ein schlanker Computermonitor und ein einzelner, hochglanzpolierter Kugelschreiber, parallel zur Tischkante ausgerichtet. Daneben eine Skulptur: ein stilisierter DNA-Doppelstrang aus gebürstetem Stahl. Elegant, aber verstörend; wie ein Artefakt aus einer Zukunft, die uns Menschen nicht braucht.
An der Wand gegenüber: eine Sitzgruppe aus schwarzem Leder, zu symmetrisch, um einladend zu wirken. Daneben ein Regal, randvoll mit Fachbüchern – Immunologie, Molekularbiologie, klinische Studien. Dazwischen eine einzige Lücke. Leer. Als hätte jemand etwas entfernt, das besser nicht mehr da ist.
Ein abstraktes Gemälde dominierte die Stirnseite: flammende Rottöne, aggressive Linien. Ordnung. Kontrolle. Und ein Hauch Eitelkeit.
Jakob ging langsam an der linken Wand entlang. Gerahmte Fotos: Whitmore mit einem US-Präsidenten. Whitmore bei einer Impfstoffankündigung. Whitmore bei einer Laboreröffnung in Singapur. Und dazwischen ein einzelnes Bild, das nicht passte: Ein Kind mit Glatze, auf einem Krankenhausbett. Ein Lächeln, das nicht echt war. Kein Text, kein Rahmen. Nur der Blick. Direkt, traurig, still.
»Erinnerungen …«, murmelte Jakob.
»Motivationen«, sagte eine Stimme hinter ihm.
Whitmore war lautlos durch eine Seitentür getreten. Jakob zuckte nicht zusammen, aber er fühlte die Anspannung. Whitmore trat nicht in einen Raum – er übernahm ihn. Diese Art von Präsenz war Jakob nie geheuer gewesen.
»Entschuldige«, sagte Whitmore. »Ich hatte noch ein Gespräch mit Seoul. Manche Dinge laufen schneller, als sie sollten.«
»Oder schneller, als sie dürfen?«, entgegnete Jakob ketzerisch, ohne sich umzudrehen.
Whitmore lächelte, ging zum Schreibtisch und nahm im lederbezogenen Stuhl Platz. Eine Bewegung wie ein Statement. Dann deutete er auf den Sessel gegenüber.
»Was wäre Wissenschaft ohne Grenzbereiche?«
Jakob setzte sich. »Was wäre sie ohne Verantwortung?«
»Ohne Verantwortung ist Tempo nur Rausch. Mit Verantwortung wird es Fortschritt.«
Whitmore war ein Mann knapp unter zwei Metern. Massiv, aber nicht unbeweglich. Seine Schultern wirkten breit gebaut, nicht trainiert. Der Anzug saß tadellos, doch der Gürtel spannte über dem Bauch. Das schüttere Haar war zurückgekämmt, die Schläfen gezeichnet von feinen Äderchen. Übergewicht, Hypertonie, beginnende arterielle Veränderungen, dachte Jakob, automatisch. Er hatte sich das nicht abgewöhnen können – ein Überbleibsel aus Jahren klinischer Praxis. Als würde sein Blick sich gegen seinen Willen durch die Oberfläche bohren.
»Jakob! Mein lieber Freund, willkommen in meinem kleinen Reich.«
Die Stimme war tief, beinahe dröhnend. Die ausgestreckten Arme weit, lang, aber etwas zu herzlich für die Stimmung im Raum, eine Geste, die spielen wollte. Ein leiser Widerstand regte sich in Jakob.
»Charles. Danke für den Empfang. Ich hoffe, ich kann helfen. Die Lage scheint ernst.«
»Ernst, ja.« Whitmore lachte kurz, zu laut, und zog ein Stofftaschentuch aus der Brusttasche, um sich beiläufig die Stirn zu tupfen. »Aber nicht aussichtslos. Du bist mit Deinen Erfahrungen genau der Richtige für unser Projekt. Zusammen können wir die Kurve noch kriegen. Aber die Luft ist dünn, sonst hätten wir nicht Dich aus Europa hierher geholt.«
Einen Moment lang war es still. Dann beugte sich Whitmore leicht nach vorn. Seine Stimme wurde weicher.
»Wir stehen an einem Punkt, Jakob«, sagte er, »an dem die Biologie uns nicht mehr fragt, ob wir bereit sind. Sie geht einfach weiter. Und sie wird uns überrollen, wenn wir nicht schneller sind.«
Jakob antwortete ruhig: »Ich bin hier, um eine Pandemie zu verhindern. Das ist meine Priorität.«
Whitmore sah Jakob direkt in die Augen. »Ganz genau, das ist unsere Priorität.«
Er drückte auf ein kleines weißes Gerät auf dem Schreibtisch. Sekunden später öffnete sich die Tür.
Dr. Richard Collins trat ein. Anfang vierzig, tadelloser Anzug, das Haar sorgfältig zurückgestrichen, jede Bewegung präzise. Kein Zögern, kein Zucken, keine Geste zu viel. Er wirkte wie jemand, der sein Umfeld lieber kontrollierte als überrascht zu werden. Jakob musterte ihn mit klinischer Nüchternheit. Da war nichts Spielerisches, nichts Unberechenbares. Alles an Collins war Form – wie ein Instrument, das nur das spielt, wofür es gebaut wurde. Und genau das machte ihn gefährlich.
Collins hätte es nie zugegeben, aber alles an ihm trug den Schatten seines Vaters – brillanter Jurist, analytisch, übermächtig, das Maß, an dem er selbst sich abarbeitete. Der Vater hätte ihn lieber im Gerichtssaal gesehen. Collins aber hatte Pharmazie studiert. Nicht aus Liebe zur Wissenschaft, sondern eher aus Strategie. Um schneller zu glänzen, um dem Vater zu beweisen, dass auch andere Wege an die Spitze führten.
Doch irgendwo, tief in ihm, hatte es einmal etwas Echtes gegeben: den Wunsch, Krankheiten zu verstehen, zu heilen. Die Überzeugung, dass ein Manager nur dann gute Entscheidungen treffen kann, wenn er weiß, was in der Pipette ist. Vielleicht war das naiv gewesen. Aber ganz losgelassen hatte er diesen Gedanken nie.
»Dr. Stein. Willkommen.«
Der Händedruck war fest, sachlich. Jakob spürte, wie wenig Raum hier für echtes Gespräch blieb. Collins wollte Daten, Ergebnisse, Lösungen – keine Diskussionen.
Whitmore sah Jakob an. »Collins ist meine rechte Hand. Er kennt jede Facette des Projekts.«
Collins nickte knapp, den Blick auf Jakob fokussiert.
»Unser Hauptproblem ist die Verträglichkeit. Es gibt Reaktionen, die wir nicht vollständig verstehen. Manchmal denke ich, wir waren zu schnell.«
»Welche Reaktionen?«, fragte Jakob.
»In Tierversuchen kam es zu Thrombosen«, sagte Collins. »Und zu neurologischen Effekten. Lähmungen im Gesicht. Wir vermuten eine Reizung eines Hirnnervs.«
Seine Stimme blieb ruhig, doch Jakob hörte das leichte Zögern.
»Und Sie wissen nicht, ob das am Trägervirus liegt oder an der genetischen Information des H5N1?«, fragte er.
Collins schüttelte leicht den Kopf. »Noch nicht. Es könnte sein, dass sich das Virusmaterial beim Kontakt mit menschlichem Gewebe verändert – oder dass es eine unerwartete Reaktion auslöst.«
»Also eine Immunantwort, die entgleist.«
Collins nickte. »Genau deshalb brauchen wir Ihre Einschätzung.«
Jakob trat einen Schritt zur Seite, senkte den Blick kurz, als wolle er sich innerlich sortieren.
Dann sah er Collins wieder an – lange genug, dass es leicht unangenehm wurde. Er wollte nicht nur eine Antwort hören, sondern auch wissen, wie sehr Collins sie selbst glaubte.
»Ich muss mir die Daten ansehen.«
»Jakob«, warf Whitmore ein, mit einer beschwichtigenden Geste, die mehr auf Außenwirkung als auf Dialog zielte. »Die Details später. Jetzt brauchen wir pragmatische Lösungen.«
Jakob hielt seinem Blick stand. »Diese Details entscheiden, in welcher Richtung wir arbeiten müssen.«
In diesem Moment öffnete sich die Tür. Eine Frau trat ein – Ende dreißig, asiatische Gesichtszüge, ihr dunkles Haar zum Pferdeschwanz gebunden, in der Hand eine grüne Mappe. Ihre Bewegungen waren ruhig, kontrolliert, ohne Eile. Und doch hatte Jakob das Gefühl, dass sie schneller denken konnte, als sie sprach.
»Dr. Stein? Janet Mei Liu. Willkommen.« Ihre Stimme klang fokussiert, klar, fast tonlos. Ihr Händedruck war einen Hauch wärmer als der von Collins, nicht freundlich – aber offen. Ein flüchtiger Blickkontakt blieb einen Herzschlag zu lange bestehen. Sie führte ihn zu einem Terminal, berührte Display und Tastatur mit der Leichtigkeit einer Pianistin. Diagramme und Kurven erschienen auf dem Bildschirm.
Jakob trat näher, verschränkte die Arme, nahm den Bildschirm fast körperlich in sich auf.
»Diese Thrombosen – wann genau traten sie auf? Und bei welchen Tieren?«
»Frettchen. Meist innerhalb der ersten 24 Stunden.« Janet blätterte beiläufig in der Mappe.
Jakob nickte langsam. »Das ist sehr schnell. Könnte auf eine überzogene Immunreaktion hindeuten. Gibt es Hinweise auf Gerinnungsstörungen?«
Collins trat näher. »Einige Tiere zeigten Anzeichen für beginnende Blutgerinnsel. Aber wir haben keine spezifischen Tests gemacht.«
Jakob runzelte die Stirn. »Keine Tests auf typische Impfreaktionen?«
Collins zögerte. Nur eine Sekunde – aber lang genug, dass Whitmore unruhig den Fuß wechselte.
»Nein.«
Whitmore trat einen Schritt näher. »Was schlägst du vor, Jakob? Wir stehen unter Druck. Wir brauchen Ergebnisse.«
Jakob ließ sich nicht beirren. Seine Stimme blieb ruhig.
»Ich muss wissen, was die Reaktionen auslöst. Liegt es am Träger? Oder am Virus selbst?«
Janet klickte sich weiter durch die Daten. »Wir haben einen bekannten Virustyp als Träger verwendet. Ein Teil der Versuchstiere hatte bereits Kontakt damit.«
Jakob lehnte sich leicht zurück, als wolle er Abstand zur Oberfläche gewinnen.
»Das könnte eine Rolle spielen. Vielleicht sollten wir einen anderen Trägertyp verwenden. Und das H5N1-Genom muss genauer untersucht werden.«
Bei diesen Worten wirkte Collins plötzlich angespannt. Die Muskeln in seinem Kiefer bewegten sich minimal. Jakob spürte, wie sich hinter der Maske des professionellen Ausdrucks ein innerer Druck aufbaute. Collins wusste mehr, als er sagen wollte.
»Wir haben es sequenziert. Aber einige Abschnitte ließen sich nicht eindeutig zuordnen. Es gab Auffälligkeiten.«
Jakob hob langsam den Kopf. »Was für Auffälligkeiten?«
Er antwortete, leise, aber glasklar: »Mutationen. Veränderungen, die im Ursprungsvirus nicht enthalten waren.«
Für einen Moment war es im Raum still.
Jakobs Blick wurde hart. »Wurde das Genom verändert?«
Whitmore blieb reglos. »Jakob, bitte. Das sind Standardverfahren.«
Langsam richtete sich Jakob auf, ohne Hast. »Ich hoffe, das stimmt. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Ein sehr großes.«
Er sah Janet an. Sie erwiderte seinen Blick – ruhig, unerschrocken. Dann sagte sie: »Ich verschaffe Ihnen Zugang zu allen Daten, Dr. Stein.«
Jakob nickte, aber als er den Raum verließ, befürchtete er, dass irgend etwas nicht stimmte. Es war die Inszenierung. Die Makellosigkeit. Whitmores zu herzliche Miene. Zu einladend, fast flehend. Er hatte diesen Ausdruck schon einmal gesehen – bei Klinikdirektoren, die wussten, dass ihre Studien kurz vor dem Abbruch standen. Bei Menschen, die sich nicht mehr sicher waren, ob sie überzeugt waren – oder einfach nur verzweifelt. Er kannte die Risse, bevor sie sichtbar wurden: erst die Sprache, dann die Daten, zuletzt die Gesichter. Was verbarg sich hinter dieser perfekten Fassade?
Er trat an die Glasbrüstung des Flurs, blickte auf das flirrende Muster der Stadt. H5N1 – jeder Virologe wusste, was auf dem Spiel stand. Ein kleiner Fehler, und alles geriet außer Kontrolle. Vertrauen war hier keine Währung. Er brauchte Zugang, Fakten, jeden Datensatz. Vielleicht wäre Janet der Schlüssel.
Am nächsten Morgen holte ihn ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes ab: dunkler Anzug, mit Zugangskarte und einem Lächeln, das nicht bis zu den Augen reichte. Wortlos fuhren sie zwei Etagen unter Straßenniveau.
Das Labor war abgeschirmt: eigene Belüftung, eigene Stromversorgung, Zutritt nur durch eine Schleuse. Isoliert und kontrolliert wie ein Atom-U-Boot.
»Bitte hier«, sagte der Mann und deutete auf eine matte Glasfläche.
Jakob legte die Hand auf, ließ seine Iris scannen. Ein weicher, synthetischer Ton bestätigte die Freigabe. Die Tür glitt lautlos zur Seite, ein Hauch ozoniger Kühle strich ihm über das Gesicht.
Hinter der Schleuse lag gefilterte, beinahe geruchlose Luft – wie kurz vor dem Start im Flugzeug. Die Luft hatte keine Geschichte; alles Persönliche blieb am Filter hängen. Keine Fenster, keine Uhren. Jakob atmete flacher, passte sich der künstlichen Klarheit an. Ihm war das nicht unbekannt, Sicherheitslabore waren sein Zuhause. Es erinnerte ihn immer etwas an einen OP-Saal: akkurate Temperatur, unsichtbare Sterilität.
Dr. Janet Mei Liu wartete bereits. Mittelgroß, das dunkle Haar zu ihrem präzisen, hübschen Pferdeschwanz gebunden, eine schlichte Brille mit dunklem Rahmen. Ihre Haltung: klar, fokussiert. Kein Zögern, kein Spiel.
»Dr. Stein. Willkommen.« Ihr Tonfall war makellos neutral.
»Dr. Liu.« Sie schüttelten einander die Hand. Ihr Griff war fest, sachlich. Nicht kalt, aber effizient.
»Mr. Whitmore sagte, Sie möchten sich einen Überblick verschaffen. Ich führe Sie durch die Plattform.«
»Das wäre hilfreich.«
Auf beiden Seiten hinter den Scheiben: Labore. Zellkulturstationen. Flüssigchromatographen. Kühlschränke mit rot leuchtenden Displays. Menschen in weißen Kitteln, fast alle mit Headsets, viele ohne Blickkontakt, wie in einer stillen Choreografie. Alles wirkte perfekt eingespielt.
Er blieb vor einem Monitor stehen, auf dem eine animierte Virusstruktur rotierte. Die Proteine wirkten wie winzige Maschinen – symmetrisch, gefährlich schön; die Proteine saßen wie exakt gefräste Schnapphaken.
Er sagte leise: »Das da – was genau sehe ich?«
Janet trat neben ihn. »Ein Strukturmodell eines Virus. Eine der neueren Varianten. Noch nicht publiziert.«
Sie passierten einen Arbeitsbereich, in dem unter Schutzbedingungen pipettiert wurde. Jakob sah die Hände der Forscher: ruhig. Die Bewegungen wirkten wie eingeübt – keine Unsicherheit, kein Überlegen. Aber es war nicht die Arbeit, die ihn stutzig machte. Es war die Architektur. Die vielen Luftschleusen. Die Sicherheitszonen, die selbst für ein BSL-3+-Labor ungewöhnlich waren.
»Wie viele im Kernteam?«, fragte er.
»Acht fest angestellte Wissenschaftler, drei Assistenzen, zwei technische Leiter, dazu rotierende Kräfte aus Partnerinstituten.«
»Bekomme ich Einblick in die Rohdaten?«
Sie blieb kurz stehen. Es war kein Zögern, sondern ein Abwägen. »Das ist im Gespräch. Mr. Whitmore möchte Ihnen Zugriff gewähren, sobald die internen Prüfprozesse durch sind. Vorläufig erhalten Sie Zusammenfassungen, Auszüge.«
»Das ist ein Anfang«, sagte Jakob. Aber kein idealer, dachte er.
Am Ende des Gangs blieb sie stehen. »Hier ist Ihr Raum.«
Ein kleiner Arbeitsbereich. Zwei Monitore, ein Whiteboard, ein Terminal. Frischer Kunststoffgeruch, wie bei neuen Möbeln. Noch unberührt. Räume sagen, was sie erlauben. Dieser erlaubte nichts.
»Wenn Sie etwas brauchen, geben Sie mir Bescheid.«
Jakob drehte sich zu ihr. »Darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen, Dr. Liu?«
»Wenn ich nicht antworten will, sage ich es.«
»Glauben Sie an das, was Sie hier tun?«
Einen Moment war es still. Dann: »Ich glaube an Fortschritt.«
Sie machte eine knappe Bewegung nach rechts, ihre Finger deuteten in eine Richtung. »Bevor Sie loslegen, sollten Sie das hier sehen.«
Sie wandte sich ab, ging voraus. Ihr Gang war ruhig, entschlossen – eine Selbstverständlichkeit in der Bewegung, die Jakob kurz fesselte.
»Willkommen auf Plattform C«, sagte sie mit einem kaum merklichen Lächeln. »Offiziell: der modernste Bereich unserer Impfstoffentwicklung. Hier wird momentan mit dem Influenza-A-Stamm gearbeitet, der das Immunsystem so ungewöhnlich stark aktiviert, dem H5N1. Hier versuchen die Kollegen, die Immunantwort gezielter zu lenken – Ihr Arbeitsfeld. Ich selbst bin in diese Forschungsarbeiten nur am Rande involviert, kann Ihnen nur einen Überblick über das Datenmaterial und die bisherigen Ergebnisse geben.«
Der Raum war kühl und fensterlos. Monitore an den Wänden, in der Mitte ein Dashboard mit Echtzeitdaten zur Antikörperbildung. Leises Summen, irgendwo ein Ticken. Zeit gab es hier nur als Prozess, nicht als Stunde. Jakob hatte mit Biobänken und Zellkulturen gerechnet – stattdessen: Datentechnik, Steuerung, Kontrolle.
»Also die Kommandozentrale?«, fragte er.
»Wenn man so will. Hier laufen Daten, Simulationen, Versuchsergebnisse zusammen.«
Sie gingen langsam zwischen den Arbeitsinseln hindurch. An einigen saßen Laborkräfte mit Kopfhörern, versunken in Bildschirme. Der Duft von Kaffee mischte sich mit dem sterilen Geruch frisch gewischten Kunststoffs. Kein Lachen, kein Flüstern – nur das leise Klicken von Tastaturen und das rhythmische Brummen eines Servers im Hintergrund.
»Plattform C entstand vor acht Monaten, innerhalb von sechs Wochen«, sagte Janet. »Personal, Technik, Freigaben. Whitmore wollte Tempo«.
»Und der Name Plattform C?«
»Plattform A und B waren Vorprojekte«, sagte Janet. »Andere Viren, andere Strategien. Dies hier war die dritte, also C.« Sie zuckte leicht mit den Schultern, ein angedeutetes Lächeln, das in ihren Augen einen Moment länger blieb. »Nicht besonders kreativ, ich weiß.«
»Gibt es Aufzeichnungen aus der Zeit davor? Aufbau, erste Wochen – also vor Plattform C?«
Janet zögerte kurz. »Ein paar. Damals lief vieles analog: Whiteboards, Skizzen, Papier. Die digitale Infrastruktur kam erst mit dem offiziellen Start.«
Jakob nickte. Acht Monate, und davor kaum Greifbares, dachte er, wie eine Geschichte ohne Anfang.
»Wer war damals schon dabei?«
»Collins, zwei Bioinformatiker, ein Immunologe aus Stanford. Ich kam zwei Wochen später.« Sie strich sich eine Strähne aus dem Gesicht. »Die ersten Tage waren chaotisch. Improvisation.«
»Beeindruckend, was ihr hier aufgebaut habt«, fand Jakob.
»Es musste schnell gehen«, sagte sie. »Das Center for Disease Control hatte gerade seine Pandemieprotokolle überarbeitet. Whitmore wollte schneller sein. Schneller als das System.«
Sie sagte es ohne Stolz, eher mit einer Mischung aus Pflichtbewusstsein und Müdigkeit. Jakob sah sie kurz von der Seite an. In ihrem Gesicht lag Konzentration, aber auch etwas Abgewandtes. Als würde sie gleichzeitig hier stehen – und innerlich ganz woanders sein.
»Und davor? Vor Plattform C?«
Janet schwieg, die Hand noch immer auf der Monitorkante, als hielte sie sich fest. Dann sagte sie, leise, fast tonlos: »Vor C war nichts, das Sie hier finden können.«
Jakob hörte nicht die Worte, sondern die Lücke, die sie offenbarten. Das beunruhigte ihn; nicht die Abwesenheit von Information, sondern die Klarheit, mit der jemand entschieden hatte, dass hier kein Anfang zu finden sein sollte.
Der Jakob zugewiesene Raum lag am Ende eines stillen Seitengangs, abgeschottet wie ein Organ tief im Körper. Auf dem Schreibtisch standen nur die beiden Monitore, daneben die Tastatur. Kein Stift, kein Papier, kein Gegenstand, der eine persönliche Spur hinterlassen hätte. Neben der Tastatur blinkte stumm ein versiegelter USB-Port.
Er startete den Rechner: kein Internetzugang, nur interne Server. Er kannte diese Festungslogik von anderen Sicherheitslaboren.
Etwa eine Stunde später wurde sein Zugang freigeschaltet. Ein Ordner erschien: IMM7 Übersichtsstudien Erstbewertung. Jakob klickte sich hinein. Die Dateinamen wirkten harmlos, nüchtern; technisches Vokabular, das mehr verschleierte als enthüllte. Er öffnete eines der PDFs: Versuchsreihe B/132 – Genverhalten in Mäusezellkulturen.
Tabellen, Diagramme, mikroskopische Aufnahmen. Die ersten Seiten lasen sich wie Routine: Zellwachstum unter Standardbedingungen, sauber dokumentiert, ordentlich formatiert. Alles wirkte kontrolliert und berechenbar. Doch ein Balkendiagramm ließ ihn stoppen: ein einzelnes Virusgen, G-Fragment ΔPRR. Erst flach, am dritten Tag ein steiler Anstieg des Messwerts, dann ein abruptes Ende. Keine Nachwirkung, keine Erklärung, kein Kommentar. Die Legende war vage: »modifizierter Signalpeptidbereich«. Was war modifiziert? Und warum? Keine Vergleichswerte, keine Kontrollreihe, keine Probenherkunft. Ein Bruchstück, das mehr Fragen stellte als Antworten gab. Für ein Hochsicherheitslabor war das erstaunlich knapp.
Er schrieb in sein Notizbuch: »G-Fragment ΔPRR gefunden, keine Referenzdaten; auffällig. Janet Liu fragen.« Dann speicherte er, schloss das Dokument. Das Bild brannte nach. Vielleicht Artefakt, vielleicht Fußnote – aber sein Gefühl sagte: kein Zufall. Über dem hellen Datensatz lag ein Schatten.
Er lehnte sich zurück. Durch die schmale Glasscheibe sah er hinüber in den Nachbartrakt. Ein junger Mann in Schutzkleidung arbeitete dort, die Bewegungen ruhig und gleichmäßig, als spiele er ein Stück, dessen Takt er seit Jahren verinnerlicht hatte. Pipette hoch, Pipette runter, wie eine Choreografie, ohne Abweichung. Jakob betrachtete ihn, als sähe er in einem Spiegel eine frühere Version seiner selbst.
Später am Nachmittag klopfte er an eine Tür auf der Nordseite des Komplexes. Auf dem Türschild stand »Dr. Janet Mei Liu«. Ihr Büro lag am Rand der Anlage, mit Blick auf einen Innenhof, in dem sich ein paar Pflanzen an einem Rankgitter festklammerten – der einzige grüne Fleck in diesem Gebäude, fast ein Fremdkörper in dieser Welt aus codierter Kälte.
Janet blickte vom Monitor auf, als er eintrat. Ihre Brille spiegelte das Display.
»Dr. Stein.«
»Ich wollte nicht stören. Nur eine kurze Rückfrage.«
Sie deutete auf den Stuhl gegenüber. »Bitte.«
Jakob setzte sich, schlug sein Notizbuch auf, blätterte kurz, dann sah er auf. »Ich habe mir heute einige der frühen Protokolle angesehen. Versuchsreihe B/132 – da gibt es ein Diagramm zu einem G-Fragment mit der Kennung ΔPRR, also ein Bereich im Gen, der offenbar verändert wurde – aber ohne nähere Erklärung. Mir ist aufgefallen, dass dazu keine Referenzdaten hinterlegt sind. Keine Sequenz, keine Kontrollreihe. Nichts, was die Kurve einordnet.«
Janet runzelte leicht die Stirn. »B/132 ... Das müsste eine der älteren internen Testreihen sein. Vor meiner Zeit hier.«
»Wurde sie nie publiziert?«
»Nicht, dass ich wüsste.«
»Und das Fragment? Wissen Sie, worum es sich handelt?«
Sie zögerte. Nicht lange – aber spürbar. Es war kein zögerliches Suchen nach Fakten, sondern ein kurzes Abwägen – wie weit sie gehen wollte. »Das klingt nach einer eingefügten Gen-Sequenz, also nach etwas, das künstlich eingebaut wurde – vermutlich ein verkürztes Eiweißstück, also ein genetisches Puzzlestück, das normalerweise dort nicht vorkommt. Aber ich müsste das genauer prüfen.«
»Am dritten Tag war die Aktivität plötzlich extrem hoch«, sagte Jakob. »Danach fiel sie schlagartig ab. Kein gleichmäßiger Verlauf, keine Phase dazwischen, nur dieser Ausschlag. Und dann Stille.«
Janet lehnte sich zurück, faltete die Hände locker vor sich. »Es gab in der frühen Phase mehrere Ansätze mit veränderten Signalpeptiden. Einige waren zu instabil, andere haben unerwünschte Reaktionen ausgelöst. Vieles wurde verworfen, bevor es in die offizielle Pipeline gelangte. Wenn Sie möchten, sehe ich nach, ob ich die Originaldateien in den Archivservern finde.«
»Das wäre hilfreich.«
Sie nickte. »Ich gebe Ihnen Bescheid, sobald ich etwas finde.«
Jakob erhob sich. Sein Blick streifte flüchtig die Bewegung ihrer Hand, als sie den Brillenbügel zurechtrückte.
»Danke. Und falls es nichts gibt – vielleicht ist auch das eine Antwort.«
Janet erwiderte nichts. Nur ein flüchtiges Lächeln. Das Schweigen hatte Konturen bekommen. Als Jakob zu seinem Raum zurückging, wusste er: Es gab Dinge, die in diesem Labor nicht in den Datenbanken standen. Aber sie existierten trotzdem. Manchmal in Blicken. Manchmal zwischen Menschen. Und manchmal in der Art, wie jemand eine Frage unbeantwortet ließ.
3
Mit leisem Summen schob sich das Metalltor nach oben. Kühle Luft schlug Whitmore entgegen: Beton, Stahl, Öl. Keine glänzenden Wände, nur Maschinen, stumm wie Erinnerungen.
Er ließ den Blick über seine Fahrzeuge gleiten, blieb an der Shelby Cobra von 1965 hängen. Der blaue Lack mit den weißen Rennstreifen schimmerte unter dem Deckenlicht wie nasse Haut im Sommer. Für einen Moment legte Whitmore die Hand auf die Karosserie.
»Du bist immer noch wunderschön«, murmelte er.
Er schloss kurz die Augen und war wieder an der Küste, hörte das Dröhnen des Motors, fühlte Wind, Freiheit, Jugend, Kraft. Als er die Lider hob, spiegelte das Glas nicht mehr den jungen Fahrer von damals, sondern einen schwer gewordenen Mann mit müden Augen. Die Cobra schwieg längst.
Ein kurzes, bitteres Lachen. »Zu viel gearbeitet, zu wenig gelebt.«
Er ging zum schwarzen Cadillac Escalade, bullig und kompromisslos. Träume zahlen keine Gehälter, sie retten keine Firmen. Whitmore straffte die Schultern, öffnete die Fahrertür und ließ sich hineinfallen. Das Cockpit erwachte.
Bevor er startete, warf er noch einen Blick in den Rückspiegel. Die Cobra stand reglos da, wie ein Stück Vergangenheit, das vielleicht eines Tages wieder Leben in sich tragen würde. Aber nicht heute.
Zwanzig Minuten später stieß Whitmore die Tür auf und trat in sein Büro, der Schritt schneller als nötig, die Stirn glänzend. Sein maßgeschneiderter Anzug spannte sich über dem Bauch, als er sich mit einem tiefen Seufzer in den lederbezogenen Stuhl fallen ließ – wie jemand, der sich in seine Festung zurückzieht.
Durch die raumhohen Fenster floss das erste Morgenlicht. Es streifte den hochglanzpolierten Granitboden, brach sich an den Kanten des Glastischs, auf dessen Oberfläche kein einziges Blatt lag – nur der silberne Kugelschreiber, parallel zur Tischkante ausgerichtet.
Die Tür öffnete sich.
»Morgen, Susan. Kaffee, schwarz. Und schicken Sie Collins her.«
Seine Sekretärin erschien wie aus dem Nichts. Kein Wort zu viel, kein Lächeln zu wenig. Alles an ihr wirkte wie auf stumm geschaltet.
»Sofort.« Sekunden später war sie wieder verschwunden.
Leises Klopfen, die Glastür öffnete sich.
Dr. Richard Collins trat ein. Makellos wie immer; der dunkle Anzug spannungsfrei, die Krawatte auf den Millimeter zentriert, im Blick einen Hauch von Überlegenheit, als ob er in jedem Raum automatisch davon ausging, der Klügste zu sein.
»Guten Morgen, Dr. Whitmore.«
Whitmore sah auf. »Collins. Setzen Sie sich. Wie laufen die Dinge in Indien?«
Collins sank in einen der beiden Besuchersessel, schlug die Beine übereinander.
»Wir haben ein Problem mit der Lieferung von Vinpocetin.«
Whitmore zog die Stirn kraus. »Vinpocetin? Alternativen?«
»Nimodipin. Citicolin. Und natürlich Ginkgo-biloba-Extrakte.«
Whitmore winkte ab, als hätte man ihm ein Kindermedikament angeboten. »Ginkgo ist Ramsch. Prüfen Sie die anderen. Wir brauchen das Forte-Label.«
Er schob den Kugelschreiber ein paar Millimeter nach rechts. Dann: »Wie steht es mit Stein?«
»Stein gräbt tiefer, als er soll. Er hat mehrfach nach früheren Versuchen gefragt, vor Plattform C. Aber wir haben das im Griff.« Collins ließ diese Sätze wie einen Stein ins Wasser fallen, beobachtete die Wellen. Dann tippte er beiläufig auf sein Tablet.
»Er hat Zugriff auf die freigegebenen Bereiche. Die unbedenklichen. Janet hält sich an die Anweisungen. Er sieht nur das, was er sehen darf. Auch Janet selbst weiß nichts von der Genomveränderung.«
Whitmore runzelte die Stirn, drehte den Stift zwischen den Fingern. »Der ist nicht dumm. In manchen Fragen überragt Stein selbst die führenden Virologen der Welt, und genau darum ist er hier. Aber er könnte die Lücken sehen.«
Collins lehnte sich zurück, ein kontrolliertes Lächeln auf den Lippen.
»Er sucht, stellt Fragen. Vor allem zur Produktionscharge 17A. Korrelationen zwischen Thrombosefällen und Dosierungen. Aber Janet sagt, er steckt schon in der Laborarbeit.«
Whitmore begann mit den Fingern auf die Glasplatte zu trommeln. Für einen Moment schweifte sein Blick ab, hinaus auf die Skyline, die im Licht der Morgensonne wie eine Projektion wirkte.
Die Tür öffnete sich erneut, Susan trat mit dem Kaffeetablett ein.
»Jetzt nicht, Susan.«
Ein Sekundenbruchteil Pause, dann glitt sie hinaus, fast geräuschlos.
»Steins Arbeitsbereich muss auf Plattform C beschränkt bleiben«, sagte Whitmore rau. »Lasst ihn nicht tiefer graben.«
Collins' Lächeln wurde noch schmaler. »Janet hält ihn beschäftigt. Er sucht in den Vektoren, nicht in der Genmodifikation. Und davon weiß auch Janet nichts.«
Whitmore trat ans Fenster, stellte sich breitbeinig hin, als müsse er etwas abwehren. In den Spiegelungen der gläsernen Fassaden meinte er, die Gesichter all jener zu sehen, die an seine Entscheidungen gebunden waren – Investoren, Minister, Patienten. Eine Menschenmasse ohne Stimme, die ihn dennoch bedrängte. Seine Schultern wollten sich aufrichten, aber sie gaben nach, als trügen sie schon seit Jahren eine unsichtbare Last.
Collins blieb ruhig, die Stimme ausbalanciert. »Außerdem sind unsere Modifikationen am Viusgenom nicht verboten. Nicht offiziell. Und die Genehmigungsanträge laufen.«
Whitmore lachte; ein kurzes, bitteres Bellen. »Präsident Flinn sucht nur einen Sündenbock. Und Campbell, dieser aufgehetzte Impfgegner im Gesundheitsministerium, würde uns in der Luft zerreißen. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand.« Er drehte sich zu dem großen, abstrakten Wandgemälde, starrte einige Sekunden gedankenversunken auf die Farben, sah dann zu Collins. »Wir müssen schneller sein. Diskreter. Bevor jemand etwas merkt. Dann wird das modifizierte Virus vernichtet. Erst dann sind wir aus dem Schneider.«
Collins nickte knapp. »Selbstverständlich. Dann fragt niemand mehr nach Details.«
Ein kurzer Moment. Collins zögerte, als wollte er mehr sagen. Vielleicht, dass sie zu schnell vorgingen. Dass zu viele Fragen offen blieben. Doch er schwieg. Schluckte den Gedanken hinunter. Für einen Sekundenbruchteil stieg in ihm das Bild eines Labors auf, kalt und grell beleuchtet. Er erinnerte sich an die Tage, an denen er selbst noch einen weißen Laborkittel getragen hatte, voller Ehrgeiz. Der Gedanke brannte. Er hätte ihn fast ausgesprochen – doch dann schloss er innerlich die Tür, wie man eine Schublade zuschiebt, die niemand öffnen darf. Hier war nicht der Ort für Skrupel. Vielleicht gab es den gar nicht mehr.
Whitmore blieb einen Moment reglos, nur die Ader an seiner Schläfe arbeitete sichtbar.
»Collins, ich weiß, dass das, was wir hier tun …« Er brach ab, die Worte rutschten ihm weg. Er sah aus dem Fenster. »Es ist nicht sauber. Mein Vater – Gott, wenn er das sehen könnte – er würde mich wahrscheinlich verstoßen. Profit darfst du nie über Heilung stellen, hat er immer gesagt.«
Er drehte sich langsam um, als koste ihn die Bewegung Kraft. »Aber er hat auch gesagt: Wenn du einmal Verantwortung trägst, darfst du nicht mehr nur träumen. Du musst entscheiden. Auch wenn es einmal die falsche Entscheidung ist.«
Collins saß steif, die Hände ineinander verschränkt.
»Wir brauchen Stein«, sagte Whitmore, nun wieder etwas fester. »Er ist so brillant, dass er unser Problem schnell lösen kann – vielleicht kann sogar nur er das so schnell. Ich will, dass er es schafft – nur eben, ohne dass alles andere dabei explodiert.«
Er öffnete eine Glasvitrine, griff nach dem hellblauen Modell einer Corvette, drehte es in der Hand und stellte es wortlos zurück.
»Wissen Sie, Collins«, begann er leise, »manchmal frage ich mich, wann genau ich aufgehört habe, Wissenschaftler zu sein.«
Seine Stimme klang rau, fast wie eingerostet.
»Damals, als ich das erste Medikament entwickelt habe – ich war stolz. Wirklich stolz. Es war mein Traum: Krankheiten besiegen. Wir haben Leben gerettet. Ich dachte, das wäre mein Weg.«
Collins stand mittlerweile neben dem Tisch. Unsicher, fast unpassend in seiner Makellosigkeit.
»Sie sind immer noch Wissenschaftler, Dr. Whitmore. Nur mit mehr Verantwortung.«
Ein kurzes, bitteres Lachen. »Verantwortung.« Whitmore rieb sich die Stirn, als versuche er, einen Abdruck der Vergangenheit loszuwerden. »Heute geht’s nur noch um Verträge, um Aktienkurse, um politische Netzwerke. Ich sitze hier, spreche mit Präsidenten, mit Ministern – statt im Labor zu stehen, statt zu tun, wofür ich einmal gebrannt habe.« Er drehte sich um, sein Blick wurde unsicher.
»Ich liebe die Wissenschaft noch immer, Collins. Aber sie liebt mich nicht mehr. Sie ist ein Werkzeug geworden. Ein Werkzeug, um mein Erbe zu schützen. Das Werk meines Vaters.«
Collins wich dem Blick aus. Dann, vorsichtig, fast tastend: »Vielleicht ist das der Preis, den man zahlt, wenn man zu viel erreicht.« Collins schwieg kurz, sagte dann mit leiser Stimme: »Wissen Sie, manchmal frage ich mich, wie weit wir noch gehen können, bevor uns das alles einholt. Ich wollte nie nur Manager sein. Ich wollte Forscher sein. Bin ich das noch?« Er sah zu Whitmore auf. »Oder bin ich nur noch ein Aufsteiger? Ich wollte etwas verändern. Jetzt bin ich damit beschäftigt, Dinge zu verstecken. Dinge, die niemand sehen darf. Manchmal wünsche ich mir, ich könnte einfach alles abstreifen, zurück ins Labor gehen. Einfach nur Moleküle sehen. Nicht Bilanzen.« Sein Blick wurde starrer, die Stimme brüchig. »Aber dann denke ich: Wenn ich nicht hier wäre – wer würde dann überhaupt noch versuchen, die Wissenschaft in diesem Konzern zu retten?«
Die Worte verhallten. Whitmore sah ihn lange an, ohne Regung, sagte dann mit leiser Stimme: »Vielleicht sind wir uns ähnlicher, als ich dachte.«
Collins ließ die Schultern sinken, fast unmerklich. »Es gibt Nächte, da frage ich mich, ob wir nicht schon zu weit gegangen sind. Wir stehen auf einem Grat zwischen Innovation und Katastrophe.«
Das Wort ‚Katastrophe‘ hing schwerer in der Luft als beabsichtigt. Für einen Moment hatte es die Kraft, das sterile Büro mit der Atmosphäre eines Gerichtssaals zu füllen. Whitmore spürte, wie sein Atem flacher wurde, als lauschte er einem Urteil, das vielleicht längst gesprochen war. Zwei Männer, die für einen Augenblick spürten, wie viel sie auf diesem Weg verloren hatten. Dann hob Whitmore langsam den Kopf. Die Stimme war wieder gefasst.
»Finden Sie einen Weg, Collins. Einen Weg, der uns leben lässt. Und Stein auch.«
Die Worte fielen schwer in die Stille, doch was in Whitmores Blick aufblitzte, war nicht Hoffnung, sondern die Ahnung, dass es vielleicht längst zu spät war.
4
Zwei Tage nach seiner Ankunft im Institut hatte Jakob das Gefühl, sich einen ersten Überblick verschafft zu haben – zumindest an der Oberfläche. Er verstand nun die Gliederung der Projekte, kannte die Kürzel, hatte Zugriff auf zentrale Datenverzeichnisse. Doch mit manchen Dateien, die er öffnete, wuchs ein leises Unbehagen. Es war nicht der Inhalt selbst, der ihn stutzig machte, der war sorgfältig dokumentiert, in sich stimmig, mit der typischen Präzision, die man von einem Hochsicherheitslabor erwartete. Es war eher die Art, wie manches wirkte: zu glatt, zu perfekt. Wie ein Flur, dessen Wände frisch gestrichen waren, aber dahinter morsch.
An diesem Nachmittag stand er in einem der hinteren Labore, die selten frequentiert waren. Durch eine breite Glasscheibe blickte er in den angrenzenden Zellkulturraum. Janet Mei Liu arbeitete dort, in voller Schutzkleidung, konzentriert über eine Plattenkassette gebeugt. Ihre Bewegungen waren präzise, elegant. Wie ein Tanz, bei dem jeder Schritt sitzt. Jakob fand, dass sie selbst in steriler Kleidung eine stille Eleganz ausstrahlte. Er beobachtete sie eine Weile; ihre Präsenz hatte etwas Unnahbares, zugleich aber auch etwas Unverstelltes. Anders als viele im Institut schien sie nicht zeigen zu wollen, wie kompetent sie war: sie war es einfach. Mit einer Selbstverständlichkeit, die man nicht lernen konnte.
Als sie wenig später aus dem Raum kam, das Gesicht von der Haube befreite und sich mit einem Tuch die Stirn abtupfte, bemerkte sie seinen Blick.
»Dr. Stein«, sagte sie knapp, mit einem Hauch ironischer Schärfe. »Sie beobachten gern.«
»Nur, wenn es sich lohnt.«
Sie lächelte leicht. »Ein gutes Labor ist wie ein Theaterstück. Alles muss stimmen – auch die Requisiten.«
»Und die Dialoge?«
»Sind selten ehrlich.«
Sie zog sich einen Hocker heran, nahm eine Wasserflasche aus dem kleinen Kühlschrank und trank einen Schluck. Dann setzte sie sich neben ihn, ohne Eile. Jakob spürte für einen Moment ihre Nähe, die Wärme einer Präsenz, die den Raum veränderte.
»Was halten Sie von dem Projekt?«, fragte sie schließlich.
Jakob lehnte sich etwas zurück, ließ den Blick durch den sterilen Raum schweifen. »Ich versuche noch, das Bühnenbild zu verstehen.«
»Und – haben Sie schon einen Verdacht, wer das Drehbuch geschrieben hat?«
»Ich vermute, es wurde mehrmals überarbeitet. Nicht von einer Hand.«
Janet sah ihn prüfend an. »Sie glauben, wir manipulieren.«
»Ich frage mich, ob hier noch jemand die Kontrolle hat. Oder sie je hatte.«
Sie schwieg für einen Moment. Dann sagte sie ruhig: »Ich bin vor acht Monaten hierher gekommen. Whitmore hat mich persönlich angeworben. Ich hatte andere Angebote – bessere, renommiertere. Aber er hat mir etwas versprochen, das ich in einer Uni nirgends bekam: Freiheit. Keine Gremien, keine politischen Vorgaben. Reine Forschung.«
»Und? Hat er Wort gehalten?«
Ihr Blick wich aus, glitt über die sterile Fläche des Labortischs. »Am Anfang ja. Dann fingen die Formulierungen an, sich zu ändern. In den Memos, in den Zielvorgaben. Erst kaum merklich, dann immer deutlicher. Ich selbst bin zwar mit dem Impfstoff nur ganz am Rande befasst, aber auch ich merke das immer wieder.«
»Zum Beispiel?«
»Früher haben wir Dinge beim Namen genannt«, sagte sie leise. »Heute klingen unsere Formulierungen, als hätten wir Angst vor dem, was sie wirklich bedeuten könnten. Als wollten wir uns selbst beruhigen, indem wir alles in wohlklingende Worte kleiden. Wortkosmetik.«
Sie schwieg einen Moment, fuhr sich über die Stirn, stellte die Wasserflasche ab. Ihr Blick war nüchtern, aber nicht kalt. »Ich bin keine Idealistin. Ich weiß, wie Forschung funktioniert: mit Zwängen, Zielvorgaben, Kompromissen. Aber ich habe mich hier beworben, weil ich glaubte, dass wenigstens einer im Team bereit wäre, im Ernstfall Stopp zu sagen.«
»Und Sie glauben, das bin ich?«
Sie sah ihn an, lange, ohne zu blinzeln. »Ich hoffe es.«
In Jakobs Brust regte sich etwas, das er nicht recht benennen konnte. Die Verantwortung, die in ihren Worten lag, schob sich über ihn wie ein Schatten. Dann stand sie auf, zog die Handschuhe über, als wäre das Gespräch nur eine Unterbrechung gewesen, und verschwand zurück in den Raum hinter Glas.
Jakob sah ihr nach. Etwas in ihm hatte sich verschoben. Es war keine Enthüllung gewesen, was sie gesagt hatte. Eher eine Geste. Ein stilles Öffnen, ein erster Spalt in einer Wand aus Neutralität. Und während er ihre Bewegungen hinter der Scheibe wieder aufnahm, spürte er, dass sie damit zum ersten Mal nicht nur Daten preisgegeben hatte, sondern ein Stück weit sich selbst. Vielleicht, zwischen all den Worten, auch einen leisen Hilferuf. Er wusste jetzt: Wenn er Antworten wollte, würde er sie nicht nur in Zahlen und Protokollen finden – sondern in Menschen.
Den Rest des Tages verbrachte Jakob im Labor. Gemeinsam mit dem Team entwickelte er neue Protokolle, um die Ursachen der Unverträglichkeitsreaktionen zu entschlüsseln. Sie variierten Dosierungen, prüften unterschiedliche Impfverstärker und modifizierten die Virusvektoren gezielt, um Immunantwort und Nebenwirkungen gegeneinander abzuwägen.
Immer wieder bereitete er neue Zellkulturen vor, wertete Blutbilder aus und verglich sie mit den Kontrollproben. Die Ergebnisse waren oft widersprüchlich – doch gerade das war für ihn der Kern von Wissenschaft: Hypothesen überprüfen, scheitern, neu ansetzen.
Am frühen Abend, als die Flure schon still wurden, saß Jakob noch vor seinem Bildschirm. Der interne Server war nach stundenlanger Sperre wieder erreichbar. Offiziell wegen einer Synchronisation. Er klickte sich durch Ordner voller makellos formatierter Protokolle. Alles wirkte korrekt. Nur eine Temporärdatei stach heraus: unscheinbar, roh, voller Zahlenkolonnen und Kürzel, wie das Atemgeräusch eines Systems, das jede Reaktion mitschreibt.
Dann fiel sein Blick auf eine Zeile: Datei gelöscht. Zeitstempel: 19:42.
Direkt darunter: Zugriff verweigert – Ressource nicht vorhanden, 19:43.
Eine Minute Unterschied. Nutzerkennung: jliu. Jemand hatte die Datei gelöscht, kurz bevor Janet darauf zugreifen wollte. Janet hatte also im System gegraben, war aber auf eine Mauer gestoßen. Er machte keine Notiz, auch keinen Screenshot. Alles wurde protokolliert, jede Abweichung wäre verdächtig. Also behielt er nur das Bild im Kopf: Löschung, Zugriff, Blockade.
Jakob schloss die Datei, öffnete eine beliebige andere und wartete, bis sein Atem wieder ruhiger wurde.
Am nächsten Vormittag arbeitete Jakob wieder im Labor. Gemeinsam mit anderen Mitarbeitern testete er verschiedene Zelllinien, prüfte alternative Produktionswege für das Antigen und ließ Protokolle zum Nachweis von Autoimmunreaktionen anlegen. Später traf er Janet in der Kaffeeküche. Sie hielt sich die warme Tasse an die Wange, ließ den Dampf an den Lidern vorbeiziehen. Sonnenlicht fiel auf ihr Profil. Der Kontrast zwischen der sterilen Laborkälte und diesem warmen Licht ließ sie für einen Augenblick verletzlicher wirken, fast wie eine Figur außerhalb der Bühne.
»Ich habe gestern in den Server geschaut«, sagte Jakob, als er sich neben sie stellte. »Da war eine Temporärdatei IMM7. Mit einem Verweis auf FSPmod_final.«
Sie stellte die Tasse ab. Keine hastige Bewegung, eher ein vorsichtiges Lösen der Finger. »Und?«
»Die Datei war gelöscht. Eine Minute, bevor jemand – vermutlich Sie – zugreifen wollte.«
Janets Blick hielt seinen fest. Kein Erschrecken, kein Abwiegeln, nur ein stilles Prüfen.
»Warum sagen Sie mir das?«
»Weil ich nicht weiß, was darin zu finden gewesen wäre. Aber ich glaube, Sie wissen es.«
Sie atmete tief ein, als müsse sie eine Entscheidung treffen. »Vor zwei Wochen war die Datei noch da. Es war ein Expressionsprofil. Eine Analyse, welche Gene das Virus aktiviert. Es ging um eine Variante, die nie offiziell dokumentiert wurde. Ein Eingriff an der Spaltstelle, dort, wo das Virus in die Zelle eindringt.« Ihre Stimme senkte sich. »Getestet an menschlichen Atemwegszellen, Calu-3. Die Resultate waren beunruhigend. Es sah nach einer Immunreaktion aus, die außer Kontrolle gerät.«
Jakob schwieg, weil er spürte, dass jedes Wort von ihr abgewogen war. Er hätte nachhaken können, doch er merkte, dass es mehr nützte, zuzuhören, als sofort eine neue Frage zu stellen.
»Die Daten wurden nicht archiviert«, fuhr sie fort. »Nicht gemeldet. Einfach verschoben. Und dann gelöscht. Jemand wollte nicht, dass man sie sieht.«
»Sie glauben, es wird vertuscht?«
»Ich glaube, jemand fürchtet Fragen.«
»Warum erzählen Sie mir das jetzt?«, fragte er leise.
»Weil ich gemerkt habe, wie Sie hinsehen. Nicht wie ein Techniker, der auf das Protokoll achtet. Auch nicht wie jemand, der Punkte für seine Karriere sammelt. Sondern wie jemand, der erkennt, wenn etwas aus dem Rahmen fällt.«
»Ich sehe den Rahmen, ja, aber ich weiß noch nicht, ob ich ihn sprengen will – oder von innen verändern.«
Janet sah ihn lange an. »Dann sind Sie weiter als ich.«
Einen Moment standen sie wortlos nebeneinander. Jakob spürte, dass sie beide auf einer dünnen Linie balancierten: Misstrauen und Nähe, Risiko und Vertrauen. Es war ein Einverständnis, das man nicht absichtlich suchte, sondern das entstand, weil man die gleiche Gefahr witterte.
Jakob stellte seine Tasse ab. »Ich werde beobachten. Fragen stellen. Nicht laut, aber gezielt.«
Janet nickte. »Gut. Wenn Sie etwas brauchen, Einblick in interne Verläufe, in nicht freigegebene Protokolle: Ich kann vielleicht etwas ermöglichen. Aber ich werde nichts schreiben. Keine Mails. Keine Spuren.«
Jakob erwiderte ihren Blick.
»Verstanden.«
Sie ging. Kein Blick zurück, kein gespieltes Pathos. Nur der leise Schritt einer Frau, die wusste, wie schnell Vertrauen zur Schwachstelle werden konnte. Im Flur verklangen ihre Schritte. Diese Temporärdatei IMM7 war ein unscheinbares Detail, und doch sie schien mehr zu sagen als alles, was in den Protokollen stand.
5
Berlin erwachte langsam. Das Rattern der Straßenbahn, Stimmen im Treppenhaus, das ferne Pochen eines Bauhammers – Geräusche, die Nora Seidel kaum noch wahrnahm. Sie gehörten zu ihrem Leben wie der Geruch von Desinfektionsmittel in den Haaren.
Der hellblaue Kasack glitt über ihre Schultern, eine Strähne blieb widerspenstig im Gesicht hängen. Im Spiegel blickten ihr müde Augen entgegen, dunkle Schatten darunter, ein Knick im Haar vom Einschlafen auf dem Sofa. Nora war 28, aber manchmal fühlte sie sich doppelt so alt – besonders an Tagen wie diesen, wenn die Nacht kaum vorbei war und die Verantwortung wie ein Bleigewicht auf ihr lag.
7:03 Uhr. Keine Nachricht von ihrer Mutter. Gut – oder vielleicht auch nicht. Sie legte das Handy weg. Wieder nur eine knappe SMS, die sie am Vorabend geschickt hatte: »Ich ruf dich morgen an«. Morgen war nie heute.
Die Türen des Seniorenheims St. Marien glitten auf. Säuerlicher, stechender Geruch, gemischt mit dem warmen Duft frischer Brötchen aus der Cafeteria. Früher war das Geborgenheit gewesen, jetzt nur ein leiser Vorwurf, dass sie sich nicht erinnern konnte, wann sie zuletzt in Ruhe gefrühstückt hatte. Ein Pfleger nickte ihr im Vorübergehen zu. Sie zwang ein Lächeln zurück.
»Nora! Endlich. Frau Krauses Kreislauf – ich bin nicht sicher, ob wir den Arzt rufen sollen.« Nachtpflegehelferin Lea, den Abdruck der Maske noch auf der Wange, stand nervös im Gang. Nora folgte ihr, spürte schon jetzt den Druck in der Brust, der jeden Arbeitstag begleitete.
Zimmer 214: Magdalena Krause, blass im Bett, Augen halb geschlossen, dünne Hände reglos auf der Decke. Nora sprach sanft, legte die Blutdruckmanschette an. 91 zu 50 – zu niedrig. Während sie fragte, ob die alte Dame genug getrunken habe, schob sich das Bild ihrer Mutter vor ihr inneres Auge – allein, die Treppe hinuntergehend, niemand, der nachfragte.
Nora ging in das Schwesternzimmer, um die Medikamente zu verteilen. Im Hintergrund lief das Radio, leise, fast beiläufig. Ein Nachrichtensprecher verlas die Morgenmeldungen:
»…In den USA wurde heute in einem biotechnologischen Forschungslabor ein Sicherheitsalarm ausgelöst. Nach Angaben der Firma Whitmore Pharmaceuticals handelte es sich um einen technischen Fehler. Über Personenschäden und Auswirkungen auf die Umgebung liegen noch keine Erkenntnisse vor ...«
Der Name Whitmore Pharmaceuticals blieb einen Sekundenbruchteil länger in ihrem Kopf hängen, als ihr lieb war. Sie konnte nicht sagen, warum. Vielleicht, weil er fremd klang, oder weil er ihr schon einmal begegnet war. Sie hörte es, nahm es wahr, doch es fühlte sich wie eine Nachricht aus einem anderen Universum an. Die Realität hier roch nach Urin, Desinfektionsmittel und dieser tief eingezogenen Müdigkeit, die Wänden und Menschen anhaftete.
Plötzlich rief eine heisere Stimme aus dem Nebenzimmer: »Fräulein Seidel! Kommen Sie schnell, es tut so weh!«