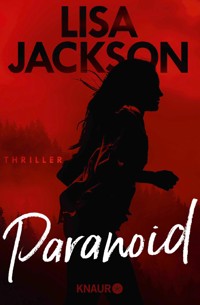
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Thriller-Queen Lisa Jackson lädt zu einem tödlichen Spiel um Rache und Schuld. Es sollte nur Spaß sein: ein harmloses Ballerspiel mit Platzpatronen. Doch als die 17-jährige Rachel auf ihren Halbbruder Luke schießt, wird dieser von einer tödlichen Kugel getroffen. Zwar berichten zwei Mädchen später von einem Schuss, der nicht aus Rachels Pistole gekommen sei, doch der Fall kann nie ganz aufgeklärt werden. 20 Jahre später fühlt sich Rachel noch immer schuldig, und letztlich ist an diesem Trauma auch die Ehe mit ihrer großen Liebe, Detective Cade Ryder, zerbrochen. Doch dann werden Rachels damalige Entlastungszeuginnen kurz nacheinander brutal ermordet, sie selbst erhält ominöse Droh-Botschaften. Als auch noch Rachels Tochter entführt wird, ist klar: Jemand hat beschlossen, für Lukes Tod blutige Rache zu nehmen. Doch weshalb erst jetzt – und was ist damals wirklich geschehen? Alte Schuld und späte Rache in einer Highschool-Clique in Oregon: Bestseller-Autorin Lisa Jackson verknüpft gekonnt harte Thriller-Spannung mit einer Prise Romantic Suspense. »Paranoid« ist unabhängig von Lisa Jacksons Thriller-Reihen lesbar, ebenso wie die Bestseller »S – Spur der Angst«, »T – Tödliche Spur«, »Z – Zeichen der Rache« und »You will pay – Tödliche Botschaft«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 682
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Lisa Jackson
Paranoid
Thriller
Aus dem amerikanischen Englisch von Kristina Lake-Zapp
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Es sollte nur Spaß sein: ein harmloses Ballerspiel mit Platzpatronen. Doch als die 17-jährige Rachel auf ihren Halbbruder Luke schießt, wird dieser von einer tödlichen Kugel getroffen. Zwar berichten zwei Mädchen später von einem Schuss, der nicht aus Rachels Pistole gekommen sei, doch der Fall kann nie ganz aufgeklärt werden.
20 Jahre später fühlt sich Rachel noch immer schuldig, und letztlich ist an diesem Trauma auch die Ehe mit ihrer großen Liebe, Detective Cade Ryder, zerbrochen. Doch dann werden Rachels damalige Entlastungszeuginnen kurz nacheinander brutal ermordet, sie selbst erhält ominöse Droh-Botschaften. Als auch noch Rachels Tochter entführt wird, ist klar: Jemand hat beschlossen, für Lukes Tod blutige Rache zu nehmen. Doch weshalb erst jetzt – und was ist damals wirklich geschehen?
Inhaltsübersicht
Jetzt
Prolog
Kapitel eins
Kapitel zwei
Kapitel drei
Kapitel vier
Kapitel fünf
Kapitel sechs
Kapitel sieben
Kapitel acht
Kapitel neun
Kapitel zehn
Kapitel elf
Kapitel zwölf
Kapitel dreizehn
Kapitel vierzehn
Kapitel fünfzehn
Kapitel sechzehn
Kapitel siebzehn
Kapitel achtzehn
Kapitel neunzehn
Kapitel zwanzig
Kapitel einundzwanzig
Kapitel zweiundzwanzig
Kapitel dreiundzwanzig
Kapitel vierundzwanzig
Kapitel fünfundzwanzig
Kapitel sechsundzwanzig
Kapitel siebenundzwanzig
Kapitel achtundzwanzig
Kapitel neunundzwanzig
Kapitel dreißig
Kapitel einunddreißig
Kapitel zweiunddreißig
Kapitel dreiunddreißig
Kapitel vierunddreißig
Kapitel fünfunddreißig
Kapitel sechsunddreißig
Kapitel siebenunddreißig
Kapitel achtunddreißig
Kapitel neununddreißig
Kapitel vierzig
Eine Liste aller Lisa-Jackson-Romane: (nur lieferbare Titel)
Jetzt
Patientin: »Ich sehe ihn. Ich sehe Luke. Er ist … am Leben, und er lächelt. Er sagt – o Gott –, er sagt: ›Ich vergebe dir.‹«
Therapeut: »Wo ist er?«
Patientin: »In der großen Halle … in der stillgelegten Fischfabrik am Wasser. Die, die auf Stützpfeilern über dem Fluss errichtet ist.«
Therapeut: »Ich weiß, welche Sie meinen. Sie haben mir schon einmal davon erzählt.«
Patientin: »Sie sollte schon vor Ewigkeiten abgerissen werden.«
Therapeut: »Ich weiß. Ist sonst noch jemand dort?«
Patientin: »Ja. O ja, sicher! Wir sind alle da. Alle, die in der Nacht auch da waren … in der Nacht, in der Luke starb.«
Therapeut: »In der Nacht, in der Sie dieses Spiel gespielt haben?«
Patientin, die Stirn in Falten gelegt, mit tonloser Stimme: »Ja … es sollte ein Spiel sein. Wir hatten solche Pseudo-Waffen. Spielzeuge. Wir haben so getan, als würden wir einander damit erschießen.«
Therapeut: »Sie und Ihre Freunde? Konzentrieren Sie sich. Was sehen Sie?«
Patientin, den Kopf schräg gelegt, was die Falten auf ihrer Stirn noch vertieft: »Nein. Nicht alle sind Freunde. Es sind auch andere da.«
Therapeut: »Wen sehen Sie?«
Patientin: »Es ist zu dunkel. Aber sie sind da.«
Therapeut: »Gehen Sie weiter. Und jetzt? Sehen Sie sie jetzt?«
Patientin, mühsam schluckend: »Ich weiß es nicht. Aber ich glaube schon. Es ist so dunkel!«
Therapeut: »Und Sie sind ganz bestimmt in der alten Fischfabrik?«
Patientin: »Ja. Ja! Ich höre den Fluss unter mir rauschen – rieche ihn –, und ich höre die Stimme der anderen Kids, auch wenn ich nicht verstehe, was sie sagen. Es ist zu laut. Der Lärm von den Waffen, die hämmernden Schritte.«
Therapeut: »Aber Sie sehen Luke?«
Patientin: »Ja!« Die Patientin verzieht die Lippen zu einem flüchtigen Lächeln, dann: »O mein Gott! Er lebt … er lebt!«
Therapeut: »Sprechen Sie mit ihm?«
Patientin: »Ja. Das habe ich Ihnen doch schon gesagt.« Die Patientin zögert. Das Lächeln verblasst. »Aber es ist schwer, ihn zu verstehen. Die anderen Kids reden mit ihm und lachen; und immer wieder das Ploppen der Schusswaffen, das von den Wänden widerhallt. Softair-Waffen. Das Gebäude ist groß. So dunkel. So …«
Therapeut: »So was?«
Patientin, ernüchtert, beinahe ängstlich, zögerlich: »Böse. Es ist … es ist, als wäre da noch etwas anderes in der alten Fabrik. Etwas, das in der Dunkelheit lauert.« Die Stimme der Patientin wird zittrig. »Etwas … Heimtückisches, Bedrohliches.« Die Patientin verfällt in Panik. Das tut sie an dieser Stelle immer. »Großer Gott!« Die Patientin wird hektisch. »Ich – wir – müssen da raus! Wir müssen abhauen! Sofort! Raus! Raus da, wir müssen uns in Sicherheit bringen!«
Therapeut, ruhig: »Es ist so weit. Sie wachen langsam wieder auf. Sie verlassen die Fischfabrik. Lassen das Gebäude und das Böse weit hinter sich.«
Patientin: »Aber Luke! Nein! Ich darf ihn nicht im Stich lassen. O mein Gott! Jemand hat auf ihn geschossen! Er blutet! Ich muss ihn retten!«
Therapeut: »Sie kehren aus Ihrer Trance zurück.«
Patientin: »Nein! Nein! Nein! Ich kann nicht ohne ihn gehen! Ich muss ihm helfen!« Die Patientin ist außer sich vor Panik. »Hilfe! Wieso hilft denn niemand?«
Therapeut: »Sie wachen jetzt auf. Lassen die Fischfabrik hinter sich. Gehen Sie aus dem Gebäude. Sie müssen sich selbst in Sicherheit bringen. Ich zähle jetzt von drei runter …«
Patientin, aufgelöst, verzweifelt: »Ja … aber … aber ich muss mich beeilen. Muss Luke da rausschaffen …«
Therapeut: »Drei … Sie lassen die Sea View Cannery und die Vergangenheit hinter sich.«
Patientin: »Wenn ich Luke zurücklasse, stirbt er! Noch einmal: Ich darf nicht …«
Therapeut, mit fester Stimme: »Zwei. Sie sind fast wach.«
Patientin: »Ich … ich muss mit ihm reden. Muss es ihm erklären.«
Therapeut: »Eins.«
Die Patientin öffnet vorsichtig die Augen und sieht sich in dem kleinen, in gedämpftes Licht getauchten Behandlungszimmer um, das heute schwach nach Jasmin duftet. Langsam normalisiert sich ihre Atmung. Sobald sie sich wieder gefangen hat, wendet sie sich dem Therapeuten zu.
Der lächelt wohlwollend und sagt leise: »Und schon sind Sie wieder zurück.«
Prolog
Zwanzig Jahre zuvor
Mitternacht
Edgewater, Oregon
Bist du wahnsinnig?
Die nagende Stimme in ihrem Hirn verfolgte Rachel, als sie durch das trockene Gras rannte, das durch den jahrzehntealten brüchigen Asphalt wucherte. Die Nacht war stockdunkel, nur wenn die Wolkendecke ab und an aufriss, warf eine schmale, fahle Mondsichel ein silbriges Licht auf das Gelände der alten Fischfabrik am Fluss. Sobald der Wind nachließe, der die Wolken vor sich hertrieb, würde sich Nebel vom Wasser her ausbreiten und feuchtkalt durch die verlassenen Piers und Verladeanlagen kriechen, um auch dieses leer stehende Gebäude einzuhüllen, bevor er sich weiter landeinwärts ausbreitete und die Stadt unter einer dichten Decke begrub. Nur eine einzelne Laterne spendete ein verwaschenes Licht, weshalb Rachel zweimal stolperte, bevor sie endlich den Maschendraht erreichte, der das Gelände der stillgelegten Sea View Cannery umgab.
Das kannst du doch nicht machen, Rachel, wirklich nicht. Denk doch mal nach! Dein Dad ist Polizist – Detective! Dreh um!
Doch sie hörte nicht auf die innere Stimme. Stattdessen schlüpfte sie durch ein Loch im Zaun, wobei sich ihr Rucksack an einem Stück Draht verfing. Er riss mit einem unangenehmen Ratschen auf, als sie gewaltsam daran ruckte, um sich nicht von ihrer Freundin abhängen zu lassen. Ihrer angeblich besten Freundin, doch inzwischen war sich Rachel da nicht mehr so sicher. Die zierliche, lebhafte Lila schien sich nämlich weit mehr für Rachels zwei Jahre älteren Bruder Luke zu interessieren als für sie.
»Beeil dich!«, rief Lila, die inzwischen gut zwanzig Meter Vorsprung hatte, über die Schulter. Ihr blondes Haar reflektierte das schwache Licht der Laterne, als sie sich aufrichtete und über die Brücke rannte – eine schmale, baufällige Fahrbahn, die genau wie die Fabrik auf Stützpfeilern im Wasser stand.
Rachel folgte ihr eilig.
So wie sie es immer getan hatte. Es war stets Lila, die mit irgendwelchen Plänen daherkam, und Rachel machte mit.
»Ich hab keine Ahnung, warum du dich immer wieder von ihr breitschlagen lässt«, hatte Luke vor rund sechs Monaten zu ihr gesagt, als sie auf dem Heimweg von der Schule waren, Luke am Steuer, Rachel auf dem Beifahrersitz. »Du benimmst dich wie ein Schoßhund, nein, wie ein Welpe, der seinem Frauchen auf Schritt und Tritt folgt.«
»Das stimmt nicht«, hatte sie widersprochen und beleidigt aus dem Fenster in den grauen, regnerischen Himmel geblickt. Seine Worte versetzten ihr einen Stich, denn in Wahrheit hatte er nicht unrecht. Um genau zu sein, traf er sogar absolut ins Schwarze, obwohl sie es hasste, das zuzugeben.
Inzwischen hatte sich das Blatt allerdings gewendet, und Lila war bei ihrem Bruder absolut angesagt. Was noch schlimmer war.
»Jetzt beeil dich, Rachel!«, drängte Lila. »Wir kommen zu spät!«
»Ja, zu unserer eigenen Beerdigung.«
»Ach, halt die Klappe!«, winkte Lila ungeduldig ab und rannte weiter. Laut Rachels Mutter zählte Lila zu den Mädchen, die vom rechten Weg abgekommen waren und ihre Freunde schneller wechselten als die meisten Leute ihre Handtücher. »Sie ist weitaus schlauer und sehr viel hübscher, als es ihr guttut. Jeder weiß, dass eine solche Kombination nichts als Ärger bringt«, hatte Melinda Gaston ihre Kinder mehr als einmal gewarnt. »Lila gehört zu den Menschen, die genau wissen, was sie wollen, und die über Leichen gehen, um es auch zu bekommen.«
Ihre Mutter hatte recht, erkannte Rachel jetzt. Absolut recht.
»Komm endlich!«
Rachel beschleunigte ihre Schritte, wobei sie sich an den Reflektorstreifen an der Rückseite von Lilas Sportschuhen orientierte. Nachlaufen. Immer nur nachlaufen. Das war wirklich ein Problem. Sie würde daran arbeiten müssen, aber nicht heute Nacht.
Der brackige Geruch des Flusses stieg Rachel in die Nase, als sie zusammen mit ihrer Freundin auf das größte der Fabrikgebäude zuhielt, eine riesige Halle, die irgendwie an eine Scheune erinnerte, erbaut auf einer mittlerweile faulenden Pfahlkonstruktion. Düster und bedrohlich erhob sich die Halle über dem Wasser, obwohl sie eigentlich schon vor Jahren hätte abgerissen werden sollen.
»Na super«, knurrte Lila genervt. »Die anderen sind längst drin.«
»Woher weißt du das?«, flüsterte Rachel, als fürchte sie, jemand könne sie hören. Sie schaute sich auf der leeren, schlaglochübersäten Freifläche zwischen der großen Halle und einem der Nebengebäude um, doch es war niemand zu sehen. Die Außenbeleuchtung an der Hallenwand warf ein trübes, bläuliches Licht auf den Beton. Vor Anspannung stellten sich die Härchen in Rachels Nacken auf.
»Ich weiß es halt, okay?« Lila verstummte und legte den Finger auf die Lippen. »Pst … Hörst du das?«
Gedämpfte Geräusche drangen durch die alten Holzwände. Stimmen, eilige Schritte, gefolgt von einem stakkatohaften Plopp! Plopp! Plopp! Klack! Klack! Klack! Nicht wie echte Schüsse. Einfach ein lautes Ploppen oder Klackern.
Softair-Waffen.
Sichere Waffen.
Keine tödliche Munition, aber weh tat es trotzdem, wenn man getroffen wurde, und verletzt werden konnte man auch, wenn es dumm lief.
Das Ploppen und Klackern machte sie nervös.
Die schnelle Schussfolge einer Automatik.
Mit wild pochendem Herzen sah Rachel, wie Lila ihren Rucksack öffnete und eine Pistole herauszog, die im Licht der Außenlampe kurz aufblitzte.
Rachel schluckte angestrengt. Obwohl sie wusste, dass aus Lilas Waffe nur Kunststoffkugeln kamen, keine richtigen, sah sie doch täuschend echt aus. Genau wie ihre eigene Pistole.
»Ich weiß nicht …«
»Wie bitte? Du willst doch jetzt wohl keinen Rückzieher machen?«, fragte Lila missbilligend. »Erst redest du ständig davon, dass du mal über den eigenen Tellerrand hinausblicken und etwas Verrücktes tun willst, und dann kriegst du Schiss? Wolltest du Mommy und Daddy nicht mal so richtig schockieren?«
»Schon, aber …«
»Klar. Wer’s glaubt.« Lila schnaubte. »Mach, was du willst. Das tust du ja sowieso. Aber ich muss mit Luke reden. Unbedingt.«
»Hier?«
»Ist doch egal, wo.«
Bang! Bang! Bang! Bang! Bang!
»Was zum Teufel ist das denn? Etwa eine echte Waffe?«, flüsterte Rachel erschrocken.
»Nee, glaub ich nicht.«
»Was dann?«
»Scheiße. Das könnte Moretti sein. Nate hat gesagt, Max und er würden Böller mitbringen, um das Spiel ein bisschen realistischer wirken zu lassen. Als wäre es nicht so schon beängstigend genug.«
»Wie bitte?«
»Verrückt, nicht wahr?« Lila schien völlig unbeeindruckt. »Nate ist so ein Schwachkopf! Kein Wunder, dass er zweimal sitzen geblieben ist. Der Typ weiß nie, wann es genug ist. Er hat sogar einen von diesen Aufsätzen, die den Schuss lauter klingen lassen und Mündungsfeuer vortäuschen.«
Das wurde ja von Minute zu Minute schlimmer! Rachel kannte Nate. Den Sohn eines Arztes und Lukes bester Freund, obwohl die beiden auf der Highschool in verschiedenen Klassen gewesen waren. »Mensch, Lila, ich finde, wir sollten das Ganze abblasen …«
»Geht nicht. Ich muss mich mit Luke treffen.« Noch bevor Rachel weitere Argumente anbringen konnte, schlüpfte Lila durchs Tor, das einen Spaltbreit offen stand, in die Halle. Rachel folgte ihr, ein ungutes Gefühl im Magen.
Von innen wirkte die gewaltige Fischfabrik noch unheimlicher. Vielleicht spielte ihr auch nur die eigene Fantasie einen Streich, doch Rachel meinte, noch immer die Fischgedärme und -schuppen zu riechen, die hier entfernt und über offene Rutschen in den Fluss befördert worden waren, wo sich Seehunde, Seelöwen, Möwen und andere Nutznießer auf die blutigen Überreste gestürzt hatten.
Das bildest du dir nur ein. Die Fabrik ist schon seit Jahren nicht mehr in Betrieb.
Doch das beruhigte ihre aufgewühlten Nerven nicht.
Gleich hinter dem Tor blieb Rachel stehen und versuchte, sich zu orientieren. Niemand, nicht einmal Lila, wusste, dass sie zuvor schon einmal hier gewesen war, kurz vor Sonnenuntergang. Sie hatte sich in der alten Fabrik umgesehen, hatte sich die Örtlichkeiten eingeprägt, um sich zumindest einen kleinen Vorteil für später zu verschaffen. Mit zusammengekniffenen Augen spähte Rachel in die Dunkelheit. Sie hatte versucht, in Gedanken eine Art Gebäudeplan zu erstellen – potenzielle Gefahrenstellen, heimtückische Löcher im Fußboden oder Hindernisse wie verrostete Fässer, Leitern und Flaschenzüge inklusive. Obwohl sie die anderen nicht sehen konnte, hörte sie sie, weil sie miteinander flüsterten oder über die alten Dielen und Betonplatten hin und her huschten. Jemand kletterte eilig eine Metallleiter hinauf, ein anderer rannte über eine schmale Laufplanke über ihrem Kopf. Ihr Herz klopfte jetzt so laut, dass sie sich Mühe geben musste, all diese Geräusche wahrzunehmen.
Das hier waren ihre Freunde, rief sie sich in Erinnerung, Kids, mit denen sie zur Schule ging, wenn sie auch in unterschiedlichen Jahrgangsstufen waren. Es gab nichts, weswegen sie sich Sorgen machen musste … Rachel stieß sich von der Tür ab und wagte sich weiter in die Halle vor. Ihre Augen gewöhnten sich nur langsam an die Dunkelheit.
Plopp! Plopp! Plopp, plopp, plopp!
Hinter ihr wurde eine Softair-Waffe abgefeuert, Kunststoffkugeln sausten zischend durch die Luft.
Sie zuckte zusammen und wirbelte so schnell herum, dass ihr die Haare ins Gesicht flogen, als sie ihre Pistole auf – ja, worauf eigentlich? – richtete. Verflucht! Nun meinte sie, einen Schatten zu erkennen, der sich auf das leicht geöffnete Tor zubewegte. Sie zielte. Vor lauter Aufregung bekam sie kaum Luft. Sollte sie wirklich abdrücken? Ihr Finger verharrte über dem Abzug. Ein Schweißtropfen lief ihr übers Gesicht.
Könnte sie das wirklich tun? Mit einer Pistole auf einen anderen Menschen schießen? Trotz der unzähligen Warnungen und Mahnungen ihrer Eltern? Der Schweiß brach ihr aus allen Poren, ihre Kehle wurde staubtrocken. Das war doch Wahnsinn! Völlig irre!
Rachel ließ die Pistole sinken. »Lila, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee …«, fing sie mit kaum hörbarer Stimme an, doch Lila war verschwunden. Natürlich. Rannte wieder einmal Luke hinterher.
Sie drückte sich mit dem Rücken an einen Stapel Holzpaletten und versuchte krampfhaft, sich an die Haupttreppe und den Verlauf der Gänge über ihrem Kopf zu erinnern. Über den verbliebenen Fließbändern wölbte sich die Decke wie bei einer Kathedrale. Unter den Fließbändern waren die großen Löcher für die Rutschen zu sehen. Die Abdeckplatten aus Metall fehlten, das Wasser darunter glitzerte im blassen Mondlicht.
Rachel duckte sich, als eine weitere Schusssalve ganz in ihrer Nähe losging, dann stürmte sie unter die offene Treppe und spähte zwischen den Metallstufen hindurch.
Bamm! Bamm! Bamm! Irgendwer rannte in vollem Lauf nach oben.
Rachel zog sich eilig zurück, wobei sie stolperte und sich den Kopf an einem Stück herabhängendem Geländer stieß.
»Verdammt«, flüsterte sie, als sie mehrere Leute in ihrer Nähe rennen hörte, lachend, rufend. Weitere Schüsse fielen. Ihr Herz hämmerte, ihr Kopf pochte, dort, wo sie sich gestoßen hatte, und obwohl sie sich wie ein Mantra vorsagte, dass ihr nichts passieren würde, dass sie sich keine Sorgen machen musste, wurde sie einfach nicht ruhiger. Bestimmt würden ihre Eltern herausfinden, dass sie und Lila gelogen hatten. Rachel hatte behauptet, sie würde bei Lila übernachten, und umgekehrt. Lilas Mutter würde ja vielleicht noch mitspielen, aber Rachels Eltern auf keinen Fall. Trotz der bevorstehenden Scheidung würden sie sich zusammentun, um ihrer Tochter wegen ihres Ungehorsams und der Lügen die Leviten zu lesen. Wenn sie dann auch noch herausfänden, dass sie unbefugt in eine stillgelegte Fabrikhalle eingedrungen war, um mit anderen Kids herumzuballern … Nein, so weit durfte es nicht kommen.
Popp! Popp! Popp!
»Au! Verdammt noch mal!«, rief eine männliche Stimme verärgert. »Scheiße! Nicht ins Gesicht! Du bist tot, Hollander!« Nate Moretti. Stinksauer.
Weitere Schüsse. Lauter. Oder Böller? Mehrere Kids rannten an ihr vorbei. Hinter sich hörte sie eilige Schritte. »Raus hier!«, schrie jemand.
»Reva? Wo bist du?« Ein Mädchen … Mein Gott, wahrscheinlich Violet. »Reva! Mercedes!« Das Mädchen klang panisch.
»Vi?«, flüsterte Rachel. »Bist du das?« Die Pistole in ihrer Hand zitterte.
Jemand polterte die Treppen hinauf.
Schüsse … mit Mündungsfeuer.
Hier stimmte etwas nicht. Ganz und gar nicht.
»Rachel!« Violets Stimme. Diesmal näher. Knack! »Oh! Mist! Auuu! Verflucht!«
»Was ist?«
»Ich bin irgendwo gegen gerannt. Mein Gott, tut das weh! Mein Schienbein! Verdammt, ich glaube, ich blute.« Ihre Stimme zitterte. »Es ist so scheißdunkel hier drinnen«, jammerte sie mit tränenerstickter Stimme.
Plötzlich war sie neben Rachel und versteckte sich mit ihr unter der Treppe.
»Ich kann nichts sehen.« Sie schniefte. »Ich hätte meine Brille aufsetzen sollen.«
»Du hast deine Brille nicht auf?«, fragte Rachel ungläubig und starrte angestrengt in die Dunkelheit. Das ergab keinen Sinn. Nicht nur, dass Violet ohne ihre Brille blind wie ein Maulwurf war – die meisten Kids trugen Schutzbrillen, um ihre Augen vor den umherfliegenden Geschossen zu schützen.
»Nein. Ich wollte nicht, dass sie zerkratzt wird.«
Das war vermutlich gelogen. Violet schämte sich wegen ihrer Brille, aber es war jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um sie darauf anzusprechen.
Blamm! Definitiv keine Softair-Waffe.
»Lass uns abhauen«, sagte Rachel und setzte sich in Bewegung, ohne Violets Antwort abzuwarten. Sie hatte nicht vor zu bleiben, bis Lila zurückkam, und dadurch zu riskieren, dass sie verletzt wurde. Geräuschlos schlich sie unter der Treppe hervor und rannte zum Tor. Wenn es sein musste, würde sie zu Fuß nach Hause gehen, allein, in der Dunkelheit. Ein weiterer Kugelhagel. Funken. Böller, die wie echte Schüsse klangen.
»Ich komme mit«, rief Violet leise. »Autsch, mein Bein! Mist! Au, au! Aufhören!«
Das war doch verrückt. Rachel machte kehrt und griff nach Violets Arm. »Nun mach schon«, drängte sie und zerrte ihre Klassenkameradin durch die Halle, aber plötzlich standen sie unter Beschuss. »Schneller!«, schrie sie und beschleunigte ihre Schritte. Violet schrie auf vor Schmerz, und auch Rachel spürte, wie eine der Softair-Kugeln ihre Schulter streifte und eine zweite ihre Wange traf. »Verdammt!«
Eine neuerliche Salve.
Rachel überlegte nicht lange, hob die Pistole und gab einen Schuss ab, wobei sie weiter aufs Tor zuhielt.
Blamm! Blamm! Blamm!
Das Krachen von Feuerwerkskörpern und Schüssen hallte durch die alte Fabrik.
»Aaah!«, stöhnte eine männliche Stimme. »Was zur Hölle soll das? O Gott – ich bin getroffen!«
Luke?
Rachel erstarrte. Etwas in seinem Ton sagte ihr, dass er es ernst meinte.
Violet stieß einen schrillen, entsetzten Schrei aus.
Rachel zerrte das Tor auf. Der bläuliche Schein der Außenbeleuchtung fiel in die Halle. Sie wandte sich um und sah ihren Bruder zusammengekrümmt in der Nähe der Treppe stehen. Sein Gesicht war aschfahl. Mit weit aufgerissenen Augen starrte er auf einen Blutfleck, der sich ganz oben auf der Vorderseite seines Shirts ausbreitete.
Seine Knie gaben nach.
Er sackte zu Boden. Violets Schreie gellten durch die alte Fischfabrik.
Rachel ließ die Pistole fallen.
Kapitel eins
Edgewater, Oregon
Jetzt
Warum nicht?« Violet Sperry schenkte sich noch ein Glas Wein ein und ließ sich in die dicken Kissen auf ihrem Bett zurückfallen. Sie richtete die Frage an ihren kleinen Hund Honey, einen Cavalier King Charles Spaniel mit seidigem Fell, der ihr aus seinem Hundebettchen dabei zusah, wie sie die Flasche leerte. Als könnte der Hund sie verstehen. Aber alles war besser, als immer nur mit sich selbst zu reden. Zumindest ihrer Meinung nach. Oder war es verrückt, sich mit Honey zu unterhalten? Sie hatte das Fenster einen Spaltbreit offen gelassen, sodass nun eine milde Frühlingsbrise die Vorhänge bauschte und den Duft nach Geißblatt ins Schlafzimmer wehte, der sich mit dem schweren Aroma des Merlots vermischte.
Sie schwenkte das Glas und betrachtete lächelnd die kreisende dunkelrote Flüssigkeit, dann nahm sie einen weiteren Schluck von dem ach so entspannenden, süffigen Wein. Das war ihr letztes Glas, ganz bestimmt. Nein, sie würde nicht nach unten gehen und einen weiteren Merlot öffnen. Auf keinen Fall. Sie stellte die leere Flasche auf ihrem Nachttisch hinter der Lampe ab. Sie würde sie später entsorgen, das »Beweisstück« vernichten, morgen, bevor Leonard nach Hause zurückkehrte.
Leonard.
Ihr Ehemann seit über fünfzehn Jahren.
Einst ein schlanker, durchtrainierter Sportler mit einem fröhlichen Lächeln und vollem braunem Haar, war Leonard für sie ein Mann mit Zukunft gewesen, ein Mann, der es mit der ganzen Welt aufnehmen würde. Er hatte sie schier umgehauen, und er hatte ihr über das Trauma hinweggeholfen, das sie in der Nacht von Luke Hollanders Tod davongetragen hatte. Sie war da gewesen, vor zwanzig Jahren. Hatte ihn sterben sehen. Gott, war das schrecklich gewesen! Sie hätte niemals in die verdammte Fischfabrik gehen sollen. An jenem Abend hatte sie sich aus dem Haus geschlichen, nur um bei Luke Hollander zu punkten. Hatte sie wirklich vorgehabt, ihm zu beichten, dass sie sich in ihn verliebt hatte? Er hätte sie ja doch nur ausgelacht, außerdem war sie längst nicht die Einzige, die für Rachel Gastons Bruder – Halbbruder – schwärmte.
Schnee von gestern.
Gott sei Dank war das alles schon lange, lange her.
Und in der Zwischenzeit war sie Leonard begegnet, dem Mann mit den vielen Träumen.
Von denen kein einziger in Erfüllung gegangen war.
Ja, sie waren nach Seattle gezogen, wo er sich unter die Künstler hatte mischen wollen und sich sogar in eine Kunstgalerie eingekauft hatte. Doch dieses Luftschloss hatte sich kurze Zeit später tatsächlich in Luft aufgelöst – sie schmunzelte über das Wortspiel –, genau wie ihr Bestreben, als Sängerin groß herauszukommen. Zu mehr als ein paar Auftritten in schäbigen Kneipen hatte es nicht gereicht.
Es hatte einfach nicht sein sollen. Bei keinem von beiden.
Nach ein paar Jahren war Leonard endlich bereit gewesen – nein, er brannte förmlich darauf –, sich von seinen Träumen zu verabschieden, und sie waren nach Edgewater zurückgekehrt, in die Kleinstadt, in der sie aufgewachsen waren. Er hatte einen Job im Einrichtungshaus seines Vaters angenommen, und vorübergehend hatte es geheißen, er würde zunächst als Partner mit einsteigen und später »Sperrys Exklusivmöbel« übernehmen, doch auch aus diesem Plan war bislang nichts geworden. Sein Vater kam nach wie vor jeden Tag ins Einrichtungshaus und sah Leonard über die Schulter, der sein Bestes gab, um Beistelltische, Lampen und Freischwinger an die Loser zu verkaufen, die hier immer noch lebten.
Violet nahm einen weiteren Schluck Wein, um ihre zunehmende Unzufriedenheit hinunterzuspülen, und kuschelte sich in die Kissen, »die besten, die man für Geld bekommt«, genau wie die atmungsaktive Matratze, fest, aber nicht zu fest, dazu ein Lattenrost mit elektrisch verstellbarem Kopf- und Fußteil.
Einer der Vorteile, wenn man mit Leonard Sperry, Möbelverkäufer der Luxusklasse, zusammen war.
Schwachsinn.
Sie warf einen Blick auf ihr Handy. Lila hatte ihr eine Textnachricht geschickt. Mit zusammengekniffenen Augen las sie sie noch einmal: Nicht vergessen! Vorbereitung Jahrgangsstufentreffen. Bei mir. Morgen um 19.30 Uhr.
Als ob sie da hingehen würde.
Auf keinen Fall würde sie an dem dämlichen Jahrgangsstufentreffen teilnehmen, geschweige denn bei der Organisation mitmachen. Zwanzig Jahre nach dem Abschluss! Pah! Sie nahm einen großen Schluck Wein, dann löschte sie die Nachricht. Sie hatte Lila damals nicht gemocht, als sie noch Klassenkameradinnen gewesen waren, und sie würde sie auch jetzt nicht mögen. Jetzt wahrscheinlich sogar noch weniger, da Lila die soziale Leiter in Edgewater emporgeklettert und ein tragendes Mitglied der Gesellschaft geworden war. Als hätte sie etwas Entscheidendes geleistet für diese lächerliche Kleinstadt-Society, indem sie einen sehr viel älteren Rechtsanwalt heiratete und sich in der Organisation nerviger Wohltätigkeitsveranstaltungen übte. Ihr Ehemann war sogar steinalt und noch dazu der Vater eines ehemaligen Mitschülers, der ein paar Klassen über ihnen gewesen war. »Wie krank ist das denn?«, murmelte Violet in ihr Glas.
Und jetzt wollte Lila, dass sie bei der Organisation des Jahrgangsstufentreffens mitwirkte. Doch nicht nur Lila ging ihr gehörig auf den Geist. Diese dämliche Mercedes Jennings … nein, sie hatte jetzt einen anderen Nachnamen … Mercedes Pope, seit sie Tom Pope geheiratet hatte. Egal. Diese dämliche Mercedes Popewar Reporterin und wollte sie zu Luke Hollanders Tod befragen.
Nach zwanzig Jahren. Für irgendeine Retro-Story in der Lokalpresse.
Aber da würde Violet nicht mitmachen.
Auf gar keinen Fall.
Die Highschool mit all ihren Dramen, Tränen und Tragödien gehörte Gott sei Dank der Vergangenheit an. Sie war jetzt mit Leonard verheiratet und hatte drei entzückende Fellbabys … Sie blickte aus dem Fenster in die dunkle Nacht. Herrje, wann hatte sich ihr Leben eigentlich in einen solchen Schlamassel verwandelt?
Honey tappte durchs Schlafzimmer und blieb winselnd neben ihrer Bettseite stehen.
»Ach du«, sagte Violet und spürte, wie sich ihre Stimmung beim Anblick des schwanzwedelnden Hündchens schlagartig hob. »Kannst du nicht schlafen? Na los, spring rauf.« Sie klopfte auf die Bettdecke, und Honey zögerte nicht. Eilig gesellte sie sich zu ihrem Frauchen, als fürchte sie, dass Violet ihre Meinung ändern könnte. Was unwahrscheinlich war. Leonard war derjenige, der die Grenze zog, wenn es um Haustiere im Bett ging. »Da bist du ja.« Sie streichelte das kupferfarbene Fell des kleinen Spaniels.
Honey kuschelte sich zu ihr in die dicken Kissen und drückte sich an sie, während Violet durch die Kanäle zappte und schließlich bei einer Late-Night-Show hängen blieb. Auch wenn sie es nur ungern zugab – sie schlief nicht gut, wenn Leonard nicht in der Stadt war. Es war wirklich albern, aber sie fühlte sich einfach sicherer, wenn er neben ihr schnarchte. Ja, er hatte mittlerweile rund fünfzehn Kilo Übergewicht, und sein ehemals volles Haar war so dünn, dass er das, was davon noch übrig war, extrem kurz geschnitten hatte, aber immerhin hielt er es mit ihr und ihrer leicht aus dem Ruder gelaufenen – nein, arg aus dem Ruder gelaufenen – Vorliebe für Wein aus. Als sie ihm gesagt hatte, dass sie keine große Lust darauf habe, Kinder zu bekommen, war er einverstanden gewesen.
Stattdessen hatten sie nun ihre Hunde. Ihre Babys. Drei reinrassige Cavalier King Charles Spaniels. Honey und die beiden anderen, Che und Trix, die zusammengerollt in ihren aufeinander abgestimmten Bettchen neben dem Kleiderschrank in der Ecke schliefen. Violet beugte sich zur Seite, um ihr Glas auf dem Nachttisch abzustellen, aber es rutschte ihr aus der Hand. Der Wein schwappte über und ergoss sich aufs Bett und in die halb geöffnete Nachttischschublade.
»O nein!« Beinahe wäre sie ausgeflippt, doch dann beruhigte sie sich und beschloss, sich am Morgen um die Sauerei zu kümmern. Es waren ja ohnehin nur ein paar Flecken auf der Decke, sie würde einfach das Bett neu beziehen. Die Schublade ließe sich auch schnell auswischen. Leonard würde gar nichts davon mitbekommen.
Sie fühlte sich leicht beschwipst, aber das machte nichts, denn auch davon würde ihr Mann nichts merken. Entspannt nahm sie ihre Brille ab, legte sie auf den Nachttisch und schloss die Augen. Sie bekam kaum noch mit, wie der Moderator der Late-Night-Show den ersten Gast interviewte – eine Schauspielerin, deren neuer Film gerade in den Kinos anlief …
Honey richtete sich auf, ein leises Knurren drang aus ihrer Kehle.
»Schscht«, flüsterte Violet, die gerade erst eingedöst war, benommen.
Ein kurzes, scharfes Bellen.
Violet öffnete mühevoll ein Auge und blickte hinüber zu den Hundebettchen der beiden anderen Spaniels. Ohne Brille musste sie die Augen zusammenkneifen, um überhaupt etwas sehen zu können. Das Männchen mit dem seidig glänzenden schwarz-braunen Fell hatte den Kopf gehoben und blickte zur Tür. »Aus, Che!« Herrgott, was hatte er nur? Doch auch Trix, die für gewöhnlich so schüchterne Dreifarbige, knurrte und hatte die Augen fest auf die Schlafzimmertür geheftet.
Für eine Sekunde stieg Sorge in Violet auf, dass Leonard früher als geplant nach Hause gekommen sein könnte. Mist! Wie sollte sie so schnell das Glas und die Flasche verstecken, geschweige denn die Flecken beseitigen?
Eilig griff sie nach ihrer Brille. Augenblick mal. Wenn Leonard nach Hause gekommen wäre, würden die Hunde doch nicht knurren, sondern begeistert jaulen und bellen … Außerdem hatte sie gar nicht das Rumpeln des hochfahrenden Garagentors gehört.
Sie warf einen Blick auf den Wecker. Die Leuchtziffern zeigten 0.47 Uhr an.
Nein, ihr Ehemann würde niemals so spät zurückkehren, ohne sie zuvor anzurufen. Sie nahm ihr Handy vom Nachttisch und scrollte durch die Anrufe und Nachrichten. Nichts von Leonard.
Klunk.
Violet erstarrte.
Was war das für ein Geräusch, und woher kam es?
Aus dem Flur?
Aber die Hunde waren doch alle drei hier bei ihr!
Sie schluckte und stellte den Fernseher stumm. Der Moderator und sein Gast lachten aus vollem Halse, wenn auch komplett lautlos.
Violet spitzte die Ohren, doch sie hörte nichts.
Nur das Hämmern ihres eigenen Herzens.
Instinktiv spürte sie jedoch, dass etwas nicht stimmte.
Jetzt verlier bloß nicht die Nerven.
Alles blieb still, aber Honey neben ihr entspannte sich nicht. Ihre großen braunen Augen waren weiterhin auf die Tür geheftet, genau wie die der beiden anderen Spaniels.
Herrgott, diese verflixten Hunde trieben sie noch in den Wahnsinn!
Che knurrte.
Trix fletschte die Zähne.
Das war nicht gut. Gar nicht gut.
Aber vielleicht war ja gar nichts.
Nervös stand Violet auf und schloss das Fenster, dann versuchte sie, sich zu erinnern, ob sie unten alles abgeschlossen hatte. Ja, sie hatte sogar sämtliche Türen und Fenster überprüft. Hier konnte niemand rein … es sei denn, er quetschte sich durch die Hundeklappe in der Küchentür oder … O verdammt! Das Garagentor! Normalerweise war es zu, aber Leonard vergaß manchmal, es hinunterzulassen, wenn er aus der Garage setzte, und die Tür zwischen Haus und Garage war in der Regel unverschlossen.
Ihr Puls schnellte in die Höhe, doch sie drängte die Panik zurück, die sich in ihr breitmachte.
Kein Grund auszuflippen.
Noch nicht.
Sie fuhr sich mit der Zunge über die plötzlich trockenen Lippen, dann zog sie die weinbefleckte Schublade weiter auf und holte ihre Pistole heraus, die sie vorsichtig entsicherte. Ihre Gedanken schweiften zu dem Moment, in dem sie zum ersten Mal eine Waffe in der Hand gehalten hatte. Zu jener Nacht vor zwei Jahrzehnten. Doch damals hatte es sich um eine Softair-Pistole gehandelt. Diese Waffe hier war echt, eine Smith & Wesson Shield 9 mm, eine Halbautomatik, die echten Schaden anrichten konnte. Ihr Finger krümmte sich um den Abzug.
Ach du liebe Güte, was tat sie da bloß?
Sie schluckte und versuchte angestrengt, einen kühlen Kopf zu bewahren. Honey sprang aus dem Bett. »Bleib«, befahl sie leise, dann drehte sie sich zu den beiden anderen Hunden um, die ebenfalls aus ihren Betten gekommen waren, und zischte: »Bleibt!«
Es ist nichts. Die drei haben vermutlich nur die Nachbarn gehört … oder vielleicht eine Maus … irgendetwas, aber bestimmt keinen Einbrecher. Bitte, lieber Gott, mach, dass es kein Einbrecher ist!
Sie schlüpfte in ihre Pantoffeln und schlich zur Tür, wobei sie vor Aufregung über den Teppich stolperte und fast die verdammte Pistole hätte fallen lassen.
Reiß dich zusammen.
Che bellte erneut.
»Pst!«
Knarz.
Ein Knarren, gleich auf der anderen Seite der Tür.
Sie sollte die Polizei rufen.
Es war doch völlig egal, dass sie beschwipst – nein, betrunken – war und eine Schusswaffe in der Hand hielt, oder? Wäre es wirklich so schlimm, wenn sich herausstellte, dass sie sich alles nur eingebildet hatte?
Aber sie bildete sich nichts ein.
Die Hunde wussten ebenfalls, dass etwas nicht stimmte.
Angespannt starrten sie zur Tür.
Es ist nichts. Es ist nichts.
Die Pistole in der rechten Hand, streckte sie die linke aus, um vorsichtig den Knauf zu drehen und die Tür aufzuziehen. Mit angehaltenem Atem spähte sie in den Flur, den ein einzelnes Nachtlicht in einen dämmrigen Schimmer tauchte.
Sie schlüpfte aus dem Zimmer, schloss die Tür hinter sich und spähte mit zusammengekniffenen Augen in die Dunkelheit.
Nichts.
Keine huschenden Schatten, kein verräterisches Knarzen mehr.
Siehst du, du hast dir tatsächlich alles nur eingebildet.
Augenblick mal.
Die Tür zum zweiten Schlafzimmer, das sie als Gästezimmer benutzten und in dem Leonard manchmal schlief, wenn er wieder mal sehr spät nach Hause kam, stand einen Spaltbreit offen. Das war nicht so gewesen, als sie auf dem Weg ins Bett daran vorbeigekommen war.
Oder doch?
Ihre Nackenhärchen sträubten sich, als sie zur Tür huschte und sie langsam nach innen drückte. Die Angeln quietschten, Leonard musste sie dringend mal wieder ölen.
Violet machte einen Schritt ins Zimmer. Die Jalousien waren zur Hälfte hinabgelassen, das Licht von der Straßenlaterne vorm Haus fiel auf das Gästebett. Violet streckte den Arm aus und tastete nach dem Lichtschalter.
Bamm!
Die Tür prallte gegen sie.
Schmerz explodierte in ihrem Gesicht.
Ihr Nasenknorpel knackte.
Die Brille fiel zu Boden.
Blut spritzte.
»Auuu!«, schrie sie und hob die Pistole.
Starke Finger umklammerten ihr Handgelenk und drehten es.
Ihr Arm wurde taub, ihr Ellbogen fühlte sich an, als würde er jeden Augenblick brechen.
Sie zwang sich, den Finger zu krümmen und abzudrücken.
Blamm!
Mit einem ohrenbetäubenden Geräusch löste sich ein Schuss. Violet fuhr zusammen. Der Angreifer riss so fest an ihrem Arm, dass sie die Pistole fallen ließ. Vor Schmerz stieß sie einen spitzen Schrei aus und versuchte, sich seinem Griff zu entwinden, aber der Irre zog sie unerbittlich aus dem Zimmer. Violets Füße rutschten aus den Pantoffeln. Die Hunde – ihre Babys – bellten wie verrückt und kratzten an der Schlafzimmertür.
Sie wurde nach hinten gezerrt, ihre Fersen schleiften über den Teppich, vor ihren Augen hing ein blutiger Schleier. »Nein!«, jammerte sie, als sie mit dem Rücken gegen das Treppengeländer krachte. Sie blinzelte, versuchte, etwas zu erkennen, doch im selben Augenblick wurde etwas über ihre Augen gezogen. Eine Binde? O mein Gott, würde dieser Unmensch sie verschleppen und wollte nicht, dass sie mitbekam, wohin er sie brachte oder wie er aussah?
Die Angst schnürte ihr den Magen zu. Dieser Wahnsinnige hatte vor, sie zu vergewaltigen oder zu verstümmeln, und anschließend würde er sie umbringen, so viel stand fest.
Sie wehrte sich. Trat um sich, zerkratzte ihm voller Panik das Gesicht, versuchte, sich die Augenbinde abzustreifen, aber diese bewegte sich keinen Zentimeter. Als hätte er sie an ihrer Haut festgeklebt.
O Gott.
Blind und voller Panik kämpfte sie gegen den Angreifer an – vergeblich. Sie war noch immer betrunken, ihre Bewegungen wenig treffsicher.
Jetzt hob er sie hoch.
Nein!
Mit rauer Stimme fragte er: »Na, wie fühlt es sich an, wenn man blind ist?«
Was?
Und dann flog sie durch die Luft. Eine Hand streifte die Kette des Kronleuchters, die kleinen Kristalle klimperten. Sie wusste, dass sie binnen des Bruchteils einer Sekunde auf dem Marmorfußboden des Vorraums aufprallen würde.
Mit einem dumpfen Geräusch traf ihr Körper auf den exklusiven Stein.
Knochen brachen, ihr Schädel knackte. Mit einem zischenden Geräusch entwich sämtliche Luft aus ihren Lungen, ihre Zähne schlugen so fest aufeinander, dass sie abbrachen. Sie stieß ein leises Stöhnen aus und schmeckte das Blut, das sich in ihrem Mund sammelte.
O Gott.
Mit letzter Kraft versuchte sie, sich zu bewegen, doch es ging nicht.
Zum Glück senkte sich kurz darauf erlösende Schwärze auf sie herab.
Violet Sperry war tot.
Kapitel zwei
Blamm! Blamm! Blamm!
Schüsse hallen durch die Sea View Cannery.
Rachel drückt sich eng an die Wand. Die Schüsse klingen so echt. Nicht wie das Ploppen und Klackern der Softair-Waffen, sondern wie der Knall einer richtigen Pistole. Hier, in diesem riesigen verfallenen Gebäude, das nach fauligem Fisch und Schweiß riecht.
Blamm! Blamm!
Jemand schreit.
Sie blickt nach unten auf die Waffe in ihrer Hand.
O Gott!
Mit hämmerndem Herzen wirft sie die verfluchte Waffe weg. Sie schlittert über den Fußboden und fällt durch eine der Öffnungen auf die Rutsche und in den schnell fließenden Fluss unter ihr.
»Rachel?«, dringt Lukes Stimme an ihr Ohr, und sie sieht ihn. Er steht vor ihr, mit aschfahlem Gesicht, taumelnd, die Hand auf die Brust gedrückt, Blut dringt durch seine gespreizten Finger. »Warum?«, fragt er entgeistert und sackt zu Boden. »Warum hast du das getan?«
Nein. Schluss damit. Nein!
Ein neuerlicher Schrei, doch diesmal ist sie diejenige, die ihn ausstößt, als sie sieht, wie sich sein Gesicht in eine von Würmern zerfressene, fleischige Masse verwandelt.
Nein! Nein! Nein!
Rachel riss die Augen auf undstarrte an die Schlafzimmerdecke. Das einzige Licht im Raum kam von den Digitalziffern ihres Weckers, die einen bläulichen Schein warfen.
Fünf Uhr siebenunddreißig.
Beruhige dich. Es war nur ein Traum. Ein Albtraum. Derselbe, der dich zwei-, dreimal die Woche aus dem Schlaf reißt, in unterschiedlichen Varianten, wenn auch im Grunde gleich.
Sie stieß einen langen, zitternden Seufzer aus und strich sich die Haare aus den Augen. Im Haus war alles still. Totenstill. Nur das gelegentliche Gluckern der Heizung durchbrach die frühmorgendliche Ruhe. Jetzt hörte sie die alte Schrottkarre des Zeitungsboten die Straße heraufrumpeln, dann den dumpfen Aufprall auf der Fußmatte. Der Zeitungsbote fuhr weiter, begleitet von einer Reihe von Fehlzündungen.
Wenn sie doch nur endlich diese verfluchten Albträume loswerden könnte!
Zumindest hatte sie ihre Kinder nicht geweckt, und wie es schien, nicht einmal ihren Hund – einen langhaarigen, gelbbraunen Mischling, dessen Kopf an einen Boxer erinnerte, während die flauschigen Haare an seinen Beinen auf einen Australian Shepherd irgendwo in seinem Genpool hindeuteten. Seit dem Tag, an dem Cade zur Tür hinausmarschiert war, zählte Reno zur Familie. Rachel hatte den abgemagerten Welpen gerettet, und er wurde der Klebstoff, der die Familie in den ersten schmerzhaften Tagen und Wochen nach der Trennung zusammenhielt. Von der ersten Nacht an hatte er das Fußende des Bettes für sich beansprucht, und Rachel fehlte die Kraft, ihn in seinen Korb im Erdgeschoss zu schicken. Außerdem fühlte sie sich schlicht und einfach sicherer, wenn der Hund bei ihr schlief, jetzt, da Cade nicht mehr da war. Es gab Wichtigeres, als einen Hund auf seinen Platz zu verweisen, man sollte sich in erster Linie um die wichtigen Dinge kümmern, zumindest hatte ihr Vater das stets behauptet. Wahrscheinlich vertrat er diese Meinung noch immer, aber sie konnte sich nicht sicher sein, denn in letzter Zeit redete sie nicht mehr viel mit ihrem Dad.
Noch eine Sache, um die sie sich kümmern musste.
Als hätte sie nicht schon genug um die Ohren. Sie zog sich die Decke über den Kopf und vergrub das Gesicht im Kissen. Vielleicht konnte sie noch ein paar Minuten die Augen zutun und ganz vielleicht sogar noch mal eindösen, um den Schlaf nachzuholen, den die Albträume ihr raubten. Warum träumte sie zur Abwechslung nicht mal von etwas Schönem? Von einem Urlaub auf den Bahamas? Weihnachten bei ihren Großeltern? Oder von heißem Sex mit einem Schauspieler? Da fielen ihr gleich mehrere ein …
Doch das echte Leben torpedierte ihren Schlaf, und nachdem sich Rachel ein paar Minuten lang unruhig hin und her gewälzt hatte, griff sie nach ihrem Handy auf dem Nachttisch, wobei sie ein halb volles Glas Wasser umstieß. »Mist!« Der Morgen fing ja gut an. Sie blickte aufs Display, das neben der Uhrzeit auch das Datum anzeigte.
Kein Wunder, dass der Albtraum so echt gewesen war.
Heute vor zwanzig Jahren war es passiert.
Exakt an diesem Datum, zwei Jahrzehnte zuvor, hatte sie ihren Eltern weisgemacht, sie würde bei Lila übernachten, und dann hatte sie sich stattdessen in die alte Fischfabrik geschlichen.
Was der größte Fehler ihres Lebens gewesen war.
»Du musst damit klarkommen«, sagte sie laut zu sich selbst und starrte wie so oft im Dunkeln an die Decke. An Schlaf war nicht mehr zu denken.
Gähnend knipste sie die Nachttischlampe an. Warmes Licht durchflutete den kleinen Raum mit den schrägen Decken, den sie sich einst mit Cade geteilt hatte. Sie spürte einen Stich im Herzen, was sie ärgerte. Niemand konnte sie so in Rage versetzen wie ihr Ex.
Denk nicht an ihn!
Sie hatten zusammen dieses gemütliche, kleine Haus gekauft, und nachdem ihre Kinder zur Welt gekommen waren, hatten sie den Dachboden ausgebaut und sich hier ihr gemeinsames Schlafzimmer eingerichtet.
Die Zeiten sind vorbei, Rachel, hör auf, ständig darüber nachzugrübeln!
»Dummkopf«, schimpfte sie vor sich hin, dann zwang sie sich, sich auf den vor ihr liegenden Tag zu konzentrieren.
Den »Jahrestag« – oder wie auch immer die korrekte Bezeichnung lauten mochte. Todestag? Nein, das klang zu schrecklich – und als wäre dieser Tag nicht schlimm genug, hatte Lila für heute auch noch das letzte Treffen des Organisatorenteams »Zwanzig Jahre Highschool-Abschluss« anberaumt.
Wie krank war das denn?
Als Rachel sie auf die besondere Bedeutung des Datums hingewiesen und vorgeschlagen hatte, einen anderen Termin zu suchen, war kurz ein Schatten über Lilas hübsches Gesicht gehuscht. »Ich weiß«, sagte sie, die Stirn besorgt in Falten gelegt. »Aber das ist der einzige Abend, an dem es mir passt, das letzte Wochenende, an dem ich vor dem Jahrgangsstufentreffen überhaupt noch Zeit habe. Natürlich ist das nicht gerade günstig, aber …« – sie warf Rachel ein zittriges Lächeln zu und zuckte die Achseln – »… was soll ich tun? Es ist doch so lange her, Rach.«
Sie hatten unter dem ausladenden Vordach von Lilas Haus in Hanglage gestanden und die langen Schatten betrachtet, die die untergehende Sonne über die Hügel warf. Von hier aus überblickte man die Dächer der Stadt und das kalte, graue Wasser des Columbia River, auf dem mehrere Fischerboote zu sehen waren. »Für mich ist das auch schwer«, hatte Lila mit leiser Stimme zugegeben, womit sie Rachel einen kleinen Blick hinter ihre ansonsten stets muntere Fassade gewährte.
Rachel wusste das. Lila war nie ganz über Luke hinweggekommen, und zwar aus einem offensichtlichen Grund: Vor zwanzig Jahren, kurz vor Weihnachten, hatte sie Lukes Sohn auf die Welt gebracht.
»Wir müssen nach vorn blicken, Rach«, hatte Lila gesagt und sich zu ihrer Freundin umgedreht. Das Licht der letzten Sonnenstrahlen fing sich in ihren blonden Haaren. »Wenn ich das kann, dann können das alle, auch du.«
Rachel hatte nicht widersprochen. Wozu auch? Lila hatte ja recht. Sie hatte nach vorn geblickt, und nicht nur das: Sie war mit Cades Vater zusammengezogen und hatte ihn schließlich sogar geheiratet – einen Mann, der mehr als doppelt so alt war wie sie. Obwohl sie einen Sohn von Luke hatte – einen Jungen, dem auf ewig die Chance verwehrt bliebe, seinen Vater kennenzulernen.
Deinetwegen.
Weil du deinen Bruder getötet hast.
»Nein«, sagte sie laut.
In weniger als einem Monat würde sie das verfluchte Jahrgangsstufentreffen hinter sich gebracht haben, und dann – o bitte, lieber Gott –, dann konnte sie vielleicht ihr Leben weiterleben. Heute war ein Tag wie jeder andere. Einfach nur irgendein Tag. Und sie würde heute Abend zum Treffen des Organisationsteams gehen, selbst wenn es sie umbrächte. Sie durfte nicht zulassen, dass dieser eine furchtbare Fehler sie für den Rest ihres Lebens verfolgte.
Zwei Jahrzehnte waren lang genug.
Sie warf einen neuerlichen Blick auf die Digitalanzeige ihres Weckers.
Noch keine sechs.
Jeden Morgen wachte sie um dieselbe Zeit auf. Ein paar Minuten, bevor der Wecker losging und sie zur Musik ihres Lieblingsradiosenders aus dem Bett scheuchte. Was ein Witz war. Alles war ein Witz. Seit sie den Wecker vor zwei Jahren gekauft hatte – einen Tag, nachdem Cade ausgezogen war –, war sie nicht ein einziges Mal von einem Song, den Nachrichten, dem Verkehrsbericht oder gar Werbung geweckt worden. Nein, sie war stets schon vorher wach, fast immer aus dem Schlaf geschreckt von einem ihrer Albträume.
Aus Gewohnheit stellte sie den Wecker aus, dann rollte sie sich aus dem Bett und wäre auf dem Weg zum Fenster beinahe auf Reno getreten, der sich heute auf dem Bettvorleger zusammengerollt hatte. In letzter Sekunde wich sie dem Hund aus und spähte durch die Vorhänge in den Garten hinunter.
Eingezäunt.
Sicher.
Jeden Abend, bevor sie zu Bett ging, überprüfte sie, ob die Fenster und Türen auch wirklich fest verschlossen waren. Drei Schlösser plus drei Bolzenriegel. An der Haustür, an der Hintertür und an der Glasschiebetür zur Terrasse. Außerdem sechzehn Schlösser an den Fenstern, wenn man die im Keller mitzählte. Jedes war mehr als ausreichend gesichert.
Der Garten lag friedlich in der frühmorgendlichen Dämmerung. Konzentriert suchte Rachel Quadratmeter für Quadratmeter ab, um sich zu vergewissern, dass dort draußen keiner hinter den Sträuchern und Bäumen lauerte, die den fleckigen Rasen einrahmten.
Niemand spähte durch die Zweige der großen Tanne, niemand drückte sich verstohlen an die Garagenwand.
Reiß dich zusammen.
Aber das gehörte zu ihrer Morgenroutine.
»Sauber«, stieß sie mit einem Anflug von Erleichterung hervor, dann drehte sie sich zu dem Hund um, der aufgestanden war und sich ausgiebig streckte. »Bereit, den Tag in Angriff zu nehmen?« Sein Schwanzwedeln war Antwort genug.
Rachel tappte ins Bad und spritzte sich kaltes Wasser ins Gesicht, anschließend betrachtete sie stirnrunzelnd ihr Spiegelbild. Ihre Haare waren zerzaust, die widerspenstigen rotbraunen Locken nur mühsam von einem Gummi oben am Hinterkopf gebändigt. Einzelne Strähnen hatten sich während der unruhigen Nacht daraus gelöst und hingen ihr ins Gesicht.
Plötzlich überfiel sie eine ungewollte Erinnerung. Vor ihrem inneren Auge reiste sie ein paar Jahre zurück und sah sich, nur in BH und Höschen, vor dem breiten Spiegel über dem Doppelwaschbecken stehen. Ein warmer Sprühnebel füllte das Badezimmer, als Cade aus der Duschkabine trat und sie von hinten umarmte. Seine Finger glitten unter ihren Tanga und zogen ihn langsam herunter, während er ihren Nacken mit Küssen bedeckte.
»Machst du Witze?«, hatte sie mit einem leisen Lachen gefragt.
»Was denkst du denn?«
In dem beschlagenden Spiegel sah sie, wie er mit einem schiefen Grinsen eine seiner schwarzen Augenbrauen in die Höhe zog. Er überragte sie um fast einen Kopf, seine Haut war einige Nuancen dunkler als ihre, seine Muskeln waren wohldefiniert, die Züge scharf geschnitten unter dem dunklen Bartschatten. Seine haselnussbraunen Augen blickten sie voller Leidenschaft an.
Allein wenn sie daran dachte, verspürte sie ein Kribbeln.
Sex.
Wie sehr sie es vermisste.
Wie sehr sie ihn vermisste.
Und genau das machte ihr zu schaffen.
Ja, sie vermisste ihn. Auch wenn sie sich das eigentlich nicht eingestehen wollte. Sie hasste es, wie sehr sie sich wünschte, er würde zu ihr zurückkehren. Jämmerlich. Sie nahm ihre Zahnbürste, drückte Zahnpasta auf die Borsten und putzte sich so energisch die Zähne, dass sie beinahe den Schmelz von den Schneidezähnen geschabt hätte. Wieso wollte sie den Kerl eigentlich zurückhaben?
»Loser«, schäumte sie, den Mund voller Zahnpasta. »Betrüger.« Sie hielt den Mund unter den Wasserhahn und spülte gründlich aus, dann warf sie einen neuerlichen Blick in den Spiegel. Diesmal sah sie zum Glück weder Cades markante Züge noch seinen wie gemeißelt wirkenden Körper vor sich – nur ihr eigenes Gesicht. »Gut. Bleib bloß weg.« Als sie bemerkte, dass sie wieder einmal mit ihrem Ex-Mann sprach, zog sie genervt die Augenbrauen zusammen. »Du bist einfach zu doof!« Jetzt sprach sie mit sich selbst, was auch nicht viel besser war. Kein Wunder, dass sie immer noch zur Psychotherapie musste. Nachdem Cade zur Haustür hinausmarschiert war, hatte sie sich in Behandlung begeben.
Er ist nicht ganz freiwillig gegangen. Du hast ihn förmlich hinausgeschubst, vergiss das nicht.
Beklommen öffnete sie den Medizinschrank, nahm ein Röhrchen Antidepressiva vom obersten Regal und schüttelte eine Tablette in ihre offene Handfläche. Sie wollte das Röhrchen gerade wieder verschließen, als sie stutzte. Sie zählte die verbliebenen Tabletten. Fünf Stück. Waren nicht mehr darin gewesen? Sie meinte, sich zu erinnern, dass das Röhrchen noch fast voll gewesen war, als sie die Einnahme unterbrochen hatte. Nachdenklich kaute sie auf ihrer Unterlippe. Konnte sich nicht mehr genau erinnern. Ja, laut Apothekenaufkleber hatte man ihr dreißig verschrieben, die sie ein, zwei Wochen lang täglich genommen hatte, und dann hatte sie damit aufgehört, weil sie mithilfe von Medikamenten ihr eigentliches Problem nicht wirklich in den Griff bekam. Sie hätte schwören können, dass noch ungefähr die Hälfte hätte da sein müssen, die Dosierung für einen halben Monat, ungefähr fünfzehn.
Oder irrte sie sich?
Die letzten Wochen waren ausgesprochen stressig gewesen, und ab und zu hatte sie vielleicht doch einmal eine Tablette zur Unterstützung eingenommen, deshalb waren nur noch so wenige übrig.
Oder?
Es würde doch wohl niemand in ihr Badezimmer eindringen und ihre Tabletten wegnehmen! Noch dazu einzeln. Ein Dieb würde mit Sicherheit das ganze Röhrchen einstecken.
Es sei denn, Harper oder Dylan hätten sich daran vergriffen. Nein, das konnte nicht sein. Ihre Kids würden sich doch niemals an ihren Medikamenten bedienen, und deren Freunde genauso wenig. Das waren lauter ganz normale Teenager. »Nein, ganz bestimmt nicht«, murmelte sie ihrem Spiegelbild zu. Doch in ihren Augen stand Sorge.
Konnte sie sich da wirklich so sicher sein?
Jetzt sind noch sechs Stück da. Merk dir das.
Sie ließ die Tablette zurück in das Röhrchen gleiten und drückte den Deckel zu, anschließend schloss sie den Medizinschrank. Fakt war, dass ihre Kinder mehr und mehr zu Fremden für sie wurden – zu Fremden mit Geheimnissen, nicht länger abhängig, nicht länger bereit, die Wahrheit hinauszuposaunen, wenn sie sie unter Druck setzte.
Typisch Teenager.
Aber es fehlen Antidepressiva.
Unsicher zog sie ihr Oversize-Shirt aus, das sie nachts trug, und schlüpfte in ihre Laufsachen: Sport-BH, Langarm-Shirt und Leggins. Anschließend eilte sie auf Socken die Treppe hinunter und blieb vor Harpers Zimmertür stehen.
Alles war ruhig.
Vorsichtig drückte Rachel die Tür einen Spaltbreit auf und warf einen Blick in das Zimmer, dessen Wände sie erst kürzlich in verschiedenen Grautönen gestrichen hatten. Harpers Zimmer war ordentlich, von dem organisierten Chaos aus Flaschen, Pinseln und Tuben auf dem Schminktisch mal abgesehen. Ihre Tochter lag schlafend im Bett, ein Arm hing über die Kante, das blonde Haar fiel ihr wirr ins Gesicht. Harper schlief tief und fest, die Ohrstöpsel noch immer eingesteckt.
Rachel zog vorsichtig die Tür zu, dann ging sie durch den Flur zum Zimmer ihres Sohnes. Ohne das BETRETEN-VERBOTEN-Schild und das alberne Polizeiband zu beachten, drehte sie den Knauf und spähte hinein. Dylan war in seine verknautschte Bettdecke gewickelt, nur sein zerzauster Schopf schaute oben heraus. Der Fußboden war übersät mit Limo- und Vitaminwasserflaschen, zusammengeknüllten Junkfood-Verpackungen und Game Controllern, auf seinem Schreibtisch standen mehrere Computer sowie umfangreiches Gaming-Equipment, von einer Staubschicht überzogen.
Sie würde einen Bagger brauchen, um da durchzukommen, sollte sie jemals beschließen, sein Zimmer sauber zu machen.
Nein, das musste er schon selbst erledigen, immerhin war es sein Zimmer.
Aber Dylan hatte recht mit dem polizeilichen Absperrband: Sein Zimmer sah wirklich aus wie ein Tatort. Unter all dem Müll konnte man locker ein paar Leichen verstecken.
Zeit, etwas daran zu ändern.
Rachel schloss leise die Tür hinter sich, dann vergewisserte sie sich, dass sie ihre Taschenlampe und das Pfefferspray bei sich hatte, kontrollierte noch einmal die Haustür und ging anschließend durch die Küche und durch die Hintertür auf die Veranda, die mit einem Fliegengitter eingezäunt war. Nach einem weiteren wachsamen Blick in den Garten ließ sie Reno hinaus. Während der Hund schnüffelnd über das taufeuchte Gras rannte, schlüpfte Rachel in ihre Laufschuhe und streckte sich. Zum Schluss zog sie ihre Jacke über und nahm die Hundeleine von dem Haken neben der Hintertür, die sie fest hinter sich ins Schloss zog. Sie wünschte sich, die alte Alarmanlage hätte noch funktioniert.
Rachel leinte den Hund an und trat durchs Gartentor auf die Straße, dann setzte sie sich langsam in Bewegung. Nach ein, zwei Minuten fiel sie in einen schnellen Lauf, Reno an ihrer Seite. Langsam wich die Anspannung der Nacht von ihr.
Die Luft war regenschwer, die Straßen feucht, am Himmel standen trotz der aufziehenden Morgendämmerung noch immer einige Sterne. Außer ihnen beiden war kaum jemand unterwegs, nur ein paar Leute, die mit ihren Hunden Gassi gingen, Zeitungsboten und andere Jogger. Sie lief durch ein Viertel mit Häusern, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden waren, als die Holzwirtschaft mit ihren Sägemühlen sowie die Fischindustrie ihre Blütezeit erlebten. Ein paar hatten sich Anbauten leisten können, die meisten nicht. Der Wirtschaftsaufschwung nach dem Krieg war bald vorbei gewesen, und heute war Edgewater längst nicht mehr eine attraktive, geschäftige Kleinstadt, sondern eher eine Pendlerstadt für das rund zehn Meilen weiter westlich an der Mündung des Columbia River gelegene Astoria.
Rachels Familie lebte seit Generationen hier, und vielleicht war das der Grund dafür, warum Rachel geblieben war. Allerdings war es durchaus möglich, dass sich das bald änderte, jetzt, da sie dringend einen Job brauchte, dachte sie und duckte sich unter dem tief hängenden Zweig einer Tanne hindurch, die Augen auf den buckligen, rissigen Gehsteig geheftet.
Auf dem Highway, der parallel zum Fluss verlief, herrschte nur wenig Verkehr, weshalb Reno und sie ihn überquerten und über den Parkplatz eines Bootshandels zu dem Fahrradweg joggten, der direkt am Ufer entlangführte. Ein Tanker kam flussaufwärts getuckert, immer wieder wurde der massive Bootskörper von dem dichten Nebel verschluckt, der über der Wasseroberfläche hing. Weiter nördlich, am gegenüberliegenden Ufer, blinkten ein paar Lichter.
Diese Tageszeit mochte Rachel am liebsten, die wenigen ruhigen Momente vor Anbruch der Morgendämmerung, wenn die Dämonen der Nacht aus ihrem Bewusstsein verschwanden.
Mein Gott, sie war wirklich verrückt.
Kein Wunder, dass Cade etwas mit einer anderen Frau angefangen hatte.
Schon wieder Cade. »Schluss damit.«
Sie biss die Zähne zusammen und zwang sich, schneller zu laufen. Auch Reno neben ihr legte an Tempo zu, seine Ohren flatterten.
Trotz der kühlen Temperatur begann sie zu schwitzen. Nach wenigen Minuten gelangte sie zu der großen Kurve, hinter der man zu Abe’s Diner gelangte, das die ganze Nacht über geöffnet hatte. Auch die alte Fischfabrik kam in Sicht, oder vielmehr das, was davon übrig geblieben war: ein zerfallendes Ungetüm auf fauligen Stützpfählen, umgeben von einem verrosteten, durchhängenden Maschendrahtzaun – derselbe Zaun, durch den sie vor so vielen Jahren geschlüpft war. Die Anspannung von vorhin kehrte zurück.
Zwanzig Jahre.
Und noch immer wurde sie heimgesucht von dem, was damals geschehen war.
Noch immer lief sie jeden Morgen hierher, um die Sea View Cannery anzustarren, als würde sie ihr eines Tages die Antworten auf die Fragen liefern, die sie nun schon ihr halbes Leben lang quälten. Wie wahrscheinlich war es, dass sie eines Tages endlich aufgeben und einen anderen Weg einschlagen würde?
Wie jeden Morgen ging sie die Szene von damals in ihrem Kopf durch.
»Ich muss mit Luke reden. Unbedingt«, hatte Lila beharrt, als sie sich an jenem Abend von zu Hause fortstahlen, um sich mit ihren Highschool-Kameraden in der alten Fischfabrik zu einem dämlichen Ballerspiel zu treffen. »Es ist wirklich, wirklich wichtig, und ich will, dass du mitkommst.«
»Ich könnte draußen warten.«
»Klar. Das dachte ich mir schon. Aber ich habe keine Ahnung, wie lange ich da drin sein werde. Ich muss ihn erst mal finden, und es ist so verdammt dunkel. Taschenlampen sind nicht erlaubt. Und außerdem hast du doch eine Waffe – die, die Luke dir gegeben hat.«
»Ja.« Rachel dachte an die Softair-Pistole in ihrem Rucksack.
»Du musst ja nicht bei dem Spiel mitmachen. Es ist nur so … ich brauche dich heute Nacht. Ich will da nicht allein rein.« Lila hatte sich sorgenvoll auf die Unterlippe gebissen, als fürchte sie, Rachel würde sie im Stich lassen.
»Na gut, dann komme ich eben mit«, hatte Rachel eingelenkt, den brackigen Geruch des Flusses in der Nase.
Das war der größte Fehler ihres Lebens gewesen.
Als sie jetzt auf den riesigen Komplex am und über dem Wasser zurannte, kam er ihr noch größer und bedrohlicher vor als sonst. Das Gelände war verkauft und wieder verkauft worden, doch aufgrund der Grundstücksnutzungsvorschriften und juristischer Schwierigkeiten war es nie neu erschlossen worden. Das sollte sich bald endlich ändern, wie der große VERKAUFT-Aufkleber auf dem verblichenen ZU-VERKAUFEN-Schild mit Lila Ryders Foto und Telefonnummer verkündete. Seltsam, dass ausgerechnet sie die Immobilie verkauft hatte, die ihrer aller Leben für immer verändert hatte. Aber so war es nun mal. So wie Rachel es verstanden hatte, hatte im vergangenen Jahr ein Investor den Antrag gestellt, auf dem Gelände der ehemaligen Fischfabrik Büros, Restaurants und Geschäfte errichten zu dürfen, geplant waren auch exklusive Eigentumswohnungen zur Flussseite. Schön. Es war höchste Zeit, dass das alte Monstrum etwas Neuem wich, vielleicht würden dann auch endlich der Schmerz und die Schuldgefühle verschwinden. Möglicherweise hatte Lila genau das im Sinn gehabt.
»Hoffentlich kommt bald die Abrissbirne«, sagte Rachel, während sie ihr Tempo verlangsamte und schließlich ganz stehen blieb, um die Halle zu betrachten, in der Luke ums Leben gekommen war.
Mit knirschenden Zähnen starrte sie auf das bedrohlich wirkende, baufällige Gebäude. Sie spürte, wie ihr die Galle hochkam – wie immer, wenn sie an jene Nacht zurückdachte. Und trotzdem zwang sie sich Tag für Tag, diesen verfluchten Weg entlangzujoggen, um vor den verwitterten Wänden der Sea View Cannery haltzumachen. Das war ihre Buße. Die sie sich selbst auferlegt hatte. Weil sie ihren Bruder getötet hatte.
Trauer und Schuldgefühle schnürten ihr die Kehle zu.
»Komm«, flüsterte sie schließlich dem Hund zu und riss den Blick von der baufälligen Halle los.
Reno, der die tägliche Routine kannte, warf sich herum und rannte bereits in Richtung eines Trampelpfads, der sie auf den eigentlichen Weg zurückbringen würde, als Rachel plötzlich einen schwarz gekleideten Mann bemerkte, der ein Stück weit hinter ihr stand. Reglos. Als wäre auch er stehen geblieben, um die Fischfabrik zu betrachten.
Das ist nichts Besonderes, redete sie sich ein. Viele Leute benutzen diesen Weg, das ist doch nicht ungewöhnlich. Trotzdem setzte sie sich in Bewegung und lief eilig weiter. Der Hund und sie rannten über einen leeren Parkplatz, durch dessen Asphalt jede Menge taunasses Gras wucherte, dann gelangten sie zu dem Trampelpfad, der noch immer aufgeweicht und rutschig war nach dem kräftigen Regen vor ein paar Tagen. Die Sonne ging gerade hinter den Bergen im Osten auf, warmes Licht brachte das Wasser zum Funkeln, der Nebel um sie herum hob sich, und die Straßenlaternen erloschen, als sie zum Stadtrand zurückkehrte und durch zwei Seitenstraßen zur Hauptstraße lief.
Der Mann in Schwarz folgte ihr nicht.
Natürlich nicht.
Rachel bog um eine letzte Ecke und ging im Schritttempo weiter. Als sie das vertraute Neonschild erblickte, trat ein Lächeln auf ihr Gesicht. Zwischen einem Versicherungsbüro und einer Pizzeria in einem alten Hotel, das man in Geschäftsflächen umgewandelt hatte, lag ihr Lieblings-Coffeeshop. Das hell erleuchtete Schild über der Markise zeigte eine große Kaffeetasse, über deren Rand weißer Dampf emporstieg. Darunter standen die Worte THEDAILYGRIND.
Ein Leuchtfeuer für die Einheimischen, die sich auf einen frisch gemahlenen Kaffee am frühen Morgen freuten.
»Ich bin gleich wieder da«, sagte sie zu dem Hund, wie sie es immer tat, wenn sie ihn an der Bank anleinte. Einige Männer, die draußen saßen und an ihren dampfenden Tassen nippten, tauschten Blicke aus und musterten sie mit hochgezogenen Augenbrauen.
Anstrengend.
Inzwischen war sie längst an neugierige Augenpaare oder geflüsterte Seitenbemerkungen gewöhnt. Vor ein paar Jahren hatte sie Dylan einmal nebenan zum Friseur gebracht, als sie plötzlich das Gespräch von zwei Frauen mitbekam, die gerade einen Laden in der kleinen Einkaufszeile verließen.
»Das ist sie … du weißt schon, die, von der ich dir erzählt habe.«
Rachel hatte einen Blick über die Schulter geworfen und die Größere der beiden tatsächlich dabei ertappt, wie sie mit dem Finger auf sie deutete.
»He!«, hatte sie empört gerufen, doch die Frau, etwa Mitte fünfzig, blieb völlig gelassen, warf Rachel einen abschätzigen Blick zu und ging zur Fahrerseite eines betagten Kombis.
»Sie hat ihren Bruder in der alten Fischfabrik abgeknallt, unten am Fluss.«
»Die war das?« Die jüngere Frau starrte Rachel durch ihre getönte Brille mit großen Augen an.
»Ja. Keine Ahnung, wie sie damit durchgekommen ist. Hat behauptet, es sei ein Unfall gewesen. Die anderen Kids, die mit ihr da waren, haben ihre Aussage bestätigt. Die haben wohl alle irgend so ein krankes Ballerspiel gespielt. Der Vater hat damals bei der Polizei gearbeitet. Als Detective. War wohl als Erster am Tatort.« Die Frau schloss den Wagen auf und schnalzte mit der Zunge. »Eine gottverdammte Schande war das, wenn du mich fragst.« Ihre Freundin stieg in den Chevy, doch sie blieb vor der offenen Tür stehen und starrte Rachel herausfordernd an.
»Wie kann sie nur damit leben?«, fragte ihre Freundin von innen und zog die Beifahrertür zu.
»Das weiß nur Gott, der Herr, allein.«
»Mom?«, hatte Dylan gefragt und Rachel am Arm gezupft.
Anstatt vor den Augen ihres Sohnes eine Szene zu machen, hatte Rachel ihn in den Salon geschoben, wo der Friseur schon wartete. Aufgewühlt hatte sie durch die Fensterscheibe dem Wagen nachgesehen, der langsam vom Parkplatz fuhr und sich in den Verkehr einreihte. Selbst jetzt noch, mindestens fünf Jahre später, spürte sie, wie ihr die Erinnerung daran die Zornesröte ins Gesicht trieb.
Sie hatte keine der beiden Frauen gekannt.
Die Jüngere hatte sie seitdem nicht wiedergesehen, nur die Ältere ab und an, wenn sie mit ihrem alten Kombi durch die Stadt fuhr.
Doch jeder in dieser kleinen Stadt wusste über Rachel Bescheid. Über jene schicksalhafte Nacht.
Niemand schien zu vergessen.





























