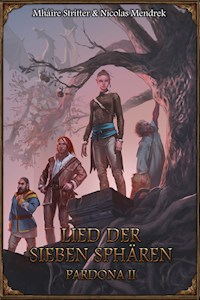Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ulisses Spiele
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Schwarze Auge
- Sprache: Deutsch
Lange vor der Zeit der Menschen herrschen die Hochelfen über Aventurien. Im lebensfeindlichen Eis des Nordens errichten sie den Himmelsturm, ein gewaltiges Monument ihrer Fähigkeiten. Das Dasein der Bewohner dreht sich um Forschung, Kunst und den Kampf gegen das Böse in Gestalt des Namenlosen Gottes. Doch als die mysteriöse Elfe Amadena im Turm erscheint, verändert sich das Leben der Elfen schlagartig. Amadena hinterfragt alles, wofür die elfische Kultur steht. Ihre kühnen Ideen ziehen schon bald den jungen Acuriën in ihren Bann – und zu spät erkennt er, dass Amadenas Ziel nichts anderes ist als der Untergang des gesamten Elfenvolkes. Die Pardona-Trilogie erzählt über einen Zeitraum von 5.000 Jahren die Geschichte einer der bekanntesten bösen Figuren Aventuriens und enthüllt, dass alle ihre Taten einem höheren Ziel dienten. Die Reihe führt durch die aventurische Geschichte, während sich eine epische Geschichte entfaltet, und eignet sich deswegen auch sehr gut für Neulinge in der Welt des Schwarzen Auges. Erster Teil einer epischen Trilogie um eine der bekanntesten Figuren aus der Welt des Schwarzen Auges.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 423
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Ulisses SpieleBand: US25733Titelbild: Dagmara MatuszakAventurien-Karte: Daniel JödemannRedaktion: Nikolai HochLektorat: Frauke ForsterKorrektorat: Claudia WallerUmschlaggestaltung und Illustrationen: Nadine Schäkel, Patrick SoederLayout und Satz: Nadine Hoffmann, Michael Mingers
Administration: Christian Elsässer, Carsten Moos, Sven Paff, Stefanie Peuser, Marlies Plötz Marketing: Philipp Jerulank, Björn Meyer, Katharina WagnerVerlag: Zoe Adamietz, Jörn Aust, Mirko Bader, Steffen Brand, Simon Burandt, Christiane Ebrecht, Frauke Forster, Christof Grobelski, Kai Großkordt, Nikolai Hoch, Nadine Hoffmann, Johannes Kaub, Arne Frederic Kunz, Matthias Lück, Susanne Majewski, Thomas Michalski, Markus Plötz, Elisabeth Raasch, Nadine Schäkel, Maik Schmidt, Ulrich-Alexander Schmidt, Nils Schürmann, Alex Spohr, Jens Ullrich, Jan Wagner Verlag USA: Bill Bridges, Timothy Brown, Darrell Hayhurst, Eric Simon, Ross Watson Vertrieb: Stefan Heinrichs, Jan Hulverscheidt, Thomas Schwertfeger, Stefan Tannert, Anke Zimmermann
Copyright © 2021 by Ulisses Spiele GmbH, Waldems. DAS SCHWARZE AUGE, AVENTURIEN, DERE, MYRANOR, RIESLAND, THARUN, UTHURIA und THE DARK EYE sind eingetragene Marken der Ulisses Spiele GmbH, Waldems.
Titel und Inhalte dieses Werkes sind urheberrechtlich geschützt. Der Nachdruck, auch auszugsweise, die Bearbeitung, Verarbeitung, Verbreitung und Vervielfältigung des Werkes in jedweder Form, insbesondere die Vervielfältigung auf photomechanischem, elektronischem oder ähnlichem Weg, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Ulisses Spiele GmbH, Waldems, gestattet.
Mháire Stritter
Kind des Goldenen Gottes
Pardona I
Ein Roman in der Welt von Das Schwarze Auge©
Originalausgabe
Mit Dank anBernhard Hennen
Prolog
Was Amadena sah, als sie die Augen öffnete, waren eine blinde Frau und ein goldener Mann mit einer Krone, die ihm einem Geweih gleich aus dem Schädel wuchs. Über ihnen stand der Nachthimmel, umrahmt von Türmen und Pyramiden aus Stein, und sie erblickte zum ersten Mal die Sterne. Jenseits der Lichter lag eine Schwärze, eine unauslotbare Tiefe. Schwindel erfasste sie und zugleich ein Hochgefühl. Sie streckte die Hand aus und musste erkennen, dass die Sterne zu fern waren, um sie berühren zu können.
Die Frau, die nicht ihre Mutter war und sie dennoch geschaffen hatte, war von Trauer getrieben. Sie hatte zuvor ihr einziges Kind verloren und sprach sanft und nachdenklich zu Amadena. Sie unterrichtete sie über die fey, die aus Traum und Licht in diese feste und unnachgiebige Welt gekommen waren. Sie sprach von den fenvar, die die restlichen fey hinter sich gelassen und die Welt und all ihren Schmerz umarmt hatten, Städte errichteten und Reiche gründeten. Sie malte aus Licht die sieben Sphären der Schöpfung und ihre Bedeutung, vom Gesetz der Welten im Ursprung bis zum mahlenden Chaos der endlosen 7. Sphäre. Ihre blinden Augen jedoch waren auf ferne Dinge gerichtet, und ihre Aufmerksamkeit wanderte rasch, als ihre suchenden Hände auf Amadenas Gesicht nicht zu finden schienen, was sie hoffte zu erkennen.
Der goldene Mann, der nicht ihr Vater war und dessen wahre Gestalt aus goldenem Panzer und riesigen Schwingen die größte Pyramide der Stadt füllte, hatte aus Ehrgeiz gehandelt. Die meisten seiner Art hatten diese Sphäre verlassen, und obwohl er verehrt wurde und ihm jeden Tag Reichtümer dargeboten wurden, fraß etwas an seinem Herzen. Wenn er zu Amadena sprach, dann über die Dinge, die sie für ihn vollbringen sollte. Die Städte, deren Schlüssel sie ihm bringen, und die Herrscher, deren Treue sie gewinnen sollte. Er war rastlos und zielstrebig, wo die blinde Königin gelassen und zugleich verloren war.
In den stillen Stunden betrachtete Amadena den Himmel und die Sterne, die in der Nacht darüber wanderten. Vielmehr jedoch zog sie weiterhin der Schwindel der Leere zwischen den Lichtern an, und an einer Stelle des Teppichs aus glühenden Funken gab es eine Narbe: eine absolute und perfekte Schwärze.
Schließlich fragte sie die blinde Königin nach dieser Bresche, und ihre Nicht-Mutter legte ihr mahnend eine Fingerspitze auf die Lippen.
»Dhaza«, sprach sie. »Dort ist etwas aus ferner Vergangenheit festgekettet und hält zur Strafe für Verrat den Himmel zusammen. Beachte es nicht, Kind.«
Amadena hatte zu dieser Zeit schon verstanden, dass sie kein Kind war und niemals gewesen war. Die anderen fenvar kamen zur Welt wie Fohlen und Welpen, in Blut und Schmerz, und wuchsen langsam mit Hilfe ihrer Eltern. Das war die Natur, wie die Königin sagte, der sie sich unterworfen hatten. Das Kommen und Gehen der göttergegebenen Welt. Amadena war anders, vollendet und mit wachem Geist geschaffen worden. Die Königin, so las sie aus den wenigen Worten, die sie dazu preisgeben wollte, hatte ihren Körper geschaffen und der Drache ihren Geist.
Doch auch der Drache, ihr Nicht-Vater, wandte sich bei der Frage nach der Narbe am Himmel von ihr ab. »Die Götter sind launenhaft«, sagte er. »Und ihre Rache für Verrat grausam. Er, der dort den Himmel geschlossen hält, hat nicht länger Einfluss auf die Schöpfung. Seine Diener sind besiegt oder haben ihm abgeschworen. Denk nicht weiter an ihn.«
Die Narbe wanderte, bis sie in der Dämmerung im Zenit stand. Amadena blickte auf und sank in die Schwärze. Die Finsternis schien golden zu werden und ein purpurnes Auge öffnete sich, blickte auf sie herab.
Sie erschauderte.
Wenn die Strafe für Verrat solche Schönheit war, welchen Lohn erhoffte sich die Welt von Treue?
Ein Licht, aus Traum erwacht,Ein Lied, das niemals stirbt.Doch golden singt Verlorenes,Das Lied und Traum verdirbt.Mit Tod und Leid kommt Leben,Verrat vergeht im LichtUnd gottgleich steht die Königin,Hält in Trauer blind Gericht.
Der Drache, Wächter, Goldener,Sprach: »Göttergleich ist nur,Wer göttergleich erneuert,Verändert die Natur.Ein Kind hast du verloren,Der Thron blieb mir verwehrt,Erschaffen wir die Königin,Die alle Welt geeint verehrt.
Sechs Städte für dein Volk,Dir und mir zur Ehre,Im Fels, im Eis, im Feuer,Im Wald, im Wind, im Meere.Sie wird zu ihnen sprechen,In unsrem Sinne einen:In meinem Namen bringt sie LichtEin Kind ist sie dem deinen.«
Der Drache und die KöniginErweckten neues Leben.Ein Balsam für die WundenEin Werkzeug für das Streben,Doch golden war ihr BlickUnd ihre Seele kalt,Und ihre Treue, sobald sie erwachtStets einem andren, verborgenen galt.
Im Turm des Schwarzen Winters,
worin Amadena zum Elfenvolk der fenvar in die Stadt am Rande der Welt kommt und die Natur des Lebens zu ergründen sucht.
»Ich bin nicht sicher, ob ich es wirklich gesehen habe«, gestand Acuriën. Der Horizont war nicht zu erkennen, eine vage Zone von Dunst und Licht in kaltem Gold, die zwischen dem weißen Grund und dem strahlend blauen Himmel lag. Vermutlich näherte sich ein Unwetter über dem Festland oder starke Winde wirbelten Eiskristalle auf, bis sie als blendende Wolke alle Umrisse und Landmarken verschwinden ließen.
Israni gab einen halb unwirschen, halb gelangweilten Laut von sich. Sie schob ihre Maske hoch, und sah von ihrem Posten am Bug des Eisseglers auf ihn herab. »Ich habe nicht darauf geachtet, aber mich kümmert es auch nicht. Willst du zurück?«
Die gesamte Gruppe aus Jägern und Forschern sah ihn abwartend an. Acuriën musterte erneut den Horizont und hob die Hand als Zeichen, noch einen Moment Geduld zu bewahren. Er konzentrierte sich auf das verschwommene Band dort, wo Meereis auf Festland stieß und die Signaltürme standen, und kniff die Augen zusammen.
Acuriën war kurz davor, sich doch abzuwenden, als das Signal endlich wiederholt wurde. Eine Reihe heller Lichtblitze flackerte auf und am Ende der Sequenz nickte er zufrieden.
»Ich fahre mit den Suchern zurück«, entschied er. »Wir erwarten eine neue Delegation.«
Israni seufzte etwas ungehalten, sprang aber von ihrer Warte herab und bedeutete den restlichen Jägern auf dem Segler, zum anderen Eisschiff zu wechseln.
»Es werden weitere Sucher kommen, teils aus Tie’Shianna. Wir werden viel vorzubereiten haben und sie einweisen müssen«, verteidigte sich Acuriën, aber seine Worte wurden ignoriert. Israni organisierte mit wenigen Befehlen die Verteilung von Vorräten und Ausrüstung. Seine Gruppe würde sie für die Heimreise nicht mehr benötigen und die Jäger konnten so länger im Eis bleiben. Schließlich legte sie aber beruhigend eine Hand auf seine Schulter und musterte ihn mit einem verständnisvollen, wenn auch amüsierten Ausdruck.
»Wir sehen uns bald.«
Sie zog die Maske wieder vor ihr Gesicht und ihre grünen Augen verschwanden hinter geschwärzten Kristalllinsen. Einen Moment lang legte sie spielerisch den Kopf schief, der nun das geschnitzte Abbild eines Luchses trug, dann setzte sie über die Reling hinweg. Mit einem letzten Winken über die Schulter trabte sie über das Eis zu dem Schiff, das ab jetzt unter ihrem Kommando stehen würde.
Acuriëns Mannschaft, auch wenn sie nicht aus Jägern und Seglern bestand, war eingespielt genug, um das leichte Gefährt zu wenden und vor den Wind zu bringen. Das Segel entfaltete sich mit dem Geräusch eines mächtigen Flügelschlags und die Kufen unter dem Holzrumpf glitten über den eisigen Boden, gen Norden. Sobald sie die felsigeren Bereiche der kleinen Inseln hinter sich ließen und das Meereis erreichten, wurde die Fahrt glatter und umso schneller. Über der weiten, weißen Ebene flirrte das Licht, und ein steter Strom von Wind schob sie vor sich her. Selbst ohne Segel wäre es schwer gewesen, ihm zu widerstehen und nach Süden, vom Turm weg, zu streben.
Der Turm selbst war noch Stunden entfernt, aber er schälte sich schon früh aus dem fahlen Licht. Eine Felsnadel, dunkel vor den ansonsten so ununterbrochenen Flächen von Weiß und Blau, wie um Land und Himmel hier zu verankern, wo das Leben zurückwich und Eis das einzige und alles beherrschende Element war. Acuriëns Heimat, seitdem er und Israni die Wälder von Simyala verlassen hatten, um Ometheons Ruf an das Ende der Welt zu folgen.
Er, wie auch die meisten anderen an Bord, löste seine Maske vom Gürtel und band sie sich gegen die stechend kalte Luft vor das Gesicht, schützte seine Augen vor dem grellen Widerschein des Lichts auf dem gefrorenen Meer. Ohne viele Worte zu wechseln, fiel die Mannschaft in ihre routinierten Abläufe und Acuriën nahm einen Platz an Backbord ein, wo er mit einem Seil gesichert als Gegengewicht fungierte. Der Eissegler, der ansonsten zu gern am Turm vorbei ewig weiter ins Nichts gestrebt wäre, wurde so auf Kurs gehalten. Von seiner Position aus konnte Acuriën auch die Kisten und Wasserbehälter im Auge behalten, die sie auf der Expedition bereits gefüllt hatten. Durch die richtigen magischen Lieder in einen ruhigen Schlaf gesungen, lagen dort die pelzigen Leiber kleiner Nager, die sich auf den wenigen Inseln fanden. Struppige Insektenlarven, aus Felsnischen gepflückt, ringelten sich in Holzkistchen, und ein seltsam stacheliger Fisch taumelte in seinem Behälter voll eiskaltem Meerwasser hin und her, durch Magie vor dem Frost geschützt. Alles Wesen, die die Natur hier in die Eiswüste gesetzt hatte und die ihre ganz eigenen Strategien besaßen, die grausamen Winter und kurzen Sommer zu überleben. Jedes ein Rätsel für sich und für Acuriën und andere Sucher eine Herausforderung.
Von allen Wesen, die hier lebten, waren die fey die einzigen, die aus eigenem Willen gekommen waren – derselbe Wille, mit dem sie der Natur ihre Methoden und Werkzeuge entlocken würden, um das Eis bewohnbar zu machen. Sie folgten den Visionen Ometheons, der schon in den älteren Städten der fenvar, jenem stets nach Neuem strebenden Stamm der fey, ein strahlendes Licht gewesen war. Gemeinsam hatten sie sich eine neue Heimat geschaffen. Sie hatten nicht nur überlebt, sondern den Raum gefunden, sich in ihrem Forschen und Schaffen noch über ihre Geschwister zu erheben, hatten, wie als Zeichen für die Schicksalsträchtigkeit ihres Vorhabens, eine massive Nadel aus Felsen am fernsten Ort der Welt gefunden und ausgehöhlt, um darin Leben und Arbeit zu ermöglichen, hatten der Kälte ein Refugium aus Wärme und Gemeinschaft abgerungen.
Acuriën lauschte auf die Melodien, die im schneidenden Wind entstanden, und auf das dumpfe Dröhnen des Eises unter den Kufen. Er nahm einige der Klänge auf und wob ein eigenes, zurückhaltendes Lied, das den Wind ein wenig formte und abmilderte, das Eis stärkte. Die Mannschaft sang mit ihm, ein Netz aus Stimmen, halb im raschen Flug über die Einöde verloren, das sie instinktiv miteinander und mit der Welt um sie verband.
Der Melodie war eine Schärfe und eine Präzision zu eigen, die Acuriën aus seiner früheren Heimat, dem mit dem Wald verschmolzenen Simyala, nicht gekannt hatte. Immer wieder gab es Zäsuren und Brüche, wie der hunderte Schritt aufragende Fels des Himmelsturms, der Horizont und Himmel zerschnitt, und eine drängende Eile, wie der unaufhaltsame Wind über dem Eis.
Er fand darin eine Gewissheit, auf dem richtigen Weg zu sein, während sie gemeinsam pfeilschnell auf den Himmelsturm am Ende der Welt zu segelten, der wie die gigantische Nadel einer kosmischen Sonnenuhr mit seinem Schatten den Tag maß.
Bei der Ankunft des Seglers im Turm herrschte die zielgerichtete, effiziente Betriebsamkeit, die seine Einwohner gerne gegenüber Besuchern betonten. Die Proben wurden verladen, das Schiff von den Bootsmachermeistern entgegengenommen und auf Schäden geprüft und Acuriën selbst hatte noch etwas Zeit ohne andere Verpflichtungen, um sich und seine Arbeit auf den Empfang vorzubereiten.
Die Sucher, zu denen er zählte, hatten sich nicht zu einem festen Clan zusammengefunden wie viele andere Bewohner des Himmelsturms. Zu weit waren ihre Interessen und Aufgaben gefasst. Sie konnten sich nicht – wie die Bootsmacher oder Instrumentenbauer – nur in eine einzige, sich immer wiederholende Aufgabe vertiefen und sie perfektionieren. Vielmehr suchten sie nach Annäherungen an die Perfektion in ihrer Umgebung und arbeiteten an Wegen, das Leben im Himmelsturm noch besser an das harsche Umfeld anzupassen. Ometheon hatte sich diesen Ort als Wohnsitz auserkoren, um seinen Willen gegen die Natur zu stellen. Kein Ort der Schöpfung sollte so unwirklich sein, dass ein fenvar dort nicht überleben konnte. Zudem boten Eis und Abgeschiedenheit eine Reinheit, eine Ferne von den Verlockungen, die andere große Schöpfer ihres Volkes zu Fall gebracht hatten. Die Sucher waren ein Symbol dafür; scharfe Geister, ruhelose Forscher, die ebenso die Natur der Welt wie die Natur der fey studierten.
Gemeinsam mit Acuriën standen mehrere dieser Sucher respektvoll in der zweiten Reihe des Halbkreises, der die neuen Bewohner und Gäste des Himmelsturms einige Stunden später empfing. Ometheon selbst, schlicht in einem grauen Gewand, dessen Gewebe so fein war, dass es wie eine Flüssigkeit schimmerte, stand im Mittelpunkt. Sein Bruder Emetiel hielt sich respektvoll einen halben Schritt zurück. Über ihnen wölbten sich die Zweige eines der Bäume, die als Samen und Setzlinge aus Simyala hergebracht worden waren. Sie gediehen unter einem falschen Himmel und in künstlicher Erde, gewässert und gewärmt von den heißen Quellen tief im Herzen des Turmfelsens. Sie sollten die Gäste zugleich mit einem vertrauten Anblick willkommen heißen und als Schaustücke der Arbeit nach Ometheons Philosophie dienen – sie gediehen an einem Ort ohne Wälder durch Genie und die Magie, mit der die Bewohner des Turms auf die Wirklichkeit einwirkten.
Acuriën begegnete dem Blick eines Gastes in den Reihen der Neuankömmlinge. Es war eine hochgewachsene Frau mit Haar, dessen blasse Farbe ihn an die langen, kalten Dämmerungen des Nordens erinnerte, wenn nach dem Versinken der Sonne noch ein letzter Glanz am Horizont blieb und vom Eis widergespiegelt wurde. Das darin nur angedeutete Gold fand sich in ihren Augen.
Ihr Blick war ruhig, forschend und schien alles und jeden zu schätzen und zu wägen. Er blieb an Acuriën hängen und eine katzenhafte, distanzierte Neugierde sprach daraus. Erst als die Frau lächelte, fiel Acuriën auf, wie schön sie war, ein Eindruck, der zunächst gänzlich hinter der Intensität ihrer Aufmerksamkeit zurückgetreten war. Ihr Gesicht, ihre Glieder, alles entsprach Maßen, die sowohl künstlerisch höchst ästhetisch waren als auch mathematisch perfekt sein mussten.
Acuriën senkte den Kopf, unterbrach den Blickkontakt und wartete, bis sie vorgestellt wurde.
»Amadena«, wurde sie von Ometheon begrüßt, der ihre Hand ergriff und ihrem Blick deutlich länger widerstand, als Acuriën es konnte. Sie wechselten einige leise Worte, dann richtete sie sich direkt an alle Versammelten.
»Ich bin Gesandte und Priesterin des Pyr’Dakon, des Wächters der Elemente. Er begrüßt euren Wagemut, das Element des Eises zu erkunden und herauszufordern, und schickt mich, um euch dabei zur Seite zu stehen. Ich bin jedoch nicht hier, um zu predigen und einen weiteren Tempel zu gründen. Ich bin hier, um euch zu zeigen, wie sehr unser Volk und der Goldene Drache eure Arbeit bewundern. Und ich werde diese Arbeit Seite an Seite mit euch verrichten. Nennt mich daher nicht bei meinem Namen der Priesterschaft, Pyrdona, sondern beim Namen meiner Geburt: Amadena. Lasst uns gemeinsam die Schöpfung, das Leben und die Elemente erforschen und erkennen und beweisen, dass wir sie meistern. Ich kann bereits sehen, dass ich hier viele Gleichgesinnte finden werde.«
Kurz wanderte ihr Blick zu Acuriëns Gruppe, streifte ihn nur für einen einzelnen Moment. Dennoch war er fasziniert von der Möglichkeit, dass sie ihn meinen konnte, dass sie bereits erkannt hatte, wer er war und was seine Berufung war. Der Rest der Begrüßungszeremonie verstrich für ihn in einem Dunst von Überlegungen. Seine Gedanken kreisten darum, wie er mit ihr reden und erklären sollte, was er und die Sucher im Turm taten und was sie schon erreicht hatten, wen er namentlich nennen sollte und was er anpreisen oder herabspielen sollte.
»Acuriën.« Ometheon wandte sich persönlich an ihn. Amadena stand zu seiner Rechten, ein Lichtstrahl neben seinem zurückhaltenden Silbergrau. »Bitte zeige der Gesandten des Pyr unsere Einrichtungen und Forschungen.«
Alle Überlegungen, die bis zu dem Moment erwachsen waren, strömten zusammen und dennoch vermochte er nur knapp, aber höflich zu sagen: »Natürlich.«
Ebenso natürlich übernahm sie mit einem Lächeln die Führung seiner Gruppe zu den Treppenhäusern des Turms, so als kenne sie bereits den Weg und was sie am Ende erwarten würde. Er folgte ihr und alle anderen Sucher folgten wiederum ihm in einer schweigenden, angespannten Reihe. Acuriëns Gedanken sprudelten erneut Ideen hervor. Er legte sich eine Reihenfolge für die Dinge, über die er sprechen würde, zurecht. Ohne weiter sagen zu können, warum, fühlte er etwas Neues beginnen, neue Ansätze und Möglichkeiten erblühen, nur durch die Anwesenheit Amadenas. Seine Erwartungen für die Zukunft erfüllten ihn mit einer beschwingten Wärme und flatterten wie die Schwingen eines Vogels von innen gegen seine Rippen.
Der Sommer kam spät für die Menschen. Die Tage wurden länger, doch das Eis brach nicht und die Vorräte wurden immer stärker eingeschränkt, bis jeder nur noch die allernötigste Menge an Fleisch und Fett erhielt, um der Kälte zu widerstehen. Aus demselben Grund waren vier Jagdgruppen gleichzeitig aufgebrochen, um den Robben des Eismeeres an ihren Atemlöchern nachzustellen. Seluk, Simaru und Alaqin setzten auf die Buchten und Zungen gefrorenen Seewassers, die den Familien schon gut vertraut waren.
Kilgan hingegen war sich sicher, dass die Robben nach dem bereits so lange andauernden Winter gelernt hatten, wo die Jäger auf sie warteten. Im Sommer mussten die Familien schließlich auch immer weiter auf die Inseln und Halbinseln hinausfahren, wo die Kolonien noch nicht so schreckhaft waren und sie sich den ruhenden Leibern der Tiere leichter nähern konnten, ohne direkt eine Panik auszulösen.
Elf Tage lang zogen sie die Schlitten, beladen mit Harpunen und für den Rücktransport der Tiere gedacht, über unebenes Land aus vereistem Fels und dicht verharschtem Schnee. Schließlich lag die Weite vor ihnen, wo zuletzt Kilgans Mutter als junge Frau gejagt hatte. Da sie von denselben Reisen eine Kette aus Bärenkrallen als Trophäe mitgebracht hatte, hatten die Jäger vorsichtshalber ihre Speerschleudern an die Gürtel gehängt und jeder balancierte eines der langen Geschosse über der Schulter, während sie den Hang hinabstiegen, wo das Eis des Landes auf das des Meeres stieß.
Dort hielten sie inne, testeten den Grund und beobachteten den Horizont, die Kapuzen gegen den Wind eng verschnürt und ihren Sichtschutz vor den Augen, um sie vor dem grellen Licht zu schützen, das die kalte Sonne in jedem Schneekristall entzündete.
»Wo sich das Eis vorne bei den Felsspitzen wölbt …«, erklärte Kilgan. Er hob die Karte seiner Mutter, aus dem Stoßzahn eines Walrosses geschnitzt und über die Jahre von ihren rauen Fingern glattgeschliffen. Perlen aus Bernstein, an geflochtenen Haaren zwischen den Spitzen von Landzungen aufgehängt, markierten gute Jagdorte. Der Stein für die im Eis gefangenen Inseln hatte einen Einschluss, der wie eine vielblättrige Blüte aussah – ein besonderes Symbol, das Kilgan seit seinen ersten Erinnerungen begleitet hatte und dessen Vertrautheit ihn beruhigte.
Die anderen gaben ihm Zeichen, dass sie verstanden hatten und zustimmten. In der Kälte wollte niemand unnötig sprechen.
Das Eis war fest und so marschierten sie weiter.
Bei den Felsen, die erste Vorboten der eigentlichen Inseln waren, gab es Leben unter dem Eis. Kilgan wusste, dass hier winzige Krebse lebten, von denen wiederum die Fische fraßen. Und die Fische lockten Robben an. Sie fanden rasch drei Atemlöcher und luden ihre Harpunen und Fanghaken ab. Die Sonne stand so hoch, wie sie um die Jahreszeit steigen würde, und zeichnete nur kurze Schatten. Ein Tag mit Hochnebel wäre günstiger gewesen, aber das intensive Blau eines klaren Himmels war am Ende doch einem Schneetreiben vorzuziehen, das zu dieser Zeit immer wieder plötzlich über das Land rasen konnte.
Sie harrten geduldig aus.
Der Nachmittag kam, bevor es die erste Regung gab. Eine runde Schnauze tauchte kurz aus dem Wasser, dunkle Augen blinzelten. Das Tier schnaubte nach Luft, testete, tauchte wieder ab. Noch handelte niemand, Kilgan und Otsia, die zweiterfahrenste Jägerin der Gruppe, tauschten Gesten aus. Besser warten, bis das Tier sich sicher fühlte und vielleicht auch andere bis hierher unter das Eis tauchten.
Das nächste Mal war die Robbe weniger vorsichtig, tauchte auf und drehte ihren Kopf hin und her, während sie schnaufend ein- und ausatmete. Flossenhände kratzten gegen das Eis. Sie warteten mehrere Atemzüge ab, dann sprang Kilgan von dem zusammengepressten Schnee auf, auf dem er gehockt hatte.
Der erste Stoß galt den Nüstern und dem Maul der Robbe, mit dem spitzen Haken geführt. Der Abwärtsschwung, so oft und immer wieder geübt, trieb den glatten Knochen tief in die weiche Wölbung neben dem Mund, brach Zähne und verhakte sich dann im Kiefer. Die Robbe schrie mit ihrer menschengleichen Stimme und versuchte, zu tauchen, aber der Haken hielt und die anderen Jäger waren heran. Harpunen stießen in die weichen, fettigen Flanken und zu fünft begannen sie den Kampf, das sich windende, stöhnende Tier auf das Eis zu zerren.
Otsia ließ ihre Harpune fahren, sobald die Beute gesichert war, nahm ihre Keule vom Rücken und schlug zwei, drei Mal zu. Der Schädel und das Genick knackten und die Schreie endeten.
Sie waren alle außer Atem, aber beruhigt und zufrieden. Der erste Tag hatte bereits Erfolg gebracht. Kilgan richtete sich auf und löste die Kordel an seiner Kapuze, um seinen Jägern zu gratulieren, als er den Alb sah.
Sein erster Gedanke war, dass sie eine Wache hätten stehen lassen sollen, wenn nicht gegen Bären, dann gegen die Erscheinung, die gerade mal dreißig Schritt entfernt auf den Felsen hockte. Esqil-Alanik hatte sie gewarnt, als sie mit der Karte aufgebrochen waren. Der Norden habe sich verändert, es zögen nun Alben über das Eis, groß wie Schneeschrate und bösartig wie ein verletzter Vielfraß.
Der Alb war größer als Kilgan, aber sicherlich kein Vergleich zu einem Schrat. Dünn war er und trug Kleider, allerdings nicht aus Leder und Pelz, sondern etwas Feinem, Dünnem, das unmöglich genug Schutz gegen die Kälte gewähren konnte. Sein Gesicht war eine Maske mit gebleckten Reißzähnen und schwarzen Augen.
»Alb«, sagte Kilgan und die anderen schreckten von ihrer Arbeit an der toten Robbe auf. Während sie erstarrten, kam der Alb in Bewegung. Er sprang aus seiner Hocke auf, gab ein paar Laute in einem verstörend vielstimmigen Singsangton von sich und lief dann über den Schnee, als besäße er kein Gewicht, bestünde nur aus Wind und gespiegeltem Licht.
Kilgan riss seine Speerschleuder vom Gürtel und rannte zu den Schlitten, auch die anderen stoben auseinander. Otsia schrie, als könne sie die Erscheinung damit vertreiben, die Keule erhoben, an der noch Robbenblut klebte. Alle wichen zurück, hielten Abstand, und ließen Kilgan Raum. Eine ferne Panik ließ sein Blickfeld flirren, aber er war geübt, war vorbereitet. Der Speer glitt rückwärts über seine Schulter, in die Schleuder eingehakt. Er zielte einen Moment lang mit der ausgestreckten linken Hand und warf.
Der Alb wich aus, der zwei Schritt lange Speer nur ein leichtes Ärgernis, sprintete vorwärts und warf eine Schlinge über Qimaks Kopf. Der junge Jäger ging mit einem erstickten Schrei zu Boden. Sein zappelnder Körper wurde rückwärts über das Eis gezogen, bis er mit der toten Robbe zusammenstieß und dort keuchend liegen blieb.
»Zurück!«, schrie Kilgan, wich selbst aus und trat hinter den Schlitten. Der Alb sang wieder in seiner unnatürlichen Stimme und weitere seiner Art erschienen über die Felsen. Ihre Bewegungen waren lautlos, leicht wie der Wind, und jedes Gesicht eine andere Fratze. Bären, Schrate, weitere Katzen mit schwarzen Augen, die zornig von langgliedrigen Leibern Besitz ergriffen hatten.
Ein Seil peitschte Otsia ins Gesicht und sie heulte auf, als Blut spritzte. Metsal und Bahan wandten sich zur Flucht. Kilgan konnte es ihnen nicht verübeln, aber er durfte nicht fliehen. Er hatte die Karte und er hatte die Gruppe hergeführt und ohne sie durfte er nicht heimkehren.
Er ließ die Speerschleuder fallen, zog sein Häutermesser und warf sich unter einer geworfenen Schlinge hinweg in den Schnee, um zu Qimak zu rutschen. Sein Versuch, das Seil zu durchschneiden, war vergebens – er schlug eine Schlaufe und zerrte mit der Klinge daran, doch die glatten Fasern gaben kein Haarbreit nach. Er musste das Messer fahren lassen und die Schlinge weiten, um sie über den Kopf des anderen Jägers zu ziehen, um ihn zu befreien, was ihn wertvolle Herzschläge kostete.
Der erste Alb mit dem Katzengesicht sang grelle Worte und zog eine Waffe, gänzlich aus mondhellem Metall. Kilgan wich erschrocken zurück, bevor er sich beherrschen konnte, kam dann endlich wieder auf die Beine und hob den Haken auf, mit dem er die Robbe gefangen hatte. Zu seinen Füßen wälzte sich Qimak beiseite, rings um ihn hörte er die Schreie seiner Jäger und die vielstimmigen Rufe der Alben. Er hatte jedoch gänzlich den Überblick verloren, wusste nur, dass er gen Norden sah und die Sonne im Rücken hatte, während ihn der erste Alb mit schräg gelegtem Kopf musterte.
Kilgan schlug nach der linken Schulter des Albs. Wieder wich die Erscheinung mühelos aus, wie schon dem Speer. Auch der nächste Hieb, gegen die rechte Schulter, ging ins Leere, diesmal packte aber eine schmale Hand den Haken und zog daran. Kilgan strauchelte und entschied sich, lieber halb zu Boden zu gehen als die einzige Waffe in Reichweite loszulassen.
Ein Schlag traf ihn hinter dem Ohr und kurz wich mit einem Dröhnen alle Kraft aus seinen Gliedern. Er fiel mit dem Gesicht voran in den blutigen Schnee und der Alb über ihm sagte etwas – zweistimmig? Vierstimmig? Dann drehte er sich um, als wäre die Sache erledigt. Kilgan stemmte sich auf die Knie hoch und rammte den Haken von hinten in die Kniekehle des Albs. Das seltsame Gewebe gab mit einem hässlichen Geräusch nach und der geschliffene Knochen versank zwischen den fingerdicken Sehnen.
Der Alb schrie auf, grell und überrascht, und Kilgan zerrte an dem Fanghaken. Eine Sehne riss, eine hielt und schälte sich wie ein weißes Band aus dem Fleisch der Kreatur, dann wälzten sich Alb und Mensch am Boden. Der Alb schrie weiter, nun vor Wut, und seine helle Klinge zog eine Spur über Kilgans Gesicht. Blut trat heiß hervor, dampfte und rann ihm ins Auge, machte ihn blind für einen simplen Fausthieb, der der Klinge folgte. Etwas knackte und brach unter den schmalen, aber felsenharten Knöcheln, er schloss die Augen gegen den Ansturm von Schlägen und spürte sie nur noch als dröhnende Einschläge, die ihn rückwärts erneut in den Schnee drückten.
Schmerz und ein unbeschreibliches Gewicht ließen seine Glieder regungslos zu Boden sinken. Kurz flackerten seine Sinne und er glaubte fast, aus seinem Körper geschleudert zu werden, die Szene von außerhalb zu sehen, durch einen grauen Schleier, dann kehrten Licht und Geräusche zurück.
Der Alb presste ein Knie in Kilgans Brust, als er durch Blut und Schwindel aufwärts blinzelte, das andere, verdreht und zerrissen, zur Seite gestreckt. Neben ihm standen zwei weitere seiner Art, ihre Klingen nach Kilgans Hals gestreckt.
Der Katzenalb hob die Hände, sprach etwas und ließ die eigene Waffe in der Scheide am geflochtenen Gürtel verschwinden. Er griff zu seiner Maske und hob sie an.
Darunter war kein Katzenschädel, auch wenn die Augen ihn mit ihrer Leuchtkraft und der großen Iris an den Blick eines Luchses erinnerten. Das Gesicht verjüngte sich von hohen Wangenknochen zu einem schmalen Kinn, dünne Brauen wölbten sich auf einer glatten Stirn. Die Haut des Wesens war eben und hell wie Licht auf stillem Wasser.
Zudem war der Alb weiblich. Sie lächelte, sagte etwas, das trotz ihrer mehrstimmigen, fremdartigen Sprache anerkennend klang. Dann legte sie Kilgan ihre Hand auf das Gesicht, sang zu ihm und er fiel in einen erstickend schweren Schlaf.
Wie Licht, das kurz durch Winterwolken bricht, drangen Eindrücke in diesen Schlaf. Sänger, unter deren Liedern Fleisch heilte und sich Wunden selbst ungeschehen machten. Körper, die über Schnee gezogen wurden. Ein Schiff, gänzlich aus Holz, das im Wind schwebte. Eine finstere Gestalt, ihr Haupt in Nebelschleiern verborgen, die über eine weite weiße Ebene blickte und ihn erwartete. Eine schwarze Linie wie ein Riss in der Dämmerung, der näher und näher kam und ihn schließlich verschluckte.
Sein Verstand sank in die Tiefe und weiter fort vom Licht, wo nur blinde Krebse unter dem Eis an seinen Träumen nagten.
Israni kam erst spät am Tag wieder und hinkte leicht. Acuriën sah sie fragend an, während er die letzten Behälter verschloss und an ihren Platz in der Sammlung stellte.
»Ich habe noch etwas Spannendes für euch gefangen«, erklärte Israni. »Aber es war damit nicht einverstanden.«
»Benötigst du Hilfe beim Heilen?«
»Nein.« Israni spähte an ihm vorbei in eine der Schachteln, wo ein Insekt sauber aufgespießt und mit gespreizten Flügeln darauf wartete, genauer untersucht zu werden. »Wie war der Empfang für den Besuch?«
Acuriën spürte wieder die frische Begeisterung in sich aufsteigen und konnte ein Lächeln nicht unterdrücken. »Absolut faszinierend. Sie bringt eine Menge neue Ideen und Kenntnisse mit und vor allem ist sie … inspirierend. Sie hat all das gesehen, was wir hier tun, was wir gelernt haben und lernen wollen und hat jeden unserer Ansätze sofort verstanden und bewertet. Sie saugt das Wissen nur so auf.«
Er versuchte mit einer Geste in den Raum mit seinen Gläsern, Röhren und Kisten voll toter und in tiefsten Schlaf versetzter Lebewesen zu erklären, wie viel an Rätseln hier schon entwirrt worden war und wie wenig das in der Gesamtheit bedeutete.
»Das ist alles nur eine Grundlage für sie. Eine erste Stufe eines noch viel weiteren Aufstiegs. Ich weiß nicht, was wir Sucher mit ihr zusammen erreichen können, aber es fühlt sich bedeutend an.«
»Mit euch Suchern?« Israni schob sich mühelos mit einem Arm auf eine der hohen Arbeitsflächen und sah von oben auf ihn herab. »Von welcher ›sie‹ reden wir hier überhaupt?«
Acuriën gab ein entschuldigendes Summen von sich. »Oh, die Botschafterin und Priesterin des Pyr aus Tie’Shianna. Amadena.«
»Wir haben eine Priesterin hier?« Isranis Augenbrauen wölbten sich ungläubig. »Das will nicht so richtig zu Ometheons Überzeugungen passen.«
»Ich denke sie ist weniger als Priesterin hier und mehr als eine weitere Forscherin«, stellte Acuriën klar. Kein einziges Mal an diesem Tag, an dem sie zusammen erarbeitet hatten, was schon im Turm erreicht worden war, hatte Amadena ihren Gott erwähnt. »Sie bringt andere wertvolle Eigenschaften mit als nur Religiosität.«
Israni lehnte sich vor, wie um ihn zu beschnuppern, dann grinste sie. »Das will ich wetten. Dir scheinen ihre wertvollen Eigenschaften ja sehr zu gefallen.«
»Natürlich!«, entgegnete Acuriën und wollte beginnen zu erklären, wie scharfsinnig, entschlossen und motivierend die Gesandte aus der Stadt des Erzes war, bevor ihm klar wurde, was Israni unterstellte. Er seufzte und massierte einen Punkt zwischen seinen Augen, von dem aus sich eine Anspannung in seinen Schädel ausbreiten wollte.
»Sie ist auch sehr attraktiv, wenn du das meinst«, gab er zu. »Was aber nicht entscheidend ist.«
»Eh«, gab Israni abschätzig von sich und rutschte wieder von der Ablage. »Sonst hätte ich hier auch das Sagen.«
Acuriën verbat sich jede Reaktion, nicht ganz sicher, wie viel Eitelkeit und wie viel Scherz in der Aussage steckten, bis Israni ihn auslachte.
»Schon gut.« Sie winkte ihm, ging rückwärts auf den Ausgang des Lagerraums zu. Ihr Hinken war kaum zu bemerken, aber wenn sie nach einer offenbar vollständigen Heilung immer noch mit den phantomhaften Überresten von Schmerz zu kämpfen hatte, war die Begegnung im Eis gefährlicher gewesen, als ihre beiläufige Erwähnung es erscheinen ließ. »Willst du nicht sehen, was wir gefunden haben?«
Als Antwort löschte er die Lichter an der Decke mit einem leisen Befehl und folgte ihr hinaus auf den aus Fels geformten Gang. Der Stein strahlte eine stete, wohltuende Wärme ab, von innen durch ein weit verzweigtes Geflecht von Röhren erhitzt, in denen das Wasser der Quellen in der Tiefe strömte. Wie ein künstlich erschaffener Baumstamm saugte der Turm unablässig Wasser von seinen Wurzeln bis zu seiner Spitze, wo es, fast all seiner Wärme beraubt, nur noch einen leichten Dunst erzeugte, bevor es zurück in die Tiefe geleitet wurde. Das stete, fast an das Innere eines riesigen Wesens erinnernde Vibrieren des Steins unter dem unablässigen Wasserstrom war inzwischen zu einer behaglichen Selbstverständlichkeit geworden.
»Es sind fünf Stück«, erklärte Israni. »Vier Männchen, ein Weibchen. Haben draußen bei den letzten Felsen Robben gejagt.«
»Bären?«, fragte Acuriën verwirrt. »Was wollen wir mit fünf weiteren Bären und wie wollen wir sie füttern?«
Israni lachte in sich hinein. »Bären«, äffte sie ihn nach, schüttelte den Kopf. »Nein, keine Bären. Bären laufen nicht auf zwei Beinen.«
»Ihr habt fünf Schneeschrate in den Turm gebracht? Das ist noch verrückter!«
»Ihr wollt doch immer alles genauer erforschen und ich habe die Nase voll von Nagern und Insekten und Fischen und Quallen. Und nein, es sind keine Schrate. Glaube ich zumindest.«
»Jetzt bin ich neugierig.«
Er folgte ihr eine gewundene Treppe hinab, noch tiefer in den Turm, dorthin, wo fast auf Höhe des Eises verschiedene Lagerräume für größere Tiere eingerichtet worden waren. Darunter fanden sich, unterhalb des Meeresspiegels, vor allem die Schmieden und natürlich die Anlagen, die das heiße Wasser förderten und transportierten. Manche Tiere schienen einfach instinktiv zu spüren, wie hoch sie im Turm untergebracht waren, und wurden bei größeren Abständen zur Eisebene nach oben oder nach unten unnötig nervös.
Hier ruhten unter anderem bereits zwei riesige, weiße Bären, derzeit in einen erzwungenen Schlaf versetzt, bis man sich ihnen wieder widmen wollte. Israni führte ihn an der Tür zu ihrem Raum vorbei bis an das Ende dieses speziellen Ganges für größere und gefährliche Wesen und öffnete eine Sichtluke in der Tür. Von innen war das Glas darin undurchsichtig, aber er konnte die fünf Gestalten klar ausmachen. Sie hatten Teile ihrer Kleidung abgelegt, die für weit kältere Temperaturen als das Innere des Turms ausgelegt war. Er musterte kurz die breiten, harten Gesichter und ihre gedrungenen Umrisse und gab ein nachdenkliches Summen von sich.
»Und?«, fragte Israni. »Schrate?« Ihr Tonfall war nur halb scherzhaft. Sie war sich tatsächlich nicht sicher.
»Ich glaube, das sind Menschen.«
»Wirklich?« Sie schob ihn beiseite und sah ebenfalls durch das Glas. »Als ich sie sah, dachte ich erst an unförmige Zwerge, aber dann verstanden sie kein Wort und verhielten sich eher … simpel. Ich dachte zudem, Menschen leben im Südosten des Kontinents, im Schatten der Riesin Chalwen und ihrer Berge.«
»Ich glaube, niemand hat sich bisher große Mühe gegeben, ihre genaue Ausbreitung festzustellen. Sie sterben schnell und pflanzen sich schnell fort, soweit ich weiß. Je kürzer die Generationen, desto rascher kann sich eine Wesensart ausbreiten. Diese hier sind auf jeden Fall an das Eis gewöhnt, sie haben sich passende Kleidung gemacht.«
Israni schnalzte mit der Zunge. »Aus Robbenfell. Gar nicht dumm. Fasst sich auch angenehm an. Ich überlege, mir auch so etwas machen zu lassen. Nicht so grob gearbeitet natürlich.«
Acuriën schloss das Fenster wieder. »Mit Menschen habe ich hier nicht gerechnet. Aber das ist eine ungewöhnliche Gelegenheit. Sie sind intelligent.«
Israni musterte ihn etwas zweifelnd. »Wie Schrate?«
»Mindestens, würde ich sagen. Sie haben Sprache oder sogar Sprachen, verwenden Werkzeuge.« Ihm kam ein Gedanke und er lächelte unwillkürlich. »Ich bin gespannt, was Amadena dazu sagt. Sie kennt Menschen vielleicht schon aus Tie’Shianna und Pyr’Dakons Siedlungen im Reich von Zze Tha. Er sammelt dort niedere Völker unter seiner Leitung.«
»Echsen sammelt er. Die sehen nicht aus wie Echsen.«
»Das stimmt auch wieder.« Acuriën legte eine Hand auf die verschlossene Sichtluke. Er war versucht, noch einen Blick hinein zu werfen oder direkt den Raum zu betreten, doch er hielt sich zurück. »Wir sollten ihnen etwas Zeit zur Eingewöhnung lassen. Haben sie Wasser? Etwas, das sie essen können?«
»Ich habe keine Ahnung, was sie essen können, aber wir haben ihnen etwas gegeben, natürlich.« Israni seufzte, streckte sich und verzog dann das Gesicht. »Ich gehe zu den Bädern. Das wird hoffentlich den Ärger mit dem Knie beenden.«
Ohne weiteren Blick zurück zur Tür schlenderte sie den Gang zurück. »Wir sehen uns morgen!«, rief sie über die Schulter, gleichgültig, was er jetzt noch machen würde.
Zuerst sah er nicht Israni, sondern Amadena. Sie musste die Nacht noch genutzt haben, um mehrere der Räume im Bereich der Sucher an ihre Wünsche anzupassen. Es war üblich, dass die Räume, Gänge und Treppen in der gigantischen Steinnadel beständig durch Geduld und Magie neue Formen fanden, aber selten so rasch. Einiges der bisherigen aus dem Stein geschaffenen Einrichtung und sogar mehrere Wände waren verschwunden. Dafür sammelten sich die gläsernen Tanks voller Fische und anderer Wassertiere im zentralen Raum der Zimmerflucht. Rotgestreifte Garnelen schwebten neben einem Schwarm aus Quallen. Vorsichtig auf weichen Stoff gebettet, ruhte ein seltsamer Vogel – flugunfähig, aber ein hervorragender Schwimmer – in herbeigesungenem Schlaf.
Amadena hielt eine kleine Kugel aus Glas oder Kristall in der Hand und formte ihre Magie in einem eindringlichen Singsang. Ihre Worte und Intonation hatten eine Klarheit und Eleganz, die Acuriën nur von wenigen anderen kannte. Ometheon konnte den Energien der Welt ähnlich effizient befehlen, ansonsten waren höchstens sein Bruder Emetiel und einige andere im engsten Kreis des Schöpfers des Turms zu solcher Disziplin bei der Anwendung ihrer inneren Kraft fähig.
Sie schuf nur ein simples Licht, das auf einen Befehl reagieren und schweben würde, aber Acuriën schwieg respektvoll. Im Himmelsturm galt die Regel, die Suche nach Perfektion eines anderen niemals zu stören, und so wenig wie er einen Meister der Instrumentenbauer bei seiner Arbeit belästigen würde, so wenig wollte er Amadena selbst bei einer so einfachen Form der Magie unterbrechen.
Als ihr Gesang, ihre knappe Anweisung an Licht, Zeit und Bewegung, beendet war, ließ Amadena die Kugel los, und sie gesellte sich zu einem Kreis anderer, die ein intensives und durch die vielen Quellen schattenloses Licht über einem Tisch in der Mitte des Raumes erzeugten.
»Ihr Sucher habt eine große Faszination für die Tiere des Wassers«, wandte sie sich an ihn anstelle einer Begrüßung. Ihr Lächeln jedoch war einladend und sie hob fragend eine Braue.
»Es ist das reichste Leben hier im Eis«, erklärte er und trat an einen Behälter heran, in dem graue und silberne Würmer aus dem Schlick am Boden ragten. Sie drehten hin und wieder die Köpfe, als würden sie einer ungewöhnlichen Choreographie folgen. Daneben kroch ein roter Seestern auf Tausenden winziger Haftfüße langsam, aber unaufhaltsam in Richtung eines Stücks Fisch, das ihm als Futter dienen sollte.
»Ometheon plant sogar ein großes Becken mit Tieren aller Art im Herzen des Turms, wo wir sie in einer Imitation ihres normalen Umfeldes beobachten können. Eine Art kleines Meer, damit sie sich natürlich verhalten.«
Amadena gab einen nachdenklichen Laut von sich und nickte. »Wenn einen das Verhalten interessiert. Ich gebe zu, mich fasziniert eher der Aufbau der Wesen. Woher ihre Fähigkeiten kommen. Eis ist die Antithesis des Humus, des Elements des Lebens, aber hier sind Lebewesen, die ausgerechnet in bitterster Kälte eine Heimat gefunden haben. Ganz ohne ein inneres Licht, wie wir es besitzen, vermutlich allesamt sogar ohne einen Verstand, der auch nur in der Lage wäre, zu begreifen, wie sehr das Element Eis sie eigentlich zu vertreiben versucht. Warum? Und wie?«
Acuriën nickte eifrig – am letzten Tag waren sie noch nicht so weit gekommen, bei den einzelnen Strömungen ihrer Forschung so sehr in die Tiefe zu gehen.
»Es gibt verschiedene Ansätze dazu. Einige von uns glauben, dass keines der sechs Elemente außerhalb der Zitadellen der Elemente oder Orten in der 2. Sphäre, wo sie ihren Ursprung haben, gänzlich rein sein kann. Hier in der 3. Sphäre gibt es in der Regel nur Vermischungen, und egal, wie rein Eis hier herrscht, es wird immer so etwas wie … Einschlüsse geben. Die näheren Elemente – Wasser, Luft und Erz – sind stark vertreten. Feuer wird vom Wasser ähnlich unterdrückt wie Humus vom Eis, aber es gibt die heißen Quellen an der Wurzel des Turms, die auf der Hitze unter dem Fels gründen, wo Magma fließt. Und Humus schlägt sich in Form von wenigen Lebewesen nieder, die aufgrund der Natur ihrer Existenz in der Lage sein müssen, dem Eis zu widerstehen.«
»Oder Götter haben sie so erschaffen«, nannte Amadena direkt das Argument einer der anderen Strömungen und nahm seine Erklärungen vorweg.
»Oder das, ja. Dann wird das Warum vermutlich ein Rätsel bleiben und Ometheon selbst zieht eine Erklärung auf Basis elementaren Gleichgewichts vor.«
Beide schwiegen einen Moment und betrachteten den beharrlichen Seestern, bis Acuriën realisierte, wie beleidigend seine Äußerung vielleicht gegenüber einer Priesterin sein mochte und dass ihr Schweigen das geduldige Abwarten auf eine angebrachte Entschuldigung war.
»Nicht, dass ich dem Glauben an Götter zu nahe treten will«, begann er hastig, aber sie lachte einfach und wischte seine Worte mit einer beiläufigen Geste weg.
»Keine Sorge. Ich bin eine Gesandte Pyrs und ja, in Zze Tha ist er ein Gott und sicherlich würde er es begrüßen, wenn ich mehr meines Volkes davon überzeugen könnte. Vor allem aber begrüßt er das Projekt des Himmelsturms an sich und wie es sich in die elementaren Städte einfügt.«
Sie wandte sich von der Reihe gläserner Behältnisse ab und einer Ablage zu, auf der zahlreiche Werkzeuge zur Inspektion bereitlagen.
»Ich werde direkt ganz offen sagen, dass das eine heikle Angelegenheit ist.«
Acuriën folgte ihr und schwieg wieder respektvoll, erleichtert und fasziniert zugleich, dass sie seine Worte nicht als Fehltritt sah. Vielmehr schien sie bereit, ihn ins Vertrauen zu ziehen, was ihre Aufgabe im Namen des goldenen Gottdrachen anging.
»Die Städte, die wir fenvar errichten, sind eine Gabe an Pyr und er wiederum verspricht uns eine Gabe von Macht und Erkenntnis über und zu den Elementen, die er mit uns teilen will. Das Eis jedoch ist ein Dorn in seiner Seite.«
Sie hob prüfend eine schmale, scharf geschliffene Klinge und sah im hellen Licht an ihrer Schneide entlang, als suche sie nach winzigen Fehlern.
»Das Eis hier im Norden ist Folge seiner eigenen Handlungen. Er konzentrierte Humus in Zze Tha, um es mit reichem Leben zu beschenken. Das Gleichgewicht der Elemente scheint dafür gesorgt zu haben, dass im Gegenzug weite Teile der Welt dem Eis gehören mussten. Er selbst und auch ich sind uns der Rolle des Gleichgewichts daher nur zu bewusst.«
Sie legte die Werkzeuge weg und richtete kurz ihre ganze Aufmerksamkeit auf ihn. »Wenn das Eis also nicht von Göttern bestimmt war, so können die Kreaturen hier nur von ihnen erschaffen worden sein, wenn sie damit auf das Eis reagierten. Kein großer Plan von vornherein, sondern etwas in der Natur der Dinge, das sich auch für sie der letzten Kontrolle entzieht.«
Unsicher, weswegen sie diesem Punkt solche Intensität widmete, lenkte Acuriën sich mit einem Blick zu dem schlafenden Seevogel ab. Seine Federn wirkten eher wie ein dichtes Fell, perfekt, um Wärme am Körper zu halten und Wasser abzuweisen. Die gleichen Werkzeuge, die das Fliegen hätten ermöglichen können, nur anders verwendet.
»Ist es denn wichtig, ob und wie sie erschaffen wurden?«, hinterfragte er vorsichtig auch seine eigenen Ansätze.
»Es ist wichtig, wer Schöpfer und wer Geschöpf ist.«
Sie wandte sich von ihm ab und ging zu einer metallenen Truhe an der hinteren Wand. Als sie die Hand auf das Schloss legte, sprang es von allein auf. Acuriën konnte jedoch spüren, wie zu einer Falle gewebte Energien, die bereit zu einer Entladung gewesen waren, harmlos unter ihrer Berührung zerflossen. Sie wollte mit dem Inhalt der Truhe kein Risiko eingehen.
»Unsere Ahnen sagen, die fey hätten sich selbst aus dem Licht in die Welt geträumt und seien das Einzige neben den Göttern, was nicht geschaffen wurde, sondern entstanden ist.«
Sie hob den Deckel an und lud ihn mit einem Winken ein, ebenfalls hineinzusehen. Während er sich etwas zurückhaltend näherte, sprach sie weiter: »Pyr selbst würde gern die Grenze verwischen. Dass er nicht bei den Göttern lebt, sondern hier in der greifbaren, 3. Sphäre, lässt ihn im Verdacht stehen, nur ein Werkzeug zu sein, ein Geschöpf.«
»Du redest tatsächlich ziemlich ungewöhnlich dafür, dass du seine Gesandte und eine Priesterin bist.« Acuriën sah in der Truhe einen gewölbten Gegenstand, über dem ein blickdichtes Tuch lag.
»Glaube mir, ich werde auch ungewöhnlich handeln«, sagte sie und zog den Stoff beiseite.
Der Gegenstand war ein Ei, so groß wie eine Robbe und aus einem milchigen, weißen Material. Durch die Hülle zeichnete sich vage ein eingerollter Umriss ab. Eine Hand, etwas kleiner als Acuriëns und mit langen Klauen versehen, presste sich im Traum von innen dagegen.
»Ein Drachenei«, stellte er fest und war selbst über seinen nüchternen Tonfall überrascht. »Warum hat der Goldene Drache dir ein Ei mitgegeben?«
»Ich habe es mitgenommen«, berichtigte sie ihn und legte zart ihre Hand auf die Schale. »Drachen sind in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich. Ich will sehen, ob sie sich an das Eis anpassen können. Oder ob man sie dahingehend ermutigen kann.«
Acuriën trat einen Schritt zurück und ließ seinen Blick über die vielen Behältnisse schweifen, die den Raum säumten. »Daher also die Frage, wie es dazu gekommen ist, dass all diese Wesen hier wie für das Eis gemacht sind.«
Sie summte einen zufriedenen, leisen Ton, zog dann vorsichtig den Stoff wieder über das Ei und verschloss die Truhe. Die Sicherung verwob sich erneut, als das Schloss einhakte.
»Es gibt natürlich noch andere Wege, sich an das Eis anzupassen«, verfolgte er laut seinen Gedankenfaden. »Wie uns, die die Elemente, unser inneres Licht und unseren Einfallsreichtum nutzen.«
Sie stand auf, strich ihre Robe glatt und machte dann eine wischende Geste, wie um sein Argument beiseite zu fegen. »Wie schon gesagt, wir sind ein Sonderfall. Selbstgeschaffen.«
»Oh, aber Menschen scheinen einen ähnlichen Ansatz zu haben.«
Jetzt drehte sie sich gänzlich zu ihm um und musterte ihn überrascht. »Menschen? Hier im Norden?«
Er fühlte sich etwas ertappt dabei, eine Information vorauszusetzen, die ihr offenbar noch niemand gegeben hatte.
»Jäger haben eine Gruppe Wesen eingefangen, die ziemlich sicher Menschen sind. Sie tragen Kleider und Werkzeuge, die das Wetter für sie erträglich machen sollen.«
»Was genau heißt ziemlich sicher?«
»Ich habe vorher noch keine Menschen gesehen«, gab er zu. »Aber die Beschreibung müsste stimmen.«
Sie betrachtete ihn einen Moment lang genau, dann nickte sie und setzt sich in Richtung der Tür in Bewegung.
»Ich kenne Menschen. Zeige sie mir.«
Kilgan war zu einer Zeit erwacht, die laut den anderen vermutlich Nacht war. Die Wände des Raums, in den die Alben sie gebracht hatten, waren aus Stein und verströmten eine unnatürliche Wärme. Immerhin hatte man ihnen Wasser und gegarten Fisch auf einem seltsamen Getreide als Essen gebracht und es roch alles frisch und sauber, sodass Kilgan und Otsia es gekostet hatten. Als Reaktionen ausgeblieben waren, hatten alle daran ihren Durst und Hunger gestillt.
Es war unklar, wie viele Stunden vergangen waren, bis die Tür sich endlich öffnete. Sie hatten ihre Jacken und Überhosen abgestreift, um in der Hitze durchatmen zu können, und Kilgan fühlte sich ungeschützt, als zwei Alben eintraten.
Sie trugen keine Masken, dafür weite, fließende Gewänder in Grautönen. Einer war männlich und hatte fragende Augen. Der andere war weiblich und bedrückend schön, so ebenmäßig und elegant geformt, dass es unnatürlich wirkte.
Die ganze Gruppe war aufgestanden und sammelte sich um ihn und Otsia an der hinteren Wand des Raums. Er wechselte Blicke mit ihnen und ihre Körpersprache passte sich an seine an: aufmerksam und vorsichtig, aber möglichst nicht bedrohlich.
Die Alben sprachen untereinander in ihrem mehrstimmigen Singsang. Dann hob der männliche eine der Jacken am Boden hoch, strich über das Robbenfell und schien es zu kommentieren. Die Albin nickte und trat dann näher an Bahan heran. Der warf Kilgan einen fragenden Blick zu und er schüttelte den Kopf.
Die Albin murmelte leise und lehnte sich noch etwas näher. Ihre goldenen Augen betrachteten Bahans Ohren, seinen Hals, dann tippte sie mit einem Finger gegen eine Strähne seines Haares. Der junge Jäger sog scharf den Atem ein, hielt aber still.
Sie nickte, sprach einige Worte und der Klang ihrer Stimme hallte in Kilgans Schädel wider. Die Welt verschwamm, sein Kopf sank schwer herab und bevor er sich wieder aufrichten, schütteln und seine Augen frei blinzeln konnte, war sie mit Bahan, der unnatürlich folgsam war, wieder aus dem Raum getreten.
»Nicht ihn!«, rief Kilgan. Bahan war der jüngste unter ihnen, dies war seine erste Jagd und jetzt ging er ohne einen Blick zurück hinter der Frau mit den goldenen Augen her in die Dunkelheit. »Lasst ihn hier! Nicht ihn!«
Der männliche Alb, der im Raum verblieben war, sah ihn aufmerksam und etwas verwirrt an. Kilgan versuchte, sich verständlich zu machen, deutete zur Tür und dann zu sich und wiederholte: »Nicht ihn! Er ist nicht der Spurenleser! Das bin ich!«
Der Alb schüttelte den Kopf und wirkte hilflos. Seine Verwirrung erboste Kilgan mehr als es offene Grausamkeit oder Häme getan hätte.
»Was wollt ihr von ihm?«, fragte er. »Was wollt ihr von uns?«
»Werdet ihr uns essen?«, fügte Otsia hinzu und er drehte sich verwirrt halb zu ihr um. Sie schien es absolut ernst zu meinen und begegnete seinem Blick mit steinerner Miene.
Der Alb gab einige singende Silben von sich, schüttelte den Kopf, schien dann aber einen Entschluss zu fassen. Er deutete auf sich und sagte langsam und trotz der mitklingenden Mehrstimmigkeit sehr deutlich: »Ah-Qu-Ri-Enn.«
Kilgan fixierte ihn so ruhig er konnte.
»Ihr habt gerade Otsias Schwestersohn entführt und du willst dich vorstellen«, stellte er fest. Der Alb, klar unverstehend, lächelte.
»Ah-Qu-Ri-Enn«, wiederholte er, als habe Kilgan einfach nicht richtig zugehört.
»Ich bin Kilgan«, erwiderte der Jäger und zwang sich ebenfalls zu einem Lächeln. »Und wenn ihr ihn tötet, werde ich ihn rächen.«
»Kil-gann«, sagte der Alb. Er wirkte zufrieden und begann sich im Raum umzusehen, zeigte auf die Wände, die Jacken und die anderen Jäger und begann, langsam Worte zu singen.
Kilgan schüttelte den Kopf und trat zurück in die Reihe der anderen.
»Ich denke, wir könnten ihn überwältigen«, sagte Otsia leise und ohne ihren Gesichtsausdruck anzupassen.
»Ich bin mir nicht sicher. Er wirkt etwas wahnsinnig, ja, aber sie beherrschen übernatürliche Kräfte. Wir müssen mehr wissen.«
Sie drehte den Kopf und sah ihn kalt an. »Werden wir mehr wissen, wenn sie Bahan getötet haben?«
Er ballte die Fäuste, atmete dann tief durch und wandte sich an den Alb.
»Aqu-Ri-Enn!«
Der Alb hielt in seinen Versuchen, ihnen seine Sprache näherzubringen, inne und sah ihn aufmerksam an.
»Was wollt ihr von uns?« Kilgan deutete auf die Gruppe aus Jägern, auf sich, dann auf den Alb. »Was wollt ihr von Bahan?« Er zeigte übertrieben auf den Ausgang und versuchte, einen fragenden Blick aufzusetzen.