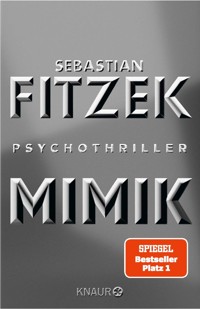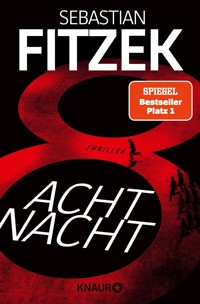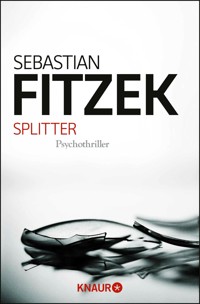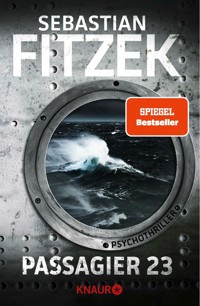
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sebastian Fitzeks erster Psycho-Thriller auf hoher See und inspiriert von wahren Tatsachen! Jedes Jahr verschwinden auf hoher See rund 20 Menschen spurlos von Kreuzfahrtschiffen. Noch nie kam jemand zurück. Bis jetzt ...: Martin Schwartz, Polizeipsychologe, hat vor fünf Jahren Frau und Sohn verloren. Es geschah während eines Urlaubs auf dem Kreuzfahrtschiff "Sultan of the Seas" – niemand konnte ihm sagen, was genau geschah. Martin ist seither ein psychisches Wrack und betäubt sich mit Himmelfahrtskommandos als verdeckter Ermittler. Mitten in einem Einsatz bekommt er den Anruf einer seltsamen alten Dame, die sich als Thrillerautorin bezeichnet: Er müsse unbedingt an Bord der "Sultan" kommen, es gebe Beweise dafür, was seiner Familie zugestoßen ist. Nie wieder wollte Martin den Fuß auf ein Schiff setzen – und doch folgt er dem Hinweis und erfährt, dass ein vor Wochen auf der "Sultan" verschwundenes Mädchen wieder aufgetaucht ist. Mit dem Teddy seines Sohnes im Arm … Die hochspannende Bestsellervorlage zum Film "Passagier 23 - Verschwunden auf hoher See"!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Sebastian Fitzek
Passagier 23
Psychothriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Martin Schwartz, Polizeipsychologe, hat vor fünf Jahren Frau und Sohn verloren. Es passierte während eines Urlaubs auf dem Kreuzfahrtschiff »Sultan of the Seas« – niemand konnte ihm sagen, was genau geschah. Martin ist seither ein psychisches Wrack und betäubt sich mit Himmelfahrtskommandos als verdeckter Ermittler. Mitten in einem Einsatz bekommt er den Anruf einer seltsamen alten Dame, die sich als Thrillerautorin bezeichnet: Er müsse unbedingt an Bord der »Sultan« kommen, es gebe Beweise dafür, was seiner Familie zugestoßen ist. Nie wieder wollte Martin den Fuß auf ein Schiff setzen – und doch folgt er dem Hinweis und erfährt, dass ein vor Wochen auf der »Sultan« verschwundenes Mädchen wieder aufgetaucht ist. Mit dem Teddy seines Sohnes im Arm …
Inhaltsübersicht
Motto
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
Widmung
Zum Buch & Danksagung
Epilog
Das Quiz für dein nächstes Fitzek-Abenteuer
Leseprobe »Der Nachbar«
Seit dem Jahr 2000 sind weltweit auf Kreuzfahrtschiffen und Fähren mindestens 200 Passagiere und Crewmitglieder über Bord gegangen.
»Spurlos verschwunden«,
Der Tagesspiegel, 25.08.2013
Ein Kreuzfahrtschiff ist wie eine kleine Stadt. Aber (…) keiner geht in einer Stadt über Bord, ohne dass man jemals wieder von ihm hört.
Der US-Abgeordnete Christopher Says,
Londoner Guardian 2010
Passagierrekord: Kreuzfahrtbranche knackt 20-Millionen-Marke. (…) Die Branche feiert einen Zuwachs von zehn Prozent – und hält das Potenzial noch für lange nicht ausgeschöpft.
Spiegel Online, 11.09.2012
Prolog
Menschliches Blut:
44 Prozent Hämatokrit.
55 Prozent Plasma.
Und eine hundertprozentige Sauerei, wenn es aus einer punktierten Ader unkontrolliert durch den Raum spritzt.
Der Doktor, wie er sich selbst gerne nannte, obwohl er nie promoviert hatte, wischte sich mit dem Handrücken über die Stirn. Zwar verteilte er damit nur die Spritzer, die ihn getroffen hatten, was vermutlich ziemlich widerlich aussah, aber wenigstens lief ihm jetzt nichts mehr von der Suppe ins Auge; so wie letztes Jahr, bei der Behandlung der Prostituierten, nach der er sechs Wochen lang Angst gehabt hatte, sich mit HIV, Hepatitis C oder sonst einem Dreck angesteckt zu haben.
Er hasste es, wenn die Dinge nicht nach Plan liefen. Wenn das Betäubungsmittel falsch dosiert war. Oder die Auserwählten sich in letzter Sekunde wehrten und den Zugang aus dem Arm rissen.
»Bitte nischt … nein«, lallte sein Mandant. Der Doktor bevorzugte diese Bezeichnung. Auserwählt war zu hochtrabend, und Patient klang irgendwie falsch in seinen Ohren, denn wirklich krank waren die wenigsten, die er behandelte.
Auch der Kerl auf dem Tisch war kerngesund, selbst wenn er im Moment so aussah, als wäre er an eine Starkstromleitung angeschlossen. Der schwarze Athlet verdrehte die Augen, spuckte Schaum und drückte den Rücken durch, während er verzweifelt an seinen Fesseln riss, die ihn auf der Liege hielten. Er war ein Sportler, durchtrainiert und mit vierundzwanzig Jahren auf dem Höhepunkt seiner Leistungskraft. Doch was nutzten all die Jahre harten Trainings, wenn einem ein Narkotikum durch die Adern strömte? Nicht genug, um ihn komplett auszuschalten, denn der Zugang war ja abgerissen, aber immerhin so viel, dass der Doktor ihn mühelos wieder auf die Pritsche drücken konnte, nachdem der schlimmste Anfall vorbei war. Auch das Blut spritzte nicht mehr, seitdem es ihm gelungen war, einen Druckverband anzulegen.
»Sch, sch, sch, sch, sch.«
Er legte dem Mann beruhigend die Hand auf die Stirn. Sie fühlte sich fiebrig an, und der Schweiß glänzte unter der Halogenlampe.
»Was ist denn auf einmal los mit Ihnen?«
Der Mandant öffnete den Mund. Die Angst sprang ihm wie ein Klappmesser aus den Pupillen. Was er sagte, war kaum zu verstehen. »Ich … will … nicht … ster…«
»Aber, aber, wir waren uns doch einig«, lächelte der Doktor beruhigend. »Alles ist arrangiert. Jetzt machen Sie mir ja keinen Rückzieher, so kurz vor dem perfekten Tod.«
Er sah zur Seite, durch die offene Tür in den Nebenraum, zu dem Instrumententisch mit den Skalpellen und der elektrischen Knochenfräse, die einsatzbereit an der Steckdose hing.
»Hab ich es Ihnen denn nicht deutlich erklärt?« Er seufzte. Natürlich hatte er das. Stundenlang. Immer und immer wieder, doch dieser undankbare Trottel hatte es offenbar einfach nicht begriffen.
»Es wird sehr unangenehm werden, natürlich. Aber ich kann Sie nur auf diese Art sterben lassen. Anders funktioniert das nicht.«
Der Leichtathlet wimmerte. Zerrte an den Schlaufen, in denen seine Hände steckten, allerdings mit weitaus weniger Kraft als zuvor.
Zufrieden registrierte der Doktor, dass die Betäubung nun doch die gewünschte Wirkung entfaltete. Nicht mehr lange, und die Behandlung konnte beginnen.
»Sehen Sie, ich könnte die Sache hier abbrechen«, sagte er, eine Hand immer noch auf der Stirn des Sportlers. Mit der anderen rückte er sich den Mundschutz gerade. »Doch danach bestünde Ihre Welt nur noch aus Angst und Schmerzen. Unvorstellbaren Schmerzen.«
Der Schwarze blinzelte. Seine Atmung wurde ruhiger.
»Ich hab Ihnen die Fotos gezeigt. Und das Video. Das mit dem Korkenzieher und dem halben Auge. So etwas wollen Sie doch nicht, oder?«
»Hmhmhhmmm«, stöhnte der Mandant, als hätte er einen Knebel im Mund, dann erschlafften seine Gesichtszüge, und die Atmung wurde flacher.
»Ich nehme das mal als ein Nein«, sagte der Doktor und löste mit dem Fuß die Feststellbremse der Liege, um den Mandanten in den Nebenraum zu rollen.
In den OP.
Eine Dreiviertelstunde später war der erste und wichtigste Teil der Behandlung vollzogen. Der Doktor trug keine Latexhandschuhe mehr, keinen Mundschutz, und den grünen Wegwerfkittel, den man wie eine Zwangsjacke auf dem Rücken zusammenbinden musste, hatte er in den Müllschlucker geworfen. Dennoch fühlte er sich in dem Smoking und den dunklen Lacklederschuhen, in denen er jetzt steckte, viel mehr kostümiert als in seinem OP-Outfit.
Kostümiert und beschwipst.
Er wusste nicht, wann es damit angefangen hatte, dass er sich nach jeder erfolgreichen Behandlung einen Schluck genehmigte. Oder zehn, so wie gerade eben. Verdammt, er musste damit aufhören, auch wenn er noch nie davor, sondern immer nur hinterher getrunken hatte. Dennoch. Der Fusel machte ihn leichtsinnig.
Brachte ihn auf dumme Gedanken.
Wie zum Beispiel, das Bein mitzunehmen.
Er sah kichernd auf seine Uhr.
Es war zwanzig Uhr dreiunddreißig; er musste sich beeilen, wenn er nicht zu spät zum Hauptgang kommen wollte. Die Vorspeise hatte er bereits verpasst. Doch bevor er sich dem Perlhuhn widmen konnte, das heute auf der Speisekarte stand, musste er erst einmal die biologischen Abfälle entsorgen – die nicht benötigten Blutkonserven und den rechten Unterschenkel, den er in einer hervorragend sauberen Arbeit direkt unter dem Knie abgesägt hatte.
Der Schenkel war in einer kompostierbaren Plastiktüte eingewickelt, die er auf seinem Weg durch das Treppenhaus mit beiden Händen tragen musste, so schwer war sie.
Der Doktor fühlte sich benebelt, aber nicht so sehr, dass er nicht wusste, dass er im nüchternen Zustand nie auf die Idee gekommen wäre, Körperteile in der Öffentlichkeit mit sich herumzuschleppen, anstatt sie einfach in die Müllverbrennungsanlage zu schmeißen. Aber er hatte sich so sehr über seinen Mandanten geärgert, der Spaß jetzt war das Risiko wert. Und das war gering. Sehr gering.
Es gab eine Sturmwarnung. Sobald er die verschlungenen Pfade hinter sich gelassen hatte, den engen Schacht, durch den man nur gebückt gehen konnte, den Gang mit den gelben Lüftungsrohren hindurch bis zum Lastenaufzug, würde er draußen garantiert keiner Menschenseele begegnen.
Außerdem wurde die Stelle, die er sich für die Entsorgung ausgesucht hatte, von keiner Kamera erfasst.
Ich bin vielleicht angetrunken, aber nicht blöd.
Er hatte den letzten Abschnitt erreicht, die Plattform am oberen Ende der Treppe, die – wenn überhaupt – nur der Wartungstrupp einmal im Monat benutzte, und zog an einer schweren Tür mit Bullaugenfenster.
Heftiger Wind wehte ihm ins Gesicht, und er hatte das Gefühl, sich gegen eine Wand stemmen zu müssen, um nach draußen zu gelangen.
Die frische Luft ließ seinen Kreislauf absacken. Im ersten Moment wurde ihm übel, rasch hatte er sich aber wieder im Griff, und der nach Salz schmeckende Wind fing an, ihn zu beleben.
Er wankte nun nicht mehr wegen des Alkohols, sondern wegen des heftigen Seegangs, der im Inneren der Sultan of the Seas wegen der Stabilisatoren nicht so spürbar gewesen war.
Breitbeinig schwankte er über die Planken. Er war auf Deck 8 ½, einer Zwischenplattform, die aus rein optischen Gründen existierte. Aus der Ferne betrachtet, verlieh sie dem Kreuzfahrtschiff ein etwas schnittigeres Hinterteil, so wie ein Spoiler bei einem Sportwagen.
Der Doktor erreichte die äußerste Backbordseite des Hecks und beugte sich über die Brüstung. Unter ihm toste der Indische Ozean. Die rückwärts gerichteten Scheinwerfer strahlten die weißen Schaumberge an, die das Kreuzfahrtschiff hinter sich herzog.
Eigentlich hatte er noch einen Spruch aufsagen wollen, so etwas wie »Hasta la vista, Baby« oder »Bereit, wenn Sie es sind«, aber ihm wollte nichts Lustiges einfallen, daher warf er die Tüte mit dem Unterschenkel wortlos im hohen Bogen über Bord.
In der Theorie hat sich das irgendwie besser angefühlt, dachte er, langsam wieder etwas nüchterner.
Der Wind zerrte so laut an seinen Ohren, dass er das Geräusch nicht hören konnte, als der Schenkel fünfzig Meter unter ihm in die Wellen klatschte. Wohl aber die Stimme in seinem Rücken.
»Was machen Sie denn da?«
Er fuhr herum.
Die Person, die ihn bis ins Mark erschreckt hatte, war kein erwachsener Angestellter, Gott sei Dank, etwa von der Security, sondern ein junges Mädchen; nicht älter als die Kleine, die er vor zwei Jahren vor der Westküste Afrikas gemeinsam mit ihrer gesamten Familie behandelt hatte. Sie kauerte im Schneidersitz neben dem Kasten einer Klimaanlage oder sonst eines Aggregats. Mit Technik kannte sich der Doktor nicht so gut aus wie mit Messern.
Da das Mädchen so klein und die Umgebung so dunkel war, hatte er sie übersehen. Und auch jetzt, wo er in die Dunkelheit starrte, konnte er nur Umrisse von ihr ausmachen.
»Ich füttere die Fische«, sagte er, froh darüber, dass er wesentlich ruhiger klang, als er sich fühlte. Das Mädchen war keine körperliche Bedrohung, aber als Zeugin konnte er sie trotzdem nicht gebrauchen.
»Ist Ihnen schlecht?«, fragte sie. Sie trug einen hellen Rock mit dunklen Strumpfhosen, darüber einen Anorak. Aus Vorsichtsgründen hatte sie die rote Schwimmweste angezogen, die auf allen Kabinen im Schrank lag.
Braves Mädchen.
»Nein«, antwortete er und grinste. »Mir geht es gut. Wie heißt du denn?«
Langsam gewöhnten sich seine Augen an das Dämmerlicht. Das Mädchen hatte schulterlange Haare und etwas abstehende Ohren, was sie aber nicht entstellte. Im Gegenteil. Er wettete darauf, dass man, bei Lichte betrachtet, die aparte junge Frau erkannte, die sie einmal werden würde.
»Ich heiße Anouk Lamar.«
»Anouk? Das ist die französische Koseform von Anna, richtig?«
Das Mädchen lächelte. »Wow, Sie wissen das?«
»Ich weiß vieles.«
»Ach ja? Wissen Sie denn auch, wieso ich hier sitze?«
Ihre freche Stimme klang sehr hoch, weil sie laut gegen den Wind ansprechen musste.
»Du malst das Meer«, sagte der Doktor.
Sie presste sich den Malblock an die Brust und grinste. »Das war einfach. Was wissen Sie noch?«
»Dass du hier nichts zu suchen hast und schon längst im Bett sein müsstet. Wo stecken denn deine Eltern?«
Sie seufzte. »Mein Vater lebt nicht mehr. Und wo meine Mutter ist, weiß ich nicht. Sie lässt mich abends oft allein in der Kabine.«
»Und da ist dir langweilig?«
Sie nickte. »Sie kommt immer erst ganz spät zurück, und dann stinkt sie.« Ihre Stimme wurde leise. »Nach Rauch. Und Trinken. Und sie schnarcht.«
Der Doktor musste lachen. »Das tun Erwachsene manchmal.«
Du müsstest mich mal hören. Er zeigte auf ihren Block. »Aber konntest du denn heute überhaupt etwas zeichnen?«
»Nee.« Sie schüttelte den Kopf. »Gestern gab es schöne Sterne, aber heute ist alles dunkel.«
»Und kalt«, stimmte der Doktor ihr zu. »Was meinst du, wollen wir deine Mami suchen gehen?«
Anouk zuckte mit den Achseln. Sie wirkte nicht sehr erfreut, sagte aber: »Okay, warum nicht.«
Sie schaffte es, aus dem Schneidersitz aufzustehen, ohne die Hände zu benutzen. »Manchmal ist sie im Kasino«, sagte sie.
»Oh, das trifft sich aber gut.«
»Wieso?«
»Weil ich eine Abkürzung dorthin kenne«, sagte der Doktor lächelnd.
Er warf einen letzten Blick über die Reling auf das Meer, das an dieser Stelle so tief war, dass das Bein des Athleten wahrscheinlich noch nicht einmal den Grund des Ozeans erreicht hatte, dann griff er nach der Hand des Mädchens und führte sie zu dem Treppenhaus zurück, aus dem er eben gekommen war.
1. Kapitel
Das Haus, in dem die tödliche Party steigen sollte, sah so aus wie das, von dem sie früher einmal geträumt hatten. Frei stehend, mit einem roten Ziegeldach und einem großen Vorgarten hinter dem weißen Palisadenzaun. Hier hätten sie am Wochenende gegrillt und im Sommer einen aufblasbaren Pool auf den Rasen gestellt. Er hätte Freunde eingeladen, und sie hätten einander Geschichten erzählt über den Job, die Macken ihrer Partner oder einfach nur unter dem Sonnenschirm auf der Liege gelegen, während sie ihren Kindern beim Spielen zuschauten.
Nadja und er hatten sich so ein Haus angesehen, da war Timmy gerade eingeschult worden. Vier Zimmer, zwei Bäder, ein Kamin. Mit cremefarbenem Putz und grünen Fensterläden. Gar nicht weit von hier entfernt, an der Grenze von Westend zu Spandau, nur fünf Minuten mit dem Fahrrad bis zur Wald-Grundschule, wo Nadja damals unterrichtete. Einen Steinwurf entfernt von den Sportanlagen, auf denen sein Sohn hätte Fußball spielen können. Oder Tennis. Oder was auch immer.
Damals war es für sie unbezahlbar gewesen.
Heute gab es niemanden mehr, der mit ihm irgendwo einziehen konnte. Nadja und Timmy waren tot.
Und der zwölfjährige Junge in dem Haus, das sie gerade observierten und das einem Mann namens Detlev Pryga gehörte, würde es auch bald sein, sollten sie noch länger hier draußen in dem schwarzen Van ihre Zeit vertrödeln.
»Ich geh da jetzt rein«, sagte Martin Schwartz. Er saß hinten, im fensterlosen Innenraum des Kastenwagens, und warf die Spritze, deren milchigen Inhalt er sich gerade injiziert hatte, in einen Plastikmülleimer. Dann stand er von dem Monitortisch auf, dessen Bildschirm die Außenansicht des Einsatzobjekts zeigte. Sein Gesicht spiegelte sich in den abgedunkelten Scheiben des Fahrzeugs. Ich seh aus wie ein Junkie auf Drogenentzug, dachte Martin, und das war eine Beleidigung. Für jeden Junkie.
Er hatte abgenommen in den letzten Jahren, mehr als man als gesund bezeichnen konnte. Nur seine Nase war noch so dick wie eh und je. Der Schwartz-Zinken, mit dem seit Generationen alle männlichen Familiennachkommen ausgestattet waren und den seine verstorbene Frau für sexy gehalten hatte, was er für den endgültigen Beweis hielt, dass Liebe tatsächlich blind machte. Wenn überhaupt, dann verlieh ihm der Kolben einen gutmütigen, vertrauenswürdigen Gesichtsausdruck; es kam hin und wieder vor, dass ihm Fremde auf der Straße zunickten, Babys lächelten, wenn er sich über den Kinderwagen beugte (vermutlich, weil sie ihn mit einem Clown verwechselten), und Frauen ganz offen, manchmal sogar in Gegenwart ihrer Partner, mit ihm flirteten.
Nun, heute würden sie das ganz sicher nicht tun, nicht, solange er in diesen Klamotten steckte. Der eng anliegende, schwarze Lederanzug, in den er sich gezwängt hatte, erzeugte schon beim Atmen unangenehme Knautschgeräusche. Auf dem Weg zu dem Ausstieg hörte es sich an, als würde er einen riesigen Luftballon verknoten.
»Halt, warte«, sagte Armin Kramer, der die Einsatzleitung innehatte und ihm seit Stunden am Computertisch gegenübersaß.
»Worauf?«
»Auf …«
Kramers Handy klingelte, und er musste seinen Satz nicht mehr vollenden.
Der etwas übergewichtige Kommissar begrüßte den Anrufer mit einem eloquenten »Hm?« und sagte im weiteren Verlauf des Gesprächs nicht sehr viel mehr außer: »Was?«, »Nein!«, »Du verscheißerst mich!« und: »Sag dem Arsch, der das verbockt hat, er soll sich warm anziehen. Wieso? Weil es im Oktober verdammt kalt werden kann, wenn er gleich für einige Stunden vor dem Revier liegt, sobald ich mit ihm fertig bin.« Kramer legte auf.
»Fuck.«
Er liebte es, sich wie ein amerikanischer Drogencop anzuhören. Und auch so auszusehen. Er trug ausgelatschte Cowboystiefel, löchrige Jeans und ein Hemd, dessen rot-weißes Karomuster an Geschirrspültücher erinnerte.
»Wo liegt das Problem?«, wollte Schwartz wissen.
»Jensen.«
»Was ist mit ihm?«
Und wie kann der Typ Probleme machen? Er sitzt bei uns in einer Isolierzelle.
»Frag mich nicht, wie, aber der Bastard hat es geschafft, Pryga eine SMS zu schicken.«
Schwartz nickte. Gefühlsausbrüche wie die seines Vorgesetzten, der sich gerade die Haare raufte, waren ihm fremd. Außer einer Spritze Adrenalin direkt in die Herzkammer gab es kaum noch etwas, was seinen Puls in die Höhe treiben konnte. Schon gar nicht die Nachricht, dass es einem Knacki mal wieder gelungen war, an Drogen, Waffen oder, wie Jensen, an ein Handy zu kommen. Das Gefängnis war besser organisiert als ein Supermarkt, mit einer größeren Auswahl und kundenfreundlicheren Öffnungszeiten. Auch sonn- und feiertags.
»Hat er Pryga gewarnt?«, fragte er Kramer.
»Nein. Der Pisser hat sich einen Scherz erlaubt, der aufs Gleiche rauskommt. Er wollte dich in die Falle laufen lassen.« Der Kommissar massierte sich seine Tränensäcke, die von Einsatz zu Einsatz größer wurden. »Wollte ich sie per Post verschicken, müsste ich sie als Päckchen aufgeben«, hatte Kramer letztens erst gewitzelt.
»Wie das?«, fragte Schwartz.
»Er hat ihm geschrieben, dass Pryga nicht erschrecken soll, wenn er gleich zur Party erscheint.«
»Weshalb erschrecken?«
»Weil er gestolpert ist und sich einen Schneidezahn ausgeschlagen hat. Oben links.«
Kramer tippte mit seinen Wurstfingern an die entsprechende Stelle im Mund.
Schwartz nickte. So viel Kreativität hätte er dem Perversen gar nicht zugetraut.
Er sah auf seine Armbanduhr. Es war kurz nach siebzehn Uhr.
Kurz nach »zu spät«.
»Verdammt!« Kramer schlug wütend auf den Computertisch. »So lange Vorbereitung, und alles für die Katz. Wir müssen die Sache abblasen.«
Er machte Anstalten, zu den Vordersitzen zu klettern.
Schwartz öffnete den Mund, um zu widersprechen, wusste aber, dass Kramer recht hatte. Seit einem halben Jahr arbeiteten sie auf diesen Tag hin. Angefangen hatte es mit einem Gerücht in der Szene, das so unglaublich war, dass man es lange Zeit für eine urbane Legende hielt. Allerdings waren »Bug-Partys«, wie sich herausstellte, keine Schauermärchen, sondern existierten tatsächlich. Sogenannte Wanzenfeiern, auf denen HIV-Infizierte ungeschützten Sex mit gesunden Menschen hatten. Meistens einvernehmlich, was solche Events, bei denen die Ansteckungsgefahr für den besonderen Kick sorgen sollte, eher zu einem Fall für den Psychiater als für die Staatsanwaltschaft machte.
Schwartz’ Meinung nach konnten erwachsene Menschen mit sich anstellen, was sie wollten, solange es freiwillig geschah. Es ärgerte ihn dabei nur, dass durch das irrsinnige Verhalten einer Minderheit die dummen Vorurteile, die viele immer noch gegenüber Aidskranken hegten, unnötig verstärkt wurden. Denn selbstverständlich waren Bug-Partys die absolute Ausnahme, während die überwiegende Mehrheit der Infizierten ein verantwortungsbewusstes Leben führte, viele sogar im aktiven Kampf gegen die Krankheit und die Stigmatisierung ihrer Opfer organisiert.
Ein Kampf, den selbstmörderische Bug-Partys zunichtemachen.
Erst recht solche der psychopathischen Variante.
Der neueste Trend in der Perversoszene waren »Events«, auf denen Unschuldige vergewaltigt und mit dem Virus infiziert wurden. Meistens Minderjährige. Vor zahlendem Publikum. Eine neue Attraktion in dem Jahrmarkt der Abscheulichkeiten, der in Berlin rund um die Uhr seine Zelte geöffnet hielt. Oft in gediegenen Häusern in spießigen Gegenden, in denen man so etwas niemals vermutete. So wie hier und heute im Westend.
Detlev Pryga, ein Mann, der im normalen Leben Sanitärbedarf verkaufte, war ein beliebter Partner des Jugendamts, nahm er doch regelmäßig die schwierigsten Pflegekinder auf. Drogen-, Missbrauchs- und andere Problemfälle, die mehr Kinderheime als Klassenzimmer von innen gesehen hatten. Gestörte Seelen, die es oft gar nicht anders kannten, als dass sie nur gegen Sex irgendwo übernachten durften, und bei denen es nicht auffiel, wenn sie bald wieder abhauten und nach einiger Zeit verwahrlost und krank erneut aufgegriffen wurden. Sie waren die perfekten Opfer, polizeischeue Störenfriede, denen man nur selten Glauben schenkte, sollten sie sich doch einmal um Hilfe bemühen.
Auch Liam, das zwölfjährige Straßenkind, das seit einem Monat im Hause Pryga lebte, würde sehr bald nach dem heutigen Abend wieder in die Gosse abgeschoben werden. Aber zuvor würde er vor den anwesenden Gästen mit Kurt Jensen, einem dreiundvierzigjährigen, HIV-infizierten Pädophilen, Sex haben müssen.
Pryga hatte Jensen über einschlägige Chatrooms im Internet kennengelernt, und so war er der Polizei ins Netz gegangen.
Der Kinderschänder saß mittlerweile seit zwei Wochen in Untersuchungshaft. In dieser Zeit hatte Schwartz sich darauf vorbereitet, Jensens Identität anzunehmen, was relativ einfach war, da es zwischen ihm und Pryga keinen Austausch von Fotos gegeben hatte. Er musste nur die Lederkleidung tragen, die Pryga sich für die Filmaufnahmen wünschte, und den Kopf kahlscheren, weil Jensen sich als groß, schlank, grünäugig und glatzköpfig beschrieben hatte. Merkmale, die nach der Rasur und dank der Kontaktlinsen nun auch auf Martin Schwartz zutrafen.
Als größte Schwierigkeit in der Tarnung hatte sich der positive Aidstest erwiesen, den Pryga verlangte. Nicht im Voraus. Sondern direkt auf der Party. Er hatte angekündigt, Schnelltests aus einer niederländischen Onlineapotheke bereitzuhalten. Ein Tropfen Blut, und das Ergebnis zeigt sich in drei Minuten im Sichtfeld des Teststreifens.
Schwartz wusste, es war dieses an und für sich unlösbare Problem, weshalb er überhaupt für diesen Einsatz ausgewählt worden war. Seit dem Tod seiner Familie galt er in Polizeikreisen als tickende Zeitbombe. Ein verdeckter Ermittler, der mit achtunddreißig Jahren in seinem Beruf stramm dem Rentenalter entgegenmarschierte und dem das Wichtigste fehlte, was ihn und sein Team im Notfall am Leben hielt: das Angstempfinden.
Vier Mal schon war er von Polizeipsychologen durchgecheckt worden. Vier Mal schon waren sie zu dem Ergebnis gelangt, dass er den Selbstmord seiner Frau nicht verkraftet habe – und erst recht nicht, dass sie zuvor das Leben ihres gemeinsamen Sohnes ausgelöscht hatte. Vier Mal sprachen sie die Empfehlung aus, ihn in den vorzeitigen Ruhestand zu versetzen, weil ein Mensch, der keinen Sinn mehr in seinem Leben sah, bei seiner Dienstausübung unverantwortliche Risiken eingehen würde.
Vier Mal hatten sie recht gehabt.
Und dennoch saß er heute wieder in einem Einsatzfahrzeug, nicht nur, weil er der Beste im Job war. Sondern vor allen Dingen, weil sich kein anderer freiwillig HIV-Antikörper in die Blutbahn jagen lassen wollte, um den Schnelltest zu manipulieren. Das Blutserum war zwar durch ein spezielles Sterilisationsverfahren von den Aids auslösenden Erregern gereinigt worden, aber eine hundertprozentige Sicherheit hatte der Teamarzt ihm nicht geben wollen, weswegen Schwartz, sobald das hier vorbei war, eine vierwöchige Medikamententherapie starten musste, die sogenannte Postexpositionsprophylaxe, kurz PEP genannt. Ein Verfahren, das er schon einmal durchlitten hatte, nachdem ihm ein Fixer in der Hasenheide eine blutige Spritze in den Nacken gerammt hatte. Im Beipackzettel der »Pillen danach«, die man spätestens zwei Stunden nach der Ansteckungsgefährdung schlucken sollte, stand, man müsse mit Kopfschmerzen, Durchfall und Erbrechen rechnen. Schwartz war anscheinend empfindlicher als andere Testpersonen. Sehr viel empfindlicher. Zwar hatte er weder gekotzt noch länger als sonst auf dem Klo hocken müssen, dafür hatten ihn heftige Migräneschübe an den Rand der Ohnmacht getrieben. Und teilweise darüber hinaus.
»Ich muss loslegen«, sagte er zu Kramer mit Blick auf den Monitor. Seit zehn Minuten war niemand mehr ins Haus gegangen.
Sie hatten sieben Gäste gezählt, fünf Männer, zwei Frauen. Alle waren mit dem Taxi gekommen. Praktisch, wenn man nicht wollte, dass sich jemand die Nummernschilder parkender Autos notierte.
»Was, wenn Pryga alle Eventualitäten berücksichtigt und einen Ersatz für mich bereithält, für den Fall, dass ich einen Rückzieher mache?«, fragte Schwartz. Die Gäste waren höchstwahrscheinlich gesund. Ganz sicher nicht im geistigen, aber im körperlichen Sinne. Doch genau wussten sie das natürlich nicht.
Kramer schüttelte den Kopf. »So viele infizierte Pädophile, die zu so etwas bereit sind, gibt es nicht. Du weißt, wie lange Pryga nach Jensen suchen musste.«
Ja. Wusste er.
Trotzdem. Das Risiko war zu hoch.
Sie konnten auch nicht einfach das Haus stürmen. Dafür würden sie keinen Grund vorweisen können. Die Vergewaltigung sollte im Keller stattfinden. Pryga hatte Hunde, die jeden Besucher ankündigten. Selbst wenn sie blitzschnell wären, würde es ihnen nicht gelingen, die Türen aufzubrechen und die Täter in flagranti zu erwischen. Und wofür sollten sie die Anwesenden dann verhaften? Es war kein Verbrechen, sich in einem Heizungsraum einzuschließen und eine Kamera vor eine Matratze zu stellen. Selbst dann nicht, wenn darauf ein Junge mit nacktem Oberkörper lag.
Im besten Fall könnten sie Pryga und seine Gäste für einige Stunden in Gewahrsam nehmen. Im schlimmsten Fall hätten sie die kranken Psychopathen nur gewarnt.
»Wir können nicht riskieren, dass ein zwölfjähriger Junge vergewaltigt und mit HIV infiziert wird«, protestierte Schwartz.
»Ich weiß nicht, ob ich vorhin zu schnell gesprochen habe«, sagte Kramer und betonte jedes Wort so langsam, als redete er mit einem Schwachsinnigen: »Du kommst da nicht rein. Du. Hast. Noch. Alle. Zähne!«
Schwartz rieb sich den Drei- oder Siebentagebart. So genau konnte er nicht sagen, wann er das letzte Mal zu Hause geschlafen hatte.
»Was ist mit Doc Malchow?«
»Unser Teamarzt?« Kramer sah ihn an, als habe er ihn nach einer Erwachsenenwindel gefragt. »Hör mal, ich weiß ja, dass bei dir nicht alle Nadeln an der Tanne kleben, aber selbst du kannst doch nicht so verrückt sein, dir die Zähne raushobeln zu lassen. Und selbst wenn …« Kramer sah auf seine Uhr. »Malchow ist frühestens in zwanzig Minuten hier, die Betäubung dauert noch mal drei, die OP weitere fünf.« Er deutete auf den Monitor mit der Vorderansicht des Hauses. »Wer sagt dir, dass in einer knappen halben Stunde die Party nicht schon längst vorbei ist?«
»Du hast recht«, sagte Schwartz und setzte sich erschöpft auf eine gepolsterte Sitzbank an der Seitenwand.
»Also Abbruch?«, fragte Kramer.
Schwartz antwortete nicht und griff unter seinen Sitz. Er zog seinen armeegrünen Seesack hervor, der ihn auf jeden Einsatz begleitete.
»Was wird denn das?«, fragte der Einsatzleiter.
Schwartz warf die Klamotten, die er vorhin gegen die Lederkluft getauscht hatte, auf den Boden und kramte in den Tiefen der Tasche.
Es dauerte nur wenige Sekunden, da hatte er zwischen Kabel- und Kleberollen, Batterien und Werkzeugen den gesuchten Gegenstand gefunden.
»Sag mir bitte, dass das nur ein Scherz ist«, sagte Kramer, als er ihn um einen Spiegel bat.
»Vergiss es«, antwortete Schwartz achselzuckend. »Es geht auch ohne.«
Dann setzte er die Zange am linken oberen Schneidezahn an.
2. Kapitel
Sie sind komplett verrückt.«
»Danke, dass Sie mir das so schonend beibringen, Frau Doktor.«
»Nein, wirklich.«
Die sonnengebräunte junge Zahnärztin sah so aus, als wollte sie ihm eine scheuern. Gleich würde sie ihn fragen, ob er sich für Rambo hielt, so wie Kramer, der SEK-Leiter, die beiden Rettungssanitäter und ein halbes Dutzend andere es schon getan hatten, seitdem der Einsatz vorbei war.
Die Ärztin, laut dem Schild an ihrem Charité-Kittel Dr. Marlies Fendrich, atmete gestresst durch ihren himmelblauen Einweg-Mundschutz.
»Für wen halten Sie sich? Für Rambo?«
Er lächelte, was ein Fehler war, weil dadurch kalte Luft an den frei liegenden Nerv gelangte. Er hatte sich den Zahn kurz über dem Kieferknochen abgebrochen, Schmerzblitze durchzuckten seinen Kopf, wann immer er mit der Zunge den Stumpf berührte.
Der Stuhl, auf dem er lag, senkte sich in Rückenlage. Eine breite Bogenlampe tauchte über seinem Kopf auf und blendete ihn.
»Mund auf!«, befahl die Ärztin, und er gehorchte.
»Wissen Sie, was das für ein Aufwand ist, den Zahn wiederherzustellen?«, hörte er sie fragen. Sie war so nah an seinem Gesicht, dass er ihre Poren sehen konnte. Im Gegensatz zu ihm legte sie großen Wert auf Körperpflege. Sein letztes Peeling lag ein Jahr zurück. Damals hatten die beiden Slowenen ihn mit dem Gesicht über den Asphalt der Autobahnraststätte gezogen.
Es war nie gut, wenn die Tarnung aufflog.
»Sie haben mir kaum einen Millimeter Substanz gelassen, viel zu wenig, um da eine Krone drauf aufzubauen«, schimpfte Marlies weiter. »Wir können eine Extrusion versuchen, also die Wurzel, die noch im Kiefer steckt, hervorziehen. Besser wäre eine chirurgische Kronenverlängerung, dann kommen wir vielleicht um eine Implantation herum, vorher muss allerdings der Wurzelkanal gründlich gereinigt werden. Nach dem, was Sie sich angetan haben, brauchen Sie ja wohl keine Betäubung, wenn ich etwas am Knochen fräse …«
»Zwölf!«, stoppte Martin ihren Redeschwall.
»Was zwölf?«
»So alt war der Junge, den sie in eine Schaukel gekettet hatten. Er trug eine Klemme, die ihm den Mund offen hielt, damit er sich beim Oralverkehr nicht wehren kann. Ich sollte ihn mit HIV infizieren.«
»Großer Gott!« Das Gesicht der Ärztin verlor einen Großteil ihrer Urlaubsbräune. Schwartz fragte sich, wo sie gewesen war. Mitte Oktober musste man schon weiter wegfliegen, um sich in die Sonne legen zu können. Oder man hatte Glück. Nadja und er hatten es einmal gehabt, vor sechs Jahren. Ihre letzte Fahrt nach Mallorca. Sie hatten Timmys zehnten Geburtstag am Strand feiern können, und er hatte sich dabei einen Sonnenbrand geholt. Den letzten seines Lebens. Ein Jahr später waren seine Frau und sein Sohn tot, und er hatte nie wieder Urlaub gemacht.
»Der Täter hat einen Glatzkopf mit fehlendem Schneidezahn erwartet. Was soll ich sagen …« Er tätschelte sich den kahlen Schädel. »… mein Frisör hat ungefähr die gleiche Laune wie Sie.«
Die Zahnärztin rang sich ein nervöses Lächeln ab. Man sah ihr an, dass sie nicht wusste, ob Schwartz einen Scherz gemacht hatte.
»Hat er, ich meine, der Junge, wurde er …?«
»Es geht ihm gut«, antwortete er ihr. Zumindest so gut, wie es einem Pflegekind gehen konnte, das sich wieder in einem Heim befand, kurz nachdem es aus den Fängen perverser Wahnsinniger befreit worden war. Schwartz hatte gewartet, bis er den Befehl Prygas auf Band hatte, »es dem Jungen in alle Löcher zu besorgen«. Die Kamera in den Nieten seiner Lederjacke, fing das erwartungsvolle Grinsen aller Gäste ein, zu denen er sich umdrehte, bevor er »Toaster« sagte, das vereinbarte Zugriffswort für das SEK. Gemeinsam mit dem scheinbar positiven HIV-Test und dem Video aus Prygas selbst aufgebauter Standkamera hatten sie genügend Beweismaterial, um die Schweine für eine sehr, sehr lange Zeit hinter Gittern zu bringen.
»Mit etwas Glück sogar für zweieinhalb Jahre«, hatte Kramer geunkt, als er ihn ins Virchow fuhr, wo sie ihm erst einmal die PEP-Mittel aushändigten: drei Pillen täglich, fünf Wochen lang. Kramer hatte sich um den Schriftkram kümmern müssen, weshalb Martin sich alleine zur Zahnklinik durchgefragt hatte, wo er jetzt, nach weiteren zwei Stunden Wartezeit, endlich drangekommen war.
»Es tut mir leid«, entschuldigte sich die Ärztin. Sie hatte ein kleines Gesicht mit etwas zu großen Ohren und niedlichen Sommersprossen auf der Nase. In einem anderen Leben hätte Schwartz überlegt, ob er sie nach ihrer Telefonnummer fragen sollte, um es dann doch nicht zu tun, da er ja verheiratet war. Das war das Problem mit dem Leben. Nie stimmte das Timing. Entweder traf man eine hübsche Frau und trug einen Ring am Finger. Oder der Ring war ab, und jede hübsche Frau erinnerte einen daran, was man verloren hatte.
»Man hat mir nur gesagt, Sie hätten sich im Dienst selbst verletzt. Sie wären einfach nur ein …«
»Ein Spinner?«, ergänzte Schwartz den Teil des Satzes, den die Zahnärztin nicht zu vollenden gewagt hatte.
»Ja. Ich wusste nicht, dass …«
»Schon okay. Holen Sie einfach den Rest raus und nähen Sie alles wieder zu.«
Dr. Fendrich schüttelte den Kopf. »So einfach geht das nicht. Sie wollen doch sicher einen Stiftaufbau …«
»Nein.« Schwartz hob abwehrend die Hand.
»Aber es kann Ihnen doch nicht egal sein, so entstellt …«
»Wenn Sie wüssten, was mir alles egal ist«, sagte er tonlos, da brummte das Handy in seiner Hosentasche. »Moment, bitte.«
Er musste sich etwas zur Seite drehen, um es aus seiner Gesäßtasche fingern zu können. Wer immer ihn anrief, tat es mit unterdrückter Nummer.
»Hören Sie, da draußen warten noch weitere Patienten auf …«, begann die Ärztin einen weiteren unvollendeten Satz und wandte sich verärgert ab, als Schwartz ihren Protest ignorierte. »Ja?«
Keine Antwort. Nur ein heftiges Rauschen, das ihn an alte Modems und die AOL-Werbung aus den neunziger Jahren erinnerte.
»Hallo?«
Er hörte ein Echo seiner eigenen Stimme und war kurz davor, die Verbindung wegzudrücken, als es in der Leitung klackerte, als würde jemand mit Murmeln auf einer Glasplatte spielen. Dann wurde das Rauschen leiser, es knackte zweimal laut, und plötzlich konnte er jedes Wort verstehen.
»Hallo? Mein Name ist Gerlinde Dobkowitz. Spreche ich mit einem gewissen Herrn Martin Schwartz?«
Er blinzelte alarmiert. Menschen, die diese Nummer wählten, hatten keine Veranlassung, nach seinem Namen zu fragen. Er hatte die private Geheimnummer nur wenigen anvertraut, und die wussten alle, wie er hieß.
»Hallo? Herr Schwartz?«
Die fremde Stimme am Telefon hatte einen Wiener Akzent und gehörte entweder einer alten Frau oder einer jungen Dame mit einem schweren Alkoholproblem. Schwartz tippte auf Ersteres, schon wegen des altertümlichen Vornamens und der antiquierten Ausdrucksweise.
»Woher haben Sie meine Nummer?«, wollte er von ihr wissen.
Selbst wenn die Dame von der Telefongesellschaft war, was er nicht glaubte, hätten sie ihn nicht mit seinem bürgerlichen Namen, sondern mit »Peter Pax« angesprochen, dem Pseudonym, unter dem er vor Jahren die Nummer beantragt hatte; sein Lieblingsdeckname, weil er ihn an Peter Pan erinnerte.
»Sagen wir einfach, ich bin ganz gut im Recherchieren«, sagte die Anruferin.
»Was wollen Sie von mir?«
»Das erkläre ich Ihnen, sobald wir uns sehen.« Gerlinde Dobkowitz hustete heiser. »Sie müssen so schnell wie möglich an Bord kommen.«
»An Bord? Wovon reden Sie?«
Schwartz bemerkte, wie die Zahnärztin, die auf einem Beistelltisch ihre Instrumente sortierte, fragend aufsah.
»Von der Sultan of the Seas«, hörte er die alte Frau sagen. »Im Moment schippern wir einen Seetag von Hamburg entfernt Richtung Southampton irgendwo im Ärmelkanal. Sie sollten so schnell wie möglich zu uns stoßen.«
Schwartz wurde kalt. Vorhin, als er Pryga gegenübergestanden hatte, war er nicht nervös gewesen. Auch nicht, als er sich in dessen Hausflur mit der Nadel des HIV-Schnelltestsets gestochen und es doch länger als die drei veranschlagten Minuten gedauert hatte, bis endlich die zweite Linie im Sichtfenster des Teststreifens erschienen war. Nicht einmal, als er den nackten Jungen in der Schaukel gesehen hatte und sich hinter ihm die Feuerschutztüren schlossen. Doch jetzt schnellte sein Puls in die Höhe. Und die Wunde in seinem Mund pochte im Takt seines Herzschlags.
»Hallo? Herr Schwartz? Sie kennen doch das Schiff?«, fragte Gerlinde.
»Ja.«
Sicher.
Natürlich tat er das.
Es war das Kreuzfahrtschiff, auf dem seine Frau vor fünf Jahren in der dritten Nacht der Transatlantikpassage über die Brüstung ihrer Balkonkabine geklettert und fünfzig Meter in die Tiefe gesprungen war. Kurz nachdem sie Timmy einen in Chloroform getränkten Waschlappen aufs schlafende Gesicht gepresst und ihn anschließend über Bord geworfen hatte.
3. Kapitel
Naomi liebte Thriller. Je blutrünstiger, desto besser. Für die Kreuzfahrt auf dem Luxusliner hatte sie eine ganze Wagenladung mit an Bord der Sultan of the Seas geschleppt (an diese neumodischen E-Reader hatte sie sich noch nicht gewöhnen können), und an guten Tagen schaffte sie fast ein ganzes Buch, je nachdem, wie dick es war.
Oder wie blutig.
Manchmal war sie sich nicht sicher, wer die größere Macke hatte: der Autor, der sich diesen kranken Mist ausdachte, oder sie, die sie sogar Geld dafür bezahlte, um es sich mit Axtmördern und Psychopathen am Pool gemütlich machen zu können, in Reichweite der knackigen Kellner, die sie zwischen den Kapiteln je nach Tageszeit mit Kaffee, Softdrinks oder Cocktails versorgten.
In den sieben Jahren ihrer Ehe, bevor der liebe Gott der Meinung gewesen war, eine Urne auf dem Kamin würde besser zu ihr passen als ein Ring an ihrem Finger, hatte ihr Mann einmal zu ihr gesagt, er frage sich, weshalb es eine Altersbeschränkung für Filme und Computerspiele gebe, nicht aber für Bücher.
Wie recht er doch gehabt hatte.
Es gab Szenen, die hatte sie vor Jahren gelesen, und sie bekam sie seitdem nicht mehr aus dem Kopf, sosehr sie es sich auch wünschte. Beispielsweise jene aus »Der siebte Tod«, in der Joe sich auf ein wildes Sexabenteuer mit seiner Eroberung im Park freut und ihm stattdessen von der durchgeknallten Ziege mit einer Kneifzange ein Hoden abgerissen wird.
Sie schauderte.
Nach dieser Beschreibung musste man denken, der Autor wäre pervers, dabei war das Buch ein Riesenerfolg und sein Urheber Paul Cleave, den sie auf einem Krimifestival bei einer Lesung erlebt hatte, charmant, gutaussehend und amüsant. Lustig, wie weite Strecken des Buches selbst.
Kein Vergleich zu »Hannibal« von Thomas Harris, wo ihr schlecht geworden war, als Dr. Lecter seinem Widersacher bei lebendigem Leib das Gehirn aus dem geöffneten Schädel löffelte. Das Buch hatte fast siebenhundert Fünf-Sterne-Bewertungen!
Krank.
Fast so krank wie die Geschichte von der Siebenunddreißigjährigen, die von ihrem Entführer in einem Brunnen gefangen gehalten wird, bis ihr eines Tages ein Eimer mit einer Schüssel Reis herabgelassen wird. Auf der Schüssel stehen zwei Wörter, die die Frau, eine promovierte Biologin, in der Dunkelheit kaum lesen kann: Spirometra mansoni.
Der lateinische Name eines Parasiten, den es vor allem in Südostasien gibt, schnürsenkelbreit und bis zu dreißig Zentimeter lang, und der zu einem halbdurchsichtigen, geriffelten Bandwurm heranwächst. Dieser schält sich unter der Haut des Menschen ins Gehirn. Oder hinter das Auge, so wie bei der Frau in der Geschichte, deren Hunger so unerträglich ist, dass sie am Ende den verseuchten Reis essen muss, um nicht elendig zu verrecken.
Blöder Mist, wie heißt das Buch noch gleich?
Sie dachte an ihr Regal zu Hause im Wintergarten, an die alphabetisch sortierten Autoren, doch sie kam nicht drauf.
Ja, ist das denn die Möglichkeit? Es ist gar nicht so lange her, dass … ah, jetzt weiß ich es wieder!
In dem Moment, in dem der Schmerz sie aus dem Sekundenschlaf zurück in die Realität trieb, fiel es Naomi Lamar wieder ein:
Das war kein Buch.
Sondern ihr Leben.
Irgendwo auf der Sultan of the Seas.
Und zu ihrem Leidwesen war es noch lange nicht vorbei.
4. Kapitel
Martin Schwartz stieg mit einem Seesack auf der Schulter mittschiffs die Treppen der Sultan nach oben und fühlte sich schlecht.
Er hasste dieses Schiff, die in dezenten Pastellfarben gehaltenen Wandverkleidungen, die Möbel aus Mahagoni oder Teak und die weichen Teppiche, auf denen man wie auf einer Wiese lief. Er hasste die lächerlichen Uniformen der Angestellten, die selbst die einfachsten Pagen trugen, als wären sie bei der Marine und nicht auf einem Jahrmarkt des Massentourismus angestellt. Er hasste den dezenten Vanilleduft, der der Klimaanlage beigemischt wurde; hasste die Euphorie in den Augen der Passagiere, mit denen er über die Gangway an Bord gegangen war. Frauen, Männer, Kinder, Familien. Sie freuten sich auf sieben Nächte im Luxus, auf 24-Stunden-All-inclusive-Buffets, erholsame Seetage an Deck oder im zweitausend Quadratmeter großen Spa mit Over-Water-Fitnesscenter. Sie planten, die Shows im modernsten Musicaltheater der Weltmeere zu besuchen und sich Cocktails in einer der elf Bars zu genehmigen, die sich auf die siebzehn Decks verteilten. Sie wollten ihre Kinder im Piratenclub abgeben, auf die längste Wasserrutsche klettern, die jemals auf einem Schiff gebaut worden war, ihr Geld im Kasino verzocken oder in der Shoppingmall ausgeben, die im Stile einer italienischen Piazza gestaltet war. Vielleicht betraten einige das Schiff mit gemischten Gefühlen wie ein Flugzeug, in respektvoller Sorge, ob die Technik, der man sich auslieferte, einen unbeschadet von A nach B brachte. Keiner der knapp dreitausend Passagiere aber, da war Martin sich sicher, verschwendete auch nur einen einzigen Gedanken daran, dass sie die kommenden Tage in einer Kleinstadt leben würden, in der Tausende Menschen verschiedenster Kulturen und Schichten aufeinanderprallten, angefangen von den Zwei-Dollar-pro-Stunde-Kräften unten in der Wäscherei bis hin zu den Millionären auf den windgeschützten Liegeinseln im Oberdeck. Eine Stadt, in der es alles gab, nur keine Ordnungshüter. In der, wenn man die 110 wählte, der Zimmerservice kam – und nicht die Polizei. Eine Stadt, in der man sich mit dem ersten Schritt an Bord der Rechtsordnung irgendeiner rückständigen Bananenrepublik unterwarf, unter deren Flagge das Schiff vom Stapel gelaufen war.
Martin hasste die Sultan, ihre Passagiere und die Crew.
Aber vor allem hasste er sich selbst.
Er hatte sich geschworen, niemals mehr im Leben einen Fuß auf ein Kreuzfahrtschiff zu setzen. Schon gar nicht auf dieses hier. Und ein einziger Anruf einer Rentnerin, die er noch nicht einmal kannte, hatte ihn alle Vorsätze über Bord werfen lassen.
Wie wahr!
Er lachte zynisch in sich hinein, und ein älteres, stark übergewichtiges Ehepaar, das ihm auf der Treppe entgegenkam, musterte ihn skeptisch.
»Über Bord werfen.«
Passender konnte man es kaum ausdrücken.
Er erreichte Deck 12 und studierte die Wegweiser mit den Kabinennummern. Für Suite 1211 musste er auf die Backbordseite.
Martin gähnte. Obwohl oder gerade weil die Zahnärztin ihn gestern doch noch zu einem Stiftprovisorium überredet hatte, hatten die Zahnschmerzen ihn die ganze Nacht nicht zur Ruhe kommen lassen, und bis auf einen Zehnminutenschlaf im Flieger nach London hatte er keine Ruhepause gehabt.
Im Taxi von Heathrow nach Southampton hatte ihm dann sein Handy den letzten Nerv geraubt. Erst versuchte Kramer, ihn zu erreichen, dann der Chef persönlich, um ihn anzubrüllen, was ihm einfiele, ohne Entschuldigung der Einsatzbesprechung fernzubleiben. Wenn er nicht sofort aufs Revier käme, könne er sich seine Papiere abholen.
»Außerdem hast du Arsch versprochen, dich regelmäßig beim Doc zu melden. Das Teufelszeug, das du hoffentlich regelmäßig schluckst, kann zu zerebralen Ausfällen führen, obwohl ich bezweifle, dass man da bei dir überhaupt noch einen Unterschied bemerkt.«
Irgendwann hatte Martin die Beschimpfungen auf seine Mailbox laufen lassen. Er glaubte nicht, dass sie auf ihn verzichten konnten. Spätestens beim nächsten Himmelfahrtskommando war auch dieser Eintrag in seiner Personalakte wieder vergessen. Oder hatte er den Bogen tatsächlich ein wenig überspannt, indem er ohne Rücksprache mit seinen Vorgesetzten und ohne Urlaubsantrag einfach die Überfahrt auf der Sultan gebucht hatte? In einer 150-Quadratmeter-Suite auf Deck 11 für zweitausend Euro die Nacht, inklusive Business-Class-Rückflug von New York nach Berlin.
Dabei hatte Martin nicht vor, die Passage überhaupt anzutreten. Er wollte nur mit Gerlinde Dobkowitz sprechen, sich ihre angeblichen »Beweise« ansehen und dann sofort wieder runter vom Kahn. Doch die offenbar etwas verschrobene Alte hatte sich geweigert, das Schiff für ihn zu verlassen. Wie Martin gestern Nacht noch durch eine Internetrecherche herausgefunden hatte, wurde die 78-jährige Gerlinde Dobkowitz in den Kreuzfahrtforen als lebende Legende gehandelt. Sie hatte sich von ihrer Rente auf der Sultan eine der wenigen Dauerkabinen auf Lebenszeit geleistet. Und seit dem Stapellauf vor acht Jahren verließ sie das Schiff nur, wenn Wartungsarbeiten das zwingend erforderten.
Martin musste also zu ihr an Bord kommen, und da man ohne Passagierausweis nicht auf die Sultan gelassen wurde, war er gezwungen gewesen, selbst eine Kabine zu buchen. Die Verandasuite im Heck des Schiffes war die einzige, die so kurzfristig online noch verfügbar gewesen war, weswegen er jetzt für ein Zwanzigminutengespräch zwölftausend Euro bezahlte. Eigentlich war die Reisezeit so bemessen, dass er über zwei Stunden Zeit für die Unterredung gehabt hätte, aber der Taxifahrer hatte es sich auf der Herfahrt zur Aufgabe gemacht, ihm jeden Stau im Süden Großbritanniens zu zeigen.
Egal, der Preis würde ihn schon nicht ruinieren.
Zwar hielt sich sein Ermittlergehalt in überschaubaren Dimensionen, doch da er seit Jahren kaum etwas davon ausgab, war sein Konto mittlerweile so gut gefüllt, dass seine Bank ihm vor zwei Monaten sogar eine Karte zu seinem achtunddreißigsten Geburtstag geschickt hatte.
In diesem Moment allerdings, mit dem Finger auf der Klingel von Kabine 1211, fühlte er sich eher wie jenseits der fünfzig.
Er drückte den polierten Messingknopf und hörte ein dezentes Glockenspiel läuten. Es dauerte nur wenige Sekunden, bis die Tür geöffnet wurde und er sich einem devot lächelnden, jungen Bürschchen gegenübersah, das Frack und Lackschuhe trug. Martin erinnerte sich, dass die Sultan damit warb, jedem Gast, der eine überteuerte Suite buchte, einen Butler zur Verfügung zu stellen.
Das Exemplar vor ihm war Anfang zwanzig, hatte kurze, schwarze Haare, die wie mit dem Bügeleisen zum Mittelscheitel geplättet auf einem eher schmalen Schädel klebten. Er hatte wässrige Augen und ein fliehendes Kinn. Mut und Durchsetzungskraft waren nicht die ersten Vokabeln, die einem bei seinem Anblick in den Sinn kamen.
»Er soll reinkommen«, hörte Martin Gerlinde Dobkowitz aus dem Inneren ihrer Suite rufen, und der Butler trat zur Seite.
Martins Gehirn hatte große Mühe, alle Eindrücke, die daraufhin auf ihn einprasselten, zu verarbeiten.
Als Ermittler wusste er, dass die Grenze zwischen exzentrischem Lebensstil und therapiebedürftigem Wahnsinn oftmals nur mit einem gespitzten Bleistift gezogen werden konnte. Gerlinde Dobkowitz, das sah er auf den ersten Blick, wandelte auf beiden Seiten der Linie.
»Na endlich«, begrüßte sie ihn von ihrem Bett aus. Sie thronte in einem Meer aus Kissen, Zeitungen und ausgedruckten Computerseiten am Kopfende der Matratze. Ihr überladenes Bett stand in der Mitte eines Raumes, der von den Innenarchitekten der Werft ursprünglich als Salon geplant gewesen war. Doch die Architekten hatten ihre Rechnung ohne Gerlinde Dobkowitz gemacht. Zumindest konnte Martin sich nicht vorstellen, dass himbeerschaumfarbene Blümchentapeten, ein Zebrafellteppich oder ein künstliches Hirschgeweih über den Lüftungsschlitzen zur Grundausstattung jeder Dreizimmer-Eigentumssuite auf der Sultan gehörten.
»Sie sollten mal Ihren Tacho eichen lassen«, sagte die alte Dame mit Blick auf eine hölzerne Standuhr im Eingangsbereich der Suite. »Es ist bald sechs!«
Mit einer unwirschen Bewegung scheuchte sie ihren Butler zurück an einen altertümlichen, filzbezogenen Sekretär, der im rechten Winkel zur Zwischenwand unter einem Ölgemälde stand, das vor langer Zeit vermutlich einmal Rembrandts Mann mit dem Goldhelm gezeigt hatte, jetzt aber mit Zetteln übersät war, die mit Reißzwecken auf der Leinwand befestigt waren.
Die alte Dame warf Martin einen bösen Blick zu. »Dachte schon, ich müsste bis New York warten, um meine Brownies ins Weiße Haus zu bringen.«
Gerlinde griff nach einer riesigen Brille auf ihrem Nachttisch. Er wunderte sich, dass sie nicht beide Hände brauchte, um sie sich auf die Nase zu setzen. Die Gläser waren blassrosa gefärbt und so dick wie die Unterseite eines Whiskeyschwenkers, wodurch die wachen Augen dahinter eulengleiche Ausmaße annahmen. Überhaupt erforderte der Vergleich mit einem Vogel bei Gerlindes Anblick keine allzu große Vorstellungskraft. Sie hatte Krallenfinger, und die lange, gekrümmte Nase stach wie ein Schnabel aus dem schmalen, nur aus Haut und Knochen bestehenden Krähengesicht der alten Dame.
»Hoffe, es ist nicht wieder Schmirgelklasse Z. Legen Sie es einfach neben die Biotonne, und dann auf Wiederkuscheln.« Sie winkte in Martins Richtung, als wollte sie eine lästige Fliege verscheuchen.
»Ich fürchte, Sie verwechseln mich«, sagte er und stellte seinen Seesack ab.
Gerlinde zog verblüfft die Augenbrauen hoch.
»Sind Sie nicht der Mann mit dem Klopapier?«, fragte sie erstaunt.
Martin, dem langsam klarwurde, was mit Biotonne,Brownies, Schmirgelklasse Z und dem Weißen Haus gemeint war, fragte sich, wie er so blöd gewesen sein konnte, hierherzukommen. Welcher Teufel hatte ihn geritten, Salz in seine niemals heilenden Wunden zu streuen? Es war die Hoffnung gewesen, die Tragödie endlich zu einem Abschluss zu bringen. Und die Hoffnung, diese trügerische Schlange, hatte ihn in eine Sackgasse gelockt, an deren Ende eine im Bett liegende Oma auf ihn wartete.
Martin folgte Gerlindes verblüfftem Blick zu ihrem Butler.
»Wer zum Henker ist das, Gregor?«
Gregor, der an dem Sekretär hinter einer Schreibmaschine Platz genommen hatte, die im Berliner Technikmuseum ein historischer Publikumsmagnet gewesen wäre, lugte ratlos über die Kante des eingespannten Papiers. »Ich fürchte, ich bin hier ebenso überfragt wie …«
»Wer sind Sie?«, unterbrach Gerlinde das vornehme Gestammel.
»Mein Name ist Martin Schwartz, wir haben gestern telefoniert.«
Sie schlug sich mit der Hand an die Stirn, dass es klatschte. »Ach du meine Güte, ja natürlich.«
Gerlinde schob einen Stapel Papier beiseite und schlug die Daunendecke zurück, unter der sie mit schneeweißen Turnschuhen gelegen hatte.
»Gut, dass Sie gekommen sind. Ich weiß, wie schwer es Ihnen fallen muss …«
Sie schob ihre Beinchen über die Bettkante. Gerlinde trug einen pinkfarbenen Jogginganzug, in den sie zweimal hineingepasst hätte.
»… wo Sie doch hier auf der Sultan Ihre Frau und Ihren Sohn …«
»Entschuldigen Sie bitte meine Ungeduld«, fiel Martin ihr ins Wort. Er hatte weder die Zeit noch die Kraft für Höflichkeiten. Selbst die Anwesenheit des Butlers war ihm gleichgültig. »Sie haben am Telefon gesagt, Sie hätten Beweise, dass meine Frau nicht freiwillig in den Tod gesprungen ist.«
Gerlinde nickte, nicht im Geringsten verärgert, dass er sie unterbrochen hatte, zog sich an einem neben ihrem Bett geparkten Rollstuhl auf die Beine und riss die Nachttischschublade auf.
»Nicht nur dafür, mein Lieber. Nicht nur dafür.«
Sie warf ihm einen verschwörerischen Blick zu, dann fügte sie hinzu: »Womöglich habe ich sogar einen Hinweis darauf gefunden, dass Ihre Familie noch am Leben ist.«
Mit diesen Worten reichte sie Martin einen kleinen, zerschlissenen Teddybären, der ursprünglich einmal weiß gewesen war und dessen Fell jetzt die Farbe dreckigen Sandes angenommen hatte.
In Martins Magen öffnete sich eine Faust, und ein langer Finger kitzelte von innen seine Speiseröhre. Ihm wurde übel. Dieses Schiff würde er so schnell nicht wieder verlassen können.
Dem alten, nach Schweiß und Schmieröl stinkenden Spielzeug fehlten ein Auge und die rechte Tatze, aber die Initialen waren noch an Ort und Stelle.
T.S.
Genau dort, wo Nadja sie vor Jahren mit der Maschine eingestickt hatte, kurz bevor Timmy auf seine erste Klassenfahrt ins Schullandheim aufgebrochen war.
5. Kapitel
Verlust. Trauer. Angst.
So oft, wie ihr Weg in den letzten Jahren mit Falltüren versehen gewesen war, hatte Julia Stiller gehofft, mittlerweile darauf trainiert zu sein, den dunklen Kellerlöchern aus dem Weg zu gehen, die das Leben für sie geöffnet hielt. Oder das nächste Mal wenigstens nicht wieder so tief in sie hineinzustürzen. Nur so weit, dass sie sich an den Kanten ihres seelischen Abwurfschachts aus eigener Kraft nach oben ziehen konnte.
Doch weit gefehlt.
Diesmal war es ein Anruf, der sie in Todesangst versetzte und der sie lehrte, dass man sich auf das Fallbeil des Schicksals nicht vorbereiten konnte. Es fiel ausgerechnet in dem Moment auf sie herab, in dem sie sich seit langer, langer Zeit endlich wieder glücklich fühlte, hier im Hafen von Southampton auf der Sultan of the Seas.
Drei freudlose Jahre war es nun her, seitdem ihr Mann sie betrogen hatte, ihr Freundeskreis zerbrochen war und ihre Tochter ihr die Schuld daran gab, nicht mehr in der Villa in Köpenick, sondern in einer Zweizimmerwohnung in Hermsdorf zu wohnen. Klein und beengt, aber doch so teuer, dass sie jede Nachtschicht in der Klinik übernehmen musste, die sie als Krankenschwester auf der Frühchenstation ergattern konnte, um irgendwie über die Runden zu kommen.
»Du hast überreagiert«, hatten selbst ihre Eltern gesagt. Als hätte sie mit Absicht nach der Abrechnung in der Altpapiertonne gesucht – zwei Flugtickets, aber nur ein Doppelzimmer. Nach Capri, obwohl Max ihr etwas von einer Fortbildung in Dresden erzählt hatte. Ein Ticket war auf seinen Namen ausgestellt und eines auf den seiner Assistentin. Die mit den billigen Haarextensions und den lächerlich hochgeschnürten Brüsten. Julia hatte nicht nachgedacht. Sie war in den Keller gegangen, hatte sich den vollen Wäschekorb gegriffen, war mit ihm in das Steuerbüro gefahren, in dem Max als Anwalt arbeitete, und hatte der verdutzten Geliebten die Schmutzwäsche auf den Schreibtisch gekippt mit den Worten: »Wenn Sie schon meinen Mann vögeln, können Sie auch seine dreckigen Unterhosen waschen.«
Das hatte sich gut angefühlt. Für ungefähr zwanzig Sekunden.
»Wo bist du?«, hörte sie Tom Schiwy nun fragen, und schon da begann sie sich zu ärgern, überhaupt ans Telefon gegangen zu sein. Sie hatte mit ihrer Tochter verabredet, mit Beginn des Urlaubs die Handys auszuschalten, doch in der Aufregung der Anreise musste sie es vergessen haben. Und jetzt hatte Julia einen der Fehltritte ihres erzwungenen Singlelebens am Ohr.
Wenn auch einen der angenehmeren.
»Ich hab dir doch gesagt, wo wir die Herbstferien über sind«, antwortete sie ihm und lächelte Lisa zu, die gerade an ihr vorbei durch die Durchgangstür in ihre eigene Kabine ging.
»Ich geh mich kurz auf dem Schiff umsehen«, flüsterte ihre fünfzehnjährige Tochter, und Julia nickte zustimmend.
Zu Tom sagte sie: »Wir sind gerade an Bord gegangen.«
»Verdammter Mist.«
Der Vertrauenslehrer ihrer Tochter klang ungewöhnlich aufgeregt, nahezu ängstlich.
»Was ist denn los?«, fragte Julia verwundert und ließ sich auf das unglaublich bequeme Boxspringbett sinken, das fast die gesamte Kabine einnahm.
Weshalb rufst du an? Hatten wir uns nicht darauf geeinigt, den Kontakt auf das Nötigste zu begrenzen?
»Wir müssen uns sehen. Sofort!«
»Ja, klar.« Julia tippte sich an die Stirn. Für keinen Mann der Welt würde sie die Sultan of the Seas jetzt wieder verlassen. Lisa bot gerade die ganze Palette an Problemen, die man in der Pubertät bekommen konnte. Sie verweigerte gemeinsame Mahlzeiten, wurde immer dünner, hatte sich die Nase gepierct, ruinierte mit schlechten Noten ihren Schnitt als ehemals Klassenbeste und traf sich nur noch mit Freundinnen, die ähnlich vampirhaft gekleidet waren wie sie selbst. Seit ihrem fünfzehnten Geburtstag pflegte sie eine Gothic-Phase, in der nur schwarze Secondhandklamotten erlaubt waren, möglichst zerrissen und so löchrig, dass selbst Motten in ihnen verhungerten. Ein ungeschriebenes Gesetz ihrer Clique war es wohl, nie zu lachen und niemals der Mutter einen Kuss zu geben. Ein Gesetz, das Lisa vor zehn Minuten zum ersten Mal seit Wochen gebrochen hatte.
»Das ist so geil, Mama«, hatte sie sich gefreut, als sie den Balkon ihrer Kabine betraten. Die Tränen in Lisas Augen mochten von dem Wind gerührt haben, der vom Hafen hoch auf Deck 5 wehte, aber Julia wollte lieber glauben, dass es die Freude über das riesige Kreuzfahrtschiff und die luxuriöse Außenkabine war, die sie für die kommenden sieben Tage beziehen würden. Und zwar jede ihre eigene.
In ihrer gegenwärtigen Situation, mit ihrem Einkommen als alleinerziehende Krankenschwester, hätte Julia sich auf der Sultan of the Seas nicht einmal eine Innenkabine leisten können. Doch Daniel Bonhoeffer, der Kapitän der Sultan persönlich, hatte sie eingeladen. Sie kannte ihn seit Jahren, fast Jahrzehnten, und doch hätte sie große Probleme, Außenstehenden ihr Verhältnis zu Daniel zu beschreiben. Als Freunde standen sie einander nicht nahe genug, für eine lose Bekanntschaft waren ihre Familienverhältnisse zu eng miteinander verwoben, immerhin war Daniel Lisas Patenonkel. Ohne diese Verbindung hätte sie längst den Kontakt zu ihm abgebrochen, immerhin war Daniel ein Kindergartenfreund ihres Mannes, wobei Julia nie ganz verstanden hatte, weshalb ihr Ex über so viele Jahre die Freundschaft mit einem Mann pflegte, der sich im Grunde nur für eine einzige Person interessierte: für sich selbst. Keine fünf Minuten eines Gesprächs vergingen, ohne dass Daniel es irgendwie gelang, das Thema auf sich zu lenken. Wegen der exotischen Ziele, die er bereiste, konnte das für den außenstehenden Zuhörer mitunter sogar recht amüsant sein. Für eine auf Gegenseitigkeit ausgerichtete Freundschaft war das Julia aber eindeutig zu wenig. Außerdem erweckte er bei ihr stets den Eindruck, als wäre seine Höflichkeit nur aufgesetzt und er würde anderen nach dem Munde reden. Das alles zusammengenommen führte dazu, dass sie sich nach einem Treffen mit ihm immer so fühlte, als käme sie gerade aus einem Fastfood-Restaurant. Im Grunde war alles okay, dennoch hatte man ein komisches Gefühl im Magen.
Jetzt, da sie erstmals auf seinem Schiff war, fragte sie sich allerdings, ob sie mit Daniel nicht etwas zu hart ins Gericht ging. Immerhin hatte er wieder einmal bewiesen, wie abgöttisch er seine Patentochter liebte. Jedes Jahr bekam Lisa ein großes Geburtstagsgeschenk, und dieses Jahr war es die Transatlantikreise nach New York. »Bedank dich bei deinem Patenonkel«, hatte Julia gesagt, als ihre Tochter ihr auf dem Balkon in die Arme gefallen war. Lisa hatte nach Tabak gerochen, ihre bleiche Schminke hatte auf Julias Wangen abgefärbt, doch das hatte sie ebenso wenig gestört wie das Nietenhalsband, das sich ihr ins Gesicht drückte. Alles, was in diesem Moment für Julia zählte, war, ihre Tochter endlich wieder im Arm halten zu können. Sie konnte sich nicht erinnern, wann sie ihrem kleinen Mädchen das letzte Mal so nah gewesen war.
»Hier ist es traumhaft«, erklärte sie Tom.
Sie hatten sich nach einem Elternsprechtag angefreundet, zu dem sie wegen der abfallenden Leistungen und der mangelnden mündlichen Beteiligung ihrer Tochter am Unterricht gebeten worden war. Als sie nach einem Monat erfuhr, dass Lisa regelmäßig Toms Schülersprechstunde besuchte, beendete Julia die Affäre. Sie hatte sich nicht wohl bei dem Gedanken gefühlt, ein Verhältnis mit der aktuell einzigen Vertrauensperson ihrer Tochter zu haben. Außerdem hatte es ohnehin nicht so recht gepasst; nicht nur des Alters wegen – immerhin war Tom mit neunundzwanzig Jahren gut zehn Jahre jünger als sie –, sondern vor allem wegen seiner fordernden Art. Beinahe täglich hatte er sie sehen und ständig mit ihr schlafen wollen, und auch wenn ihr das Interesse eines so jungen und attraktiven Mannes schmeichelte, war dieser Anruf ein weiterer Beleg dafür, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hatte.
Dachte Tom wirklich, er musste nur durchklingeln, und sie würde die Herbstferien mit ihrer Tochter sausenlassen?
»Keine zehn Pferde bekommen mich von diesem Schiff hier wieder runter.«
»Pferde sicher nicht, aber möglicherweise ein Video!«