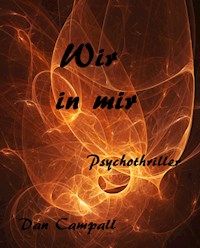Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks Self-Publishing
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Marcus Tullius Tiro war der engste Vertraute und der ehemalige Leibeigene des legendären Marcus Tullius Cicero. Er schwelgt zuweilen in Erinnerungen an diesen großen Staatsmann, Advokaten und Redner, denkt mit pochendem Herzen an die Zeiten ihrer beider besonderen Verbundenheit zueinander, jedoch auch an jene der gemeinsamen Jagd nach einem Serienmörder.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 49
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dan Campall
Pater Patriae
Der Vater des Vaterlandes
Dieses eBook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Pater Patriae
Impressum
Pater Patriae
Pater Patriae
Der Vater des Vaterlandes
Noch einmal blies Tiro über die geschriebenen Worte in Tinte und betrachtete sein Werk, bevor er das Schriftstück aufrollte, das einige Erlebnisse wiedergab, die ihn vor einem Vierteljahrhundert so sehr geprägt hatten.
Der zierliche Mann erhob sich von seinem Platz, trat an einen von Papyrus überladenen Marmortisch und legte seine Aufzeichnungen ab. Mit den Fingerspitzen fuhr er nochmals über die aufgeraute Struktur. Er atmete tief ein. Ein Zucken umspielte seine Lippen und er presste sie gegeneinander, nur um nicht dem Wunsch Genüge zu tun, aus dem Gefühl der überwältigenden Einsamkeit heraus zu schluchzen.
Der aufdringliche Geruch gärender Frucht lenkte seinen Blick zur Obstschale an der Ecke des Tisches, in welcher einige Feigen unzähligen Obstfliegen ein reiches Mahl bescherten. Ihn selbst gelüstete es selten, zu speisen. Er nahm lediglich das zu sich, was er unbedingt benötigte, um bei Kräften zu bleiben. Alles andere fiel der Verrottung anheim. Zwangsläufig. Seit Jahren bereits.
Angewidert wendete er sich ab und sah hinüber zum Fenster. Dabei zog er gedankenverloren den Fingerring unter seinem Gewand hervor, den ihm sein Herr vor dessen Ermordung als Zeichen der Freilassung aus dem Sklavenstand übergeben hatte. Diesen, nebst seinem Namen und finanziellen Mitteln, um seinem Getreuen nach dem Ableben weiterhin ein ordentliches Dasein zu ermöglichen. Wie unzählige Male zuvor schloss Tiro die Augen, wenn er an ihn dachte. Er küsste den Ring und verbarg ihn wieder unter dem Stoff an seinem Leib.
Die Hitze dieses Sommertages schlug ihm ins Gesicht, als er sich aus dem Fenster lehnte. Müde stützte sich Tiro mit den Händen am Sims ab und sah auf die Straße. Er betrachtete das emsige Treiben der Menschen, hörte ihre Stimmen, die bis zu ihm hinaufdrangen. Wütende Rufe mischten sich zu jenen, die etwas feilboten. Lachen und freundliche Floskeln erinnerten den einstigen Sklaven daran, wie inhaltslos so manches Gespräch gewesen war, das sich sein Dominus gezwungen sah, zu führen. Damals, als es noch galt Wählerstimmen zu erhaschen.
Selbst wenn er sich inmitten dieses pulsierenden Lebens befand, spürte Tiro deutlich, dass er anders war, als jeder Einzelne von jenen dort unten, die sich darin tummelten. Nicht leeres Gerede hatte ihn beflügelt, viel mehr waren es die Worte seines Meisters, die stets von besonderem Sinn getragen, ihn in neue, unbekannte Bewusstseinsebenen zu befördern vermochten.
Er richtete den Blick auf die Dächer der umliegenden Häuser, sah hinab auf Rom. Tiro erkannte in der Ferne die Wege, die er unzählige Male gemeinsam mit seinem Dominus gegangen war. Auf denen sie sich zusammen fortbewegt hatten, um sich den Konfrontationen im Senat zu stellen, um Verhandlungen zu führen, diplomatische Gespräche oder mitunter, um die Vergehen einiger Staatsfeinde aufzudecken.
Er ging neben seinem Herren her, auf diesen staubigen Straßen, als Mann ohne Rechte in den Augen der Menschen. Tatsächlich aber gestand ihm sein Dominus mehr zu, als den meisten, die den Sklaven herablassend betrachteten. Indem er ihm zuhörte, seine Ratschläge in Erwägung zog und die eigenen Betrachtungsweisen mit Hilfe von Tiro in andere Richtungen steuern ließ, gewährte der Staatsmann dem Leibeigenen die Möglichkeit, das Geschick des Politikers mit zu lenken. Er schenkte ihm das Glück behilflich zu sein, den steinigen Pfad bis ganz hinauf in die höchsten Ränge des Senats zu ebnen, machte ihn zum Wegbereiter. Dies erfüllte den Mann von gesellschaftlich niedrigem Rang stets mit Stolz.
Wieder lenkte Tiro den Blick auf die Menschen und er fragte sich insgeheim, ob sie es tatsächlich verdient hatten, dass ein ehrenwerter Römer sein Leben für sie ließ, weil er sie geliebt hatte, wie keiner sonst. Er war gestorben aus reiner Zuneigung zu diesem Volk, im Namen der Freiheit und der einzig wahrhaften Form von Verbundenheit. Er, der Vater des Vaterlandes.
***
Römischer Senat, 63 v. Chr.:
»Wie lange, Lucius Sergius Catilina, willst du unsere Geduld missbrauchen? Wie lange soll diese, deine Raserei ihr Gespött mit uns treiben?« Marcus Tullius Cicero ließ seine Fragen wirken und sah sich im vollbesetzten Saal der Curia lulia um. Er blickte in die fragenden Gesichter der Senatoren, betrachtete die seiner Verbündeten, aber auch jene seiner Feinde und der politisch Neutralen. In jedem konnte er eine andere Botschaft lesen, jedoch fanden sie nicht alle sein Wohlgefallen.
Noch einige Momente verharrte er, um dann seine Aufmerksamkeit zurück auf den Mann zu lenken, der sich gemeinsam mit Gaius Iulius Caesar und Marcus Licinius Crassus gegen ihn verschworen hatte und ihm nach dem Leben trachtete. Lange schon war dies Cicero bekannt. All die vorausgegangenen, anklagenden Worte seiner Reden vor dem römischen Senat verloren sich jedoch bislang wie Sand mangelnder Beweiskraft im Nichts und erlaubten den Feinden mit Spott und Häme den Kläger bloßzustellen.
Endlich war es nun so weit. Seine Anschuldigungen gegen Catilina, den Handlanger eines anderen, nicht zu unterschätzenden Gegners, sollten nicht mehr als bloße Vermutungen abgetan werden. Trotzdem konnte der Konsul Gefahr laufen, dass sich im ungünstigen Fall die anwesenden Zuhörer nicht überzeugen ließen. Also galt an dieser Stelle zu untermauern, dass dieses Gespann machtgieriger Verbrecher einige Tage zuvor den Willen gezeigt hatten, auf Cicero ein Attentat zu verüben, um mit diesem, die Grundfeste des Römischen Reiches erbeben zu lassen. Mehr sogar noch, um damit einen ersten Schritt zu wagen, die Republik zu stürzen. Selbst wenn es letztlich gelungen war, die Schergen dieser Aufrührer mit Hilfe treuer Anhänger unschädlich zu machen, so durfte sich der Konsul nur für den Augenblick sicher wähnen und mit ihm all jene, die nicht im Sinne dieser Verbrecher handelten.