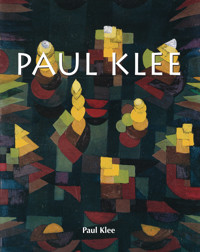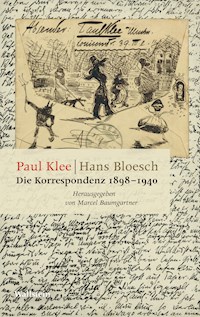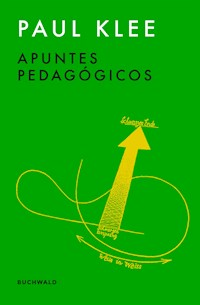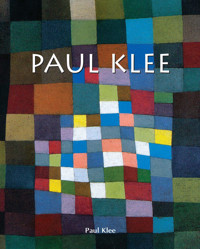
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Parkstone International
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Paul Klee gehört zu den Künstlern, die sich nur schwerlich einer bestimmten kunstgeschichtlichen Bewegung zuordnen lassen. In engem Kontakt mit Wassily Kandinsky und Franz Marc gehörte er wie diese der expressionistischen Künstlergruppe Der Blaue Reiter an. Später knüpfte er Verbindungen zum Bauhaus und unterrichtete sogar Malerei an der Dessauer Schule. Seiner Ansicht nach ging es bei der Kunst keineswegs um die Produktion, sondern vielmehr darum, die Dinge äußerst sichtbar werden zu lassen. In seinen Gemälden vereinte Klee geschickt die zu Beginn des 20. Jahrhunderts vorherrschenden Tendenzen. Er führte kubistische und orphistische Elemente in den deutschen Expressionismus ein und verlieh seinen eigenen Werken eine surrealistische und melancholische Poesie. Der Autor führt uns hier die Wunder der Klee’schen Welt vor Augen, in der jeder Pinselstrich die Macht der Farben bestätigt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Autor: Paul Klee
Redaktion der deutschen Ausgabe: Klaus H. Carl
Layout:
Baseline Co. Ltd
61A-63A Vo Van Tan Street
4. Etage
Distrikt 3, Ho Chi Minh City
Vietnam
© Confidential Concepts, worldwide, USA
© Parkstone Press International, New York, USA
Image-Barwww.image-bar.com
© Paul Klee Estate, Artists Rights Society (ARS), New York / VG Bild-Kunst, Bonn
Weltweit alle Rechte vorbehalten.
Soweit nicht anders vermerkt, gehört das Copyright der Arbeiten den jeweiligen Fotografen, den betreffenden Künstlern selbst oder ihren Rechtsnachfolgern. Trotz intensiver Nachforschungen war es aber nicht in jedem Fall möglich, die Eigentumsrechte festzustellen. Gegebenenfalls bitten wir um Benachrichtigung.
ISBN: 978-1-78310-689-9
Paul Klee
Inhalt
AUSZÜGE AUS DEN TAGEBÜCHERN
Kindheit, Jugend und die ersten Studienjahre
München, 1881 bis 1901
Italienreise
Oktober 1901 bis Mai 1902
Die ersten Berufsjahre, Heirat und Studienreisen
1902 bis 1914
Als Soldat im Ersten Weltkrieg
1914 bis 1918
AUSZÜGE AUS DEN THEORETISCHEN SCHRIFTEN
Die Natur als Vorbild
Kunst als Abstraktion
Grundlagen der Form und Gestaltung
Bewegung als oberste Grundlage
Die Tonalität
Jugendliches Selbstporträt – frei, 1910.
Feder, Bleistift und schwarzes Aquarell auf Leinen
auf Karton, 17,5x15,9cm. Privatsammlung, Schweiz.
AUSZÜGE AUS DEN TAGEBÜCHERN
Rote und weiße Kuppeln, 1914. Aquarell und
Gouache auf Papier auf Karton, 14,6x13,7cm.
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf.
Kindheit, Jugend und die ersten Studienjahre
München, 1881 bis 1901
Ein ästhetisches Gefühl war schon ganz früh entwickelt, man zog mir, als ich noch Röcke trug, zu lange Unterhosen an, sodass ich selber den grauen Flanell mit dem roten Wellenbesatz sehen konnte. Als jemand anklingelte, versteckte ich mich, um zu vermeiden, dass Besuch mich in diesem Zustand sehen konnte (zwei bis drei Jahre).
Meine Großmutter, Frau Frick, lehrte mich sehr früh mit farbigen Stiften zeichnen.
Die Leiche meiner Großmutter machte mir gewaltigen Eindruck. Eine Ähnlichkeit war nicht zu entdecken. Wir mussten weit entfernt bleiben. Dazu flossen die Tränen der Tante Mathilde wie ein stilles Bächlein. Noch lang gruselte mir, wenn ich an jener Tür vorbeiging, die in den Keller jenes Spitals hinabführt, wo man die Leiche vorläufig untergebracht hatte.
Dass man bei Toten entsetzt sein konnte, hatte ich also selber erfahren, Tränen vergießen aber hielt ich für eine Sitte der Erwachsenen (fünf Jahre).
Im Traum überfielen mich oft Vaganten. Ich wusste mir aber stets dadurch zu helfen, dass ich vorgab, selber ein Vagant zu sein. Das half bei den Kollegen stets (etwa sieben Jahre).
Im Restaurant meines Onkels, des dicksten Mannes der Schweiz, standen Tische mit geschliffenen Marmorplatten, auf deren Oberfläche ein Gewirr von Versteinerungsquerschnitten zu sehen war. Aus diesem Labyrinth von Linien konnte man menschliche Grotesken herausfinden und mit Bleistift festhalten. Darauf war ich versessen, mein „Hang zum Bizarren“ dokumentierte sich (neun Jahre).
„Es tröstet ihn die Schwester“, hieß die illustrierte Stelle eines Gedichtes. Auf den Trost der Schwester aber gab ich nichts, weil sie unästhetisch aussah (sechs bis acht Jahre).
Aufenthalt in Basel Herbst 1897 und 1898 (nach dem Abschluss der Schulausbildung mit der Matura) bei meinen Verwandten. Man sorgte sehr nett für meine Unterhaltung. Man hatte eine gewisse Bewunderung für meine Begabungen. Ich fühlte mich wohl. Meine Pubertät erzeugte auch gewisse schüchterne Beziehungen zu meiner Kusine D. Typische Dinge, ganz uneingestanden.
Einen herrlichen Spaziergang machte ich mit D. durch die Rebberge von Weil hinauf nach Tüllingen. Die weite obstreiche Ebene sehe ich noch zu unsern Füßen liegen.
Viel Theaterbesuch. Oper hauptsächlich. Eine Ballettaufführung. Manchen Vierzeiler dichtete ich zum Ausgleich mangelhafter Befriedigungen.
Ebenso echte als schlechte Kunst. 24. 4. 1898.
Im Steinbruch, 1913. Aquarell auf Papier auf Karton,
22,4x35,3cm.Zentrum Paul Klee, Bern.
Vor der Stadt, 1915. Aquarell auf Papier auf Karton,
22,5x29,8cm.The Berggruen Klee Collection,
The Metropolitan Museum of Art, New York.
Bern. 27. 4. 1898. „Setzen Sie sich und lernen Sie es besser!“, hieß es in der Mathematik, aber das ist vorbei und vergessen. Gegenwärtig spielt sich draußen das erste Gewitter des Jahres ab. Ein frischer Wind von Westen streicht über mich, bringt Thymianduft und Eisenbahnpfiffe, spielt mit meinem feuchten Haar. Die Natur liebt mich doch! Sie tröstet mich und verspricht mir.
An solchen Tagen bin ich gefeit. Außen lächelnd, innen freier lachend, ein Liedchen in der Seele, ein zwitscherndes Pfeifen auf den Lippen, werfe ich mich auf das Bett, dehne mich, hüte die schlummernde Kraft.
Westwärts, nordwärts, gehe es, wohin es will: Ich glaube!
Ich schrieb einige Novellen, vernichtete sie aber insgesamt. Anno 1898. Doch nahm ich mich auch wieder in Schutz.
Dass die Produkte nichts Rechtes sind, ist noch kein Beweis ungöttlicher Abstammung. In einem solchen Latein-Milieu muss man ja jede Realität als Halt entbehren. Was gibt einem ursprünglichen Trieb der verblasste Humanismus für Nahrung? Man ist ganz auf die Wolken angewiesen. Reiner Drang ohne Stoff. Überhohe Berge ohne Fuß.
Rückblick: Zuerst war ich ein Kind. Dann schrieb ich nette Aufsätze und konnte auch rechnen (bis zum elften bis zwölften Jahr). Dann bekam ich die Leidenschaft für Mädchen. Dann kam eine Zeit, wo ich die Schulmütze hinten am Kopf trug und den Rock nur mit dem untersten Knopf zuknöpfte (bis fünfzehn). Dann fing ich an, mich als Landschafter zu fühlen, und beschimpfte den Humanismus. Vor der Sekunda wäre ich gern durchgebrannt, was aber der Eltern Willen verhinderte. Ich fühlte nun ein Martyrium. Nur das Verbotene freute mich. Zeichnungen und Schriftstellerei. Als ich ein schlechtes Examen bestanden hatte, fing ich in München das Malen an.
Nachdem ich mich als Knirrschüler durchgesetzt hatte, begann die Aktzeichnerei etwas an Reiz einzubüßen, und andere Dinge, Lebensfragen wurden wichtiger als der Glanz in der Knirrschule. Es wurde mitunter auch geschwänzt. Ich sah auch (mit Recht) gar nicht ein, dass aus fleißigen Aktstunden jemals Kunst werden könnte. Dieses Einsehen vollzog sich aber nur im Unterbewusstsein. Wenn mich das Leben, das ich so wenig kannte, mehr als alles anzog, so hielt ich das doch für eine Art Lumperei von mir. Ich schien mir charakterschwach, wenn ich der Stimme im Innern mehr Gehör schenkte als den äußeren Geboten.
Kurz, ich sollte vor allem ein Mensch werden, die Kunst würde dann daraus folgern. Dazu gehörten natürlich Beziehungen zu Frauen. Eine meiner ersten Bekanntschaften war Fräulein N. aus Halle an der Saale. Ich hielt sie allerdings aus einem Irrtum für frei und für geeignet, mich in jene Mysterien zu führen, um die sich diese Welt, das „Leben“, einmal dreht. Viel später, als sie für mich gar nicht mehr in Betracht kam, erfuhr ich dann von ihrer unglücklichen Liebe zu einem Sänger. Vielleicht war es gut für mich, so hat sich diese Dame nicht allzufest an mich anklammern können.
Ich hatte sie in einem (gemischten) Abendakt kennengelernt, plötzlich wurde ich da von einer Tochter des Professors V. in Bern angesprochen, die mich von Bern her äußerlich kannte. So geriet ich ins Damenlager hinüber, wo man das Aktmodell, einen sexuell sehr erregbaren Mulatten, von hinten sah. Die Schweizerin stellte mich einer Ostpreußin vor. Ich überlegte, ob das wohl das richtige Studienobjekt für mich war. Aber der Anreiz war zu unentschieden. Die Richtige sollte mir am nächsten Abend vorgestellt werden, in der Person der erwähnten N. Ein blondes blauäugiges Ding, Sopranstimme, mehr zierlich. Ich blieb ohne weiteres in ihrer Nähe und ging auf dem Heimweg neben ihr. Man bewunderte die winterliche Schönheit der Leopoldstraße, auf deren Bäumen im Licht magischer Bogenlampen schwerer Schnee lag.
Ohne Titel, 1914. Aquarell und Feder
auf Papier auf Karton,17,1x15,8cm.
Kupferstichkabinett, Kunstmuseum Basel, Basel.
Hommage an Picasso, 1914.
Öl auf Karton, 38x30cm.Privatsammlung.
Haller kam nun auch nach München, er setzte es durch, statt in Stuttgart Architekt zu werden. Er kam in die Knirrschule, wo er sich, als ich kam, schon sehr zu Hause fühlte. Allerdings hatte ihm die Freundschaft des „besten Schülers seit zehn Jahren“ gute Dienste getan, die er bei seiner Einführung wohl auszunützen verstand. Dazu kam sein frisch zugreifendes Wesen, das schon damals etwas Mitreißendes an sich haben konnte. Ich fand also den Aktsaal durch sein Gelächter desto heimischer. Nun bildete sich um uns eine schweizerisch angehauchte Talentgruppe, die sich alles erlauben durfte, besonders Spott und Hohn den heterogenen Elementen.
Rückblick: Inspektion meiner selbst, ganz vor mir, der Literatur, der Musik Valet gesagt. Meine Bestrebungen, eine verfeinerte Sexualerfahrung zu gewinnen, in jenem einen Fall aufgegeben. An die bildende Kunst denke ich kaum, ich will nur an meiner Persönlichkeit arbeiten. Dabei muss ich konsequent sein und jegliche Audienz vermeiden. Dass ich dann wohl Ausdruck in der bildenden Kunst finden werde, ist noch am wahrscheinlichsten.
Ein kleines Leporelloregister all der Geliebten, die ich nie besaß, mahnt ironisch an die große sexuelle Frage. Die Reihe des Registers beschließt der Anfangsbuchstabe des Wortes „Lily“ mit der Bemerkung: abwarten. Diese Dame, meine spätere Frau, lernte ich im Herbst 1899 musizierenderweise kennen.
Die Ansicht, dass die Malerei der richtige Beruf ist, festigt sich mehr und mehr. Nur das Wort hat außerdem noch Reiz. Vielleicht bei voller Lebensreife werde ich mich seiner noch einmal bedienen.
Zu Fräulein Schiwago stand ich sehr merkwürdig. Ich verehrte sie sehr, aber ohne mich zu verlieren. Dazu war ich innerlich wohl schon zu sehr mit Lily verbunden, ohne Garantien, ohne Risiko, rein ich.
Schiwago schien mir zuerst außerdem dadurch unzugänglich, weil es schien, dass zwischen Haller und ihr etwas bestehe oder im Gange sei. (Dass ihr diese Zurückhaltung nicht einmal recht war, erfuhr ich erst 1909.)
Oft bin ich vom Teufel besessen, mein Missgeschick auf jenem so problemreichen Sexualgebiet machte mich nicht besser. In Burghausen hatte ich große Schnecken auf verschiedene Weisen geärgert. Jetzt unterliege ich in dieser, womöglich noch entzückenderen Thunerseegegend ähnlichen Versuchungen. Unschuld reizt mich. Der Gesang der Vögel geht mir auf die Nerven, jeden Wurm möchte ich zertreten.
Ich skizzierte ein Testament. Drin bat ich alles an Kunstbestrebungen vorhandene zu vernichten. Ich wusste wohl, wie kümmerlich das alles war und wie nichtig im Vergleich zu den vorgefühlten Möglichkeiten. Zeitweise sank ich ganz in Bescheidenheit zusammen, wollte Illustrationen für Witzblätter machen. Später würde ich dann immer noch die eigenen Gedanken illustrieren können. Was bei solcher Bescheidenheit herauskam, waren mehr oder weniger raffinierte technisch-grafische Experimente. Es ist bequem, einen zuschanden gewordenen Willen als überspannte Verirrung zu bezeichnen.
Dieser Sommer gibt mir zu viel Zeit zum Nachdenken. Zum Arbeiten ohne Aktmodell und Schule bin ich nicht weit genug. Abend ist es schließlich geworden und Herbst. Wie betäubt vom Tag und seiner Plage bin ich erwacht und sehe, dass schon Blätter fallen. In diesen Boden soll ich nun säen? Im Winter soll ich hoffen? Das wird finstere Arbeit. Aber doch Arbeit.
Herbst 1900. Der Vergleich meiner Seele mit den verschiedenen Stimmungen der Landschaft kehrt häufig wieder als Motiv. Meine dichterisch-persönliche Auffassung der Landschaft liegt dem zugrunde. „Es ist Herbst. Dem Strom meiner Seele schleichen Nebel nach.“
Es beginnen religiöse Gedanken aufzutreten. Das Natürliche ist die erhaltende Kraft. Das Individuum, welches sich vernichtend über das Generelle erhebt, verfällt der Schuld. Es gibt aber noch etwas Höheres, das über Positiv und Negativ steht. Das ist die Allmacht, die diesen Kampf übersieht und leitet.
Vor dieser Allmacht könnte ich bestehen, und ethisch bestehen wollte ich.
Vollständig bezecht, fantasierte ich eine Nacht in meinem Tagebuch über das Thema Lily. Wie tief ging mir das alles, was von ihr kam. Sogar eine eifersüchtige Variation war dabei. Die Sinnlichkeit feierte Orgien. In der Schlussvariation figurierten zum Cantus firmus Worte, die wir gewechselt hatten.
Aschermittwoch. Der Rausch ist dahin, aber stärker als mein Elend ist die Gewalt Deines Bildes, unter Larven ein holdes Angesicht.
Der Englische Garten ist abermals Garten der Gefühle und der Konfusionen. Ich schwöre, dass ich schon bald ermüde, bei meiner nicht ganz einwandfreien Ehre.
Lily und wieder Lily. Abermals fühle ich mich bestärkt in meinen Gefühlen zu ihr und kurz darauf wieder erschüttert. Weder Weg noch Steg. Von den Folgen im Studium schweige ich.
Etwas formell teilt sie mir mit, dass wir das Duospiel fortsetzen wollen, das gnädige Fräulein. Ich denke doch nur an sie. Alles andere gewinnt mir keine Miene ab.
Mein unruhiges Leben ließ eine vorübergehende Spur in meinem Körper zurück. Nervöse Herzaffektionen quälten mich, besonders im Schlaf. Dieses Herz ward zum Thema in meinen Kompositionsübungen. Aber ich tat doch alles, um mich davon zu befreien, und mein zukünftiger Schwiegervater erlebte an mir einen ärztlichen Triumph.
Gedanken über Porträtkunst. Mancher wird nicht die Wahrheit meines Spiegels erkennen. Er sollte bedenken, dass ich nicht dazu da bin, die Oberfläche zu spiegeln (das kann die fotografische Platte), sondern dass ich ins Innere dringen muss. Ich spiegele bis ins Herz hinein. Ich schreibe Worte auf die Stirn und um die Mundwinkel. Meine Menschengesichter sind wahrer als die wirklichen.
Im Frühjahr 1901 stellte ich folgendes Programm auf: Zuoberst die Kunst des Lebens, dann als idealer Beruf: Dichtkunst und Philosophie, als realer Beruf: die Plastik und zuletzt in Ermangelung einer Rente: die Illustration.
Ich habe ein neues Leben begonnen. Und diesmal gelingt es! Tief lag ich zu Boden. Alles sei mir erlaubt, glaubte ich, auszukosten sei meine Stärke. Zum Narrentanz ging ich, ein schmutziger Lump. Die Liebe der Jungfrau hat mich erlöst von solcher Gestalt. Ich sah mein Elend, und da war es schon halb gebannt. Der Schrecken raffte mich auf. Ich will ernst werden und besser. Durch den Kuss des liebsten Weibes ist alle Not von mir genommen. Ich werde arbeiten. Ein guter Künstler will ich werden. Die Bildhauerei erlernen. Meine Begabung ist in erster Linie formal. Diese Erkenntnis nehme ich mit auf den Weg.
Stuck meinte, mir zur Bildhauerei zuraten zu dürfen, wenn ich dann wieder malen wollte, könnte ich das Erlernte gut brauchen. Ein Beweis dafür, dass er nichts von der Welt der Farbe versteht. Und er riet mir, zu Rümann zu gehen. Als Stuckschüler hoffte ich, da ohne weiteres eintreten zu können.
Der Alte verlangte aber ein Eintrittsexamen von mir. Ich bat um Dispens, denn schon der Umstand, dass man es von mir verlangte, war für mich mit Recht so viel wie ein Durchfall. Er aber wurde bei dem Ansinnen ganz aufgeregt: „Ich habe selber einmal ein Aufnahmeexamen machen müssen.“ Das klang königlich. Dann unterzog er meine Zeichnungen einer scharfen Kritik, an einigen ließ er aber doch etwas dran. Schließlich ging ich, ohne ihm in der Examensfrage entgegenzukommen. Ein wenig hatte ich vielleicht doch imponiert. Ob er wohl auf ein Wiedersehen rechnete?
Kleines Tannenbild, 1922.
Öl auf Nesseltuch auf Karton,31,6x20,2cm.
Vermächtnis Richard Doetsch-Benziger,
Kunstmuseum Basel, Basel.
Warnung der Schiffe, 1917. Feder,
Aquarell aufrohweißem Papier,auf rosa
eingefärbtem Büttenpapier, 24,2x15,6cm.
Grafische Sammlung,Staatsgalerie Stuttgart, Stuttgart.
Astrale Automaten, 1918.
Aquarell auf Papier, 22,5x20,3cm.
Beyeler Foundation, Riehen/Basel.
Ein Engel serviert ein kleines Frühstück, 1920.
Lithografie, 19,8x14,6cm.Sprengel Museum, Hannover.
Die sieben Worte des Propheten von Rümann:
I. Vorschriften lass ich mir keine machen.
II. Ein Zeichner allerersten Ranges sind Sie übrigens auch nicht, wie ich sehe.
III. Dies ist ja ganz hübsch gezeichnet.
IV. Aber dieser Kopf verdient das Prädikat schlecht.
V. Von einer Probearbeit werden nur Leute dispensiert, die schon jahrelang modelliert haben.
VI. Ich habe selber einmal eine Probearbeit machen müssen. (Hier ging ich.)
VII. Guten Tag, Herr Klee.
„Der Schönheit diene ich durch Zeichnung ihrer Feinde (Karikatur, Satire)“, sagte ich des Öfteren. Aber das ist noch nicht alles, ich muss sie auch direkt gestalten, mit voller Überzeugungskraft. Ein weiteres, erhabenes Ziel. Halb im Schlummer wagte ich mich schon auf diese Bahn. Es wird wach geschehen müssen. Sie ist vielleicht länger als mein Leben.
Der Strebende wird das Irdische nie ruhig genießen. Die ersten Umformungen (Nachformung der neu erlebten Welt) sind ein stetiger Kontrast zur Fülle und Frische der Eindrücke. Vorwärts, den reifen Werken entgegen. Die Kindheit war ein Traum, dereinst alles vollbringen zu können. Die Lehrzeit ein Suchen in allem, im Kleinsten, im Verborgensten, in Gutem und Bösem. Dann geht irgendein Licht auf und eine einzige Richtung wird verfolgt (in dieses Stadium trete ich jetzt ein, nennen wir es die Wanderzeit).
Juni 1901. Bedenken stellten sich ein. Was hatte ich Lily zu bieten? Von Kunst ward nicht einmal einer satt. Also kamen wieder Abschiedsgedanken aufs Neue an die Reihe.
Ideell kam ein großes Kraftgefühl über mich, durch den Sieg oder durch die Liebe. Doch was nützt das im Leben? Was für eine Vollkommenheit erlangt man durch die Liebe! Welche Steigerung aller Dinge. Was für ein Maßstab ist sie! Was für ein Schlüssel.
Rückblick über die künstlerischen Anfänge in diesen drei Jahren. Was in diesen Tagebüchern unklar ist, wirr und unentwickelt, wirkt kaum so abstoßend oder gar lächerlich wie die ersten Versuche, diese Zustände in Kunst umzusetzen. Ein Tagebuch ist eben keine Kunst- sondern eine Zeitleistung.
Aber eines muss ich mir zugestehen, der Wille nach dem Echten war da. Sonst hätte ich ja als leidlicher Aktzeichner einfach Kain und Abel komponieren können. Dazu war ich aber zu skeptisch.
Ich wollte die kontrollierbaren Dinge geben und hielt mich einzig an mein Inneres. Je komplizierter es nun da mit der Zeit aussah, desto toller die Kompositionen. Die sexuelle Ratlosigkeit gebiert Monstren der Perversion. Amazonensymposien und anderes Schreckliches.
Dadurch, dass der ganze Mensch im Verlauf dieser drei Jahre zeitweise sehr herunterkam, wurde er auch wieder läuterungsbedürftig und -fähig. Viele Projekte sprechen dafür. Schließlich bleibt auch das Bedürfnis nach absoluter Form nicht aus. Damit beginnt das Gleichgewicht sich herzustellen. Dass damit meine Verlobung zeitlich zusammenfällt, ist durchaus logisch.
Vor Italien (Sommer 1901). Das Kraftbewusstsein hielt an. Die Trennung war zuerst nicht übermäßig schwer. Dass ich nun ein sittlicher Mensch war, auch nach der sexuellen Seite hin, gab mir darin eine gewisse Ruhe. Diese Frage als solche konnte mich nicht mehr beunruhigen. Der Geist war frei von solcher Trübnis. Ich konnte nun mit voller Konzentration an ein Studium gehen. Die drei Jahre München hatten sein müssen, um mich so weit zu bringen. Ich setzte nun alles auf Italien. Eine Verwirklichung des Humanismus stellte ich nun außer dem Spezialstudium noch in Aussicht.
Über den Sternen will ich meinen Gott suchen. Als ich nach irdischer Liebe rang, suchte ich keinen Gott. Nun da ich sie habe, muss ich ihn finden, der Gutes an mir tat, als ich von ihm abgewandt war. Wie kann ich ihn erkennen? Lächeln muss er wohl des Toren, daher die Kühlung linder Winde in der Sommernacht. Stumme Seligkeit ihr zum Dank und einen Blick nach jenen Bergeshöhen!
Bewegung der Gewölbe, 1915.
Aquarell auf Papier auf Karton,
20x25,2cm.The Berggruen Klee Collection,
The Metropolitan Museum of Art, New York.
Wintertag kurz vor Mittag, 1922.
Öl auf Papier auf Karton, 29,8x45,9cm.
Kunsthalle Bremen, Bremen.
Versunkene Landschaft, 1918.
Aquarell, Gouache, Feder und Tinte auf Papier,
oben und unten mit Seidenpapier eingefasst, auf Karton,
17,6x16,3cm. Museum Folkwang, Essen.
Italienreise
Oktober 1901 bis Mai 1902
Milano, 22. 10. 1901. Ankunft.
Brera: Mantegna; Raffael nicht besonders vertreten. Überraschung: Tintoretto.
Genova, Ankunft bei Nacht.
Das Meer im Mondschein. Wunderbare Luft von draußen. Ernste Stimmung. Von tausend Eindrücken müde wie ein Lasttier. Das Meer bei Nacht zum ersten Mal von einer Anhöhe gesehen. Der gewaltige Hafen, die Riesenschiffe, die Auswanderer und die Hafenarbeiter. Die südliche Großstadt.
Vom Meer hatte ich mir einen ungefähren Begriff gemacht, nicht aber vom Hafenleben. Eisenbahnwagen, bedrohliche Dampfkräne, Warenladungen und Menschen, an stark gemauerten Dämmen entlang, über Taue steigen, vor Kahnvermietern fliehen: Die Stadt und der Hafen, die amerikanischen Kriegsschiffe, die Leuchttürme, das Meer. Die eisernen Pflöcke als Stühle. Das ungewohnte Klima. Dampfer aus Liverpool, Marseille, Bremen, Spanien, Griechenland, Amerika. Respekt vor der großen Erde. Wohl mehrere hundert Dampfer neben zahllosen Seglern, Dampferchen, Schleppschiffen. Und erst die Menschen. Da die abenteuerlichsten Gestalten mit Fes. Hier auf dem Damm ein Haufen Auswanderer, Süditaliener, gelagert (schneckenartig) in der Sonne, affengeschmeidige Gebärden, stillende Mütter. Die größeren Kinder spielend und zankend. Ein Ernährer bahnt sich durch mit einem dampfenden Geschirr (frutti di mare), auf schwimmenden Küchen erworben. Woher der auffallende Öldampfgeruch kommt? Dann die Kohlenträger, schön gebaute Gestalten, leicht und flink, halbnackt vom Kohlenschiff mit der Ladung am Buckel (ein Tuch schützt das Haupthaar), auf ein langes Brett, den Damm hinauf, hinüber ins Magazin zum Wiegen der Ladung. Dann frei hinunter über ein zweites Brett ins Schiff, wo ein frisch aufgeschaufelter Korb bereitsteht. Leute so in ununterbrochenem Kreislauf, braun von Sonne, schwarz von Kohle, wild, verächtlich. Dort steht ein Fischer. Das ekelhafte Wasser kann nichts Gutes beherbergen. Es wird nichts gefangen, wie überall. Angelzeug: dicke Schnur, daran ein Stein, eine Hühnerpfote, eine Molluske.
Die Dämme tragen Häuser und Magazine. Eine Welt für sich. Wir diesmal die Müßiggänger drin. Und doch arbeiten wir, zum Mindesten mit den Beinen.
Hohe Häuser (bis zu dreizehn Stockwerke), engste Gassen in der alten Stadt. Kühl und übelriechend. Abends dicht mit Menschen besetzt. Tagsüber mehr mit Jugend. Deren Windeln flattern wie Flaggen in einer Feststadt in der Luft. Quergespannte Schnüre von Fenster zu vis-à-vis Fenster. Tagsüber stechende Sonne in diesen Gässchen, metallen blinkende Reflexe des Meeres da unten, eine Flut von Licht von überall: Blendungen. Dazu die Töne eines Drehklaviers, ein malerisches Gewerbe. Drumherum tanzende Kinder. Das Theater in Wirklichkeit. Ziemlich viel Schwermut habe ich über den Gotthard mitgenommen. Auf mich wirkt Dionysos nicht einfach.
Segelschiffe, 1927.
Bleistift und Aquarell auf Papier auf Karton,
22,8x30,2cm.Zentrum Paul Klee, Bern.
Hafenbild nachts, 1917.
Aquarell und Gouache auf Leinwand auf
Gipsgrundierung auf Papier auf Karton, 21x15,5cm.
Musée d’Art Moderne et Contemporain, Straßburg.
Livorno langweilig. Wir flohen mit einem Wägelchen eiligst. Das Pferdchen verstand es. Lustig war die Ausladung gewesen. Die Bootsleute, die sich mit den Rudern bekämpften: „Una Lira“, natürlich. Die Freitreppe aus dem Wasser, das Zollamt.
Am Bahnhof viel Gedränge. Haller hatte nicht den Mut, Billett zu verlangen. Er nahm mich unter seinen Mund und dozierte zuerst stotternd: „P-P-Pisa“ und dann „Q-quando p-parte il t-treno?“
Die Worte lagen in der Tat recht dumm. Ich frisch voran. Zuerst fragte man mich „andate o ritorno?“, was ich nicht kapierte, also hieß es danach barsch „alle mezz“, was auch nicht so einfach war. Ich lernte dabei mein erstes praktisches Italienisch. Und der Zug, der alle halbe Stunde fährt, stand bereit und brachte uns durch wenig reizvolle Gegend nach Pisa.
In Pisa blieben wir von neun Uhr früh bis fünf Uhr abends. Außer dem Dom ist wenig zu sehen, ehestens noch die Piazza dei Cavalieri. Der Dom ein Wunder. Wie kommt der Riese in dieses Nest. Ganz abseits liegt diese Schaustellung, eine Menagerie auf dem Dorf.
Auf den schiefen Turm mussten wir steigen, das Echo im Baptisterium hören, etc. Damit war unsere Unternehmungskraft erschöpft. Statt ein Restaurant ausfindig zu machen, kauften wir uns Kastanien und setzten uns auf irgendeine Bank.
Der sausende Zug romwärts, das war ein Gefühl.
Ankunft in Rom am 27. Oktober 1901, gegen Mitternacht. Wir feierten in einem Hotel am Bahnhof das Ereignis mit drei Litern Barbera und einem schweren Rausch. Am zweiten Tag war ich schon eingemietet, mitten in der Stadt, Via de l’Archetto 20, für 30 Lire monatlich.
Rom nimmt mehr den Geist gefangen als die Sinne. Genua ist eine moderne Stadt, Rom eine historische; Rom ist episch. Genua dramatisch. Daher lässt es sich nicht im Sturm nehmen.
Die Ungeduld drängte mich gleich zu den Sehenswürdigkeiten, zuerst zu Michelangelos Sistina und zu den Stanzen Raffaels. Michelangelo wirkte wie Prügel auf den Knirr- und Stuckschüler. Er nahm sie an und fand, dass es Perugino und Botticelli auch nicht besser ging. Die Raffaelschen Fresken bestanden, aber nicht ohne die Absicht zu bestehen.
Ruhiger war der Eindruck der Marc-Aurel-Reiterstatue und der Hl.-Petrus-Statue in der Peterskirche. Seine abgeküssten Zehen kommen noch hinzu. Marc Aurel ist konzentrierte Kunst, beim Petrus spielt der Glaube noch eine Rolle. Nicht, dass ich die Gläubigen, die sich um seinen Fuß zu schaffen machen, verstünde, aber sie sind doch da. Wer kümmert sich um Marc Aurel? Die primitive Steifheit des Petrusgusses, wie ein Stück Ewigkeit im Getümmel des Zufälligen (31. Oktober).
2. 11. 1901. Nach der Via Appia gezogen, um die Umgebung Roms kennenzulernen. An der Stadtgrenze lenkte uns der lateranische Palast davon ab. Und die Mutter aller Kirchen daneben. Die byzantinischen Mosaiken im Chor, zwei köstliche Hirsche. Nach dieser Vorspeise hinüber zum christlichen Museum des Laterans. Skulpturen in naivem Stil von hoher Schönheit, die in der starken Kraft des Ausdrucks besteht. Die Wirkung dieser eigentlichen Unvollkommenheiten lässt sich intellektuell nicht gut begründen, und doch bin ich dafür empfänglicher als für die am meisten gepriesenen Wunderwerke. In der Musik erlebte ich auch schon einzelne Parallelen hierzu. Natürlich gehe ich nicht als Snob vor. Aber die Pietà in der Peterskirche ging spurlos an mir vorüber, und vor irgendeinem alten ausdrucksvollen Heiland kann ich wie festgebannt stehen.
Auch bei den Fresken Michelangelos steht irgendwas Geistiges über der Kunst. Die Bewegung und hügelige Muskulatur sind nicht reine Kunst, aber auch mehr als reine Kunst. Dieses Formbetrachtungs-vermögen verdanke ich den Eindrücken der Architektur, Genova: San Lorenzo. Pisa: Dom. Rom: St. Peter. Mein Gefühl opponiert oft stark dem Burckhardtschen Cicerone.
Dass ich den Barock nach Michelangelo hasse, ist eventuell damit zu erklären, dass ich gemerkt habe, wie sehr ich selber bis dahin im Barock steckte. Trotz der Erkenntnis, dass der edle Stil durch die Vollkommen-heit der Mittel verlorengeht (ein einziger Deckpunkt: Leonardo), zwingt es mich zum edlen Stil zurück, ohne die Überzeugung, dass ich mich je damit vertragen werde. Kühnheit und Fantasie sind jetzt fehl am Platz, wo ich Lehrling sein soll und will.
Nachher gerieten wir nicht in die Via Appia, sondern in die Via Latina, wo uns in einer Schenke ein gutes Mittagessen erwartete. Davon wurden bei mir noch zwei Katzen satt, bei Haller ein Hund, ein Stück Opposition gegen mich war dabei mit seinen Motiven vermischt. Die landschaftlichen Idyllen hier in den Schenken sind reizvoll. Wenn ich so produzieren soll, wie ich es schon kann, muss ich mal mit einer Radierplatte herauskommen.
Das Eselstreiben auf diesen klassischen Straßen. Der Vorstadtcharakter. Die Weinhäuser und Küchen. Mein Abscheu vor der Tierquälerei.
Haller lebt in einem düsteren Atelier. Ein Staub ist dort und Flöhe! Einmal kam ich hin, als er Fotografien von seiner russischen Freundin Sch. im Nachttopf tönte. Seinen Zyklus an die Sonne will er durchzwingen. Seine Energie steht außer Frage.
Mit einem reizenden kleinen Modell fiel er herein. Es sei kein Berufsmodell, hieß es, nur um seine Mutter und vier Geschwister vom Hungertod zu retten, habe es sich überwunden (ein Schreiben an den Papst blieb ohne Erfolg). Abends schreien die Kleinen: Mamma, fame! Die Mutter hat den halben Verstand darüber verloren. Zum Betteln zu stolz.
Einmal wollte Haller sie bezahlen und schickte sie mit 50 Lire zum Wechseln, sie brachte ihm nur 45 zurück, die er nobel erst später nachzählte. Nun sahen wir den ganzen Schwindel ein. Und es war ein so famoses Modellchen. Stand schwindelfrei hoch auf einem Gebäude von Tisch und Stuhl, und breitete verzückt die Arme aus, sonnenwärts.
Villa R, 1919. Öl auf Karton,
26,5x22,4cm.Kunstmuseum Basel, Basel.
Station L112, 14 km, 1920. Aquarell und
Tusche auf Papier auf Karton, 12,3x21,8cm.
Hermann und Margrit Rupf-Stiftung,
Kunstmuseum Bern, Bern.
Diese Woche wieder ein Stück Rom erobert. Die Pinakothek des Vatikans und die Galleria Borghese. Im Vatikan größte Gediegenheit, nur wenig Bilder. Ein unvollendeter Leonardo (Hieronymus), ein paar Peruginos, von Tizian ein Pfaff im Ornat.
Raffael ist schwerer zu würdigen. Mitten aus einem ungeheuerlichen Streben hinweggerafft. Die Möglichkeiten undiskutierbar, das Positive zu jüngerhaft.
Weniger gerecht wird Burckhardt dem Botticelli (im Cicerone eine Seite).
So weit bin ich jetzt, dass ich die große Kultur der Antike und ihre Renaissance überblicke. Nur zu unserer Zeit kann ich mir kein künstlerisches Verhältnis denken. Und unzeitgemäß etwas leisten zu wollen, kommt mir suspekt vor.
Große Ratlosigkeit.
Deshalb bin ich wieder ganz Satire. Sollte ich mich noch einmal ganz darin auflösen? Vorläufig ist sie mein einziger Glaube. Vielleicht werde ich nie positiv? Jedenfalls werde ich mich wehren wie eine Bestie.
Immer mehr Renaissance, immer mehr Burckhardt. Ich spreche schon seine Sprache, eine Stelle zum Beispiel.
Sehr ungern denkt man in diesem Zusammenhang an die gotischen Gewänder der Deutschen.
Dürer ist damit nicht gemeint, die Münchener Apostel seien musterhaft gekleidet.
Ähnliche Ungerechtigkeit gegen den Barock. Man glaube nicht mehr, dass es Griechen gegeben habe. Bernini ein Unglücksrabe.
15. November. Bedeutendes Konzert im Teatro dell’Opera di Roma.
Antikensammlung des Konservatorenpalastes. Die Lupa. Der Dornauszieher. Für den Kenner des Aktes insbesondere die Musenstatuen. Eine drehbare weibliche Figur vollkommen wie die Natur. Der Deutsche dreht. Seine kurz Angetraute sitzt auf einer Bank und bewundert ihn. Der Italiener macht dumme Späße. Der Engländer liest in seinem Führer, edle Töne von sich gebend. Man ist nie allein in den Museen.