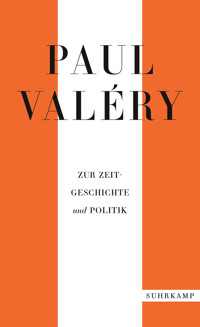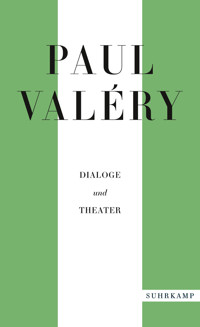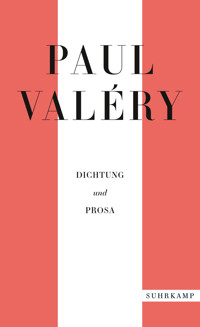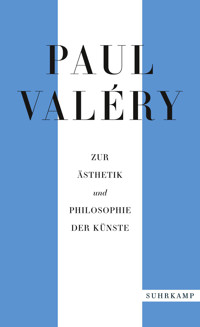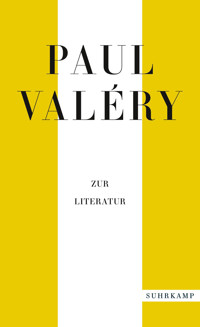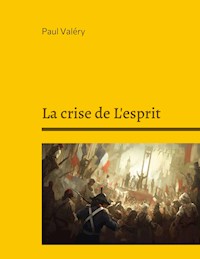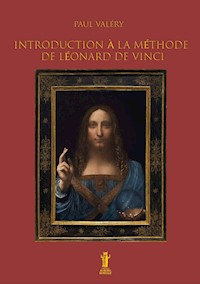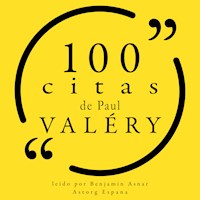19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Band 5 der Gesamtausgabe gliedert sich in zwei Teile: Teil 1 umfasst Zeitschriften- und Redebeiträge zur Dichtkunst, frühe Analysen literarischer Technik sowie Niederschriften seiner am Collège de France gehaltenen Poetik-Vorträge. In Teil 2 des Bandes folgen Vermischte Gedanken: das einzige zu Lebzeiten Valérys veröffentliche Cahier, die Aphorismen Windstriche und weitere Kurzprosa, darunter Prosagedichte und Epigrammatisches.
Wie für Valéry charakteristisch fügen sich fragmentarische Beobachtungen, abstraktes Denken und moderne Prosaentwürfe zu einem Ganzen: »Wie die Kompaßnadel bei wechselnder Fahrtrichtung ziemlich konstant bleibt, so lassen sich die Sprünge unseres Denkens deuten als Abweichungen von einer irgendwie gleichbleibenden tieferen und wesentlichen Richtung des Geistes.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 703
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
PAUL VALÉRY WERKE
Frankfurter Ausgabe in 7 Bänden
Herausgegeben von Jürgen Schmidt-Radefeldt
Suhrkamp
Band 5 Zur Theorie der Dichtkunst und vermischte Gedanken
Herausgegeben von Jürgen Schmidt-Radefeldt
Die Originalausgabe erschien 1957 unter dem Titel Œuvres I sowie 1960 unter dem Titel Œuvres II bei Éditions Gallimard, Paris.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2023
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 5218.
© 1991, Insel VerlagAnton Kippenberg GmbH & Co. KG, Berlin
© Éditions Gallimard, 1957 und 1960
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Brian Barth
eISBN 978-3-518-77147-1
www.suhrkamp.de
INHALT
ZUR THEORIE DER DICHTKUNST
Vorrede
Über die literarische Technik
Die ›Semantik‹ von Michel Bréal
Vorwort zur ›Erkenntnis der Göttin‹
Ansprache im PEN-Club
Rede über die Dichtkunst
»Poésie pure«
Probleme der Dichtkunst
Notwendigkeit der Dichtkunst
Die ästhetische Erfindung
Poetik-Unterricht am Collège de France
Antrittsvorlesung über Poetik am Collège de France
Dichtkunst und abstraktes Denken
Meine »Poetik«
VERMISCHTE GEDANKEN
Cahier/Heft B 1910
Windstriche
Weitere Windstriche
Literatur
Verschwiegenes
Suite
Schlimme Gedanken und andere
ANHANG
Editorische Nachbemerkung
Verzeichnis der Abkürzungen
Anmerkungen
Nachweise zu den einzelnen Texten
Namen-und Werkregister
ZUR THEORIE DER DICHTKUNST
VORREDE
Mein Titel ist einigermaßen irreführend. Gewiß vereinigt dieser Band verschiedene hier und da erschienene (und auch einige unveröffentlichte) Versuche, die mit dem Dichterberuf und der Verskunst zu tun haben; aber es wird hier fast nichts zu finden sein, das aus der Absicht käme, die Poesie zu erklären.
Poesie, ein zweideutiges Wort, meint einmal: Gemütsbewegung, die zum Schaffen strebt; und ein anderes Mal: Leistung, die danach strebt, unser Gemüt zu bewegen.
Im ersten Falle handelt es sich um eine Erregung, deren einzigartige Wirkung darin besteht, daß sie sich in uns und durch uns eine Welt bildet, die ihr entspricht.
In der zweiten Bedeutung versteht man unter diesem Wort ein bestimmtes Gewerbe, über das man mit Vernunft reden kann. Es bemüht sich, in andern Menschen jenen schöpferischen Zustand, von dem ich eben gesprochen habe, zu erzeugen und wiederzuerzeugen, und zwar durch die besonderen Mittel der artikulierten Sprache. Zum Beispiel versucht es, die Vorstellung einer Welt heraufzurufen, die so beschaffen ist, daß sie zum Anlaß der eben erwähnten Erregung wird. Das höchste Ziel dieser Kunst in bezug auf einen gegebenen Leser ist dann erreicht, wenn dieser keinen anderen vollkommenen und notwendigen Ausdruck für die Wirkung, die ein Werk auf ihn ausübt, finden kann als dieses Werk selbst.
Der erste Sinn jedoch bezeichnet uns eine Art Mysterium. Die Poesie ist die eigentliche Gelenkstelle zwischen Geist und Leben, diesen beiden undefinierbaren Wesenheiten.
Die Menschen, in denen dieses Mysterium sich vollzieht, begnügen sich meist mit der Empfindung, die sie davon haben. Sie empfangen, wie es gerade kommt, dieses schöne Geschenk: bis zum Erfinden erregt zu sein.
Als passive oder aktive Poeten erleben oder erstreben sie den Genuß ohne Erkenntnis. Ja, man lehrt sogar gemeinhin, daß die beiden Seinsweisen einander ausschließen; daß eine Gefahr darin liegt, und vielleicht eine Pietätlosigkeit, sie in einem Kopf vereinigen zu wollen. Im Bereiche des Empfindungsvermögens ist diese Meinung unbestreitbar – vorausgesetzt, man nennt »Empfindungsvermögen« genau das, was unvernünftig und göttlich sein soll.1
Aber wo gäbe es Gefahren, die niemand anlockten?
Manche Leute, wenn auch ziemlich wenige an Zahl, begnügen sich also nicht damit, durch eine bestimmte ursachlose Gabe lediglich von der Natur Begünstigte zu sein. Nicht ohne Verdruß, nicht ohne Widerstreben lassen sie es zu, daß Anwandlungen und Lustgefühle von so hoher Art nicht in die geistige Betrachtung eingehen und in ihr aufgehen sollen.
Weit davon entfernt, die klaren und deutlichen Verfahren des Geistes in einen Gegensatz zur Poesie zu stellen, behaupten diese Unentwegten, daß der Ehrgeiz, die poetische Leistungskraft zu analysieren und womöglich zu begreifen, nicht nur an sich selbst der allgemeinen Tendenz unseres Willens zur Einsicht entspreche und den ganzen Umfang unserer Denktätigkeit beanspruche, sondern darüber hinaus auch wesentlich sei für die Würde der Muse – oder vielmehr aller Musen, denn ich spreche jetzt ganz allgemein von allen unseren Fähigkeiten, ideale Gegenstände zu erfinden.
In der Tat, mag die Poesie auch noch so sinnenhaft und leidenschaftlich sein, gänzlich untrennbar von bestimmten Entzückungen, mag sie manchmal bis zur Ordnungslosigkeit vorstoßen, so verträgt sie sich dennoch mit den genauesten Fähigkeiten der Intelligenz. Das ist leicht zu zeigen. Denn wenn sie auch im Prinzip eine Art Erregung ist, so ist sie doch eine ganz besondere Art von Erregung, nämlich eine, die sich Gestalten erschaffen will. Der Mystiker und der Liebende können im Unsagbaren verharren; aber die Schau oder die Gefühle des Dichters streben danach, sich einen exakten und dauerhaften Ausdruck in der realen Welt zu gestalten.
Leidenschaftliche Erregungen erstaunen uns im Innersten und verändern uns durch Überraschung. Bald entfesseln sie verborgene Kräfte in uns, die uns plötzlich aus unserer Fassung bringen; bald erschöpfen sie uns maßlos in ungeordneten Bewegungen, die sich nur durch die Überfülle des Augenblicks erklären lassen; bald nötigen sie uns zu mehr oder weniger verständlichen und verständigen Handlungen, die irgendein Ding zu erreichen suchen, dessen Besitz oder dessen Vernichtung uns den früheren Frieden und die Freiheit für die folgenden Augenblicke wiederbringen soll.
Aber es kommt auch vor, daß solche besonders tiefen Verwirrungen oder Erregungen irgendwelche Ausdruckskräfte in Tätigkeit setzen. Als deren unmittelbare Wirkungen entstehen dann im Geiste Formen und Rhythmen, unerwartete Beziehungen zwischen verborgenen Orten der Seele, die bisher weit entfernt voneinander waren, gewissermaßen ohne Kenntnis voneinander im gewöhnlichen Lauf der Zeit, jetzt aber plötzlich wie dazu geschaffen, einander als Teile eines harmonischen Gefüges oder eines vorherbestimmten Ereignisses zu entsprechen. Dann ahnen wir, daß wir irgendein Ganzes in uns bergen, von dem uns die gewohnten Umstände nur Fragmente abverlangen. Auch beobachten wir nun, wie die ursprüngliche Ordnungslosigkeit des Bewußtseins Ansätze von Ordnung hervorbringt, sich mit Entwürfen und Verheißungen durchdringt; wie tausend mögliche Vollkommenheiten im Unvollkommenen erwachen, wie die Zufälligkeiten die Wesensformen hervorlocken – und wie eine ganze Schöpfung aus Kontrasten, aus Symmetrien, aus harmonischen Relationen2 sich unserem Denken enthüllt, sich durchsetzt, auch wohl sich verweigert, so deutlich sie auch immer zu spüren bleibt.
Wenn ich aber in bezug auf die Poesie von Erregungen spreche, so kann ich hier vielleicht eine Bemerkung einflechten, die mit der allgemeinen Absicht meiner Überlegungen zusammenhängt.
Die Dichter – ich meine damit Personen, die von poetischen Empfindungen weitgehend beherrscht werden – sind nicht sehr verschieden von den andern Menschen, was die Intensität der Erregungen angeht, die sie dort erleben, wo sich jedermann erregen läßt. Von dem, was jedermann stark ergreift, werden sie nicht viel tiefer ergriffen – wenn sie es auch durch ihr Talent recht oft glauben machen können. Dagegen unterscheiden sie sich von den meisten Leuten dadurch, daß sie von Dingen, die keinen sonst aufregen, im höchsten Grade erregt werden können, und dadurch, daß sie fähig sind, sich selbst in vielfältige Leidenschaften, wundervolle Stimmungen und lebhafte Gefühle zu versetzen, denen der geringste Anlaß genügt, um aus dem Nichts zu entstehen und sich in erhebende Begeisterung zu steigern. Sie besitzen gewissermaßen in sich selbst unendlich viel mehr Antworten, als das gewöhnliche Leben ihnen Fragen vorzulegen hat; und darin liegt ihr stets bereitgestellter, überfließender und gleichsam überreizter Reichtum, der einem Nichts zuliebe Schätze, ja sogar Welten zur Entfaltung bringt.
Die Größe der Wirkungen im Vergleich zur Geringfügigkeit der Ursachen – das unterscheidet schlicht in seinem Wesen das poetische Temperament.
Aber ist dies nicht überhaupt der eigentümliche Charakter unseres Nervensystems? Die Herausbildung der greifbaren Erscheinung an Stelle der unfaßbaren, unübersteigbaren und mit sich selbst unvergleichbaren Wirklichkeit, ist sie nicht die hervorstechende Besonderheit dieses Systems? Denn dieser Energieträger, dieser geheimnisvolle Apparat des Lebens, hat die Aufgabe, alles Verschiedene zur Einheit zusammenzufügen, das, was nicht mehr ist, auf das, was ist, wirken zu lassen, Abwesendes gegenwärtig zu machen und mit unbedeutendem Kraftaufwand unermeßliche Wirkungen zu erzielen; darum bietet er uns endlich alles, was nötig ist, um die Poesie in ihr Amt einzusetzen.
Ein Dichter ist letzten Endes ein Individuum, das die Beweglichkeit, die Subtilität, die Allgegenwart, die Fruchtbarkeit dieses allmächtigen Kräftehaushalts im höchsten Grade verkörpert.
Wenn wir davon etwas mehr wüßten, könnte man versueben, sich eine hinreichend genaue Vorstellung von der dichterischen Leistungskraft zu machen. Aber wir sind sehr weit davon entfernt, im Besitz dieser zentralen Wissenschaft zu sein. Jene Liebhaber der Analyse, von denen ich vorhin sagte, daß sie sich nicht damit begnügen, lediglich die Spielbälle ihrer Begabungen zu sein, sie erfahren es bald, daß das Problem der Erfindung der Formen und der Ideen eines der heikelsten ist, die eine geübte spekulative Vernunft sich stellen könnte. Auf diesem Forschungsgebiet wäre alles ganz neu zu erschaffen – nicht etwa nur die Mittel und die Methoden, die Worte und die Begriffe –, sondern darüber hinaus, und vor allem andern, müßte man erst einmal den eigentlichen Gegenstand unserer Wißbegierde definieren.
Etwas Metaphysik, etwas Mystik, viel Mythologie werden noch lange Zeit genügen müssen, um in diesem Problembereich die Stelle von positiven Erkenntnissen zu vertreten.
ÜBER DIE LITERARISCHE TECHNIK
... Die Literatur ist die Kunst, mit der Seele der anderen Menschen sein Spiel zu treiben. So brutal wissenschaftlich hat man in unserer Zeit das Problem der Ästhetik des Wortes, das heißt das Problem der FORM, stellen sehen.
Wenn ein Eindruck, ein Traum, ein Gedanke gegeben sind, dann müssen sie derart ausgedrückt werden, daß man dadurch in der Seele des Zuhörers den maximalen Effekt erzielt – und zwar einen vom Künstler vollständig berechneten Effekt.
Diese Formel ergibt durch Deduktionsschluß einige sehr klare Begriffe vom Stil: Der Stil ist kein unwandelbarer Ritus, kein endgültiger Ausguß einer ewigen Gußform – selbst nicht bei einem Flaubert1 –, er muß sich der Absicht des Autors anpassen und einzig dazu dienen, das abschließende Feuerwerk vorzubereiten. Er muß dem Gegenstand adäquat sein. Schließlich muß der Schriftsteller verschiedene Register auf der Klaviatur des Ausdrucks beherrschen, um vielfältige Wirkungen zu erzielen – so wie der Musiker zwischen einer gewissen Anzahl von Klangfarben und rhythmischen Tempi die Wahl hat.
Und dies führt uns natürlich zu einer ganz neuen und modernen Vorstellung vom Dichter. Er ist nicht mehr der zerzauste Schwärmer, jener, der ein ganzes Gedicht in einer Fiebernacht schreibt, er ist ein kühler Wissenschaftler, fast ein Rechenkünstler, im Dienste eines verfeinerten Träumers. Höchstens hundert Verse werden seine längsten Stücke enthalten ... Er wird sich davor hüten, alles aufs Papier zu werfen, was ihm in glücklichen Minuten die Muse der Ideenassoziation eingibt. Sondern im Gegenteil, alles, was er ausgedacht, empfunden, geträumt, aufgebaut hat, wird durch ein Sieb hindurchgehen müssen, wird gewogen, geläutert, in Form gebracht werden, so stark wie möglich verdichtet, um an Kraft zu gewinnen, was es an Länge preisgibt: Ein Sonett zum Beispiel wird eine richtige Quintessenz sein, ein Osmazom, eine konzentrierte Kernsubstanz, immer wieder destilliert, auf vierzehn Verse reduziert, sorgfältig komponiert im Hinblick auf einen überwältigenden Endeffekt. Hier muß das Adjektiv unauswechselbar sein, die Klangwerte der Metren kunstvoll abgestuft, der Gedanke oft mit einem Symbol geschmückt, einem Schleier, der im Finale zerreißen wird ...
Ich habe soeben das Wort Symbol hingeschrieben, und ich kann nicht umhin, im Vorbeigehen diese unvergleichliche künstlerische Ausdrucksweise zu berühren. Bei allen mystisch veranlagten Völkern war es in täglichem Gebrauch, dann ist es vor dem Rationalismus und Materialismus verblichen. Die Künstler haben die Schönheit der Allegorie vergessen, und doch ist sie, wie Charles Baudelaire geschrieben hat, eine wesentliche ästhetische Form.2
Heute haben Dichter vom Range eines Sully Prudhomme, eines Mallarmé dargetan, welchen Gewinn die zeitgenössische Literatur aus dem wieder zu Ehren gebrachten Symbolismus ziehen könnte ...3
... Das Gedicht hat also unserer Ansicht nach kein anderes Ziel, als seinen Ausklang vorzubereiten. Am besten können wir es mit den Stufen eines prachtvollen Altars vergleichen, mit Schwellen aus Porphyr, die das Tabernakel überragt. Die Ornamentik, die Kerzen, die Goldschmiedearbeiten, die Weihrauchwolken – alles schwingt sich auf, alles ist so angeordnet, daß die Aufmerksamkeit auf das Sakrament gelenkt wird – auf den letzten Vers! Eine Komposition, der diese Abstufung fehlt, bietet einen Anblick von fataler Eintönigkeit, so reich und kunstvoll ziseliert sie auch sein mag. Dies ist unserer Ansicht nach der große Fehler der Sonette von Heredia – zum Beispiel –, die allzu schön sind, ihrer ganzen Länge nach, von Anfang bis zu Ende. Jeder Vers hat bei ihm sein Eigenleben, seinen besonderen Glanz, und dadurch lenkt er den Geist vom Ganzen ab.4
...Wenn das Gedicht einen gewissen Umfang hat, sagen wir hundert Verse, dann muß der Künstler darauf bedacht sein, den Gedanken an ein paar wichtigen Punkten festzuhalten, die am Schluß einander genähert und verstärkt werden, so daß sie kraftvoll zum letzten, entscheidenden Aufleuchten beitragen. Das führt mich zu der so eigentümlichen Poetik von Edgar Allan Poe; nachher werde ich mit einigen Worten auf eine Musiktheorie zu sprechen kommen, deren Kenntnis meiner Ansicht nach für jeden, der sich mit Literatur beschäftigt, sehr anregend ist.
Edgar Allan Poe, der Mathematiker, Philosoph und große Schriftsteller, legt in seinem merkwürdigen Bändchen Die Methode der Komposition (The Philosophy of Composition) mit klarer Bestimmtheit den Mechanismus der dichterischen Hervorbringung dar, so wie er ihn praktiziert und wie er ihn versteht.5
Keines seiner Werke enthält mehr Scharfsinn in der Analyse, mehr Strenge in der logischen Entwicklung der durch Beobachtung entdeckten Prinzipien. Seine Technik ist ganz und gar a posteriori entstanden, und zwar auf der Psychologie des Zuhörers aufgebaut, auf der Kenntnis der verschiedenen Noten, die in der Seele des anderen zum Erklingen gebracht werden sollen. Die bohrende Induktion Poes dringt in die innersten Reflexe des aufnehmenden Subjekts ein, kommt ihnen zuvor, nutzt sie aus. Er kennt genau den unermeßlichen Anteil, den die Gewohnheit und der Automatismus an unserem geistigen Leben haben, und darum führt er Verfahren ein, die seit den Alten den niederen Gattungen überlassen geblieben waren. Die Wiederholung gleicher Worte, die, scheint es, von den Ägyptern verwendet wurde, hat er zu neuem Leben erweckt. Mit Sicherheit vermag er die niederdrückende Wirkung eines düsteren Kehrreims vorauszusehen, oder häufiger Alliterationen:
And the Raven, never flitting, still is sitting, still is sitting.
Ebenso kehrt das verzweiflungserregende Nevermore in jeder Strophe wieder; zunächst ohne tiefere Bedeutung; allmählich immer schmerzlicheren Sätzen gegenübergestellt, wird es mehr und mehr zu einem Totengeläute der Hoffnungslosigkeit, bis zum Ausklang:
And my soul from out that shadow that lies floating on the floor
Shall be lifted – nevermore!
(... doch erheben wird sich aus dem Schatten schwer Meine Seele nimmermehr.6)
Alle, die das großartige Gedicht »Der Rabe« (vor allem im Original) gelesen haben, werden von der Kraft des kunstvoll verwendeten Kehrreims betroffen gewesen sein. Man kann sagen, daß dieses Mittel in der französischen Poesie niemals (ich meine niemals zielbewußt, im Hinblick auf eine Wirkung) angewendet worden ist, wenigstens nicht auf eine überlegte und wirklich kunstgerechte Art ...
Nehmen wir einmal an, es würden an Stelle eines einzigen eintönigen Kehrreims deren mehrere eingeführt; jede Person, jede Landschaft, jede Stimmung hätte den ihr eigentümlichen, so daß sie im Vorbeiziehen daran zu erkennen wären; am Schluß des Stückes in Versen oder in Prosa würden alle diese bekannten Zeichen zusammenströmen und jene Apotheose bilden, die man »musikalische Klimax«7 genannt hat, einen Schlußeffekt, der das Ergebnis der Gegenüberstellung, der Begegnung und Annäherung der Kehrreime wäre. Dann kämen wir zu der Konzeption des Leitmotivs, die der Wagnerschen Musiktheorie zugrunde liegt.
Hält man es für unmöglich, diese Prinzipien auf die Literatur anzuwenden? Sollten sie nicht für bestimmte Gattungen eine ganze Zukunft enthalten, wie zum Beispiel für die Ballade in Prosa, diese Schöpfung Baudelaires, die von Huysmans und Mallarmé vervollkommnet wurde?
... Und hier sollte man das Wort Décadence vermeiden, das nichts bedeutet. Die alten Kulturgesellschaften, die Jahrhunderte innerer Analyse und literarischen Schaffens hinter sich haben, brauchen immer neue, immer schärfere Reize! Was uns angeht, wir werden uns niemals darüber beklagen, daß wir in einer Zeit leben, in der man einen Hugo, einen Flaubert, die Goncourt nebeneinander sieht, in der die krankhafte Empfindsamkeit eines Verlaine der ungeheuren Vitalität eines Zola gegenübersteht und man sich dieses seltenen Schauspiels erfreuen kann8: die Brutalität der Lebenskonkurrenz, der Merkantilismus, das Auslöschen der Persönlichkeit, gegenübergestellt dem Feminismus, der verwöhnten, hingebenden Lässigkeit der Künstler und der verfeinerten dilettanti. Uns gefällt diese sublime Antithese: die barbarische Größe der Industriewelt gegenüber der äußersten Eleganz und der morbiden Süche nach den allerseltensten Lustgefühlen.9
Und wir lieben die Kunst dieser Zeit, kompliziert und künstlich wie sie ist, übermäßig mitschwingend, übermäßig angespannt, übermäßig musikalisch, um so mehr, je geheimnisvoller, beklemmender, unzugänglicher sie für die große Menge wird. Was macht es denn, daß sie den meisten verschlossen bleibt, daß ihre äußersten Ausdrucksformen der Luxus einer kleinen Zahl bleiben, wenn sie nur bei den paar Gerechten, deren göttliches Königreich sie ist, den höchsten Grad von Glanz und Reinheit erreicht?
DIE ›SEMANTIK‹ VON MICHEL BRÉAL
Alle Transformationen, denen die Sprache unterworfen werden kann, müssen eine bestimmte Menge von Eigenschaften unverändert lassen – so nehme ich an. Dieser Bodensatz enthielte dann wohl die grundlegenden Beziehungen zwischen der Sprache und dem, was man hypothetisch »Geist« nennt.
Wäre er erfaßbar, könnte man Probleme wie »was ist ein Substantiv, ein Verb, ein Satz?« auf ganz andere Weise lösen als durch bloße Beispiele oder noch unklarere Definitionen. Ebenso könnte man ein Gesetz für jede Art von Syntax formulieren, das zusammengefaßt die unterschiedlichsten Erfordernisse der Wortstellung und Kongruenz erfassen und auch die – verstehensmäßige – Einheit von Sätzen festlegen würde.
Jeder meint, daß diese Probleme gegenwärtig nicht angegangen werden könnten. Aber wer hat es denn überhaupt versucht? Man stellt sich ihnen nicht einmal. Diese einzigartige Vernachlässigung bewirkt, daß uns die Sprache in sehr viel geringerem Maße angehört als viele andere Phänomene, insofern wir von ihr eine klare Vorstellung hätten oder sogar handelnd auf sie ein wirken könnten, um nach einem solchen Versuch dann zu sehen, was aus ihr wird. Damit will ich sagen, daß wir noch heute linguistische Vorstellungen akzeptieren können, die ebenso absurd sind, wie jene von der ständigen Bewegung in der Mechanik es waren – einfach weil dem absolut nichts entgegensteht. In diesem Sinne hört man nicht selten, daß man doch »alles ausdrücken kann« usw.
Auf der anderen Seite muß man jene Leute sehen, die es auf sich genommen haben, tiefer in die Schwierigkeiten der Sprache einzudringen, und erkennen, daß sie dabei eigentümliche Besonderheiten erforschen und die Zustände beschreiben, sei es ein für allemal, sei es, um zu Behauptungen – die sie Gesetze nennen – zu gelangen, die entweder höchst vage oder höchst falsch oder höchst unnütz sind, je nach geringerer oder größerer Entfernung vom buchstäblich verstandenen Detail. Die besten dieser »Gesetze« haben den Wert mnemotechnischer Hilfsmittel. Keines von ihnen läßt eine allgemeinere Konstruktion erkennen, ja man kann in ihrem Aufbau nicht einmal ausmachen, was als durchgehend bekannt zugrunde gelegt wird und was nicht.
Dieses Unvermögen jenseits eines bestimmten Punktes ist nicht erstaunlich. Es rührt einzig und allein daher, daß die Psychologie von keinerlei Nutzen ist. Wenngleich ich nicht genau weiß, was die Psychologie ist, so bezeichne ich doch eine bestimmte Art von Problemen als psychologisch. So zum Beispiel, wenn ich mir beim Lesen sage »Ich verstehe« oder »Ich verstehe nicht« und mich daraufhin frage, was das denn eigentlich bedeute. Ich frage mich weiterhin, ob es zwischen diesen Zuständen Zwischenstufen gibt usw.
Auf diese scheinbar so einfachen Fragen hat niemand eine Antwort gefunden. Auch die Psychologen unserer Zeit haben, so fürchte ich, Probleme dieser Art nicht aufgegriffen, wo doch deren Lösung die Sprache nahezu umfassend erklären würde. Selbst die reinen Logiker haben kein Instrument erstellt, das vordringlich auf die gesprochene Sprache anzuwenden wäre: damit meine ich, daß sie keine allgemeine Analyse der allen Systemen gemeinsamen Bedingungen unternommen haben – eine Untersuchung, für die man mehr als einen wertvollen Hinweis in den exakten Naturwissenschaften finden kann und die mit ihnen so untrennbar verbunden ist.
Man sollte also kurz gesagt die Sprachwissenschaftler darum bewundern, daß sie der Meinung gewesen sind, Sprache an der Seite des so wenig bekannten Geistes zu erfassen. Ihre Werke, Sammlungen, Myriaden von Einzelaspekten, Feststellungen von Häufigkeit und der freie Gebrauch von Metaphern, die sich beim ersten Versuch auflösen – all dies erschließt im eigentlichen Sinne nichts. Dieses oder jenes Buch ist klar geschrieben, regt zum Denken an – aber keines kann als Beginn einer Wissenschaft gelten.
Michel Bréal, glücklicherweise einer der großen Kenner von allem, was man im Bereich der Sprachwissenschaft weiß und was es dort gibt, rückt nun die Sprache wieder an ihren einzig möglichen Platz.1
Die Semantik ruft uns in Erinnerung, daß Worte Bedeutungen haben, daß sie eine Gruppe aus zwei Elementen bilden, einem physischen und einem mentalen. Das Studium des ersteren ist schon recht weit fortgeschritten, das des zweiten jedoch weniger vorangekommen; das Studium der Gruppe insgesamt hat noch nicht begonnen, und gerade das wäre wichtig.
Die Semantik wendet sich nun diesem Gesamten zu. Sie betrachtet die Sprache als Mittel des Verstehens und als Ergebnis der wesentlichen Operationen des Denkens. Leider steht ihr keine angemessene Psychologie zur Verfügung, um diesem Gegenstand zu entsprechen und sein Vermögen festzulegen. In allen vorliegenden Theorien des Geistes trifft sie auf allzu veraltete, verschwommene Begriffe, die in ihrer Geschichte Verwechslungen erfahren haben, voller Auseinandersetzungen sind, so etwa Wille, Intelligenz usw., die ihre Benutzer ständig dahin führen, unbewußt synthetische Urteile zu vollziehen. Ich halte es also für wünschenswert, daß alle Begriffe, die in einer Semantik vorgesehen sind, noch schärfer und konventioneller als die der Mathematik definiert werden; denn es geht nun einmal darum, einige Begriffe festzulegen, um auf diese alle übrigen zurückzuführen ... Aber der Fehler der Psychologen hat kein Ende.
Gleich auf den ersten Seiten verwirft der Verfasser jene vitalistisch und evolutionär geprägte Metaphorik, die allenfalls für seichte Erklärungen nützlich ist.2 Nebenher sei bemerkt, daß es nicht minder logisch unstimmig ist, aus der Sprache ein sich entwickelndes Lebewesen zu machen, als sie, de Maistre folgend, als vollkommenes Geschenk der Gottheit zu betrachten.3 Es bestehen ebenso viele Schwierigkeiten, analytisch von einer Onomatopöie zu einem Substantiv zu kommen wie von dem reinen Nichts zu einer vollständigen artikulierten Sprache; im System der Evolution jedoch wird diese Schwierigkeit durch einen Kunstgriff kaschiert, den die Logik leicht aufzeigen kann und der sich darauf beschränkt, die Verteilung des Nicht-weiter-Reduzierbaren und Unverstehbaren in beiden Systemen zu verändern.
Aus gutem Grund hat Michel Bréal die bedenklichen Fragen nach dem Ursprung unbeachtet gelassen.4 Der Ursprung steht in allen Gegenstandsbereichen für eine Illusion. Die Suche danach jenseits unserer Erfahrung bleibt ein rein verbales Unterfangen. Dieser Begriff ist allzu stark mit allen Gegenständen unserer Erkenntnis verhaftet: Er fuhrt uns dazu, die Gegenstände durch das Denken zu verändern, bis man sie nicht mehr wiedererkennt, d.h., sie momentan zu zerstören; und daraus könnten wir durchaus etwas lernen. Zu gleicher Zeit aber führt es dazu, ohne daß wir uns dessen gewahr würden, den Gegenstand, den man verändert, durch andere, davon unterschiedene Gegenstände zu ersetzen; und diese neuen Gegenstände werden mit dem ersteren als gleichzeitig und als vorhergehend angenommen. Diese mentale Vorgehensweise vermittelt uns also nichts mehr; sie täuscht uns ...
Der Verfasser entwickelt danach in einzelnen Kapiteln die wesentlichen semantischen Sachverhalte. Ich werde einige davon darstellen, wenngleich ich durch die Zusammenfassung dieser bemerkenswerten Teile die ursprüngliche Methode unvermeidlich verzerre. Das liegt daran, daß man sie kaum zusammenfassen kann; wenn man das könnte, wäre die hier zu schaffende Wissenschaft gemacht. Jeder Teil wird durch Beispiele ergänzt, die mit größter Feinsinnigkeit vom Anfangszustand der Semantik her ausgewählt sind. Die Gesetze und die Unterteilungen des Themas werden als vorläufige dargestellt und das Buch insgesamt als eine »Orientierung« der geistigen Welt präsentiert. Die Absicht des Verfassers besteht darin, Arbeiten anzuregen, die auf ein Detail gerichtet sind: sein Werk ist geeignet, unterschiedliche Theorien zu stützen; es bietet einen elastischen Rahmen, verbesserungsfähige Beziehungen, ein festgelegtes, solides System der für das Denken aufbereiteten Sachverhalte. Gerade bei diesen habe ich jene seltsamen Bündelungen von derart verschachtelten Beobachtungen bewundert, von denen doch jede einzelne klar, wichtig und frei inmitten anderer ist, so daß der Leser darüber verfügen und selbst – sozusagen parallel zur Semantik – eine konkrete Geschichte unserer Sprache zusammenstellen kann, eine induktive Grammatik und dazu manch besondere Gruppenbildung.
Der Leser der Semantik stößt zuerst auf das Gesetz der Spezifikation: ein Wort ist veränderbar, so etwa das Adjektiv durch Steigerung, das Substantiv durch Deklination, das Verb durch Konjugation; das Wort markiert diese Veränderung in einer bestimmten Epoche durch Modifikation am Wortende. Nach und nach wird in bestimmten Fällen diese Markierung aufgegeben. Man ersetzt sie durch eine Anzahl unveränderbarer Wörter, die unabhängige Begriffe darstellen. Man ersetzt also ein einzelnes abhängiges Element durch ein allgemeines unabhängiges Element. Schließlich verlieren die Wörter, die so zu reinen Hilfsmitteln werden, in diesem Gebrauch ihre ursprüngliche Bedeutung. Im Altfranzösischen etwa hatte das Adjektiv fort die Steigerungsform forçor; sie entwickelte sich jedoch zu plus fort. Im Englischen kann das Verb to do (machen) als Hilfsverb zur Konjugation aller übrigen Verben verwendet werden. In dieser Funktion entbindet es nach und nach davon, die Vielzahl der vorherigen Konjugationsformen zu kennen; es hat alle Tempus-, Modus- und Person-Veränderungen übernommen, wohingegen das Hauptverb zu einer Art Attribut geworden ist und unveränderlich in der Form des Infinitivs verharrt. Diese Anwendung der Spezifikation ist noch nicht völlig abgeschlossen. Man sagt: I go (ich gehe), I went (ich ging) usw. und nicht I do go, I did go. Es ist jedoch wahrscheinlich, daß sich die Vereinfachung auch auf die Formen der Affirmation ausdehnen wird, wenn man sich dazu die gegenwärtige Verbreitung des Englischen und sein Erfordernis allerorten klarmacht.
Das Gesetz der Repartition wirkt sich bei der Wortbedeutung aus. Wenn zwei Wörter in einer bestimmten Zeit dieselbe Bedeutung haben, so bleibt diese Synonymie nicht für längere Zeit bestehen. Sofern die beiden Wörter aus verschiedenen Sprachen stammen, von denen die eine als volkstümlich gilt, übernimmt das volkstümliche Wort die triviale Bedeutung. »Der Savoyarde«, schreibt Bréal, »verwendet die Bezeichnung père und mère für seine Eltern, die archaischen Wörter pâré und mâré demgegenüber für das Vieh.«
Das Gesetz der Irradiation ist eines der überraschendsten. Ein Wort etwa, dessen Bedeutung ich mit A wiedergebe, hat eine Endung oder einen Auslaut, den ich einmal b nennen will. Man bildet nun neue Wörter mit der Endung auf b, zum Beispiel Cb, Mb; b führt in diese neuen Wörter Bedeutungselemente von A ein. Das ist der Fall bei den französischen Adjektiven auf -âtre, die pejorativ sind: im Griechischen gab es Substantive auf αστηρ, wie etwa διχαστήρ, έργαστήρ. Einige dieser Wörter mit potentiell abwertender oder boshafter Bedeutung wurden in das Lateinische übernommen, wobei man symmetrisch eine Klasse pejorativer Wörter auf -aster bildete: filaster, patraster usw. Im heutigen Französisch haben wir marâtre, douceâtre, und wir können durch eine solche Endung die Bedeutung eines Adjektivs vermindern oder »verschlimmern«. Anhand dieses Beispiels erkennt man, wie das Lateinische einer Endung arbiträr eine Bedeutung zuordnet, weil einige griechische Wörter mit dieser Endung eben diese Bedeutung aufwiesen, und wie es dann diese Bedeutung vermittels dieser Endung weitergibt. Das Französische gibt dieser Endung danach einen noch größeren Wert, indem diese Veränderung für die meisten Adjektive gültig wird und den Status einer Art Bedeutungsgraduierung gewinnt.
Im Anschluß daran stellt Michel Bréal unter Überschriften wie »Überleben der Flexion«, »Falschwahrnehm ungen«, »Analogien«, »Neuerwerbungen« verschiedene Klassen von semantischen Sachverhalten vor, die ich jedoch wegen ihrer Länge hier nicht weiter ausführen möchte.
Auf andere Teile seines Buches, so etwa zu den Fragen »Wie hat sich die Syntax herausgebildet«, »Wie hat sich die Bedeutung der Wörter verfestigt«, soll besonders hingewiesen sein. Ich werde sie nicht aufnehmen, möchte nur sagen, daß sie zu den packendsten Problemen überhaupt fuhren, für diejenigen, die sich durch sie packen lassen. Im übrigen könnte ich wohl kaum genauer oder kürzer davon sprechen, als es der Verfasser schon selbst tut. Somit werde ich mich auf den Versuch beschränken, in der Abhandlung dieser ganzen Semantik einige allgemeine Eigenschaften zu erkennen.5
Indem ich nun dieses Buch durchblättere, es durch das aufgeschlagene Rad seiner Seiten hindurch erneut betrachte, ausgelesen und lebendig geworden, so setzt es eine Mischung von Gedanken frei, Gedanken, die sich in ihm auffinden lassen, die sich von ihm herleiten, und solchen, die durch einen schlagartig glücklichen Kontakt zwischen einer ersten und einer letzten Zeile erfunden wurden.
Zuerst nur in vagen Umrissen zeigt sich die Sprache: als eine Schwierigkeit wird sie vorgelegt; all ihrer Gewohnheiten, in denen sie sich versteckt, beraubt; gezwungen, von sich selbst zu sprechen, sich beim Namen zu nennen; zu diesem Zweck dann mit neuen Zeichen ausgerüstet. Man betrachtet ihre Veränderung, die an nichtigste Metaphern denken läßt, wenn man vorschnell ihre Beobachtung abbricht. Man bemerkt Klanggebilde, die entstehen, vergehen, die sich mischen, ablösen; man spürt, wie Vorstellungen schwächer werden, sich verzweigen, sich ausbreiten, ersetzt werden, ihre Lautstärke ändern. Dabei gibt es unerklärliche Abbrüche, absurde Glückstreffer: Austausch, ständige Veränderung, Umstellungen von Begriffen und Bildern, langsame und sichere Wiederaufrufe aus dem Wörterbuch des Begriffsvermögens.
Von dieser philosophischen Sicht her erscheinen jene Formen, welche die vertrautesten waren und am schnellsten verstanden wurden, als die am schwersten bewußt wiederverstehbaren. Die meisten dieser Redeweisen, die sich festsetzen, würden jeder Logik widerstreben. Umgekehrt scheinen jedoch die vollständigsten Formen, das heißt die für die Analyse geschaffen wurden und exakt die Urteilskategorien erfüllen, nicht dem Gebrauch zu widerstehen und werden sich also abschwächen müssen, um zu überdauern. Ihre Dauer, die durch ihre rationale Vollkommenheit gesichert scheint, wird durch etwas anderes festgelegt.
In dieser Unerwartetheit zeichnet sich nun das Individuum ab.
Es unternimmt alles mögliche, um sich zu verstehen – da es vor allem zu sich selbst spricht, wenn es spricht. Es muß ständig – mit starrem Material, das es aus einer einzigen Ordnung von Eindrücken entnimmt – ein Ensemble konstruieren – ein Gesamt, das ihm die Vielfältigkeit und die Werte, die schlagartigen Veränderungen, die Geschwindigkeiten und die mächtigen, unreduzierbaren, universalen Gruppierungen seines Denkens zurückgibt. Es muß dieses Denken wiederherstellen können, indem es dem Denken fremde Elemente nach bestimmten Regeln anordnet. Diese Elemente können als rein konventionell betrachtet werden. Die Regeln, die unverzichtbar sind, sind die eigentlichen Gesetze des Verstehens.
In einem Geist stellt sich jede sprachliche Form wie eine Art Gruppe oder Ganzes dar, das aus festen Zeichen und Ideen zusammengesetzt ist. Diese Gruppe muß bestimmten Bedingungen genügen, um existieren zu können – um dem spezifischen Verstehensempfinden zu entsprechen: ich werde diese Bedingungen an dieser Stelle jedoch nicht genauer fassen. Während die Zeichen, die in die Gruppe aufgenommen werden, identisch bleiben, kann die ideale Mengengröße Veränderungen unterworfen sein, sie kann durch eine andere ersetzt werden, die gleicherweise den Existenzbedingungen des Gesamten genügt. Die Gruppe kann im allgemeinen mehr als eine psychologische Lösung erhalten. Diese Diversität macht es möglich, daß man widersprüchlich reden, falsche Syllogismen bilden kann – wie auch korrekt abgeleitete, doch absurde Schlußfolgerungen. Sie erklärt die logische Unvollkommenheit, die Inkonsistenz und formalen Fehler, wie man sie in Schriften, in den scharfsinnigsten Werken des philosophischen Denkens und geradezu regelmäßig beim Dichter findet. Nebenher würde ich behaupten, daß es keine allzu großen internen Unterschiede zwischen dem Wort, der festen Fügung und dem Satz gibt. Worte lassen sich meistens weiterentwickeln. Das Hauptproblem der Logik besteht darin, eine gewisse Entwicklung eines Wortes als konstant festzuhalten: etwa durch Definition. Aber in Wirklichkeit ist das Individuum alles, die Zeit läßt es dahin kommen, sich unterschiedlichster Definitionen ein und desselben Worts zu bedienen: wie das geschieht, kann man sich leicht vorstellen: die sprachlichen Zeichen sind von ihren Bedeutungen absolut unabhängig, kein rationaler oder empirischer Weg vermag vom Zeichen zur Bedeutung zu führen.6 Deshalb erscheint der Mensch sich selbst ja auch niemals inkohärent im Augenblick seines Denkens; seine Sprache ist Teil seiner selbst, er ist einfach gezwungen, sich zu verstehen.
Die Forschungen Bréals ertragen diese Verallgemeinerung durchaus, regen sie geradezu an. Sie lenken die Untersuchung auf alle weiteren vielfältigen symbolischen Systeme. Die Algebra, die musikalische Komposition, bestimmte Arten der Ornamentik, die Kryptographie usw. können alle semantisch analysiert werden. Von seiten der Bedeutungen betrachtet, müssen diese Systeme wie auch die Sprache meiner Meinung nach zu einer grundlegenden Differenzierung unter den Modi führen, nach denen mentale Zustände verbunden werden. Wenn wir zwei solcher verbundenen Zustände a und b nennen, so gilt, daß, wenn a gegeben, auch b gegeben ist. In bestimmten Fällen wird man nun eine andere Beziehung als die der Abfolge zwischen a und b finden können. In diesen Fällen wird sich b mit Hilfe von a konstruieren lassen und umgekehrt. Im allgemeinen folgt daraus, daß jede Veränderung des einen Terms eine Veränderung im anderen nach sich zieht. In anderen Fällen jedoch kann es geschehen, daß zwischen den beiden angenommenen Termen nur eine reine Abfolgebeziehung besteht. Dann wird man sagen können, diese Verbindung sei symbolisch oder konventionell. Die Sprache besteht aus Beziehungen dieser letzteren Art. Aufgabe der Theorie wird es sein zu erforschen, was aus diesen Symbolen wird, wenn sie der Wiederholung, dem Gebrauch unterworfen werden, wenn sie mit Gruppierungen der ersteren Art vermischt werden, wenn sie der Willkür des Individuums ausgesetzt sind und von diesem zu den äußersten Grenzen ihres Werts gedrängt werden ... Aber der Leser wird mich unverständlich finden, ich werde ein anderes Mal versuchen, klarer, vollständiger, ausführlicher zu sein, vor seinen Augen explizit die Abstraktionen bilden, deren ich mich bediene, und die grundlegenden sprachlichen Hypothesen festzulegen versuchen.
Betrachten wir noch etwas anderes – einen Text. Das typographische Bild und die erste allgemeine Bedeutung der Sätze fallen uns direkt zu. Lassen wir danach hunderttausend Gedanken vorbeiziehen. Geben wir sie auf, zerstören wir sogar diese ganze komplexe Bedeutung. Jedes einzelne Wort scheint sich von seiner Gestalt zu lösen, Freiheit zu gewinnen, sich zu öffnen, für sich allein zum Eintritt des ganzen Geistes zu werden. Jede Seite erscheint nacheinander als ein unendlich verknüpftes System, ein unberechenbares Netz. Stellen wir uns eine beliebige Anordnung von Wörtern vor: erkennen wir ihre grammatikalischen Unterschiede im einzelnen, das heißt ihr Gesetz der Zahl, der Existenz in der Dauer, ihre psychologischen Eigenarten. Stellen wir uns vor, wir gingen mit Akribie einen Vers entlang, in dem wir all diese Unterschiede aufgrund verstärkter Anstrengung wahrnehmen, folgten den Konturen wie ein Insekt auf einem großen Blatt ... Das ist eine Reise, die man auch noch auf andere Weise wieder machen kann. Rufen wir uns das Wissen der Geschichte, der Sprachwissenschaft, der Etymologie ins Gedächtnis. Wenngleich diese Kenntnisse nicht die allersichersten sind, so nehmen sie doch zumindest den Platz von echten Kenntnissen ein. Kommen wir erneut auf unseren Text zurück, dessen Topographie sich verändert hat. Die Wörter werden nun mit ihrer historischen Schicht in Verbindung gebracht. Die festen Fügungen werden natürlich, jedoch seltsam fremd an diesem Ort erscheinen. Man wird den Eindruck eines Standbilds haben, dessen Glieder antik, dessen Gestalt barbarisch ist; oder vielleicht den Eindruck eines Bettlers, der mit von Prosa zerfressenen Zeitungen bekleidet ist und sie sich zu einem Hemd des Notbehelfs zusammengeklebt hat.
Man wird wohl lächeln, soviel aufzuwirbeln, nur um die kleinste Zeile zu schreiben. Das unerbittliche Bewußtsein gibt jedoch dieser kleinsten Zeile die Größe von Wagram8, den Anspruch einer Theorie vom Mond; und ohne sich dessen bewußt zu sein, entwirft man Millionen solcher Zeilen! Wovon der Schriftsteller keine Ahnung hat. Ich erinnere mich dennoch an lange Gespräche mit Marcel Schwob9: nichts war amüsanter als meine Überraschungen – sofern nicht überhaupt der Dialog dieser beiden Charaktere-, wenn er einen Faden aus irgendeinem Wort oder einer Redewendung spann und sie fernab, am Teufel, an einem bestimmten Örtchen zu einem bestimmten Zeitpunkt festmachte, entsprechend den delikatesten Wahrscheinlichkeiten, die man sich vorstellen kann. Oft entzückte mich ein schlagender Beweis. Der Argot von Gaunern, so wie er ihn in der Ecke des Kamins gewählt anzubringen verstand, erfüllte mich mit kindlichem Vergnügen, mit literarischem Genuß, mit höchstem Glück, wie es eine perfekte Analyse zu vermitteln vermag. Eine einmalige Gelegenheit: ich konnte ihn noch so sehr mit Fragen bedrängen, er blieb keine Antwort schuldig.
VORWORT ZUR ›ERKENNTNIS DER GÖTTIN‹
Seit einigen vierzig Jahren ist der Geist um einen Zweifel ärmer. Eine endgültige Beweisführung hat das uralte Bemühen um die Quadratur des Kreises ins Reich der Träume verwiesen. Glücklich die Mathematiker, die von Zeit zu Zeit einen solchen Nebelfleck aus ihrem System tilgen; weniger glücklich jedoch sind die Dichter; sie haben noch immer keinen sicheren Beweis für die Unmöglichkeit, jeden Gedanken in das Quadrat einer poetischen Form zu erheben.
Die Verfahren, die uns den Wunsch erfüllen, eine harmonische und unvergeßliche Sprachfigur zu bauen, sind sehr geheim und sehr verwickelt; darum ist es noch gestattet – und wird es immer gestattet sein –, zu fragen, ob die philosophische Spekulation, die Geschichte, die Wissenschaft, die Politik, die Moral, die Apologetik (ganz allgemein gesprochen, alle Themen der Prosa) nicht die musikalische und persönliche Gestalt eines Gedichtes annehmen können. Das wäre nur eine Frage des Talents: es gibt kein absolutes Verbot. Die Anekdote und ihre moralische Pointe, die Schilderung und die Verallgemeinerung, der Unterricht, der Streit der Meinungen: ich sehe keine intellektuelle Materie, die nicht im Laufe der Jahrhunderte in Rhythmen gezwungen und durch die Kunst wunderlichen – göttlichen Ansprüchen unterworfen worden wäre.
Weder der eigentliche Zweck der Poesie noch die Methoden, ihn zu erreichen, sind geklärt; denn die Wissenden schweigen, und die Ignoranten schreiben Dissertationen. Deshalb bleibt jede Klarheit in diesen Problemen individueller Art, die größte Gegensätzlichkeit der Ansichten ist erlaubt, und für jede gibt es berühmte Beispiele und schwer zu bestreitende Erfahrungen.
Dank dieser Ungewißheit ist das Produzieren von Gedichten über die verschiedensten Themen bis in unsere Tage fortgesetzt worden. Ja, gerade die größten Versdichtungen, die bewunderungswürdigsten vielleicht, die uns überliefert sind, gehören zu den didaktischen oder historisierenden Gattungen. Das De natura rerum, die Georgica, die Aeneis, die Divina Commedia, die Légende des Siècles1... entleihen einen Teil ihrer Substanz und ihrer Anziehungskraft Stoffen, die die gleichgültigste Prosa hätte aufnehmen können. Man kann sie übersetzen, ohne sie gänzlich belanglos werden zu lassen. Es war also vorauszusehen, daß eines Tages die breitangelegten Systeme dieser Art einer Differenzierung nachgeben würden. Man kann sie auf mehrere voneinander unabhängige Arten lesen oder sie in verschiedene Momente unserer Aufmerksamkeit zerlegen; und diese Vielfältigkeit der Lektüre mußte schließlich zu einer Art Arbeitsteilung führen. (So hat auch die Betrachtung eines beliebigen Körpers im Laufe der Zeit die Vielzahl der Wissenschaften erforderlich gemacht.)
Um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts zeigt sich in unserer Literatur ein beachtlicher Wille, die Poesie definitiv von allem, was nicht zu ihrem Wesen gehört, abzusondern. Ein solches Herauspräparieren der Poesie in ihrer Reinheit war mit der größten Bestimmtheit von Edgar Allan Poe vorausgesagt und empfohlen worden. Deshalb ist es nicht erstaunlich, daß dieser Versuch einer nur noch mit sich selbst beschäftigten Vervollkommnung bei Baudelaire begann.2
Ebenfalls Baudelaire ist eine andere Initiative zuzuschreiben. Als erster von unseren Dichtern erliegt er dem Eindruck der Musik, ruft sie zu Hilfe, holt sich bei ihr Rat. Mit Berlioz und Wagner hatte die romantische Musik die Wirkungen der Literatur erstrebt.3 Sie hat sie in triumphaler Art erreicht; was leicht zu begreifen ist. Lassen sich doch die Wucht, ja geradezu Raserei, die auf die Spitze getriebene Tiefgründigkeit, Verzweiflung, Pracht oder Lauterkeit, die zum Geschmack jener Zeit gehörten, kaum in das Medium der Sprache übertragen, ohne eine Menge unverdaulicher Albernheiten und Lächerlichkeiten nach sich zu ziehen; diese Elemente des Scheiterns sind bei den Musikern weniger auffällig als bei den Dichtern. Vielleicht kommt das daher, daß die Musik eine Lebensintensität hat, die sie uns körperlich zwingend aufnötigt, während die Werke der Wortkunst uns ganz im Gegenteil dazu auffordern, ihnen die unsere zu leihen ...
Wie dem auch sei, es kam für die Poesie eine Epoche, wo sie sich gegenüber den Energien und Kraftvorräten des Orchesters erbleichen und hinschwinden fühlte. Das üppigste, das klangreichste Gedicht von Hugo ist sehr weit davon entfernt, seinem Zuhörer jene extremen Illusionen, jene Schauer, jene Entrückungen zu vermitteln; und darüber hinaus, auf dem quasi intellektuellen Gebiet, diese vorgetäuschten Klarheiten, diese Formen des Denkens, diese Gleichnisse einer seltsamen realisierten Mathematik, die von einer Symphonie entbunden, umrissen oder ausgestrahlt werden und die sie bis zum völligen Schweigen verbraucht, in einem Augenblick vernichtet, in der Seele den außerordentlichen Eindruck von der Allmacht und der Täuschung hinterlassend ... Die Zuversicht der Dichter zu ihrem besonderen Genius, die Ewigkeitsverheißungen, die sie seit der Frühe der Zeiten und der Sprache empfingen, ihre unvordenkliche Macht über die Lyra und jener erste Rang, den sie so gern in der Hierarchie der Diener des Alls beanspruchen möchten, alles das war anscheinend noch niemals einer so eindeutigen Bedrohung ausgesetzt. Erschüttert kamen sie aus den Konzerten. Erschüttert – und geblendet; so als hätte eine grausame Gnade sie nur deshalb in solche Höhen emporgehoben, damit sie eine leuchtende Betrachtung all der ihnen versagten Möglichkeiten und unnachahmbaren Wunder erleben sollten. Je heftiger und unbestreitbarer sie diese herrischen Wonnen erfuhren, um so gegenwärtiger und verzweifelter waren die Leiden ihres Stolzes.
Der Stolz war ihr Ratgeber. Bei Geistesmenschen ist er eine Lebensnotwendigkeit.
Jedem blies er also seiner Natur gemäß den Atem des Kampfes ein – seltsamer geistiger Kampf. Alle Mittel der Verskunst, alle bekannten Kunstgriffe der Rhetorik und der Prosodie wurden in Erinnerung gerufen; und manche ganz neue Dinge wurden beschworen, sich vor dem überreizten Bewußtsein zu produzieren.
Das war es, was man auf den Namen Symbolismus4 taufte: ganz einfach eine Intention, die mehreren (übrigens miteinander verfeindeten) Dichtersippen gemeinsam war, »der Musik ihren Vorteil wieder abzujagen«.5 Nichts anderes ist das Geheimnis dieser Bewegung. Die ihr so oft vorgeworfenen Dunkelheiten und Seltsamkeiten; der Anschein allzu enger Beziehung mit der englischen, slawischen oder germanischen Literatur; die Unordnung des Satzbaus, die unregelmäßigen Rhythmen, die Merkwürdigkeiten des Wortschatzes, die beständig gehäuften Bilder ..., alles das läßt sich leicht ableiten, sobald das Grundprinzip bekannt ist. Umsonst haben sich die Beobachter dieser Experimente, ja sogar jene, die sie praktizieren, an das ärmliche Wort Symbol geklammert. Es enthält, was man hineinlegt; wer seine eigene Hoffnung daran heftet, wird sie dort wiederfinden! – Wir aber waren mit Musik gespeist, und unsere Literatenköpfe träumten von nichts anderem, als der Sprache fast die gleichen Wirkungen abzugewinnen, die die reinen Klänge auf unsere Nerven ausübten. Die einen verehrten Wagner, die andern Schumann. Ich könnte auch sagen, sie haßten sie. Die Temperatur des leidenschaftlichen Interesses läßt diese beiden Gemütszustände ununterscheidbar werden.
Ein Abriß der Versuche dieser Zeit würde eine systematische Arbeit erfordern. Selten sind so viel Inbrunst, so viel Kühnheit, so viel theoretische Forschungen, so viel Wissen und Kunst, so viel andächtige Achtsamkeit, so viel Diskussionen in so wenigen Jahren dem Problem der reinen Schönheit gewidmet worden. Man kann sagen, es wurde von allen Seiten gleichzeitig angegangen. Die Sprache ist ein komplexes Ding; ihre vielspältige Natur gestattete den Suchenden die Verschiedenheit der Versuche. Manche bewahrten zwar die traditionellen Formen des französischen Verses, bemühten sich aber, die Schilderungen, die Sentenzen, die Moraltendenzen, die beliebigen Verdeutlichungen auszumerzen; sie reinigten ihre Poesie von fast allen den intellektuellen Elementen, die die Musik nicht ausdrücken kann. Andere verliehen allen Dingen unendliche Bedeutungen, die eine verborgene Metaphysik vermuten ließen. Sie verwendeten ein köstlich vieldeutiges Material. Sie bevölkerten ihre verzauberten Parks und verdämmernden Haine mit einer völlig idealen Fauna. Alles war Anspielung; nichts beschränkte sich darauf, zu sein; in diesen spiegelgeschmückten Reichen hatte jedes Ding seine Gedanken; oder schien sie wenigstens zu haben ... Darüber hinaus vergriffen sich einige kühnere und konsequenter denkende Magier an der altehrwürdigen Prosodie. Es gab solche, für die der farbige Klang und die Kombinationskunst der Alliterationen keine Geheimnisse mehr zu haben schienen; mit Vorbedacht übertrugen sie die Klangfarben des Orchesters in ihre Verse: und sie täuschten sich nicht immer. Andere erneuerten mit großem Kunstverstand die Naivität und die spontane Anmut der Volksdichtung. Bei den ewigen Diskussionen dieser rigorosen Liebhaber der Muse berief man sich auf Philologie und Phonetik.
Es war eine Zeit der Theorien, der abseitigen Interessen, der leidenschaftlichen Glossen und Erläuterungen. Eine ziemlich strenge Jugend verwarf das wissenschaftliche Dogma, das bereits aus der Mode zu kommen begann, ohne sich jedoch dem religiösen Dogma zuzuwenden, das noch nicht wieder in Mode war; sie glaubte in dem tiefen und gewissenhaften Kult der Gesamtheit der Künste eine Disziplin, und vielleicht sogar eine Wahrheit, ohne Vorbehalte zu finden. Sehr wenig hätte gefehlt, und eine Art Religion wäre gestiftet worden ... Doch die Werke aus jenen Zeiten sprechen diese Bestrebungen nicht in positiver Weise aus. Ganz im Gegenteil muß man gerade das mit Sorgfalt beobachten, was sie verbieten und was innerhalb dieser Zeitspanne, von der ich spreche, aus den Gedichten verschwand. Es scheint, das abstrakte Denken, das bisher im Vers zugelassen war, hatte die Möglichkeit verloren, sich mit den unmittelbaren Erregungen zu verbinden, die in jedem Augenblick hervorgerufen werden sollten; es wurde aus einer Poesie verbannt, die sich auf ihre eigentliche Essenz beschränken wollte. Erschreckt von den mannigfaltigen Überraschungseffekten und musikalischen Reizen, die der moderne Geschmack verlangte, scheint es in die Phase der Vorbereitung und in die Theorie des Gedichtes verlegt worden zu sein. Die Philosophie und sogar die Moral zeigten die Tendenz, sich aus den Werken zurückzuziehen und ihren Ort nur noch in den vorhergehenden Überlegungen zu suchen. Dies war ein echter Fortschritt. Wenn man aus der Philosophie alles Ungefähre und alles Widerlegte herausnimmt, läßt sie sich jetzt auf fünf oder sechs Probleme zurückführen, die scheinbar eindeutig, in Wirklichkeit aber unbestimmt sind, sich nach Belieben leugnen und immer auf sprachliche Streitfragen reduzieren lassen, Probleme, deren Lösung von der Art abhängt, wie man sie schreibt. Doch das Interesse, das diese merkwürdigen Arbeiten zu bieten haben, ist nicht so geschrumpft, wie man meinen könnte; es liegt eben gerade in dieser Zerbrechlichkeit und in diesen Streitfragen, das heißt in der Empfindlichkeit des immer subtileren logischen und psychologischen Apparates, dessen Anwendung sie verlangen; es liegt nicht mehr in den Schlußfolgerungen. Philosophieren heißt also heute nicht mehr, irgendwelche noch so bewundernswerten Betrachtungen über die Natur und ihren Urheber von sich geben, oder über das Leben, über den Tod, über die Zeit, über die Gerechtigkeit ... Unsere Philosophie wird nicht durch ihren Gegenstand, sondern durch ihren Apparat definiert. Sie ist nicht mehr trennbar von ihren eigentümlichen Schwierigkeiten, die ihre Form ausmachen; und sie könnte die Form des Verses nicht annehmen, ohne ihr Wesen aufzugeben und ohne den Vers zu zerstören. Heute von philosophischer Dichtung sprechen (etwa unter Berufung auf Alfred de Vigny, Leconte de Lisle6 und einige andere) heißt miteinander unvereinbare Bedingungen und Anwendungen des Geistes naiv durcheinanderbringen. Es heißt vergessen, daß das Ziel dessen, der spekuliert, darin besteht, einen Begriff zu fixieren oder zu schaffen – also ein Können oder das Werkzeug eines Könnens, während der moderne Dichter versucht, in uns eine Stimmung zu erzeugen und diese außergewöhnliche Stimmung bis zur Höhe eines vollkommenen Genusses zu steigern ...
So erscheint mir, als Ganzes gesehen, aus dem Abstand eines Vierteljahrhunderts und von dem heutigen Tage durch einen Abgrund von Ereignissen getrennt, das große Programm der Symbolisten. Ich weiß nicht, was die Zukunft von ihren vielgestaltigen Bemühungen bewahren wird, die Zukunft, die ja keineswegs notwendigerweise ein gescheiter und gerechter Richter ist. Solche Bestrebungen gehen nicht ohne Kühnheiten ab, nicht ohne Wagnisse, nicht ohne übertriebene Grausamkeit, nicht ohne Kindereien ... Die Tradition, die Verständlichkeit, das seelische Gleichgewicht fallen ja im allgemeinen den Bewegungen des Geistes, wenn er seinem Ziel nachstrebt, zum Opfer; auch unter unserer Hingabe an die reinste Schönheit haben sie manchmal gelitten. Manchmal waren wir dunkel; und machmal unreif. Unsere Sprache war nicht immer des Lobes und des Bestandes so wert, wie wir es in unserem Ehrgeiz gewünscht hätten; und unsere zahllosen Behauptungen bevölkern traurig die milde Unterwelt unserer Erinnerung ... Das mag noch hingehen für die Werke, mag noch hingehen für die Meinungen und die technischen Vorlieben! Aber unsere Idee selbst, und unser höchstes Gut, bedeuten sie heute nichts weiter als bleiche Schattenelemente der Vergessenheit? Muß man so weit versinken? Wieso versinken, Kameraden? – Was hat denn unsere Gewißheiten auf so heimtückische Art zernagt, unseren Mut in die Winde gestreut? Hat man die Entdeckung gemacht, daß Licht altern kann? Und wie ist es möglich (dies ist das eigentliche Geheimnis!), daß jene, die nach uns kamen und die schließlich auch selbst wieder abtreten werden, durch eine ganz ähnliche Wandlung überspielt und ausgeschaltet, wie ist es möglich, daß sie andere Sehnsüchte gehabt haben als wir, und andere Götter? Es schien uns doch so eindeutig, daß unser Ideal ohne Fehl sei! War es denn nicht aus der gesamten Erfahrung der früheren Literaturepochen abgeleitet? War es denn nicht die höchste, wundervoll spät gezüchtete Blume der ganzen Tiefe der Kultur?
Zwei Erklärungen dieses Scheiterns bieten sich an. Zunächst läßt sich denken, daß wir ganz einfach einer geistigen Illusion zum Opfer gefallen sind. Nachdem sie sich aufgelöst hat, bliebe uns nur noch das Gedächtnis an widersinnige Handlungen und an eine unerklärliche Leidenschaft ... Aber ein Verlangen kann nicht illusorisch sein. Nichts ist so im eigentlichen Sinne wirklich wie ein Verlangen in seinem Wesen als Verlangen: ähnlich wie der Gott des heiligen Anselmus7, ist seine Idee von seiner Wirklichkeit untrennbar. Man muß also weitersuchen und für unser Scheitern eine tiefer verborgene Begründung finden. Man muß ganz im Gegenteil den Fall setzen, daß unser Weg wirklich der einzig mögliche war; daß wir in unserem Verlangen an das eigentliche Wesen unserer Kunst rührten und daß wir die Gesamtbedeutung der Arbeiten unserer Vorgänger wirklich entziffert hatten, das Kostbarste aus ihren Werken herausgelöst, unsere eigene Bahn mit diesen Wegzeichen abgesteckt, diese einzigartige Fährte verfolgt hatten, geleitet von Palmen und Süßwasserquellen: am Horizont immer der Stern der reinen Poesie ... Da liegt die Gefahr. Genau dort unser Untergang. Und ebendort das Endziel.
Denn eine derartige Wahrheit ist ein Grenzwert der Welt. Es ist nicht erlaubt, sich darin einzurichten. Mit den Bedingungen des Lebens verträgt sich nichts, was so rein ist. Wir durchqueren nur die Idee der Vollkommenheit, wie die Hand ungestraft durch die Flamme streift. Aber die Flamme ist unbewohnbar, und die Behausungen der höchsten Glückseligkeit stehen notwendigerweise leer. Ich meine, unser Streben nach der äußersten Strenge der Kunst – nach einer Folgerung aus den Voraussetzungen, die uns frühere gelungene Werke boten –, nach einer Schönheit, die ihrer Entstehungsgeschichte immer tiefer bewußt wäre, die von allen Inhalten immer unabhängiger, von vulgären Gefühlsreizen ebenso wie von groben Effekten der Beredsamkeit immer freier geworden wäre – all dieser allzu aufgeklärte Eifer führte vielleicht zu einem beinahe unmenschlichen Zustand. Das ist eine allgemein feststellbare Tatsache: die Metaphysik, die Moral, ja sogar die Wissenschaften haben es bezeugt.
Die absolute Poesie kann nur durch außergewöhnliche Wunder sich vollziehen. Die Werke, die sie vollständig komponiert, bilden in den unwägbaren Schätzen einer Literatur das, was sich an Erlesenstem und Unwahrscheinlichstem denken läßt. Aber wie das vollkommene Vakuum und wie der tiefste Temperaturstand nicht erreicht, nur um den Preis ungeheuer vermehrter Leistungen angestrebt werden können, so verlangt die letzte Reinheit unserer Kunst so lange und harte Selbstüberwindungen, daß diese fast die ganze natürliche Freude, Dichter zu sein, aufzehren und am Ende nur den Stolz übriglassen, niemals befriedigt zu sein. Den meisten jungen Leuten, die mit dem dichterischen Instinkt begabt sind, ist diese Strenge unerträglich. Unsere Nachfolger begehrten unsere Martern nicht; sie haben sich unsere Empfindlichkeiten nicht zu eigen gemacht; manchmal haben sie für Freiheiten gehalten, was wir als neue Schwierigkeiten erproben wollten; und manchmal haben sie zerrissen, was wir nur sezieren wollten. Auch haben sie wieder die Akzidenzien des Daseins ins Auge gefaßt, für die wir uns blind gemacht hatten, um seiner Substanz ähnlicher zu werden ... Alles dieses war vorauszusehen. Aber auch die weitere Folge war nicht weniger unmöglich zu erraten. Mußte man nicht eines Tages versuchen, unsere frühere Vergangenheit mit der später folgenden Vergangenheit zu verbinden und beiden diejenigen Teile ihrer Lehren zu entnehmen, die miteinander vereinbar sind? Hier und da sehe ich diesen natürlichen Prozeß in einigen Geistern sich vollziehen. Das Leben hat keine andere Form des Ablaufs; und die gleiche Entwicklung, die sich in der Aufeinanderfolge der Lebewesen beobachten läßt, wo Kontinuität und Atavismus kombiniert sind, kehrt auch in den Verkettungen des literarischen Lebens wieder ...
So sprach ich eines Tages zu Herrn Fabre8, als er zu mir gekommen war, um über seine Bestrebungen und seine Verse zu reden. Ich weiß nicht, welcher Geist des Leichtsinns und des Irrtums seine kluge und klare Seele bewogen hatte, eine andere zu befragen, die beides nicht allzusehr ist. Wir suchten uns über Poesie zu verständigen, und obgleich dieses Konversationsthema sehr leicht immer wieder ins Unendliche führt, schafften wir es doch, uns nicht zu verlieren. Unseren Gedanken, voneinander verschieden, weil jeder sich in seinen eigenen unüberschreitbaren Grenzen bewegte und umbildete, gelang es nämlich, eine bemerkenswerte Entsprechung aufrechtzuerhalten. Eine gemeinsame Terminologie – die genaueste, die es gibt – erlaubte uns in jedem Augenblick, uns nicht mißzuverstehen. Algebra und Geometrie, nach deren Vorbild die Zukunft ganz gewiß eine Sprache für den Intellekt konstruieren wird, gestatteten uns von Zeit zu Zeit, genaue Signale auszutauschen. Ich entdeckte in meinem Besucher einen jener Geister, für die der meine eine Schwäche hat. Mir gefallen diese Liebhaber der Poesie, die ihre Göttin zu hellsichtig verehren, um ihr ein weichliches Denken und eine erschlaffte Vernunft darbringen zu wollen. Sie wissen sehr wohl, daß sie kein sacrifizio dell’intelletto9 fordert. Weder Minerva noch Pallas, oder Apollon in seiner Lichtfülle, billigen jene schändlichen Verstümmelungen, die manche ihrer verirrten Verehrer dem Organismus des Gedankens zufügen; sie weisen sie mit Abscheu von sich, wenn sie eine Logik blutiger Fetzen heranbringen, die man sich vom Leibe gerissen hat und auf ihren Altären verzehren möchte. Den echten Gottheiten schmecken unvollständige Opfergaben nicht. Zweifellos fordern sie geweihte Speisen; dieser Anspruch ist allen höheren Mächten gemeinsam, denn sie müssen schließlich leben. Aber sie wollen sie im ganzen.
Herr Lucien Fabre weiß das wohl. Nicht umsonst hat er eine ganz besonders dichte und umfassende Bildung erworben. Die Kunst des Ingenieurs, der er nicht den besten, aber vielleicht den größten Teil seiner Zeit widmet, fordert bereits lange Studien und führt den, der sich darin auszeichnet, zu vielseitiger Tätigkeit: man muß Menschen zu lenken verstehen, mit Stoff umgehen können, man muß für die unvorhergesehenen Probleme, in deren Kreise die Technik, die Wirtschaft, die bürgerlichen Gesetze und die Naturgesetze einander widerstreitende Anforderungen bringen, zufriedenstellende Lösungen finden. Diese Überlegungen über komplexe Systeme sind kaum dazu geeignet, allgemeine Formen anzunehmen. Für so besonders gelagerte Fälle gibt es keine Formeln, keine Gleichungen zwischen so heterogenen Voraussetzungen. Nichts läßt sich hier mit Gewißheit herstellen, und sogar das Herumtappen ist hier nur verlorene Zeit, wenn es nicht von einem sehr feinen Spürsinn gelenkt wird. Für einen Beobachter, der durch den äußeren Augenschein hindurchzudringen vermag, lassen sich diese Leistungen, dieses wohlüberlegte Zaudern, diese Erwartung innerhalb des Zwanges, diese Glücksfunde recht wohl mit den inneren Momenten eines Dichters vergleichen. Aber ich fürchte, es gibt wenige Ingenieure, die eine Ahnung davon haben, daß sie den Erfindern von Figuren und den Justierern von Wörtern so nahe stehen ... Nicht viele werden, wie Herr Fabre es getan hat, tiefe Stollen in die Metaphysik des Daseins gebohrt haben. Er hat bei den Philosophen gelernt. Sogar die Theologie ist ihm nicht fremd. Er hat nicht glauben wollen, daß die geistige Welt so jung und so eingeschränkt sei, wie der Laie sich das heute vorstellt. Hat sein positiver Geist vielleicht einfach den geringen Grad von Wahrscheinlichkeit abgeschätzt? Wie kann man glauben, wenn man nicht seltsam leichtgläubig ist, daß die besten Geister sich innerhalb von zehn Jahrhunderten völlig fruchtlos in Spekulationen von eitler Strenge erschöpft haben? Manchmal denke ich (aber schamhaft und im Geheimsten meines Herzens), eine mehr oder weniger ferne Zukunft werde die in unseren Tagen über das Kontinuum, das Transfinitum und einige andere Begriffe Cantors10 getätigten Arbeiten mit der gleichen mitleidigen Miene betrachten, wie wir sie heute für die scholastischen Bücherweisheiten haben ... Aber die Theologie hat gewisse Texte als Grundlage; und Herr Fabre ist nicht vor dem Hebräischen zurückgeschreckt!...
Diese allgemeine Bildung, und doch diese Gewöhnung an Strenge; dieser entschlossene praktische Sinn, und doch diese glanzvoll unnützen Kenntnisse bezeugen in ihrer Gesamtheit einen Willen, der sie anordnet und zuordnet. Es kommt vor, daß er sie der Poesie zuordnet. Der Fall ist recht bemerkenswert; man muß darauf gefaßt sein, daß ein Geist von dieser Vorbildung und Klarheit die ewigen Probleme, über die ich vorhin ein paar Worte gesagt habe, seiner Natur gemäß aufnimmt. Würde er sich auf eine rein technische Intelligenz reduzieren, dann sähe man ihn auf brutale Art Neuerungen erzwingen und in eine uralte Kunst die Energie naiver Erfindungen eindringen lassen. Beispiele dafür sind keineswegs unauffindbar: Papier ist geduldig. Der Wunsch, Staunen zu erregen, ist der natürlichste, am leichtesten begreifliche aller Wünsche; er erlaubt dem geringsten Leser, das höchst einfache Geheimnis vieler überraschender Werke mühelos zu entschlüsseln. Aber auf einer etwas gehobeneren Bewußtseins- und Erkenntnisstufe sieht man deutlich, daß die Sprache nicht so leicht vervollkommnungsfähig ist; man sieht: die Prosodie ist auf sehr viele verschiedene Arten im Laufe der Jahrhunderte angewandt worden; man begreift: all die Achtsamkeit und all die Arbeit, die wir verausgaben können, um den Ergebnissen so vieler allmählich errungener Erfahrungen zu widersprechen, müssen uns notwendigerweise an anderen Stellen fehlen. Das Vergnügen, das Bekannte nicht zu verwenden, muß mit einem unbekannten Preis bezahlt werden. Ein Architekt kann die Statik vernachlässigen oder den Versuch machen, den Formeln für den Widerstand der Materie untreu zu werden. Das heißt, sich über die Wahrscheinlichkeit lustig machen; die Strafe wird in hundert Fällen gegen einen nicht auf sich warten lassen. In der Literatur ist die Strafe weniger schrecklich; sie tritt auch sehr viel weniger rasch ein; jedoch läßt die Zeit es sich angelegen sein, ziemlich schnell auf das Vergessen der einfachsten Regeln der angewandten Psychologie mit dem Vergessen eines Werkes zu antworten. Es liegt also in unserem eigensten Interesse, unsere Kühnheit und unsere Bedächtigkeit so korrekt zu kalkulieren, wie wir können.
Herr Fabre, der kluge Rechner, hat mit dem Poeten Lucien Fabre immer Fühlung behalten. Und da dieser letztere sich vorgenommen hatte, etwas zu machen, was zum Schwierigsten und Beneidenswertesten in unserer Kunst gehört – ich meine ein System von Gedichten, das ein geistiges Drama bildet, und zwar ein vollendetes Drama, das zwischen den verschiedenen Mächten unseres eigenen Wesens spielt–, fanden die Präzisionen und die Ansprüche des ersteren eine natürliche Verwendung in dieser Konstruktion. Der Leser mag sich selbst ein Urteil bilden über diesen merkwürdig kühnen geistigen Kraftaufwand, der darin besteht, unmittelbar ins Werk gesetzten Wesenheiten Leben und leidenschaftlichste Bewegung zu geben. Eros, der sehr schöne und gewalttätige Eros11, ist der eigentliche Hauptheld dieser Gedichte: aber ein Eros, der heimlich irgendeiner Vernunft untertan ist, die seine Raserei auslöst und sie auch wieder zu binden weiß. Ich leugne nicht, daß diese Vernunft manchmal ein wenig zu deutlich in der Sprache durchblickt. Ich habe mich bemüßigt gefühlt, Herrn Fabre gegenüber den Gebrauch einiger Wörter anzufechten, die mir in die dichterische Sprache zu schwer einzugehen scheinen. Damit habe ich einen recht hinfälligen Vorwurf erhoben, denn diese Sprache wandelt sich wie die andere; und die geometrischen Ausdrücke, die hier und da meine Widerstände auf den Plan riefen, werden mit der Zeit vielleicht, wie es mit so vielen anderen technischen Vokabeln geschehen ist, in das abstrakte und homogene Metall der Sprache der Götter eingeschmolzen werden.
Doch jedes Urteil über ein Kunstwerk muß vor allem die Schwierigkeiten berücksichtigen, die der Autor sich auferlegt hat. Man darf sagen, die Aufstellung dieser freiwilligen Hindernisse, soweit sie sich rückblickend erschließen lassen, enthüllt sofort den geistigen Rang des Dichters, den Eigenwert seines Stolzes, die Empfindlichkeit und die gebieterische Unbedingtheit seiner Natur. Herr Fabre hat sich edle und rigorose Bedingungen auferlegt; so kraftvoll seine Erregungen auch in seinen Versen zum Ausdruck kämen, sollten sie doch einander in dichter Folge zugeordnet und der unsichtbaren Herrschaft der Erkenntnis unterworfen sein. Stellenweise mag es vorkommen, daß diese zwielichtige und seherische Königin einige Überfälle und einige Einbußen in ihrem Machtbereich erleidet – denn, wie der Autor so prachtvoll sagt:
L’ardente chair ronge sans cesse
Les durs serments qu’elle a jurés. 12
[Das glühende Fleisch zernagt unablässig
Die harten Gelübde, die es schwor.]
Doch welcher Dichter könnte sich darüber beklagen?
ANSPRACHE IM PEN-CLUB
Lediglich ein Gast steht hier vor Ihnen ... Vor einigen Tagen wußte ich nicht, daß es einen PEN-CLUB überhaupt gibt. Ich möchte also ganz einfach meine Bewunderung über diese prachtvolle Vereinigung ausdrücken, in der ich Männer wie Galsworthy, Pirandello, Unamuno, Kuprin1 und so viele Schriftsteller aus aller Herren Länder sehe, inmitten so vieler Schriftsteller unseres eigenen Landes.