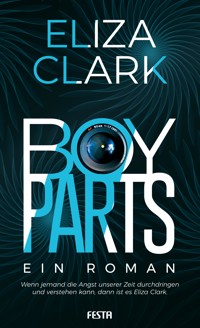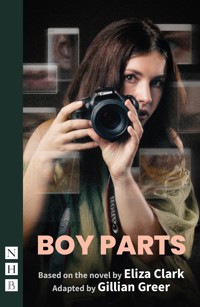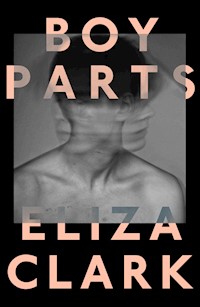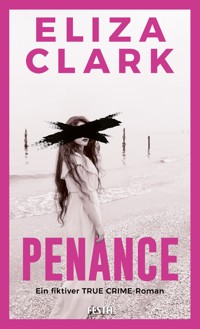
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Hast du den Podcast gehört? Wie sie über sie gelacht haben? Hast du die Fotos ihrer Leiche gesehen? Hast du im Netz danach gesucht? Der grausame Mord ist fast zehn Jahre her: In einer heruntergekommenen Stadt an der Küste von Yorkshire wurde die 16-jährige Joan Wilson am Strand von drei anderen Schulmädchen lebendig verbrannt. Und nun werden die Ereignisse jener schrecklichen Nacht zum ersten Mal veröffentlicht. Lies den Bericht des Journalisten Alec Z. Carelli über das Verbrechen und was dazu führte. Lies alle Interviews mit Zeugen und Familienmitgliedern und dazu die erschütternde Korrespondenz mit den Mörderinnen. Aber wie viel von dieser Geschichte ist wahr? Eliza Clark stellt beunruhigende Fragen über die modernen Medien und zerrt unsere dunkelsten Neigungen ans Licht. Diese unwahre True-Crime-Geschichte verwebt echte und erfundene Morde zu einer bösen Satire auf das True-Crime-Genre und seine Fans. Eine wirkliche Meisterleistung der Erzählkunst. Von der Autorin des Bestsellers BOY PARTS. MSLEXIA: »Wenn jemand die Angst unserer Zeit durchdringen und verstehen kann, dann ist es Eliza Clark.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 554
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Aus dem Englischen von Simona Turini
Impressum
Die englische Originalausgabe Penance
erschien 2023 im Verlag Faber & Faber.
Copyright © 2023 by Eliza Clark
Copyright © dieser Ausgabe 2025 by
Festa Verlag GmbH
Justus-von-Liebig-Straße 10
04451 Borsdorf
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung:
Lektorat: Elena Helfrecht
Titelbild: Pixabay / nahidhatamiz
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-98676-241-4
www.Festa-Verlag.de
Für George,
auf ewig und überall.
Aber meistens waren es Lügen, die ich erzählte; es war nicht meine Schuld, ich konnte mich nicht erinnern, denn es war, als wäre ich in einem dieser Spukschlösser gewesen, die in Legenden besucht werden: Ist man erst fort, erinnert man sich nicht mehr. Alles, was bleibt, ist das gespenstische Echo tiefgreifenden Staunens.
TRUMAN CAPOTE
Beim vorliegenden Buch handelt es sich um eine Untersuchung des Mordes an der Jugendlichen Joan Wilson, den 2016 drei Mädchen derselben High School begingen. Es wurde vom Journalisten Alec Z. Carelli verfasst und erschien erstmals im März 2022.
Kurz nach der Veröffentlichung beschuldigten einige von Carellis Interviewpartnern ihn öffentlich der Falschdarstellung und sogar Fälschung von Teilen ihrer Interviews.
In der Folge wurde aufgedeckt, dass Carelli sich auf illegale Weise die in der Haft entstandenen therapeutischen Texte zweier der drei Beschuldigten beschafft hatte.
Im September 2022 wurde das Buch vom Verlag zurückgezogen.
Nach Beilegung des Rechtsstreits wurden für diese Neuveröffentlichung auf Antrag der Betroffenen mehrere Namen geändert.
Wir sind der Meinung, dass Schriftsteller (auch Non-Fiction-Autoren) das Recht haben, sich frei auszudrücken und ihre Geschichten so zu erzählen, wie sie es angemessen finden.
Weiterhin sind wir davon überzeugt, dass das Publikum die Freiheit und das Recht hat, einen Text für sich selbst zu lesen und zu beurteilen – und dass umstrittene Werke mit künstlerischem Wert nicht einfach deshalb aus der Geschichte entfernt werden sollten, weil sie Anstoß erregen. Trotz der Kontroversen um dieses Buch haben wir beschlossen, es in seiner ursprünglichen Form zu veröffentlichen.
Auszug:I Peed on Your Grave,Episode 341, 01.07.2018
Moderatoren: Steven Doyle, Andrew Koontz, Lloyd Alan
00:00:31 – 00:02:46
DOYLE: Hallo und willkommen bei I Peed on Your Grave, dem True-Crime-Podcast. Ich bin Steve Doyle, und wie immer sind bei mir …
KOONTZ: Ich, der große Andy Koontz.
ALAN: Und ich, Lloyd Alan.
DOYLE: Und heute machen wir einen Ausflug ins gute alte England.
KOONTZ: Oh! [mit Cockney-Akzent] Einen kleinen Ausflug nach England also?
ALAN: Himmel, bitte keine Akzente.
KOONTZ: [mit Cockney-Akzent] Was für ein Akzent denn, Mister? Ich bin doch nur ein lesbisches Schulmädchen.
DOYLE: [lachend] Andy, hör auf.
KOONTZ: [mit Cockney-Akzent] Ich bin ein lesbisches Schulmädchen und hab kein Höschen an.
DOYLE: [lachend] Andy, Mann.
KOONTZ: [mit Cockney-Akzent] Gefällt Ihnen mein Akzent nicht, Mister? Das letzte Mädel, das mich geärgert hat, hab ich abgefackelt, Mister.
ALAN: O Mann, ist das ein Spoiler?
DOYLE: Nein, glücklicherweise will ich genau damit anfangen.
KOONTZ: [mit Cockney-Akzent] Wie gut, dass Sie mich nicht bestrafen müssen, weil ich die Folge versaut hab, Mister …
ALAN: Okay, Mann, die Mädels waren vielleicht 14.
DOYLE: Eigentlich eher 16.
KOONTZ: Aber in England ist das doch okay, oder? Da kann ich so verschroben und geil sein, wie ich will.
DOYLE: [lachend] Schätze, schon.
KOONTZ: [mit Cockney-Akzent] Mein Höschen bleibt aus, Mister … [jetzt ohne Akzent] Ich hör auf. Die meisten dieser Mädels sind nicht mal heiß.
DOYLE: Nein, eher verdammt abstoßend.
KOONTZ: Bis auf diese Doris.
ALAN: Doris?
DOYLE: Doris? Doris? Was glaubst du, welches Jahr sie in England haben, Mann?
KOONTZ: [mit Cockney-Akzent] 1843, Mister! [lachend, wieder ohne Akzent] Egal, Dolly, Doris, die ist auf jeden Fall echt heiß.
ALAN: Aber älter, oder?
KOONTZ: Wie würdest du’s finden, wenn ich sag ›Nee, Mann, sie ist die Jüngste‹?
ALAN: Ist sie das?
DOYLE: Nein, aber die Heißeste.
[alle lachen]
KOONTZ: Die heißesten Mädels sind immer irre. Ich behaupte nicht, dass alle heißen Mädels verrückt sind, denn in diesem Podcast respektieren wir heiße Mädels. Aber ich behaupte, dass die heißesten Mädels irre sind.
DOYLE: Ihre Verrücktheit macht sie normalerweise besonders heiß. Wir respektieren auch verrückte Mädels.
KOONTZ: Ja, die sind echt auf einem anderen Level. Das ist nicht sexistisch – ich liebe durchgeknallte, heiße Mädels. Die heiße Doris darf mich gern in Brand stecken.
[alle lachen]
ALAN: O mein Gott.
DOYLE: Darf ich bitte mit der Folge anfangen?
KOONTZ: Leg los, leg los, sorry. Ich hol mir hier einfach einen runter, während du dein Intro liest.
[alle lachen]
DOYLE: Okay, also, das ist ein ziemlich aktueller Fall – ungewöhnlich für uns, aber er ist einfach verdammt interessant, Jungs. Heute betrachten wir den Mord an Joan Wilson, einer 16-Jährigen aus England, die 2016 von ihren Freundinnen in Brand gesteckt wurde.
ALAN: Ach du Scheiße.
DOYLE: Jepp! Auch Schulmädchen, alle um die 16, 17.
ALAN: Auf keinen Fall. Wie zum Henker kann es sein, dass wir nichts davon mitgekriegt haben?
DOYLE: Im Brexit voll untergegangen, Mann. Sie haben sie am Abend von dem beschissenen Brexit-Abstimmungsding umgebracht. Ich glaube, wir sind tatsächlich die Ersten, die überhaupt darüber berichten. Ich konnte absolut nichts über diesen Fall finden.
KOONTZ: Also ein exklusiver Knüller?
DOYLE: Mehr oder weniger? Es gab lokale Berichterstattung, aber im Grunde habe ich nur davon erfahren, weil ein wunderbarer Hörer – der anonym bleiben möchte – uns diesen irrsinnig detaillierten, ähm … DethJournal-Post über den Fall geschickt hat. Unter anderem enthielt der auch die archivierten Blogs der Mörderinnen, die ein paar von diesen verdammt unheimlichen True-Crime-Tumblr-Mädels gesichert haben. Ob der Post nun von dir stammt oder nicht, anonymer Hörer, wir danken dir!
ALAN: Ist es nicht schrecklich, dass ich weiß, was DethJournal ist?
KOONTZ: Verdammt, Mann – das hier ist also brandaktuell, hm?
DOYLE: Total. Ich denke, wir packen hier ein richtig heißes Eisen an. Vielleicht war das nicht die beste Wortwahl.
[alle lachen]
Wussten Sie schon, was mit ihr passiert ist? Haben Sie es in der Zeitung gelesen? Stammen Sie aus der Gegend? Kannten Sie sie? Haben Sie es im Internet gesehen? Wurden Sie durch einen News-Aggregator aufmerksam, der die Lokalnachrichten nach den schlimmsten Details »wahrer Verbrechen« durchforstet? Haben Sie einen Artikel über sie gefunden, versteckt zwischen den Clickbait-Werbebannern einer ohnehin dubiosen Seite? Haben Sie das rothaarige Stockfoto-Model gesehen, das jemand in das bearbeitete Bild eines verkohlten Leichnams montiert hat, unter dem stand: »Sie werden nicht glauben, was sie ihr angetan haben«? Haben Sie einen Podcast darüber gehört? Haben die Moderatoren Witze gerissen? Haben sie einen Sinn für schwarzen Humor? War es deshalb okay? Oder waren sie doch eher einfühlsam? Haben sie an den richtigen Stellen betroffen geklungen? Haben sie eine Contentwarnung ausgesprochen? Haben Sie diese Stellen übersprungen?
Haben Sie die Fotos gesehen?
Haben Sie danach gesucht?
—
Am 23. Juni 2016 gegen 4:30 Uhr wurde die 16-jährige Joan Wilson mit Benzin übergossen und angezündet, nachdem man sie in einer kleinen Strandhütte mehrere Stunden lang gefoltert hatte. Ihre Angreiferinnen waren drei andere Mädchen im Teenageralter – alle vier besuchten dieselbe High School.
Das Verbrechen geschah in Joans Heimatstadt Crow-on-Sea in North Yorkshire. Zwischen Scarborough und Whitby gelegen, ragt der Ort aus der Ostküste Englands hervor wie ein kleiner Finger, der sich nach dem Kontinent streckt. Sowohl im Norden als auch im Süden gibt es einen Strand.
Am Nordstrand geht es laut zu. Mit seinen grellbunten Spielhallen, Souvenirgeschäften, dem Eselreiten und einem Rummelplatz ist er bei Touristen und Familien gleichermaßen beliebt.
Der Südstrand ist exklusiver. Dort findet man gute Restaurants und kleine Kunsthandwerkläden unterhalb der Ruinen von Crow-on-Sea-Castle.
An beiden Stränden reihen sich hübsche, pastellfarbene Strandhütten aneinander. Die Hütten am Nordstrand gehören der Gemeinde und sind günstig zu haben. Die meisten Familien aus Crow können es sich leisten, eine Hütte am Nordstrand anzumieten – zumindest zu besonderen Gelegenheiten. Die Hütten am Südstrand hingegen sind modern, teuer und zumeist in Privatbesitz.
Joan starb am Südstrand.
In den Jahren 2015 und 2016 waren die Hütten beider Strände Ziele einer Serie von Brandstiftungen, weshalb die wenigen Zeugen, die den Rauch aufsteigen sahen, auch nicht die Behörden informierten. Das Feuer war nur klein und bereits 2015 hatten die Notdienste in Crow die Brände der Strandhütten in einem Bericht der Lokalnachrichten als »Zeitverschwendung« bezeichnet.
Eine brennende Strandhütte regte hier niemanden mehr auf. Genauso wenig wie ein Auto mit drei Teenagern, das um 4:30 Uhr durch die leeren Straßen raste. Die Jugendlichen von Crow langweilten sich – kleinere Jugenddelikte gehörten hier zum Alltag.
Die Angreiferinnen wurden als Mädchen A, B und C bezeichnet, bis die Lokalzeitung ihre wahren Identitäten preisgab. Mädchen C (die Älteste) fuhr, Mädchen A saß vorn und Mädchen B hinten. Ihre Aussagen zur Stimmung im Auto unterscheiden sich. Ihre Aussagen zu allem, um genau zu sein. Sie waren sich uneins, wessen Idee es gewesen war, Joan wehzutun, wer an jenem Abend »angefangen hatte« und wer das Feuer entzündet hatte, unter anderem. Mädchen A beschuldigte C und umgekehrt. Mädchen B hatte im Wagen gewartet. Sie hatte Joan nichts getan und war stattdessen die ganze Nacht entsetzt und verwirrt zwischen Strand und Auto hin- und hergelaufen. Sie gab an, sie habe ihre Freundinnen von der Tat abbringen wollen. Die anderen Mädchen widersprechen dem – A und C behaupten, das Feuer sei die Idee von B gewesen.
Wenigstens ein paar Fakten sind unstrittig. Der zeitliche Ablauf steht mehr oder weniger fest. Nachdem die Mädchen das Feuer gelegt hatten, rannten sie vom Südstrand aus eine Betontreppe hinauf zum Fahrzeug von Mädchen C, einem Fiat 500, den sie ihrer älteren Schwester gestohlen hatte. C hatte ein Jahr lang sporadisch Fahrunterricht gehabt. Im Januar und März war sie jeweils durch die Fahrprüfung gefallen. In einigen Wochen sollte sie die Prüfung wiederholen. Sie lieh sich regelmäßig das Auto ihrer Schwester, aber in jener Nacht hatte sie es ohne deren Erlaubnis genommen.
Das Trio fuhr zum nächsten durchgehend geöffneten McDonald’s – eine Raststätte etwa eine halbe Stunde westlich. Im Wagen sagte Mädchen A, sie hoffe, Joan würde mit der Strandhütte verbrennen, damit die Polizei keine weiteren Verletzungen fand. Sie hoffte, man würde Joan die Schuld an der Brandserie geben. Es würde wie ein Unfalltod aussehen. Man würde sich an Joan Wilson als junge Brandstifterin erinnern, die bei der Ausübung ihres bizarren Hobbys tragisch umgekommen war.
Aber Joan Wilson starb nicht.
Das kleine Feuer, das die Mädchen gelegt hatten, verlosch ziemlich schnell. Der Schaden an der Strandhütte war minimal. Das Benzin, das sie über Joan gekippt hatten, war nur der Bodensatz eines Kanisters gewesen, der für Notfälle im Auto lag. Es sengte den Boden ringsherum an, verbrannte Joans Kleidung und Gesicht bis zur Unkenntlichkeit und verletzte sie so schwer, dass sie womöglich nicht überleben würde. Aber es verlosch.
Die Mädchen hatten unterschätzt, wie schwierig es ist, einen menschlichen Körper zu verbrennen. Wie die meisten Dinge im Leben ist auch die Beseitigung eines Leichnams nicht so einfach wie im Film. Ich schreibe Beseitigung eines Leichnams, weil sie annahmen, Joan sei tot. Sie dachten, sie hätten sie umgebracht. Das Feuer sollte Joan aber keinen möglichst schmerzhaften Tod bescheren: Es war nur der panische Versuch, einen »misslungenen Streich« zu vertuschen. Was für einen »Streich«?
Stunden zuvor war Joan in den Wagen gezerrt worden. Die Mädchen A, B und C entsorgten ihr Handy und fesselten sie an den Händen. Sie warfen einen Ziegelstein nach ihr, als sie zu entkommen versuchte, und sperrten sie in eine Strandhütte, die As Vater gehörte. C machte ein Foto von Joan und postete es auf Tumblr.
Trotz ihrer entsetzlichen Qualen und zahlreichen Kopfverletzungen lebte Joan noch, als das Feuer gelegt wurde, und kam irgendwann wieder zu Bewusstsein.
Es ist anzunehmen, dass sowohl Joan als auch die Hütte brannten, als sie nach draußen auf den Strand kroch. An ihr klebte Sand, sodass die Ärzte davon ausgingen, sie hätte sich vielleicht herumgerollt, um die Flammen zu ersticken.
Vom Adrenalin befeuert, schaffte es Joan, aufzustehen. In solchen Augenblicken ist der menschliche Körper zu den wundersamsten Taten in der Lage. Sie erklomm eine Betontreppe zur Straße und hinterließ blutige Fußabdrücke. Nackt. Sie stolperte die Straße entlang und suchte Hilfe. Barfuß und unbekleidet lief sie immer weiter, voller Sand. Öffentliche Überwachungskameras nahmen auf, wie sie schwach mit ihren verbrannten Händen an die Türen von Frühstückspensionen und Ferienhäusern klopfte, bis sie ein geöffnetes Hotel fand. Sie weckte die Rezeptionistin.
Die damals 19-jährige Lucy Barrow hatte am Tresen geschlafen und glaubte nun, in einem Albtraum gefangen zu sein. Sie wählte den Notruf und hoffte, es wäre wirklich nur ein Traum. Als die Notrufzentrale fragte, ob Joans Verbrennungen »größer als Ihre Handfläche« seien, antwortete Lucy: »Sie ist verbrannt, sie ist komplett verkohlt; ich kann sie riechen, obwohl ich so weit weg von ihr stehe.«
Lucy sagte Joan, der Krankenwagen werde in fünf Minuten kommen, und Joan bat um Wasser. Sie konnte sprechen, aber es war schwer, sie zu verstehen. Ihre Stimme war heiser, ihre Lippen weggebrannt. Immer wieder bat sie um Wasser.
Da sie das Glas nicht selbst halten konnte, flößte Lucy ihr das Wasser ein – entgegen der Anweisung von Notrufdisponentin Eve Wells, die Lucy verboten hatte, Joan anzufassen; sie sollte nicht einmal in ihre Nähe gehen. Bei derart schweren Verbrennungen war das Risiko einer tödlichen Infektion hoch.
Eve hatte eine ruhige Nacht gehabt. Sie arbeitete in der Notfallleitstelle von North Yorkshire kurz vor York. Eve erzählt, dass dieser Anruf einer der schlimmsten ihrer langjährigen Karriere war: Eve hat schon panische Eltern bei der Herz-Lungen-Wiederbelebung ihrer Babys angeleitet, hat mit Eheleuten gesprochen, deren Partner gerade ermordet worden waren, und hat Menschen am Telefon sterben hören. Obwohl sie immer wieder mit häuslicher Gewalt, tragischen Unglücken und grauenhaften Todesfällen konfrontiert wurde, zählt Lucys Anruf für sie zu den unheimlichsten. Dieses »Ich kann sie riechen« hat ihr einen Schauder über den Rücken gejagt.
Verbrennungen kamen nicht allzu häufig vor – und wenn doch, resultierten sie aus Fabrik-, Küchen- oder Freizeitunfällen. Niemals war es Absicht. Eve fragte Joan (über Lautsprecher), ob sie einen Unfall gehabt habe. Joan verneinte leise. Lucy gab ihre Antworten weiter. Hatte sie sich das selbst angetan? Nein. Hatte jemand anderes ihr das angetan? Ja.
Die Polizei kam vor dem Krankenwagen an. Eve bat Lucy, das Telefon an einen der Beamten weiterzugeben. Sie wollte nicht, dass sie in den beengten Empfangsraum platzten – damit sie keine Keime einschleppten, die Patientin berührten oder gar versuchten, sie mit einer Decke zu umhüllen. Wenn die Verbrennungen auch nur annähernd so schwer waren, wie Lucy gesagt hatte, wäre Joan extrem anfällig für Infektionen.
Eve bat die Polizisten, Abstand von Joan zu halten – das Zimmer nicht zu betreten, dem Krankenwagen zu folgen und erst Fragen zu stellen, wenn Joan im Krankenhaus war. Einige dieser Anweisungen befolgten die Beamten vor Ort, wie Abstand zu halten und Joan nicht zu berühren, aber sie betraten das Hotel und stellten ihre Fragen. Hat Ihnen das jemand angetan? Sind sie noch in der Nähe? Joan nickte, die Sprechversuche hatte sie aufgegeben. Der Krankenwagen brauchte zehn Minuten, bis er da war.
Im Krankenwagen schien Joan klarer zu werden. Der Sanitäter Dave Fisher fragte sie nach ihrem Namen und Alter (was sie beantwortete: Joan Wilson, 16), dann wollte er wissen, ob sie in ein Feuer geraten sei. Hatte sie einen Unfall gehabt? Manchmal machten Teenager Lagerfeuer am Strand – vielleicht war sie in eines hineingefallen, alkoholisiert oder auf Drogen. Vielleicht waren ihre Freunde daraufhin in Panik ausgebrochen und hatten sie allein zurückgelassen. Einige Monate zuvor hatte er schon mal ein Brandopfer in ihrem Alter behandelt; das Mädchen hatte am Strand betrunken mit ihren Freunden gespielt: Sie waren über ein kleines Lagerfeuer gesprungen und die Trainingshose des Mädchens hatte Feuer gefangen. Dave hoffte, dass auch hier etwas in der Art passiert war.
War das ein Unfall?, fragte er. War es nicht.
Sie nannte die Namen ihrer Peinigerinnen dreimal, und Dave, der kein Papier hatte, schrieb sie sich mit einem Kugelschreiber auf die Innenseite seines Arms.
Das erste Mädchen, das sie nannte, wurde hier zu A, das zweite zu B und das dritte zu C.
Dann fragte Joan nach ihrer Mutter und verlor das Bewusstsein. Sie würde nie wieder aufwachen.
Die Mädchen A, B und C waren zu früh bei McDonald’s, um das erhoffte Frühstück zu bekommen. Also bestellten sie drei große Portionen Pommes frites, eine Cola light, eine Fanta und einen Vanillemilchshake. Außerdem einen Hamburger, eine 20er-Box Chicken McNuggets, ein McChicken-Sandwich und einen Big Mac.
Mädchen A schob den McChicken in den Big Mac und sagte den anderen, sie habe jetzt einen »McGangBang«. B, die den Hamburger bestellt hatte, sprach in ihrer Polizeiaussage ausführlich darüber, wie ekelhaft der Anblick, der Geruch, das Geräusch gewesen sei.
C dippte ihre Pommes und die Chicken McNuggets in den Milchshake.
A sagte, der halb gegessene McGangBang (das heißt: der mayobeschmierte Salathaufen, der zusätzliche Ketchup, das angekaute Fleisch) sehe aus wie Joans Leiche. Das wurde vor Gericht besonders hervorgehoben. Sie alle lachten überdreht, waren wild und hemmungslos, vollgepumpt mit Koffein, Zucker und Adrenalin. Sie schrien herum, schlugen mit den Händen auf die Tischplatte, verspritzten Cola aus den Nasenlöchern. B sagte, sie seien wie im Delirium gewesen, hysterisch, unfähig, die Ungeheuerlichkeit und Endgültigkeit ihrer Tat zu begreifen. A schien den Witz sogar noch vor Gericht lustig zu finden. C gab an, sich an nichts von alledem erinnern zu können.
Joans Mutter, Amanda Wilson, kam in Morgenmantel und Hausschuhen ins Krankenhaus. Freddy Wilson arbeitete auf einer Bohrinsel; er würde erst 16 Stunden später nach Hause kommen. Anfangs war Amanda nicht in der Lage, ihre Tochter zu identifizieren. Das wunde, knallrote Gesicht wies nahezu keine erkennbaren Züge mehr auf. Joans Haar war vor dem Feuer abgeschnitten worden, der Rest dann verbrannt. Man schätzte, dass 80 Prozent ihrer Haut verbrannt waren. Amanda musste sich Joans Zähne ansehen. Joan fehlte ein Stück vom linken Schneidezahn, auf dem sie sonst eine Kunststoffkrone trug. Diese war abgesprungen, sodass Amanda die Lücke wiedererkannte. Dann bemerkte sie den kleinen Fingernagel des Mädchens. Er war blau lackiert – das stimmte mit dem Nagellack überein, den Joan zuletzt getragen hatte: Blueberry Muffin von Barry M. So identifizierte sie Joan und übergab sich sofort danach im Flur des Krankenhauses, da sie es nicht bis zur Toilette schaffte.
Auch Mädchen B hatte sich übergeben, im Waschraum der Raststätte. Die Mädchen A, B und C verließen McDonald’s etwa zur selben Zeit, als Joan im Krankenhaus ankam. Sie hinterließen Chaos. Die Angestellten beschrieben sie später als laut, respektlos und aufgedreht. Ann Brown, die die Mädchen bedient hatte, sagte, sie habe angenommen, dass sie am Strand getrunken und vielleicht sogar Drogen genommen hatten. Sie waren zerzaust und voller Sand.
Mädchen C setzte zuerst A ab, dann B. A lebte ein Stück außerhalb von Crow, der Raststätte am nächsten. B wohnte ganz in der Nähe von C.
A schlief auf dem Sofa ein, sobald sie zu Hause war. Es dauerte etwa 20 Minuten, bis die Polizei kam. A ging an die Tür, da ihr Vater noch im Bett war. Anfangs gab sie sich streitlustig und unbesorgt, aber laut den Beamten »drückte sie voll auf die Tränendrüse«, sobald ihr Vater dazukam. Ihr Vater war selbst erst vor Kurzem nach Hause gekommen und noch betrunken von den Feierlichkeiten rund um das EU-Referendum. Er drohte, die Beamten wegen Polizeigewalt zu verklagen, als sie seine Tochter in Handschellen zum Wagen führten.
Als Mädchen B nach Hause kam, ging sie nicht schlafen. Stattdessen lief sie weinend im Erdgeschoss des kleinen Hauses auf und ab, das sie mit ihrer Mutter und deren Partner bewohnte. Sie zerbrach eine Vase. Als ihre Mutter nach unten kam, stand sie gerade am Telefon und wählte, dann legte sie auf. Wählte erneut, legte auf. B und ihre Mutter gerieten in Streit, der schließlich zu einem halben Geständnis führte. Als die Beamten an die Tür des vollkommen unschuldigen »Mädchen D« klopften, fuhr Bs Mutter ihre Tochter gerade zur Polizeiwache.
Das fälschlich beschuldigte »Mädchen D« war zwar mit den Mörderinnen (und dem Opfer) befreundet, hatte aber absolut nichts mit dem Mord zu tun. D war nicht von Joan Wilson genannt worden, hatte jedoch das Pech, sowohl die (sehr frische) Ex-Freundin von Mädchen C zu sein als auch aus einer bekanntermaßen »zwielichtigen« Familie zu stammen. (»Zwielichtig« war der Ausdruck, den die Polizei vor Gericht verwendete, als nach dem Grund für diese Verhaftung gefragt wurde.) D selbst war noch nie mit der Polizei in Konflikt geraten, wohl aber ihr Bruder und entferntere Verwandte.
Die Mutter von D war verwirrt, als sie drei Polizisten die Tür öffnete. Sie hatte Mühe, das kleine Rudel Tierschutz-Greyhounds zu bändigen, die beim Anblick der Männer panisch zu bellen begonnen hatten. Keiner der Hunde sprach gut auf Fremde an. Die Mutter fragte nach einem »Haftbefehl«, als wären sie im Fernsehen. Als die Polizisten sich an ihr vorbeidrängten, riss sich das unberechenbarste und aufgebrachteste Tier los. In Gegenwart von Männern waren die Hunde besonders ängstlich – und der Anblick von Fremden, die schrien und ihre Besitzerin herumschubsten, machte sie rasend. Eigentlich hatten sie ein sanftes Gemüt; sie bellten und heulten höchstens, wenn sie verängstigt waren oder bedrängt wurden. Aber dieser besonders unberechenbare Greyhound biss einen Beamten. Der Hund wurde mit einem Taser betäubt und starb später.
Die Mutter von Mädchen D nahm an, sie wären hier, um ihren Sohn zu verhaften, der ihrer Aussage nach noch schlief und den sie – wenn sie ihr nur eine Minute geben würden, um die Hunde wegzusperren – holen gehen würde. Doch sie waren wegen ihrer Tochter hier. Sie war fassungslos. Ihre Tochter sei die ganze Nacht zu Hause gewesen, beteuerte sie – rund um ihr Haus gebe es Überwachungskameras, das könnten sie nachprüfen. Aber die Polizisten ignorierten diese Aussage und stürmten ins Obergeschoss.
Mädchen D wurde aus dem Bett gezerrt. Verwirrt und unter Tränen wurde sie fast 24 Stunden lang verhört, ehe bestätigt werden konnte, dass sie die ganze Nacht zu Hause in ihrem Bett gewesen war. Erst dann ließ man sie frei. Dennoch wurde ein Foto von ihr gemacht und später in der Lokalzeitung, Post-on-Sea, veröffentlicht.
Mädchen C wohnte im selben Viertel wie B, fuhr aber nicht nach Hause, nachdem sie ihre Freundin abgeliefert hatte. Stattdessen drehte sie ein paar Runden in ihrer Siedlung und machte sich dann auf den Weg zurück zur Autobahn.
Nachdem sie B abgeliefert hatte, fuhr C also in ihrer Siedlung im Kreis herum und erst dann zurück zur Autobahn.
Die Schwester war an diesem Morgen sehr früh aufgestanden, um zur Arbeit zu fahren, und wurde wütend, als sie feststellte, dass ihr Auto weg war. Sie ging zu Fuß zum Haus ihrer Mutter, »stocksauer auf ihre Schwester«. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Mädchen A und B der Polizei bereits erzählt, C sei die Anführerin gewesen. Die Polizei fragte weiter nach »Mädchen D« – was A und B verwirrte und die ganze Befragung in die Länge zog.
Die Mutter von Mädchen C kochte Kaffee und die ältere Schwester versuchte, C auf dem Handy zu erreichen. Ihr Stiefvater rief gerade bei der Polizei an, als die Beamten auch schon vor der Tür standen.
Es dauerte mehrere Stunden, bis man C fand. Sie war in eine Nothaltebucht der Autobahn gefahren und dort eingeschlafen.
Die Geständnisse kamen schnell, aber die Geschichte war verworren. An ihrer Schuld bestand kein Zweifel – das Wer, Wann, Warum und Wie des Angriffs erwies sich jedoch als kompliziert. Die Mädchen A, B und C gaben kindische Gründe, Ausflüchte und obskure Rechtfertigungen an. (Während eine verwirrte und aufgelöste D darum bettelte, nach Hause zu dürfen.) Sie beschrieben einander wahlweise als Psychopathinnen, Folterknechte, gewalttätige Idiotinnen, bösartige Genies, willensschwache Mitläufer, Anführerinnen einer Minisekte und armselige Mobberinnen. Sie tischten den Beamten wilde, ausführliche Hintergrundgeschichten auf, die bis in die Grundschulzeit zurückreichten.
»Es war wie in einem Albtraum, in dem man wieder zur Schule geht«, sagte ein Beamter vor Gericht. »Wir konnten einfach nicht folgen.«
Joan starb drei Tage nach ihrem Martyrium. Die Geschichte ihres Todes wurde von den meisten Medien weitestgehend ignoriert, geschah die Tat doch während des EU-Referendums. Wochenlang dominierte der Brexit die Nachrichten, und nichts an Joan Wilsons Ermordung war für die Narrative der mehrheitlich nach rechts tendierenden britischen Presse von Interesse. Alle beteiligten Mädchen waren weiße Britinnen. Sie entstammten durchschnittlichen sozioökonomischen Milieus – wenngleich die Familie von Mädchen A reich und im Ort ausgesprochen prominent war. Ihr Vater war ein rechter »Politiker«, ein Großmaul. Möglicherweise wollten die Zeitungen, die dem Vater ganze Spalten widmeten, die Tatsache, dass seine Tochter eine teuflische, mörderische Mobberin war, nicht allzu sehr herausstellen.
Crow stimmte für den EU-Austritt – und das hatte nichts mit dem Mord zu tun. Mit der Berichterstattung über diese Geschichte war nichts zu gewinnen. Es gab keine »Grooming Gangs« oder Immigranten, die man beschuldigen konnte, keine bösen ausländischen Teenager. Nur vier weiße britische Mädchen in einem mehrheitlich weißen britischen Küstenort, der auf dem absteigenden Ast war.
Die Identitäten aller drei Täterinnen (und die von »Mädchen D«) wurden rasch von der Post-on-Sea enthüllt. Offenbar gab es Unstimmigkeiten, was das Alter einiger der Mädchen anging; man dachte, Mädchen C und D wären 18 und nicht 17. Man nahm an, der leidlich berühmte Vater wollte seine Tochter A zu einer Person des öffentlichen Lebens machen. Für die Enthüllung des Namens von Mädchen B gab es keine Rechtfertigung.
Ich war versucht, ihnen Pseudonyme zu geben, aber die Mädchen A und B sind mittlerweile aus der Haft entlassen und haben neue Identitäten erhalten. C muss eine Erwachsenenstrafe absitzen; wenn (falls) sie eines Tages in die Gesellschaft zurückkehrt, wird auch sie sicherlich eine neue Identität brauchen. Ihre echten Namen sind bekannt – also bin ich ebenfalls dabei geblieben. Ich habe mit Mädchen D gesprochen, die kein Problem damit hat, namentlich genannt zu werden. Sie möchte ein für alle Mal klarstellen, dass sie nichts mit alledem zu tun hatte.
Mädchen D, unser unschuldiger Kollateralschaden, heißt Jayde Spencer. Noch eine Generation zuvor war ihre Familie tief in die lokale Bandenkriminalität verstrickt. Jetzt betreiben sie einfach nur ein Wettbüro und leben mit einem unverdient schlechten Ruf.
Angelica Stirling-Stewart ist Mädchen A. Ihr Familienname ist untrennbar mit Crow-on-Sea verknüpft. Es wäre schwer, ein umfassendes Bild von ihr zu zeichnen, ohne ihren Namen zu nennen. Ihr Vater ist lokaler Geschäftsmann, Schriftsteller und hat kürzlich einen unliebsamen Vorstoß in die Politik des rechten Flügels gemacht. Sie ist ein verwöhntes Gör und war in der Grundschule eine Mobberin. In der High School wendete sich dann das Blatt – man fand sie allgemein eher seltsam und machte sich über sie lustig. Sie gehörte zu Joans Schulclique, auch wenn es überall heißt, die beiden hätten sich nicht gut verstanden.
Violet Hubbard ist unser Mädchen B. Ruhig, eine gute Schülerin, ihre Mutter ist Sozialarbeiterin, ihr Vater ein in London lebender Staatsbeamter. Violet war in der Grundschule mit Joan befreundet. Obwohl sie sich auseinandergelebt hatten, schrieben sie einander regelmäßig Nachrichten. Den Großteil ihrer Zeit verbrachte Violet online. Bevor sie Mädchen C traf, hatte sie keine Freunde »IRL« – im echten Leben –, war schrecklich schüchtern und litt unter Ängsten und Depressionen.
Die Anführerin, Mädchen C, heißt Dorothy »Dolly« Hart – sie war etwa anderthalb Jahre vor der Tat bei ihrer Mutter und ihrem Stiefvater eingezogen.
Ihr biologischer Vater war fünf Jahre zuvor gestorben, und sie hatte entschieden, nach seinem Tod bei ihrer Großmutter zu bleiben, während ihre Halbschwester (Heather) lieber zu ihrer Mutter ziehen wollte. Als die Großmutter das Kind nicht mehr bändigen konnte, zog es nach Crow.
Laut ihren Lehrern war Dolly eine »glamouröse, charismatische Unruhestifterin«. Sie war sehr hübsch und anfangs auch beliebt – aber sie setzte Gerüchte in die Welt, spannte anderen Mädchen die Freunde aus und fing grundlos Schlägereien an. Sie war unberechenbar und grausam, sodass sie schon einen Monat nach ihrer Ankunft an der neuen Schule verpönt war. Dolly tat sich schwer in ihrer neuen Umgebung und ihre gravierenden psychischen Probleme wurden immer schlimmer.
Irgendwann trafen die Mädchen aufeinander. Den Großteil des Jahres vor dem Mord tauchten sie immer tiefer in eine bizarre Fantasiewelt ab – einen kleinen Kult, basierend auf ihren Obsessionen und ihrer Wut. Sie erkoren Joan Wilson zu ihrem Ziel. Wegen dem, was sie getan hatte, und dem, was sie in den Köpfen der Mädchen vielleicht tun würde.
Sie taten nur so, als ob. Bis es ernst wurde.
Auf den Fall aufmerksam wurde ich über eine Clickbait-Anzeige auf einer besonders trashigen True-Crime-Website, die die widerwärtigsten, groteskesten Geschichten aus aller Welt sammelte.
Widerwärtig und grotesk war genau das, wonach ich suchte; meine letzten beiden Bücher hatten sich nicht gut verkauft.
Für alle, die nicht mit meiner Arbeit vertraut sind: Ich war mal Journalist. Für die mittlerweile eingestellte Boulevardzeitung Polaris[1] berichtete ich über schwere Verbrechen in Großbritannien.
Ich war in den Abhörskandal von News International verwickelt (obwohl ich nie bei News International angestellt war) und wurde daraufhin gefeuert. Aber ich war finanziell gut versorgt und verfügte noch über genug Beziehungen, dass es mich nicht allzu schlimm traf. Größere Namen gerieten im Zuge des Skandals in Verruf; die Leute sind meistens überrascht, wenn sie erfahren, dass ich ebenfalls involviert war. Damit war mein Ruf zwar befleckt, aber das war nicht das Ende der Welt – wahnsinnig gut war er sowieso nie gewesen.
Also beschloss ich, stattdessen Bücher zu schreiben, und veröffentlichte zwei überaus erfolgreiche Werke: Wie konnte sie nur? über das Mörderpärchen Raymond und Kathleen Skelton und In Luft aufgelöst über das mysteriöse Verschwinden der Schülerin Molly Lambert – beides Fälle, die ich bereits für Polaris recherchiert hatte.
Mein letztes Buch, Mein Leben mit Verbrechen, kam 2015 heraus. Es ist teils autobiografisch, teils True Crime. Darin schreibe ich über die bekanntesten Fälle, die ich bearbeitet habe, wobei ich dummerweise viel von meinem besten Material verschwendet habe. Es hätten gut und gern drei Bücher werden können, wenn ich den Stoff etwas mehr ausgebreitet hätte. Offensichtlich spreche ich darin auch entschieden zu viel über mich selbst.
Die Presse nannte es »ausschweifend« und »wenig aufschlussreich« – und ich wurde dafür kritisiert, Teile von Wie konnte sie nur? und In Luft aufgelöst aufgewärmt zu haben. Diese Bücher wurden dem Publikum stattdessen empfohlen. Das Werk verkaufte sich nicht besonders gut, aber es war auch kein so großer Flop wie mein nächstes Buch.
Der True-Crime-Boom setzte 2013 ein. Und während sich Serial und Making a Murderer im Kulturbereich durchsetzten, litt ich bitterlich unter dem relativen Misserfolg von Mein Leben mit Verbrechen. Es kam mir ungerecht vor, dass ich nicht unmittelbar von der riesigen True-Crime-Welle profitierte – immerhin machte ich das doch schon seit Jahrzehnten.
Dann gingen die Verkaufszahlen meiner ersten beiden Bücher wieder nach oben, da sie regelmäßig als Lesetipps in den einschlägigen Podcasts genannt wurden und auf Listen erschienen wie »20 Bücher, die man lesen muss, wenn man Serial liebt« oder »True-Crime-Empfehlungen für Podcast-Süchtige«. Anfang 2016 bot mir mein alter Verleger mit einem weiteren Buch eine neue Chance.
Weil ich mein »bestes« Material bereits in Mein Leben mit Verbrechen verarbeitet hatte, musste ich ein frisches Thema finden. Die nächsten 18 Monate verbrachte ich damit, ein Buch über eine Serienvergewaltigerin zu schreiben: eine Lehrerin, die Jungs missbrauchte. Ich nannte es Im Spinnennetz und veröffentlichte es Ende 2017. Mir gefiel es recht gut, und anders als Mein Leben mit Verbrechen bekam es positive Kritiken. Aber niemand las es. Der Fall erregte kaum Aufmerksamkeit. Ich wurde zu einigen Podcasts eingeladen, gab ein paar größere Presseinterviews, meistens jedoch fragte man nur nach meinen älteren Büchern. Es machte mich nicht wie erhofft zur True-Crime-Instanz. Die Angebote blieben aus. Meine Verleger hatten kein Interesse an einem weiteren Machwerk von mir.
2018 hatte ich auf Twitter einen peinlichen Streit mit einem beliebten Podcaster. Ich beschwerte mich darüber, wie geschmacklos sein Podcast war, und er reagierte mit einer Reihe Screenshots alter Artikel über den Abhörskandal. Sein Tweet ging viral, und ich wurde in der Folge von selbstgerechten Zoomern, meinen ebenfalls verifizierten Kollegen und anderen Leuten aus der True-Crime-Community niedergemacht. In gewisser Weise wurde ich gecancelt. Mein Literaturagent ließ mich fallen wie eine volle Kotztüte. Ich wurde nicht mehr zu Podcasts oder Conventions eingeladen. Wenn Journalisten und Podcaster meine Bücher überhaupt noch erwähnten, dann mit der einschränkenden Bemerkung, dass ich »ein ziemlicher Arsch« oder »echt schäbig« sei.
Nachdem ich ein Jahr lang absolut nichts getan hatte, langweilte ich mich und sah mich nach einem neuen Projekt um. Ich wollte es noch mal wissen. True Crime war nach wie vor ein großes Thema – und nun waren es nicht mehr nur Bücher und Podcasts. Jetzt gab es Fernsehdokumentationen und fiktionalisierte Serien. True Crime war beliebter denn je – das Genre war jenseits von Nischenpodcasts und der einen oder anderen Netflix-Sendung allgegenwärtig und profitabel. Von Hollywoodfilmen bis HBO – berühmte Schauspieler buhlten darum, Ted Bundy verkörpern zu dürfen und als ausführende Produzenten bei der neuesten Prestige-Doku mitzumischen. Ich verbrachte meine Zeit auf den schäbigsten Webseiten, die das Netz anzubieten hatte, und hoffte, den nächsten großen Hit zu finden.
Als ehemaligem Boulevardjournalisten war es mir nicht fremd, im Dreck zu wühlen – aber selbst für mich wurde es langsam deprimierend.
Ich stolperte über einen Fall in Abilene, Texas: Ein Mann entführte eine junge Frau und hielt sie in einem Hundezwinger gefangen. Der Mann aß nichts als Frühstücksflocken für Kinder und hatte vor, sein Opfer zu verstümmeln und sie zu einer Art Puppe oder Sklavin zu machen. Schräg, aber nicht schräg genug. Die Polizei fand sie lebendig und unverletzt, und der Entführer hatte nie zuvor Vergleichbares getan.
Es kam mir vor, als wäre das »typisch« für alle merkwürdigen oder interessanten Fälle, die ich fand. Keiner war bedeutend genug. Es gibt keine richtig großen, komplexen Fälle mehr, kann das sein? Nicht so wie früher. Die Kriminaltechnik ist zu weit entwickelt, und die Polizei weltweit scheint sich ihrer eigenen systemischen Probleme nur allzu bewusst zu sein, die in der Vergangenheit dafür gesorgt haben, dass Serienkiller so leicht davonkommen konnten. Es gibt außergewöhnliche Einzelverbrechen, aber die sind selten so komplex wie die verworrenen, langwierigen Serienfälle. Nichts, in das man sich verbeißen kann – es sei denn, das Internet ist in irgendeiner Form involviert. Wenn ich einen waschechten Betrüger oder einen Facebook-Svengali finden könnte – meine eigene Gypsy-Rose Blanchard –, hätte ich gewonnen.
Unterhalb des Artikels über den Fall aus Abilene gab es eine Clickbait-Anzeige mit mehreren Themen. »Sie war mal das schönste Mädchen der Welt; so sieht sie HEUTE aus«; »10 Tipps für einen flacheren Bauch und einen runderen HINTERN«; »Betrogen von der Ex: Freund LACHT ZULETZT« – jede dieser Überschriften wurde von einem Bild begleitet. Da waren ein stark verfremdetes Kindermodel, ein weibliches Hinterteil in knappen Shorts und eine weinende Frau mit großen Brüsten. Und unter dem Hinterteil, neben der vollbusigen Fremdgängerin:
SIE WERDEN NICHT GLAUBEN,
WAS MAN IHR ANGETAN HAT …
Unter der Überschrift prangten zwei Bilder, ein attraktives Stockfoto-Model mit rotem Haar und daneben ein verkohlter Leichnam, der so bearbeitet war, dass er gruselig glatt aussah und mit seltsam weißen Augen in die Kamera starrte.
Jeder dieser Artikel sollte die niedersten Instinkte ansprechen, die tiefsten Tiefen unserer Neugier. Ich klickte und las. Ich musste mehr erfahren.
Dann googelte ich den Namen und fand ein paar Podcasts – einen Auszug aus der ersten Sendung, die sich mit dem Fall befasste, habe ich bereits vorgelegt. I Peed on Your Grave, ein Trio aus nervtötenden Amerikanern, die durcheinanderbrüllen und sich gegenseitig mit Witzen über lesbische Jugendliche und alberne »britische« Akzente zu überbieten versuchen. Ihre Informationen hatten sie von einem Einwohner von Crow-on-Sea. IPOYG schien die Quelle zu sein, die andere Podcasts anzapften, um ihre eigenen Beiträge zu diesem Thema zu erstellen. Ich hörte zwei weißen Frauen zu, die bei Weißwein darüber plauderten, dass dies die »beste aktuelle Geschichte« sei, die sie seit Jahren recherchiert hätten. Sie hielten an den richtigen Stellen inne und gurrten »armes Mädchen«, »armes Ding«, »arme Kleine«.
Natürlich kratzte das alles nur an der Oberfläche. Amerikaner eben. Am breiteren sozioökonomischen Kontext des Verbrechens schienen sie nicht interessiert zu sein – weder sprachen sie über die Stadt, in der es stattgefunden hatte (bis auf Witzeleien wegen des seltsamen Namens), noch befassten sie sich eingehender mit der Geschichte des Opfers oder seiner Mörderinnen. Dass man über diesen Fall berichten und einen so wichtigen Akteur wie Angelicas Vater ignorieren konnte (von dem die meisten politikinteressierten Briten durchaus gehört haben), erschien mir absurd.
Ein paar Fotografien gingen rum, einige Youtube-Videos (die sich ebenfalls auf den IPOYG-Bericht stützten) und eine Menge Reddit-Threads mit Screenshots der Social-Media-Profile der Mörderinnen. Eine der besten Quellen, die ich ausfindig machen konnte, war ein Post auf »DethJournal«, einem LiveJournal-Klon von True-Crime-Fans. Im »TCC [True-Crime-Community] Wank[2]«-Thread der Seite hatte ein User ein umfassendes Archiv von Dolly Harts und Violet Hubbards Tumblr-Posts aus der Zeit vor dem Löschen ihrer Blogs angelegt – inklusive Posts und Chatlogs mit den Reaktionen von Dollys Online-Bekanntschaften.
Wo immer ich hinsah, wollten die Leute mehr Informationen zu dem Fall: Quellen fernab der zwielichtigen Lokalpresse, der ewig gleichen Podcasts und der wenigen DethJournal-Posts. Die Leute wollten ein Buch.
Die Geschichte musste einfach erzählt werden, und ich schien der Erste vor Ort zu sein.
Ich werde schnippisch. Obwohl mein Interesse anfangs rein egoistischer Natur war, berührte mich Jonis Schicksal. Die Podcasts über sie ärgerten mich. 2014 starb Frances, meine einzige Tochter. An einem verschneiten Januarmorgen trieb sie ans Südufer der Themse, wo sie sich offenbar das Leben genommen hatte. Sie war 20 Jahre alt. Als ich begann, mich mit dem Fall Joan Wilson zu beschäftigen, fragte ich mich, wie die Leute wohl über Frances reden würden. Ich stellte mir vor, wie Männer sie auslachten, dass Fremde Witze über die Umstände rissen, die zu ihrem Tod geführt hatten, und ihren Akzent nachahmten.
Also zog ich Ende 2019 vorübergehend nach Crow-on-Sea. Ich versuchte, Teil der Gemeinde zu werden. Ich wollte einen Beitrag leisten, wollte genauso über die Stadt schreiben, in der dieses Verbrechen passiert war, wie über das Verbrechen selbst. Ich freundete mich mit den Einheimischen an und ließ mich in ihrer Bibliothek nieder – und nutzte die Hilfe der örtlichen Historiker und Journalisten. Ich bekam die unschätzbare Möglichkeit, die Freunde und Verwandten des Opfers und der Täterinnen zu interviewen, und kommunizierte sogar ausgiebig mit Violet Hubbard und Angelica Stirling-Stewart. Dolly Hart war nicht zu erreichen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist sie noch immer in Haft.
Vieles von dem, was im Folgenden zu lesen ist, entstammt diesem Austausch, Zehntausenden Blogbeiträgen und dem Inhalt meiner Interviews. In diesem Buch stecken Hunderte Stunden unermüdlicher Recherche, und ich hoffe, damit zum Herzen dieser Geschichte vorgedrungen zu sein. Das hier ist keine gekürzte Fassung, die man als leichte Lektüre auf dem Weg zur Arbeit liest; es gibt auch keine albernen Akzente und keine Unterbrechung durch Matratzenwerbung.
1Polaris (1947–2015) war eine der wenigen britischen Boulevardzeitungen mit eher linken Tendenzen. Die letzte Ausgabe erschien im Mai 2015.
2 »Wank« ist ein umgangssprachlicher (mittlerweile veralteter) Begriff, der Streitereien innerhalb von Fangruppen bezeichnet, aber manchmal auch für allgemein schlechtes Benehmen benutzt wird. Einige Gruppen auf LiveJournal und ähnlichen Webseiten widmeten sich der Einordnung und Diskussion solcher »Wank«-Ereignisse.
Joan Margaret Wilson wurde am 19. Dezember 1999 geboren. Wie ihr Tod wurde auch ihre Geburt von einem wichtigen historischen Ereignis überschattet. Amanda Wilson erzählte mir, wie sehr es sie genervt hatte, dass die Ankunft ihrer Tochter auf dieser Welt vor der Jahrtausendwende verblasste.
»Besonders dieser Y2K-Problem-Kram hat mich fertiggemacht«, sagte sie. »Dass mir meine Freunde andauernd vorbeteten, zu welchen riesigen Partys oder in welche Clubs sie an Silvester gehen wollten – das hat genervt. Aber dieser Y2K-Mist war einfach nur … dumm. Ständig kam das Thema auf, während ich völlig gestresst und erschöpft war. Sie wissen schon, so dämliche Fragen wie ›Wird das Babyfon denn auch im Jahr 2000 noch funktionieren? Weißt du, was du machst, wenn der Strom ausfallen sollte? Hast du dein ganzes Geld von der Bank geholt?‹. Dieser Quatsch.«
Amanda war 25, als sie Joan bekam. Damals war sie »so eine Art Hippie«, was sich nicht geändert hat. Sie trägt Pluderhosen und langes Haar, raucht selbst gedrehte Zigaretten und isst Tofu. Sie hat Tattoos, ein Bauchnabelpiercing und benannte ihre Tochter nach der Folksängerin Joni Mitchell. Amanda bat alle, das Baby Joni zu nennen.
Als ich sie interviewte, hatte Amanda sich gerade von Jonis Vater Freddy scheiden lassen. Das Interview ist zwar das erste in diesem Buch, aber tatsächlich war Amanda eine der letzten Personen, mit denen ich gesprochen hatte. Ich hatte bereits einige Monate in Crow gewohnt, als sie sich Anfang März 2020 bereit erklärte, mich zu treffen. Langsam offenbarte sich, was für eine Bedrohung das Covid-19-Virus war, also plante ich, meine Arbeit in Crow zu Ende zu bringen und zurück nach London zu reisen – nur für den Fall, dass es schlimmer werden sollte.
Zuerst plauderten Amanda und ich über das Virus. Sie war ein bisschen skeptisch, sah nicht ein, warum es gefährlicher als eine Grippe sein sollte. Zu der Zeit stimmte ich ihr zu.
Auch mir gegenüber war sie skeptisch. Sie sagte, sie habe noch mit niemandem von der Presse über den Tod ihrer Tochter gesprochen, obwohl sie durchaus Angebote bekommen habe. (Es wurden mehr, nachdem die I-Peed-on-Your-Grave-Episode ausgestrahlt worden war.) Sie wusste nicht recht, was sie davon halten sollte. Auch vier Jahre später stand sie noch unter Schock – das wird sie vermutlich für immer.
Sie führte mich in ihren Wintergarten, wo sie einige Fotoalben bereitgelegt hatte. An der Wand hingen selbst gezeichnete Mandalas, außerdem Aquarelle von hinduistischen und buddhistischen Motiven und viele von Tieren und Pflanzen.
Sie war spindeldürr. Blaue Venen zeichneten sich über den langen, filigranen Handknochen und um die dicken Tränensäcke herum ab. Auf alten Fotos glänzt ihr kastanienbraunes Haar, aber im Licht des Wintergartens erkannte ich, dass es spröde und schütter geworden war. Das Grau rann von ihrem Scheitel herab, als hätte ihr jemand einen Eimer Silberfarbe über den Kopf gegossen.
Amanda machte klar, dass sie nicht darüber reden wollte, wie sie von Jonis Tod erfahren hatte, und auch nicht über das Identifizieren des Leichnams oder die Beerdigung. Auch über das Ende ihrer Ehe wollte sie keine Details preisgeben.
Sie erzählte mir, dass sie kaum Erinnerungen an das Jahr 2016 hatte, nicht nach dem Juni. Sie verbrachte viel Zeit im Bett und Freddy bei seinen Eltern. Keiner der beiden konnte mit der eigenen Schuld umgehen oder mit der Last der Trauer des anderen. Nach der Beerdigung lebten sie mehr oder weniger getrennt.
Amandas Eltern waren tot und sie hatte keine Geschwister. Ihre Freunde kümmerten sich um sie. Sie brachten ihr Essen und putzten das Haus, während Amanda im Bett lag oder stundenlang duschte.
»Ich wollte nicht aus meinem Schlafzimmer raus, weil ich überall nur sie sah«, sagte Amanda. »Aus dem Augenwinkel. Wie sie um die Ecke spähte oder in ihr Zimmer ging. Nur ihren Rücken. Und ab und zu roch ich sie auch, sie oder … das Krankenhaus. Und dann ging ich unter die Dusche. Wenn ich das Krankenhaus roch, ging ich duschen und versuchte, den Geruch mit dem Duschgel zu überdecken, das sie immer benutzt hatte. Sie war nie in mein Schlafzimmer gekommen, wenn ich also … Wenn ich es nicht aushielt, dann blieb ich einfach dort. Aber manchmal, da … lief ich auch durchs Haus, hoffte, sie zu sehen. Mich nur eine Sekunde lang normal zu fühlen.«
Ich erzählte Amanda, dass es mir nach dem Tod meiner Tochter genauso gegangen war. Die Umstände waren anders, meine Tochter hatte bereits ein paar Jahre nicht mehr bei mir gewohnt – aber ich konnte schwören, dass ich Frances’ Pferdeschwanz um eine Ecke verschwinden sah oder ihr Parfüm roch.
Einige Monate nach ihrem Tod bekam ich plötzlich große Angst, dass Frances’ Lieblingsduft womöglich irgendwann nicht mehr hergestellt werden würde, also ging ich in den Laden und kaufte 20 Flaschen davon. Ich versprühte es auf sämtlichen Polstern meiner Wohnung – aber weil ich es so übertrieb, nahm ich es schließlich nicht mehr wahr.
Als mir das klar wurde, brach ich zusammen und wollte alle meine Möbel der Wohlfahrt spenden, um neue zu kaufen und den Geruch wiederzubekommen.
Amanda sagte, bei ihr und Jonis Duschgel sei es ähnlich gewesen – eines Tages hatte sie eine Großbestellung dafür aufgegeben.
»Immer wenn im Erdgeschoss eine Bodendiele knarrte, der Wasserkocher blubberte oder der Fernseher anging – obwohl ich wusste, dass das nur … Julie war oder eine meiner anderen Freundinnen –, dann … Ich dachte immer, sie wäre es. Das ist im Grunde alles, woran ich mich erinnere. Das ständige Gefühl, dass … sie da war, obwohl ich wusste, dass dem nicht so war. Rational wusste ich, dass sie nicht hier sein konnte, und mein Gefühl sagte mir, dass ich dann auch nicht hier sein sollte. Wenn sie nicht hier war, sollte ich doch eigentlich dort sein, wo sie war. Ich sehnte mich so sehr nach ihr. Aber ich konnte nicht bei ihr sein. Als mir all das klar wurde, fühlte sich das an, als hätte ich einen Lungenflügel verloren. Ohne sie konnte ich nicht atmen.«
Das erste Weihnachten verbrachte sie mit Freddys Familie. Der Tag war schrecklich – erbitterte, boshafte, vom Alkohol befeuerte Streitereien führten zur offiziellen Trennung Anfang Januar.
Nach Weihnachten kamen Amandas Freunde nicht mehr so oft vorbei. Sie nahm stark ab und schlief nicht mehr.
Dafür begann sie, sich Dokumentationen über ermordete Kinder anzusehen, weil dort oft mit den Müttern gesprochen wurde. Nur wegen der Mütter sah sie sich das an. Sie waren ordentlich angezogen, außerhalb ihres Zuhauses und sprachen über den Tod ihres Kindes. Amanda sagte, sie studierte diese Frauen regelrecht, als wollte sie ihr Geheimnis ergründen. Wenn sie diese anderen Frauen beobachtete, lernte sie vielleicht, wie auch sie sich wieder richtig anziehen und das Haus verlassen konnte. Dann verstand sie vielleicht, wie sie nach diesem schrecklichen Verlust wieder funktionieren konnte.
Als ihr die Dokumentationen ausgingen, las sie deren Blogs, Kolumnen und Memoiren. Sie wurde eifersüchtig auf die Mütter von Opfern von Amokläufen oder Polizeigewalt, weil die etwas hatten, wofür sie sich einsetzen konnten. Sie wusste nicht, welchen Zweck sie Jonis Ermordung zuschreiben sollte; sie fand keinen Sinn darin.
»Und dann stolperte ich über diese Frau – Marcia. Sie ist Amerikanerin. Ihre Tochter war 14 und wurde von zwei Mädchen ermordet, mit denen sie zur Schule gegangen war. Und in ihrem Blog ging es darum, dass sie … den Mörderinnen ihrer Tochter vergeben hatte und sich für mildere Strafen einsetzte und sogar … Eine der Täterinnen hatte im Gefängnis begonnen, Blindenführhunde auszubilden, und Marcia spendete einen Welpen für das Trainingsprogramm dieses Mädchens. Es machte mich wahnsinnig. Ich war noch nie zuvor so wütend gewesen. Ich schickte ihr diese durchgeknallte E-Mail, diese völlig irre, bestimmt fünfseitige E-Mail über alles, was mir zugestoßen war, und ich schrieb, dass ich sie für total krank und verrückt hielt und den Monstern, die mir meine Tochter genommen hatten, niemals verzeihen würde.«
Ich fragte, wie Marcia geantwortet hatte.
»Total großherzig. Ich verstehe Ihren Schmerz. Ich fühle Ihren Schmerz, das schrieb sie. Und sie … Ich will nicht näher drauf eingehen, aber am Ende half sie mir sehr«, sagte Amanda. »Wir sind immer noch befreundet. Ohne Marcia würde ich vermutlich nicht mit Ihnen sprechen, denn sie hat erzählt, wie befreiend es für sie war, den Journalisten zu unterstützen, der ein Buch über ihre Tochter geschrieben hat.«
Außerdem: Jonis Geschichte zirkulierte bereits. Nachdem sie einige Jahre lang gnädigerweise von allen außer der Lokalpresse ignoriert worden war, hatte die True-Crime-Maschinerie Amanda schließlich doch gefunden. Obwohl sie auf keinen Fall wollte, dass die Menschen zwischen Werbung für Matratzen und Kochboxen vom Mord an ihrer Tochter hörten, war es längst so weit. Und die Leute wollten mit ihr reden. Es gab kein Entkommen mehr vor den True-Crime-Machern. Machern wie mir, um ehrlich zu sein.
»Die Typen von I Pissed on Your Face oder wie auch immer haben mir E-Mails geschickt. Sie haben wohl Ärger für die Episode bekommen, weil sie so respektlos waren. Und dann schrieben sie mich an und fragten mich, ob … ob ich zu ihnen kommen würde, damit sie mich um Entschuldigung bitten konnten. Wie durchgeknallt ist das denn bitte? Wie beschissen schräg ist das denn?«
Andere Journalisten hatten angeklopft und Interviews, Buchverträge und Bargeld geboten. Mein Vorteil war, dass ich in Crow war, Freunde für mich bürgten (trotz meines Rufs) und – hauptsächlich – auch meine Tochter unter schrecklichen Umständen ums Leben gekommen war. Völlig anders, aber trotzdem schrecklich.
Selbst ein kurzes Leben ist komplex und erfüllt. Selbst tote Kinder sind voller Gegensätze, Fehler und Rätsel, die man nie ganz ergründen oder auflösen kann. Auch ein Schriftsteller, der im Genre so erfahren ist wie ich, kann sein Sujet nie perfekt einfangen. Ich kann eine schöne, akkurate Skizze von Joni entwerfen, aber auch die Skizze eines versierten Künstlers bleibt eine Skizze.
Amandas Eltern Jan und John betrieben eine Spielhalle namens Vegas by the Sea am Nordstrand. Amanda zeigte mir Fotos von an die Wand gesprühten Showgirls, Münzschiebern in Form von Roulettetischen, ein Bild von ihr mit acht oder neun, zahnlos grinsend vor riesigen Spielkarten-Neonlichtern. Das Geräusch von Spielautomaten klingt für Amanda noch immer tröstlich; sie sagte, wenn sie nicht schlafen könne, spiele sie ein zehnstündiges Youtube-Video mit Umgebungsgeräuschen aus Spielhallen ab.
Jan und John Black stammten nicht aus Crow. Sie zogen in den späten 60ern zu und eröffneten 1971 ihre Spielhalle, ohne sich mit dem verschworenen Kreis der Geschäftsleute und örtlichen Promis »gemeinzumachen«, die die Stadt übernommen hatten. Amanda kam vier Jahre nach der Eröffnung des Vegas auf die Welt.
Der Einfluss des verschworenen Kreises der Geschäftsleute wuchs in den 25 Jahren, die es das Vegas gab. Sie breiteten sich in der Kommunalverwaltung aus und machten es denjenigen schwer, ein Geschäft zu gründen oder zu halten, die nicht zu ihrem Herrenclub gehörten. Sie blockierten die Eröffnung neuer Läden von allen, außer von ihren eigenen Leuten, und gleichzeitig sanken die Preise rings um das Vegas by the Sea. Außerdem bekamen Jan und John regelmäßig willkürliche Strafen aufgebrummt (für den falschen Stellplatz ihrer Mülltonnen; die Anzahl an Feuerlöschern auf ihrem Grundstück; dafür, dass sie keine uralten Rechtsdokumente vorlegen konnten) und wurden vom Geschäftsmann Gerald Dowd[3] immer wieder mit zunehmend niedrigeren Kaufangeboten belästigt.
1996 gaben Jan und John auf und verkauften an Dowd. Einen Teil des Geldes schenkten sie Amanda, die damit eine Reise finanzierte. Sie war 21. Seit sie 13 gewesen war, hatte sie im Vegas gearbeitet und feierte ihren Karrierewechsel nun mit einem Urlaub. Sie hatte zwar noch keinen neuen Job, war aber überzeugt, dass sie nach ihrer Rückkehr problemlos etwas in einem Hotel oder einer Frittenbude finden würde. Sie wollte in Teilzeit arbeiten und am College Kurse für Kunstpädagogik belegen.
Sie flog nach Korfu, weil es im Reisebüro gerade ein Angebot gab. Club 18–30. Amanda fragte mich, ob ich mich an Reisebüros erinnern könne, ein wenig ungläubig, dass es jemals welche gegeben hatte. Sie buchte zusammen mit ihrer besten Freundin Julie.
Eigentlich hatte sie nach Ayia Napa reisen wollen, was teurer war. Sie hatte es in den Broschüren gesehen – blauer Himmel, weißer Sand. Aber Julie erzählte ihr, eine gemeinsame Freundin von ihnen sei in Ayia Napa ausgeraubt worden. Sie weigerte sich entschieden, dorthin zu reisen; besonders weil Korfu billiger war und genauso schön. Also wurde es Korfu. Amanda hatte noch nie einen Sommerurlaub gemacht. Zur Touristensaison musste sie im Vegas sein. Ihre Eltern nahmen sie während des Schuljahrs zu den seltsamsten Zeiten heimlich mit zur Costa del Sol oder auf die Kanaren. Ihre Kindheitsurlaube fanden immer im Februar und November statt.
Nun kaufte sich Amanda zum ersten Mal knappe Bikinis und Hotpants. Dann versteckte sie sie aus Angst, ihr konservativer Vater könnte sie finden. Am Abend vor ihrem Flug enthaarten sie und Julie sich gegenseitig die Beine mit Wachs.
Sobald Amanda im Hotel ankam, traf sie auf Freddy. Während sie und Julie ihre Koffer zur Rezeption schleiften, entdeckte sie ihn an der Hotelbar. Er war in ihrem Alter und groß, blond und gebräunt. Eigentlich stand sie nicht auf blonde Männer – ihre blassen Augenbrauen und Wimpern gefielen ihr nicht. Amanda fand, dass er nach Schickimicki aussah, aber das war er ganz und gar nicht. Er kam zu ihnen und bot an, ihre Koffer zu tragen. Sein Akzent klang schwer und vertraut.
»Hull?«, fragte sie ihn. Er nickte und wollte wissen, ob sie aus Scarborough kam.
»Fast«, sagte sie.
Sie stellten sich einander vor. Das Angebot mit den Koffern lehnte sie ab, versprach aber, ihn später zu treffen. Er lächelte sie an. Ohne sie zu bedrängen. Er stimmte zu und ließ sie gehen – fasste ihre Ablehnung nicht als Beleidigung oder Affront gegen seine Männlichkeit auf.
Die Gelassenen – Amanda mochte die gelassenen, netten Jungs, die ihre Freundinnen manchmal als »schlapp« bezeichneten. Sie hatte keine Lust auf die eifersüchtigen, gegen Wände boxenden Schläger, die den ganzen Sommer in ihrer Spielhalle herumlungerten, sich an den Hau-den-Lukas-Geräten maßen, die Greifautomaten schüttelten, den Mädchen auf der Straße nachriefen. Vielleicht war angesichts dessen ein Club 18–30-Urlaub nicht die beste Entscheidung. Aber sie fanden einander. Mand und Freddy, gleich am ersten Tag.
Später in der Bar winkte er ihr zu, rückte ihr jedoch nicht auf die Pelle. Julie und Amanda schlürften süße Drinks mit Papierschirmchen und Ananasrührstäben aus Plastik. An der Bar konnte man den Ozean hören. Amanda witzelte, dass sie besser nicht an die Küste gefahren wären; sie hätten zum Skifahren gehen sollen.
An jenem Abend trafen sich Freddy und Mand zufällig am Strand. Julie war mit einem Jungen verschwunden; Mand war zufrieden damit, ihr billiges griechisches Bier zu trinken und den Mond zu betrachten, warmer Sand zwischen ihren Zehen und in ihrem Haar. Freddy ließ sich neben sie fallen (nachdem er um ihre Erlaubnis gebeten hatte – »Hallo! Darf ich?«) und erzählte, wie er im Laufe des Abends seine vier Freunde verloren hatte, mit denen er hier war. Mand fragte, ob es ein Ausflug unter Kumpeln sei, und Freddy erklärte, er sei mit zwei Freundinnen und zwei Freunden unterwegs. Jetzt fand sie ihn noch netter. Er war ein Junge, der kein Problem damit hatte, wenn man Nein sagte, und er war mit Mädchen befreundet? Das war neu. Da ihre Freundin ebenfalls weg war, hatten sie schon mal etwas gemeinsam.
Eine Stunde lang redeten sie darüber, wo sie aufgewachsen waren und was sie so machten. Freddy quietschte neidisch, als sie ihm von der Spielhalle ihrer Eltern erzählte – Freddy liebte Spielhallen. Die Hälfte seiner Kindheit hatte er am Strand von Scarborough verbracht, mit von Eiscreme klebrigen Fingern, die nach dem Kupfer von Pennystücken rochen, und mit einem Haufen billiger Stofftiere aus den Greifautomaten in der Handtasche seiner Oma. An einer Zuckerstange hatte er sich ein Stück vom Schneidezahn abgebrochen und den Schaden nie beheben lassen – wenn er lächelte, konnte man durch die kleine Lücke seine Zunge sehen.
Jahre nachdem sich Mand und Freddy begegnet waren, würde auch ihre Tochter sich an einer Zuckerstange den Zahn abbrechen. Die Bruchstelle war ähnlich groß und geformt wie bei Freddy. Amanda sagte, all ihre Erinnerungen an Freddy seien fest mit Joni verbunden, selbst die vor deren Geburt. Sogar ihre eigene diffuse Kindheit verschmolz mit der ihrer Tochter. War es Amanda gewesen, die sich drei Milchzähne auf einmal gezogen hatte? Oder Joni? Hatten sie das beide im selben Alter getan? Sie glichen einander so sehr. Alle drei – Freddy, Mand und Joni. Wie ein Ei dem anderen.
Mand und Julie wurden in Freddys Urlaubsfreundesgruppe aufgenommen. Freddys Freunde zogen ihn auf – nach gerade mal zwei Tagen waren Freddy und Mand schon wie ein schnulziges Pärchen Frischverliebter; sie umflatterten einander wie kleine Vögel. Sie hatten einfach alles gemeinsam. Sie bestellten gleichzeitig ihre Piña colada. Beide hatten einen altmodischen Musik- und Filmgeschmack; Freddy proklamierte entschieden die Überlegenheit von Hendrix und Pink Floyd über modernen Britpop und Mand versprach, ihm New Skin for the Old Ceremony vorzuspielen, wenn sie zurück in Yorkshire waren und er sie besuchen kam. Beiden gefiel amerikanischer Grunge. Beide liebten Asphalt-Cowboy, Die durch die Hölle gehen, Taxi Driver.
»Es war unheimlich«, sagte Amanda. »Ich dachte, er würde mich aufziehen. Dass er mir nur zustimmte, weil er mir an die Wäsche wollte, und ich nie wieder von ihm hören würde, sobald wir zu Hause waren.«
Sie tauschten Telefonnummern und Adressen aus und versprachen einander, in Kontakt zu bleiben. Amanda erzählte, dass sie im Taxi zum Flughafen fast geweint habe; einerseits war sie glücklich wie nie zuvor, andererseits fürchtete sie, dass diese Geschichte im Sande verlaufen würde. Julie hatte einen gigantischen Kater und musste das Taxi anhalten lassen, um sich aus der Tür zu übergeben.
Sie kamen an einem Donnerstagabend nach Hause und Freddy rief sie um elf Uhr am Freitagmorgen an. Da wusste Amanda, dass er es ernst meinte. Ihre Mutter war ans Telefon gegangen und hielt beide Daumen hoch, als sie ihr den Hörer gab. Am folgenden Samstag kam Freddy zu Besuch.
Das war im Juli 1996. Im August 1997 flogen sie zusammen nach Zypern und Freddy hielt an einem Strand in Ayia Napa um ihre Hand an. Amanda zeigte mir ihren Ring, den sie noch immer trug – er ist antik, eine milchige Perle in einem Kreis aus kleinen Diamanten. Sie liebte den Ring. Und Freddy. Er zog zu ihr nach Crow.
Mand schloss das College ab und fing als freiberufliche Kunstlehrerin an. Sie besuchte Schulen und veranstaltete Aktionstage (Drucken, Batiken, Malen) mit Grundschulkindern und Kindern mit Lernbehinderung. Freddy arbeitete auf einer Bohrinsel in der Nordsee; zwei Wochen war er dort, zwei Wochen hatte er frei, was beiden gut passte. Der Verdienst kam ihnen zupass und genauso der Freiraum; die Intensität, wenn sie zwei Wochen zusammen waren, die Freiheit, wenn er zwei Wochen arbeitete.
Im September 1998 heirateten sie. Bei der Hochzeit gerieten Freddy und Mands Mütter Pat und Jan in Streit. Freddys Eltern gehörten der Arbeiterklasse an, blickten aber auf andere, ihrer Meinung nach gewöhnlichere Arbeiter herab. Und nichts wirkte gewöhnlicher als Mands Eltern: das messingblonde Haar und der protzige Schmuck ihrer Mutter, der Goldzahn und das rote Gesicht ihres Vaters. Pat runzelte die Stirn über Mands Bauchnabelpiercing.
Damit begann der Streit. Pat hatte kommentiert, wie schade es doch sei, dass man Amandas Bauchnabelring durch das Hochzeitskleid sah; nach zwei Flaschen Champagner sagte Jan zu Pat, sie solle sich verziehen. Dann, sie solle sich verpissen. Dann nannte sie sie eine fette, verklemmte Kuh. Um ein Haar hätten sie damit den ganzen Tag ruiniert. Pat weinte melodramatisch und die Mütter mussten getrennt werden. Mand war nur froh, dass sie bereits die Fotos gemacht hatten.
Die Flitterwochen verbrachten sie in Berlin, weil sie etwas machen wollten, das ein bisschen cool und ausgefallen war, und weil sie zu cool und ausgefallen für Strandurlaub waren. Amanda zeigte mir ein Foto von sich, auf dem sie vor einem Stück der Berliner Mauer das Peacezeichen macht. Ihre gebleichten Haare sind zu Space Buns frisiert und sie trägt ein kleines Bindi aus Plastik auf der Stirn. Sie erzählte, dass sie zu der Zeit ein großer Fan von Gwen Stefani war. Auf dem nächsten Bild ist Freddy zu sehen, mit Haaren bis zum Kiefer und einem schäbigen Nirvana-T-Shirt.
»Damals war ich ungefähr zehn Minuten lang mal cool«, sagte Amanda lächelnd. »Definitiv das coolste Mädchen in Crow, aber das bedeutet einen Scheiß. Dann wurde ich schwanger. Das soll jetzt nicht verbittert klingen, aber ich glaube einfach nicht, dass man eine coole Mum sein kann. Man verliert sofort sämtliche Glaubwürdigkeit, wenn man schwanger wird.
Als Teenager hab ich mich mal mit meiner Oma angelegt. Ich weigerte mich, zum Geburtstag meines Onkels im Arbeiterheim zu gehen, und sagte, ich wolle dort nicht tot überm Zaun hängen. Sie sah mich an und sagte dann etwas wie ›Mandy, du kannst dich so hochnäsig aufführen, wie du willst, aber eines Tages wirst du Scheiße unter deinen Nägeln kleben haben, und es wird nicht deine eigene sein‹. Daran musste ich denken, als ich zum ersten Mal Jonis Windel wechselte. Tatsächlich musste ich jedes Mal beim Windelwechseln daran denken.«
Amanda blickte auf ihre zarten Hände und musterte ihre Nägel, die bis aufs Bett abgenagt waren. Ich fragte sie, ob sie gern Mutter war.
»Klar. Die Scheiße unter meinen Fingernägeln hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Ich wirke vermutlich nicht wahnsinnig mütterlich, aber das täuscht. Ich liebe kleine Kinder und kümmere mich gern um Menschen. Deshalb mag ich auch meinen Job – ich bin gern mit Kindern zusammen und hatte gern eigene.«
Wir sahen uns Babyfotos an. Jonis winzige Hände um Amandas lange, dünne Finger geklammert. Kratzfäustlinge, Schaumbäder, Schnuller, weiche Decken. Joni, die auf Freddys Brust schläft. Auf einem Bild liegt die etwa sechs Monate alte Joni von 15 kleinen Teddys umringt in ihrer Krippe. Unter dem Foto steht in Amandas Handschrift: »Die Ältesten haben sich versammelt, um über dich zu richten.«
Die Post-on-Sea bezeichnete Amanda als »eisig«: