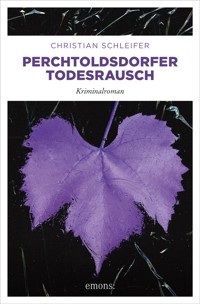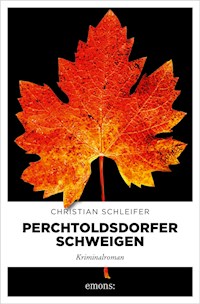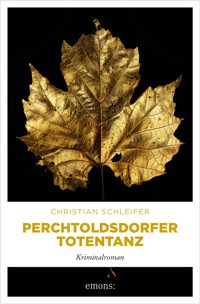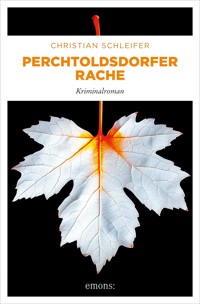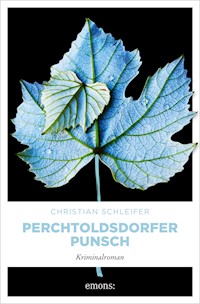
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Charlotte Nöhrer
- Sprache: Deutsch
Die Weinkrimiserie geht weiter: humorvolle Unterhaltung aus dem Wiener Speckgürtel. Stille Nacht, heilige Nacht? Nicht in Perchtoldsdorf! Der Wahlkampf der »Heimatpartei« sorgt für miese Stimmung, mitten im Ort soll ein Edelbordell eröffnen, und dann gibt es auch noch eine Bombendrohung gegen die Kirche. Als der Pfarrer vom Wehrturm gestoßen wird, reicht es der Charlotte endgültig. Die Jungwinzerin und Ex-Polizistin lässt ihren Punschstand auf dem Adventmarkt stehen und stürzt sich in die Ermittlungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 465
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Christian Schleifer, Jahrgang 1974, ist gebürtiger Perchtoldsdorfer, gefangen im Leben eines Wieners. Nach erfolgreichem Lehramtsstudium der Anglistik und Germanistik arbeitete er zwanzig Jahre lang folgerichtig als Sportjournalist bei zwei österreichischen Tageszeitungen, bevor er 2015 beschloss, sich mehr Zeit für seine Frau, die Zwillinge und das Krimischreiben zu nehmen.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2022 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: Johanna Schendel/Pixabay.com
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Uta Rupprecht
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-989-1
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Der Hofer war’s, vom Zwanzgerhaus!
Der schaut mir so verdächtig aus!
Der Hofer hat an Anfall kriagt
und hat die Leich da massakriert!
Da geht a Raunen durch die Leut,
und a jeder hat sei Freud.
Der Hofer war’s, der Sündenbock!
Der Hofer, den was kaner mog.
Wolfgang Ambros, »Da Hofa«
PROLOG
Nacht von Samstag, 13. Dezember, auf Sonntag, 14. Dezember
»Was zum Teu…!« Im letzten Moment verkniff sich der Perchtoldsdorfer Pfarrer Richard Kraus das böse Wort. War ja nun wirklich nicht schicklich, im (Neben-)Hause Gottes so zu fluchen.
Es war kurz nach Mitternacht, noch knapp zwei Wochen bis Weihnachten, und in wenigen Stunden musste er seine Predigt beim Sonntagsgottesdienst halten. Und daran arbeitete er in der Küche seiner Dienstwohnung gerade. Erinnerte ein wenig an einen Schüler, der erst am Vorabend für eine Schularbeit zu lernen beginnt. Aber – und das war ein großes ABER – Kraus machte seinen Job schon seit über vierzig Jahren. Den Großteil davon hatte er hier in der Perchtoldsdorfer Pfarre verbracht. Er kannte seine Schäfchen, umso mehr, als sie über die Jahrzehnte immer weniger geworden waren.
Natürlich hatte das auch mit dem unvermeidlichen »natürlichen Abgang«, wie es im Business-Deutsch so schön hieß, zu tun, aber die Zeiten, sie hatten sich eben geändert. Der regelmäßige Besuch der Sonntagsmesse war bei Weitem nicht mehr so selbstverständlich wie zu Beginn seiner Zeit als Geistlicher. Ein Schicksal, das er mit so gut wie allen Pfarrern in Österreich teilte.
Weil er schon so lange im Dienst war, machte er sich aber auch keine Sorgen, dass ihm für die Sonntagspredigt nicht etwas Passendes einfallen würde. Kraus war ein begnadeter Redner. Dass er zu diesem Zeitpunkt schon einen gewissen Illuminierungsgrad aufwies, hatte mit seiner Wurschtigkeit gegenüber der anstehenden Aufgabe wohl auch etwas zu tun.
Das »Damenspitzerl« war einem geselligen Beisammensein mit einigen seiner treuesten Schäfchen beim Punschstand zu verdanken. Zum Glück hatte er es diesmal nicht weit nach Hause ins Pfarrheim gehabt. Mit Schaudern erinnerte er sich noch an den Vorfall vor gar nicht so langer Zeit, als ihn das Nöhrer-Gör und ihr Cousin übers Ohr gehaut hatten. Direkt vor seiner Haustür hatten sie ein improvisiertes Planquadrat durchgeführt, nur um ihn unter Druck zu setzen, damit er ihnen vertrauliche Informationen gab. Mit Führerscheinentzug hatte ihm der Leo Nöhrer gedroht! Was war ihm schon übrig geblieben? Also war er eingeknickt, hatte sich erpressen lassen und die Informationen rausgegeben. Und was hatten sie jetzt davon? Eine ganze Familie war ausgelöscht worden. Er konnte das Gefühl, eine Mitschuld an dieser Tragödie zu tragen, nicht abschütteln.
Er war nicht beichten gegangen, zumindest nicht zu einem anderen Pfarrer, dafür kannte er seine Kollegen zu gut. Die würden in so einem Fall nicht dichthalten, Schweigegebot hin oder her. Deshalb hatte er sich die Beichte einfach selbst abgenommen. Als Sühne hatte er sich zehn Rosenkränze auferlegt und geschworen, dass er nie wieder so schwach sein und einknicken werde. Lieber den Führerschein verlieren. Besser aber nicht mehr betrunken mit dem Auto fahren. Das war einfacher.
Und genau so hatte er es auch an diesem Abend gehalten. Nach seinem kargen Abendmahl aus Salzerdäpfeln und einer gekochten Knacker (seine Haushälterin hatte sich ihren alljährlichen Vorweihnachtsurlaub genommen, um ihre Verwandtschaft in Polen zu besuchen) war er zu Fuß den kurzen Weg hinüber zum Weihnachtsmarkt am Kirchenvorplatz marschiert. Das waren ja nicht viel mehr als hundert Meter, also wirklich kein Grund, sich hinter das Steuer seines Autos zu klemmen. Am Weihnachtsmarkt hatte er pflichtbewusst jeder Punschhütte einen Besuch abgestattet (man wollte als Pfarrer ja alle gleich behandeln) und sich mit seinen zahlreich anwesenden Schäfchen unterhalten. Quasi das Ohr am Volksmund, sich ihre Sorgen und Nöte anhörend, weitab vom Beichtstuhl (allerdings nur im übertragenen Sinn, denn tatsächlich stand der Beichtstuhl nur zwanzig Meter vom Weihnachtsmarkt entfernt) und mit vom Alkohol gelockerter Zunge. So war er auch auf sein Thema für die Sonntagspredigt gekommen: die leidige Sache mit den Asylwerbern.
In wenigen Wochen fanden in Niederösterreich Landtags- und Gemeinderatswahlen statt, und so zuverlässig wie das Amen im Gebet, nur unheiliger, hatte die ÖHP (kurz für Österreichische Heimatpartei) den Wahlkampf frühzeitig gestartet, mit ihrem immer gleichen Thema, den Ausländern in Österreich. Kraus hatte das Gefühl, dass sie heuer einen Schritt weiter gingen als in den Jahren zuvor. Dementsprechend aufgeheizt – nicht zuletzt durch den Alkohol – waren auch die Diskussionen an den Punschständen. Es war halt immer einfacher, jemand anderem die Schuld an den eigenen Unzulänglichkeiten zu geben.
In Wirklichkeit lagen die großen Flüchtlingsströme schon einige Zeit zurück, und in Perchtoldsdorf war es sowieso nie zu einem gröberen Zwischenfall gekommen. Aus einer privaten Initiative war ein Flüchtlingshilfswerk hervorgegangen, das sich alle Mühe gab, die wenigen Dutzend Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan, die noch nicht weitergezogen oder zurückgeschickt worden waren, so gut es ging, zu integrieren und sich um sie zu kümmern. Der Gemeinde hatte man dafür ein ganzes Stockwerk im architektonisch scheußlichen Kulturzentrum abgeschwatzt. Dort gab es einige Notschlafstätten, ansonsten wurde es eben zum Netzwerken und für Integrationsprojekte verwendet. Einige der Asylwerber hatten Aushilfsjobs im Ort gefunden, andere warteten noch auf die Abwicklung ihres Verfahrens oder zitterten vor der Abschiebung in die Heimat. Selbst das Nöhrer-Gör hatte ein oder zwei Flüchtlinge als Aushilfskräfte bei sich aufgenommen. Apropos Nöhrer-Gör: Ihre Punschhütte hatte der Pfarrer natürlich als einzige ausgelassen. Nach der Aktion mit dem Planquadrat wollte er ihr nicht auch noch Geld in den Rachen werfen. Außerdem hielt er es da ganz mit dem Alten Testament: Auge um Auge, Zahn um Zahn und so weiter.
Seine Dienstwohnung befand sich im ersten Stock des Pfarrheims, erreichbar durch eine kurze Stiegenflucht. Und eben war dort eine der Topfpflanzen umgefallen, die seine Haushälterin seit Jahren mit Hingabe, aber leider nicht dem entsprechenden Talent, hegte und pflegte. Das hatte für seinen anfänglichen Fluch gesorgt.
»Wer hat denn schon wieder die Katze rausgelassen?«, schimpfte er in seinen durchaus ansehnlichen weißen Rauschebart. Kraus hätte, auch aufgrund seiner Körperfülle, einen hervorragenden Weihnachtsmann abgegeben. Hätte, denn als katholischer Pfarrer kam für ihn natürlich nur das Christkind in Frage.
Kraus erhob sich von seinem Platz in der Küchenessecke, ging den kurzen Vorzimmerflur entlang, riss die Eingangstür auf – und blickte in ein dunkel verschmiertes Gesicht. Stechende Augen musterten ihn, bevor sich der Eindringling unsanft Eintritt verschaffte. Aus einem schwarzen Vollbart blitzten dem Pfarrer im Zwielicht des schwach beleuchteten Stiegenhauses funkelnd weiße Zähne entgegen. Dann spürte Kraus einen stechenden Schmerz mitten im Gesicht, und ihm wurde schwarz vor Augen.
Als der Pfarrer wieder zu sich kam, konnte er weder Arme noch Beine bewegen. Auch das Atmen fiel ihm schwer, sein Mund war mit Gafferband zugeklebt. Der Kopf dröhnte, die gebrochene Nase schmerzte, und Atmen war fast unmöglich. Panik ergriff ihn. Der Angstschweiß tropfte von der Stirn direkt in sein angeschwollenes linkes Auge. Auch das tat weh. Der salzige Schweiß brannte darin wie Feuer.
Nach einigen Sekunden wurde sein Blick klarer. Er stellte fest, dass man ihn an einen seiner eigenen Küchenstühle gebunden hatte. Drei dunkle Gestalten saßen nebeneinander in der sonst so gemütlichen Essecke und machten sich an seinem Laptop zu schaffen, in den er noch vor wenigen Minuten die Stichworte für seine Rede getippt hatte.
Er kannte sich nicht mehr aus. Was wollten die drei Typen mit seinem Laptop? Der war uralt und gerade noch dazu zu gebrauchen, um Text zu schreiben und ein bisschen im Internet herumzusurfen. Und das auch nur, wenn die Seiten nicht zu überladen mit Grafiken waren. In so einem Fall zog der Laptop regelmäßig den Kürzeren und stürzte ab. Im nächsten Moment ärgerte er sich maßlos über sich selbst. Wieso hatte er sich nie angewöhnt, seinen Laptop zu sichern, wenn er ihn herumstehen ließ?
Kraus betrachtete die Einbrecher genauer. Sie murmelten ganz leise untereinander. Zu leise, um ein Wort oder auch nur die Sprache zu verstehen. Der Pfarrer schloss aber aus, dass es sich um Einheimische handelte. Ihre Gesichter waren dunkel verschmiert, wie man es sonst nur aus Kriegsfilmen kannte. Alle trugen Vollbärte und Kopftücher, die mit einem Band befestigt waren. Ein paar schwarze Locken lugten hervor. Das Gewand sah ein wenig sackmäßig aus, es war weit und aus leichtem Leinenstoff. Es musste sich um einen Kaftan handeln. Eigentlich viel zu kalt für diese Jahreszeit.
Der Pfarrer konnte es nicht fassen. Gerade eben hatte er an einer Predigt zur Verteidigung der islamischen Flüchtlinge gearbeitet, und da wurde er von irgendwelchen Arabern überfallen? Und überhaupt: Wer rannte hier schon so herum? Fehlte nur noch ein großer Säbel. Das war ja wie bei Karl May! Kraus begann, ernsthaft an seinem Gott zu zweifeln.
Einer der drei Männer tippte wild am Laptop herum. »Adler-Technik«, also nur mit den beiden Zeigefingern. Die beiden anderen sahen dennoch begeistert zu. Schließlich war der Tipperant fertig. Er warf seinen beiden Komplizen einen Blick zu, diese nickten, und schließlich drückte er mit einer langen Ausholbewegung auf eine Taste. Einen Moment später erklang ein kurzes »Ping«, und der Pfarrer wusste, dass die Männer ein E-Mail abgeschickt hatten. Aber wer zum Teufel (der Pfarrer bekreuzigte sich in Gedanken) brach in einem Pfarrheim ein und verprügelte den Pfarrer, nur um ein E-Mail von dessen Laptop abzuschicken?
Die Männer klappten den Laptop zu und packten ihn in einen mitgebrachten Rucksack. Dann begannen sie, die Wohnung zu verwüsten. Jede Lade wurde herausgerissen, die Schränke wurden geöffnet, und der Inhalt wurde am Boden verteilt. Die Marienstatue wurde aus ihrem Platz in der Ecke der Küche gerissen, zertreten und schließlich sogar geschändet. Einer der drei krempelte seinen Kaftan hoch und pinkelte mit einem heiseren Lachen auf den abgebrochenen Kopf der Holzfigur.
Mitgenommen wurde nichts. Allerdings hatte der Pfarrer bis auf einen billigen Flatscreen-TV, einen Blu-Ray-Player und eine uralte Stereoanlage auch keine Vermögenswerte in seiner Dienstwohnung. Als die Eindringlinge nach einer Viertelstunde mit ihrem Zerstörungswerk fertig waren, sah es in der Wohnung aus wie Sodom und Gomorrha.
Schließlich wandten sie sich wieder dem Pfarrer zu. Einer der Männer klaubte ein Küchenmesser vom Boden auf und fuchtelte wild vor dem Gesicht des Pfarrers herum. Kraus begann wieder zu schwitzen. Die Panik erfasste ihn immer heftiger und machte sich nun auch in seiner Brust breit. Ein Hilfeschrei verfing sich ungehört im Klebstoff des Gaffertapes. Die Männer lachten.
Dann ging der mit dem Messer langsam im Kreis um den gefesselten Kirchenmann herum. Ein Mal, zwei Mal, drei Mal. Kraus hatte die Augen geschlossen und soeben in Gedanken sein letztes Gebet gesprochen. Jeden Moment würde sein Peiniger auf ihn einstechen oder – eine noch schlimmere Vorstellung – ihm langsam die Gurgel durchschneiden.
Nach schier endlosen Sekunden kam der Schnitt. Und noch einer. Der Pfarrer fiel vornüber und knallte mit der zuvor gebrochenen Nase ungebremst auf den Holzboden. Erneutes Lachen. Sie hatten ihn nicht umgebracht! Nur die Fesseln durchgeschnitten. Einer der Männer zog ihn hoch und zwang ihm die Hände auf den Rücken. Dort machte sich ein anderer wieder mit dem Gaffertape zu schaffen. Mit am Rücken gefesselten Händen stießen sie Kraus zur Eingangstür.
Der geprügelte Pfarrer sah alles nur noch durch einen roten Schleier. Beim Aufprall am Boden hatte er sich auch noch eine Platzwunde an der Stirn zugezogen, das Blut rann ihm in die Augen. Die Schmerzen waren unbeschreiblich. Mit schlurfenden Schritten bewegte er sich langsam in die Richtung, in die ihn seine Peiniger drängten. Einer der Männer beugte sich zum linken Ohr des Pfarrers. »Weitergehen!«, zischte er leise. Auch dieses einzelne Wort gab Kraus keinen Hinweis, wer seine Kidnapper waren oder woher sie kamen.
Weiter ging es durch das Stiegenhaus, vorbei an der umgeworfenen Yuccapalme, dann standen sie im Freien. Das Pfarrheim lag direkt am Marktplatz, aber um diese späte Stunde und bei diesem Sauwetter – es hatte wieder einmal stark zu schneien begonnen – war niemand mehr unterwegs.
Zwei der Männer packten den Pfarrer links und rechts unter den Achseln, und so wurde der hilflose Mann Gottes davongeschleppt. Kurz darauf standen sie vor dem versperrten Eingang zum Wehrturm, gleich neben der Pfarrkirche. Sehnsüchtig verdrehte der Pfarrer den Kopf, suchte die vermeintliche Sicherheit seiner Kirche, aber die Kidnapper waren gnadenlos. Einer der Männer gab ihm eine schallende Ohrfeige, die Kraus zwang, den Blick wieder auf den Wehrturm zu richten.
Die Männer schien es nicht zu stören, dass das schwere Eingangstor versperrt war, einer zog einen Schlüssel aus seinem Kaftan. Momente später ging die Tür auf. Die drei sahen sich nochmals um, aber niemand hatte sie beobachtet. Die Fußspuren würden am nächsten Morgen auch kein Problem mehr sein – der Neuschnee würde sie komplett verdeckt und ausgelöscht haben. Kraus spürte eine Faust im Kreuz und stolperte ins Innere des Perchtoldsdorfer Wahrzeichens.
Schwache Notbeleuchtung erhellte das Innere der kleinen Eingangshalle. Eigentlich war das hier die Nikolauskapelle, aber sie wurde schon lange nicht mehr für kirchliche Zwecke genützt. In jeder der vier Ecken standen steinerne Heiligenstatuen, genau in der Mitte sah man den obersten Teil einer jahrhundertealten Zisterne. Sie war durch ein Metallgitter gesichert, damit kein neugieriges Kind die zehn Meter tief hinunter in den Schacht fallen konnte. Seine Entführer stießen den Pfarrer nun genau dorthin. Das Zisternenloch selbst war durch einen Holzverhau geschützt, ein Eck der Holzplanken bohrte sich schmerzhaft in die Hüfte von Kraus. Wieder eine Hand, diesmal im Nacken. Der Pfarrer gab seinen geringen Widerstand auf und ließ sich nach vorne drücken. Er schaffte es gerade noch, den Kopf zur Seite zu drehen, ehe er auf dem schmiedeeisernen Gitter aufprallte. Die ohnehin schon malträtierte Nase hatte so zwar nichts mehr abbekommen, dafür war jetzt auch noch sein Jochbein gebrochen. Der Schmerzensschrei verhallte aber wieder ungehört. Das Gaffertape hielt.
Diesmal lachten seine Peiniger nur leise. Eine gewisse Anspannung machte sich innerhalb der Gruppe breit. Hinter ihnen öffnete sich wieder das Tor, aber das schien niemanden zu beunruhigen. Der Pfarrer konnte nicht anders, er musste nach unten blicken. Sanftes orangefarbenes Licht erhellte den Grund der Zisterne, die schon längst kein Wasser mehr enthielt. Aber der Blick durch das Loch im Stein ins Innere unter dem Wehrturm war ein beliebtes Touristenmotiv, weil die Zisterne nicht einfach ein schmaler Schacht war, sondern sich in einigen Metern Tiefe zu Katakomben erweiterte. Diese wurden durch das orangefarbene Licht ausgeleuchtet.
Im nächsten Moment wurde der Pfarrer wieder hochgezogen, und jetzt sah er, wieso sich das Tor geöffnet hatte. Ein vierter Kidnapper hatte sich zu ihnen gesellt. Er war etwas kleiner als die anderen drei, schien aber der Anführer zu sein. Seine drei ursprünglichen Peiniger standen stramm wie bei einem militärischen Appell. Als die kleinere Gestalt nickte, wurde der Pfarrer vorwärtsgestoßen. Der Neuankömmling war so dicht verhüllt, dass es dem Pfarrer unmöglich war, das Gesicht zu erkennen.
Im rechten Eck, gleich neben dem Eingang zum Wehrturm, war eine weitere Tür, flankiert von zwei Heiligenstatuen. Jetzt, in der Nacht, sah die kleine Tür aus wie ein schmales schwarzes Loch, das weiß Gott wohin führte.
Was wollen die nur von mir?, fragte sich Kraus. Er empfand eine seltsame Ruhe. Ihm war klar geworden, dass er diese Nacht nicht überleben würde. Seinen Frieden mit Gott hatte er schon längst geschlossen. Er hatte ein erfülltes Leben gehabt, war seiner Berufung gefolgt und würde nun wohl im Namen seines Gottes sterben. Ein moderner Märtyrer. Nur wie ihn seine Entführer umbringen wollten (und warum), war ihm noch nicht klar.
Wieder eine Hand im Rücken. Sie stieß ihn auf die Tür zu, die natürlich nichts anderes als der Durchgang zu der engen Wendeltreppe war, die hunderteinundvierzig Stufen hinauf zur Spitze des Wehrturms führte. Mit all den Verletzungen und in seinem fortgeschrittenen Alter war der Aufstieg mühsam. Über vierzig Meter ging es in die Höhe, die restlichen gut zwanzig Meter machte das Keildach aus, das dem Wehrturm sein unverwechselbares Aussehen gab. Das Treppenhaus war so eng und niedrig, dass man sich stellenweise bücken musste, um sich nicht den Kopf anzustoßen. Nach einigen Minuten hatten sie den höchsten Punkt des öffentlich zugänglichen Teils erreicht – die Glockenstube. Der Zugang zur Glocke selbst war durch Gitter versperrt. Der Anführer stieß eine Holztür auf. Sie führte ins Freie auf einen Wehrgang, der weniger als einen Meter breit war und einmal komplett um den Turm herumlief. Die Steinbrüstung reichte den Vermummten bis zum Nabel. Auch wieder ein Zeichen, dass der Turm zu einer ganz anderen Zeit und für ganz andere Bedürfnisse gebaut worden war.
Ein eisiger Wind fegte ihnen den Schnee ins Gesicht. Die kleinen, messerscharfen Schneekristalle bissen sich in die Wangen des Pfarrers, aber sein Empfinden für Schmerz war schon längst erloschen.
Kraus wurde an die Brüstung gepresst. Trotz seiner misslichen, ja hoffnungslosen Lage bewunderte er den nächtlichen Ausblick. Von hier aus konnte man an einem klaren Tag kilometerweit in jede Richtung schauen. Da, wo Kraus jetzt gezwungenermaßen stand, reichte der Blick von Wien über das südliche Umland bis zum Wienerwald. Direkt unter ihnen lagen der Marktplatz und seine Ausläufer, eine Bushaltestelle und ein kleiner Grünbereich mit einer Handvoll der für diese Gegend so typischen Föhren. Von hier aus konnte man auch in die vielen kleinen, versteckten Innenhöfe der alten Häuser sehen. Was sich hier für architektonische Schätze befanden, von denen die meisten Einheimischen gar nichts wussten! Alles war von Schnee bedeckt, der das orangefarbene Licht der Straßenbeleuchtung und den Mondschein so stark reflektierte, dass es fast schon so hell wie während der Dämmerung war. Nur der starke Schneefall verhinderte einen genaueren Blick auf Details.
BOOHOONNNGGGG! BOOOHHOOONNNNGGGGG! Die Turmuhr über ihnen schlug zwei Uhr morgens. Vor Schreck hielten sich die Entführer die Ohren zu. Auch Kraus hätte das gerne getan, aber seine Hände waren ja hinter dem Rücken gefesselt. Als wieder Ruhe eingekehrt war, nickten sich die vier zu. Einer schrie: »Alluha akbar«, riss Kraus das Gaffertape vom Mund, durchschnitt die Fesseln, und dann spürte der Pfarrer wieder eine Hand im Rücken. Der Druck wurde immer größer, bis er schließlich das Gleichgewicht verlor. Seinen Entführern schien es nicht schnell genug zu gehen, schließlich packten sie ihn an den Beinen. Kraus sah noch, wie der Ausblick vor ihm kippte. Statt der ruhigen Winterlandschaft blickte er auf einmal kopfüber auf die Steinwand der Brüstung. Den Rest übernahm die Schwerkraft. Kraus schloss die Augen und wartete. Eine noch nie da gewesene Klarheit erfasste ihn, und stumm ergab er sich in sein Schicksal.
Kurz vor dem Aufprall schrie er dann doch noch.
Die Neuschneemengen fingen seinen Aufprall ab. Ein wenig.
Zu wenig. Wenn hundert Kilo aus vierzig Metern Höhe ungebremst auf die Erde klatschten, konnte das so oder so kein schönes Ende nehmen.
In einem Haus gegenüber dem Wehrturm ging Licht an.
1. Teil
1
Nacht von Samstag, 13. Dezember, auf Sonntag, 14. Dezember
Am Anfang war das Wort. Eigentlich waren es sogar zwei Wörter: »Alluha akbar!« Wenige Sekunden später folgte ein Schrei. Der ist phonetisch schwer wiederzugeben, war es doch, wie wir wissen, ein Todesschrei. Nein, stimmt nicht ganz. Es war ein Beinahe-Todesschrei. Oder ein Kurz-vor-dem-Tod-Schrei.
Wurscht, es klang auf jeden Fall so wie: »Aaaaaahhhh!« Bei ganz genauem Hinhören hätte man sogar noch ganz leise ein »Scheiße!« vernommen.
Der Schrei also beziehungsweise die Schreie dauerten ein, zwei Sekunden, dann war wieder Ruhe. Die Charlotte war sich nicht sicher, ob sie wirklich etwas gehört hatte. Sie stand nämlich zitternd und bibbernd vor der Turmbar, ihrem Stammlokal. Mit halb erfrorenen Fingern schob sie sich eine widerspenstige kastanienrote Locke unter ihre Wollmütze. Sie wollte nur ein bisschen frische Luft schnappen. Drinnen war es dermaßen verraucht, dass ihr bereits der Kopf brummte. Die Musik, die trotz geschlossener Tür wummernd ins Freie dröhnte, machte es ihr fast unmöglich zu entscheiden, was sie da jetzt gehört hatte. Tatsächlich einen menschlichen Schrei? Vielleicht waren es nur zwei Katzen gewesen, die sich um eine tiefgefrorene Maus stritten. Und das »Alluha akbar« davor? Ja, sie war schon ein bisschen betrunken (leicht untertrieben), aber sie war sich sicher, dass es eigentlich »Allahu akbar« heißen musste. Und überhaupt! Was taten laut grölende Araber, die nicht mal die eigene Sprache richtig beherrschten, um diese Uhrzeit im beschaulichen Perchtoldsdorf?
Sie schüttelte den Kopf, um ihn wieder frei zu bekommen. Wohl alles nur eingebildet. Die Tür zur Turmbar öffnete sich, und sie wurde von der Andrea nach drinnen gezogen.
»Komm schon!«, brüllte die Freundin ihr ins Ohr, um sich über die laute Musik hinweg irgendwie verständlich zu machen. Die blonden Haare der Andrea kitzelten sie in der Nase. Die Charlotte ließ sich reinziehen und mit der Menge mittreiben. Masse, ja, das war so eine Sache in der Turmbar. Die war zwar gesteckt voll, aber das bedeutete, dass sich vielleicht fünfzig Leute eng aneinanderpressten, um in der kleinen, aber feinen Cocktailbar wenigstens einen Stehplatz zu haben. Die Luft war zum Schneiden, die Augen tränten. Der Charlotte schmerzten die Zehen von den unzähligen Malen, die irgendein Idiot beim Vorbeigehen draufgestiegen war.
»Soll ich dir den Schmerz wegküssen?«, hauchte die Andrea an ihrem Kopf, was die feinen Härchen an Charlottes Ohr strammstehen ließ. Sie nahm die Einladung an. Nach nur drei Sekunden löste die Andrea wieder ihre Lippen von der Charlotte.
»Ich habe so einen Durst«, sagte sie laut lachend und zerrte die Charlotte nach vorne zu ihren Plätzen direkt an der Bar. Der Mario, Barbesitzer und Chefbarkeeper in einer Person, warf der Charlotte einen kurzen Blick zu und begann sofort, ihr einen weiteren Cuba Libre zu mixen.
Als das dunkle, süß-säuerliche Getränk vor ihr stand, versuchte die Charlotte zu rekonstruieren, wie viel sie heute schon getrunken hatte. Wenig war es nicht gewesen. An ihrem Punschstand am Weihnachtsmarkt gleich ums Eck hatte sie die letzte Schicht gemacht. Das hieß Dienst bis zweiundzwanzig Uhr. Davor hatte sie sich um ihren Heurigenbetrieb oben in den Weinbergen von Perchtoldsdorf gekümmert. Jener Heurige, der zum elterlichen Weingut gehörte und in den sie nach knapp zehnjährigem, selbst auferlegtem Exil als Polizistin in Wien im letzten Frühjahr reumütig wieder zurückgekehrt war. Als Juniorchefin hatte sie dort mittlerweile kaum einen Stein auf dem anderen gelassen und sich damit nicht nur Freunde gemacht.
Der Samstag war der erste Ausstecktag gewesen, und da sollte alles rundlaufen – weshalb die Chefin persönlich anwesend sein musste. »Musste« ist jetzt natürlich ein starkes Wort, denn der Herr Papa und das restliche Personal hätten das schon ganz gut auch ohne die Frau Juniorchefin hinbekommen. Aber die Charlotte wollte halt unbedingt mittendrin sein und ein bisschen Flagge zeigen. Schön und gut, dass sich auch der Herr Papa, quasi der Alt-Chef, um den Betrieb kümmern wollte, aber sie kannte ihren Papa bestens. Gerade am ersten Tag würden seine ganzen Spezln vorbeischauen, und dann war es nix mehr mit Arbeiten.
Vor einem Jahr war das noch ganz anders gewesen. Da hatte die Charlotte mit dem elterlichen Betrieb nix zu tun haben wollen. Da war aber ihre selbst auferlegte Alternativkarriere als Polizistin auch schon vorbei gewesen und die Charlotte auf einem langweiligen Security-Posten in einer großen Shoppingmall im Süden Wiens gelandet. Dann war der Skiurlaub in Schladming gekommen, und fast über Nacht hatte sich alles geändert.
In der Folge hatte die Charlotte die Zügel im Weingut der Eltern in die Hand genommen. Das war dem Herrn Papa zu Beginn nicht einfach gefallen (obwohl er es sich ja immer gewünscht hatte, aber Wunsch und Realität waren dann eben doch zwei verschiedene Paar Schuhe), aber inzwischen hatte er gelernt, dass er sich voll und ganz auf seine Tochter verlassen konnte. Eigentlich auf seine Töchter, denn da war ja auch noch die Flora, die kleinere, sechzehnjährige Tochter. Die ging zwar noch zur Schule, hatte aber ihrer fast doppelt so alten Schwester im letzten Jahr nicht nur einmal hilfreich unter die Arme gegriffen. Und das nicht nur, was das Geschäft betraf.
Also, wie viel Alkohol hatte sie schon intus? Beim Heurigen hatte die Charlotte nicht viel getrunken. Zwei oder drei Achterl vielleicht, um mit ein paar der treuesten Stammgäste anzustoßen, aber die hatte sie gar nicht ganz ausgetrunken. Vor einem Jahr hätte das noch gereicht, dass sie sich halb komatös hätte hinlegen müssen. Inzwischen hatte sie sich eine dem Winzertum keinesfalls abträgliche Trinkfestigkeit zugelegt. Das Beste war, dass das quasi ganz von alleine funktioniert hatte. Sie hatte sich gar nicht besonders anstrengen müssen.
Beim Punschstand war es dann ein wenig anders. Sie hatte dort die Flora abgelöst, die die Frühschicht von zehn bis sechzehn Uhr übernommen hatte. Um kurz vor sieben Uhr abends war dann der werte Herr Pfarrer aufgetaucht und hatte sich quer durch alle Punschstände getrunken. Nur ihren hatte er ausgelassen. Sie wusste schon, warum, aber trotzdem ärgerte sie dieses kindische Verhalten. Daraufhin hatte sie einen Punsch zur Beruhigung getrunken. Und noch einen. Und noch einen. Und dann … hatte die Andrea sie gepackt und auf einen Hocker gesetzt, ihr tief in die Augen geschaut, einen feuchten Kuss auf die Lippen gedrückt und gesagt: »So, genug gesoffen, Charly. Komm wieder runter. Der alte Pfaffe ist es doch gar nicht wert.« Natürlich wusste die Charlotte, dass ihre Freundin recht hatte und dass sie sich total kindisch aufführte, aber das änderte nichts an der Tatsache, dass es sie ganz furchtbar wurmte, wie auffällig Pfarrer Kraus einen großen Bogen um gerade ihren Stand machte.
Den anderen Besuchern des Weihnachtsmarkts war das natürlich nicht aufgefallen, lediglich ein junges Mädchen – oder eher schon eine junge Frau – hatte das Ganze mit einem verschmitzten Lächeln registriert. Die Charlotte hatte sie im Ort schon ein paarmal gesehen, aber nie näher mit ihr zu tun gehabt. Hübsch war sie. Lange, glatte schwarze Haare, blasse Haut, rote Lippen, eisblaue Augen – man hätte fast meinen können, das Schneewittchen wäre direkt aus den Seiten eines Märchenbuchs in die Realität gesprungen. Die Charlotte schätzte sie auf achtzehn, neunzehn Jahre.
Das Engelsgesicht hatte am späten Nachmittag zwei Punsche bei der Charlotte getrunken und sich zwischendurch unters Publikum gemischt. Auch mit dem Pfarrer hatte sie geplaudert, obwohl der offensichtlich wenig Wert auf eine Unterhaltung mit dem schwarzhaarigen Engel legte. Nicht, dass es den Engel gestört hätte. Sie hatte weiter selig vor sich hin gelächelt und war noch vor dem Pfarrer wieder verschwunden. Die Charlotte hatte keinen weiteren Gedanken an sie verschwendet, zu sehr war sie noch auf den Pfarrer grantig.
Pünktlich um zweiundzwanzig Uhr hatte sie den Punschstand dichtgemacht, nach Hause wollte sie aber noch nicht. Eine Whatsapp-Nachricht von der Flora hatte ihr versichert, dass daheim alles gut laufe und sie sich den Rest des Abends freinehmen solle. Das musste man ihr natürlich nicht zweimal sagen. Ein kurzer, tiefer Blick in die Augen der Andrea, und die Sache war klar.
Also saß man ein paar Minuten später auch schon beim Mario in der Turmbar. Dort war an diesem Abend zwar wegen einer Geburtstagsfeier »geschlossene Gesellschaft«, aber der Mario hatte sie einfach zu sich an die Bar geholt, ihnen zwei Cuba Libre vor die Nase gestellt und nur gemeint: »Passt schon, ab Mitternacht ist sowieso wieder für alle geöffnet.« Da ist dann auch der Leo, der Cousin der Charlotte und der lokale Chefinspektor, eingetrudelt. Er war aber nicht wegen der Charlotte und der Andrea da, sondern wegen der Elena. Das war die brandneue Kellnerin vom Mario. Sie kam aus Tschechien. Ein echt heißer Zahn, wenn man auf den Look stand …
Platinblonder Pagenkopf (»nuttenblond«, wie die Charlotte zu dieser ganz speziellen Blondierung immer sagte – wobei sie in diesem Fall gar nicht so falschlag), üppige Brüste, die am liebsten aus dem knappen Dekolleté gesprungen wären, endlos lange Beine und ein Hüftschwung beim Servieren der Getränke, der die männliche Hälfte des Lokals schwindlig machte, weil man bei jedem Schritt unwillkürlich mit dem Kopf mit hin- und herschwingen musste. Dazu noch ein rauchiger, östlich angehauchter Akzent.
Wenn alles nach Plan lief, würde die Elena aber nicht allzu lange ihre Brötchen als Kellnerin verdienen. Sie war die erste »Dame«, welche von der Magda aus ihrer ehemaligen Heimat Tschechien nach Perchtoldsdorf importiert worden war, weil sie hier ein – natürlich streng legales – Luxuspuff aufsperren wollte. Darüber wusste der Leo als Polizeichef des Orts selbstverständlich Bescheid. Dass die Elena dort in Zukunft anschaffen würde, wusste der Leo allerdings (noch) nicht. Glaubte zumindest die Charlotte. Aber er war ja ein großer Bub, und die Charlotte wollte ihm seine Träume nicht zerstören. Abgesehen davon: Es hatten sich sicher schon seltsamere Paare gefunden als ein Polizist und eine Nutte. Auf Anhieb wollte ihr jetzt aber keines einfallen.
Die Magda selbst war nicht anwesend. Sie hatte – und nicht zu Unrecht – einen Teil der Zaitler-Erbschaft eingestrichen. Mit dem Geld wollte sie sich jetzt wieder in ihrem alten Beruf selbstständig machen. Die Sache mit dem Bordell war schon recht weit vorangeschritten, was dafürsprach, dass die Magda das schon länger geplant hatte. Es fehlten nur noch die letzten behördlichen Bewilligungen, dann konnte sie loslegen.
Die Finanzspritze aus dem Zaitler-Erbe war eine überraschende, aber natürlich willkommene Unterstützung gewesen. Und der Leo wusste, er würde mit dem Etablissement noch genug Arbeit haben. So legal und verantwortungsbewusst konnte die Magda das Puff gar nicht führen, als dass es nicht früher oder später irgendwelche Wickel geben würde. Und wenn es nur deswegen war, weil daheimgebliebene Ehefrauen den Leo ständig auf die Suche nach ihren »abgängigen« Göttergatten schickten.
Was mit dem Zaitler-Weingut passieren würde, stand noch in den Sternen. Verwandte gab es keine mehr, also würde es wahrscheinlich komplett oder in Teilen versteigert werden. Baugrund für neue Luxuswohnungen wurde im Ort immer gesucht – und gut bezahlt.
Daran verschwendete die Charlotte momentan aber noch keinen Gedanken. Ja, sie wollte zwar einen Teil der Zaitler-Weingärten kaufen, aber die Marianne – die Einzige, an der ihr von dieser Familie etwas gelegen hatte – war ja noch nicht einmal unter der Erde. Das Begräbnis fand erst nächste Woche statt. So lange wollte die Charlotte aus Pietätsgründen auf jeden Fall warten, ehe sie sich einen genauen Schlachtplan zur Anschaffung der für sie interessanten Parzellen überlegte.
Ein Griff an die Hüfte und eine sanft nach oben wandernde Hand rissen die Charlotte schließlich aus ihren Tagträumen. Der Andrea war langweilig, und sie wollte ein bisschen herumschmusen. Weil grundsätzlich gehört ja sowieso viel mehr geschmust. Kein Problem, dachte die Charlotte und ließ sich – bildlich gesprochen – fallen. Eine halbe Stunde später checkte sie ihr Äußeres im kleinen Wandspiegel auf der Damentoilette. Ihr Lippenstift war komplett weg, der Eyeliner im ganzen Gesicht verschmiert. Das war aber eher auf die brütende Hitze in der Bar zurückzuführen. Wenigstens konnte sich die Charlotte nicht erinnern, dass ihr die Andrea auch die Augen abgeschleckt hätte.
Zurück zum Alkohol. Die Charlotte hatte also schon circa zwei Achterl, mehrere Häferl Punsch und mindestens drei oder vier Cuba Libre intus. Sie wunderte sich, dass sie überhaupt noch gerade stehen konnte. Durch die warmen Temperaturen in der Bar schien sie den Alkohol aber genauso schnell auszuschwitzen, wie sie ihn in sich hineinschüttete.
Das Problem war eher der Rauch. Der war ihr zu sehr in den Kopf gestiegen. Und in die Augen. Und in die Nase. Und überhaupt. Sie hatte unbedingt frische Luft gebraucht. Also war sie kurz vor die Tür getreten, und da hatte sie – hatte sie wirklich? – den eigenartigen Schrei gehört. Jetzt saß sie vor ihrem x-ten Cocktail und wurde langsam müde. Eigentlich wollte sie nur noch ins Bett. Die Andrea war dem Vorschlag nicht abgeneigt – wenngleich mit anderen Hintergedanken als die Charlotte –, und so verabschiedeten sie sich. Arm in Arm schlenderten sie das schmale Gässchen über vereistes Kopfsteinpflaster zum Marktplatz. Da auch die Andrea zu viel getrunken hatte, wollten sie ein Taxi nehmen. Das Auto würde sie am nächsten Vormittag holen.
»Mist, wir müssen noch mal zum Punschstand.« Die Charlotte fluchte.
»Wieso? Hast noch nicht genug getrunken?«, lallte die Andrea amüsiert.
»Bäh! Für heute reicht’s mir. Nein, ich muss meinen Schlüsselbund dort vergessen haben.« Zur Kontrolle griff sie noch mal in alle Mantel- und Hosentaschen, aber sie fand nur ihr Handy, eine Packung Zigaretten und die Schlüssel für die Punschhütte. Also machten sie einen kleinen Umweg.
Direkt unterhalb des auf einem kleinen Hügel erbauten Wehrturms führten ein paar breite Steinstiegen hinauf zum Kirchenvorplatz. Links und rechts säumten alte, hohe Föhren die Treppen, die Wiese darunter war – wie alles andere in diesem Winter – von einer dicken Schneedecke eingehüllt. Die Stiegen waren, natürlich, um diese Uhrzeit wieder mal weder geräumt noch gestreut, und so musste sich die Charlotte am dünnen Eisengeländer festhalten, das seitlich in den Stein geschraubt war. Es herrschte völlige Stille, nur das Knirschen ihrer Schuhe im frischen Schnee war zu hören. Die Stille hielt genau so lange, bis ein spitzer Schrei sie durchbrach. Die Charlotte fuhr vor Schreck zusammen, bevor sie registrierte, dass der Schrei von direkt neben ihr kam. Es war die Andrea gewesen. Sie war kreidebleich im Gesicht und starrte an der Charlotte vorbei auf eine Stelle unter den Föhren. Dann übergab sie sich geräuschvoll. Herrgott, nicht schon wieder, dachte die Charlotte ein wenig genervt. Aber das war nun mal die Reaktion der Andrea, wenn sie plötzlich vor einer Leiche stand. Was eben jetzt wieder einmal der Fall war. Gut, der Anblick, der sich ihnen bot, war wirklich kein schöner. Der viele Schnee hatte den Aufprall des Pfarrers zwar gemildert, aber trotzdem war die Wucht so groß gewesen, dass es den Körper des Geistlichen ziemlich, nun ja, zerrissen hatte.
Kraus war mit seiner Breitseite aufgeschlagen. Die linke Seite des Körpers war zerdrückt und aufgeplatzt, graue Gehirnmasse hatte sich in die schmelzende Schneedecke ergossen. Darunter hatte sich rasch stockendes Blut gemischt, das aus unzähligen natürlichen (und unnatürlichen) Körperöffnungen herausgepresst worden war. Nein, es war wirklich kein schöner Anblick.
Nach einigen Momenten fing sich die Charlotte wieder. Automatisch reichte sie der Andrea ein Taschentuch aus ihrer Manteltasche, damit sie sich den Mund abwischen konnte. Ein kurzer Blick nach unten reichte, um zu sehen, dass die Andrea ihr auch noch auf die Stiefel gekotzt hatte. Fuck, dachte die Charlotte, die waren noch brandneu! Na ja, das war jetzt ihr geringstes Problem. Während sie ihr Handy herausholte und die Nummer vom Leo wählte, wischte sie ihre Stiefel in einem Schneehaufen am Rand der Stufen ab.
Nach fünfmaligem Läuten hob der Leo endlich ab.
»Jetzt ist schon wieder was passiert«, murmelte die Charlotte gefasst ins Handy.
»Zu viel Wolf Haas gelesen, Cousinchen?« Der Leo schmollte gut hörbar. Offenbar war er noch immer fleißig beim Anbraten der Elena.
»Ich wusste gar nicht, dass du so belesen bist, mein Bester«, maulte die Charlotte zurück. »Reiß dich von deiner Elena los, da machst sowieso keinen Stich, außer du hast genug Bares dabei«, sagte die Charlotte. Sie trampelte ganz bewusst auf den Gefühlen ihres Cousins herum.
»Was soll das schon wieder …?«
»Ach, komm schon, Leo. Ist dir echt noch nicht aufgefallen, was für eine deine Elena ist? Aber egal, schwing deinen Arsch zum Marktplatz herüber. Der Pfarrer ist tot.«
»Der Pfarrer? Wo bist du genau?«
Die Charlotte beschrieb dem Leo, wo sie über die Leiche des Pfarrers gestolpert waren. Drei Minuten später war er schon bei ihnen. Überraschenderweise mit der Elena im Schlepptau.
Ob sich da tatsächlich eine Pretty-Woman-Geschichte anbahnte? Der Leo musste sich jedenfalls fast schon gewaltsam losreißen, so fest hatte die Elena ihn an der Hand. Oder in der Hand?, fragte sich die Charlotte.
»Ist dir nicht kalt?«, wandte sie sich an die Aushilfskellnerin, die es nicht für nötig befunden hatte, sich für den Ausflug ins Freie etwas überzuwerfen. Sie stand in ihrem Minirock und dem gerade das Notwendigste bedeckenden Oberteil da und zitterte nicht einmal.
»Nein«, gurrte die Elena. »Leo macht mich so heiß!«
Oh. Mein. Gott. Das waren die einzigen drei Wörter, die der Charlotte dazu einfielen, die sie aber geflissentlich für sich behielt. Augenverdrehen durfte (und musste) aber sein.
Dann wandte sie sich dem Leo zu. Der war schon über die Steinbrüstung auf die Wiese gehechtet und sah sich den Leichnam genauer an.
»Ihr bleibt unten«, wies er seine Cousine an. »Ich habe schon den Rest der Mannschaft verständigt. Nicht dass ihr mir irgendwelche Spuren kaputt macht.«
»Ach, und was ist mit dir?«, schnappte die Charlotte zurück.
»Was soll mit mir sein?«, konterte der Leo. »Nur weil du selbst mal Polizistin warst, weißt du nicht automatisch alles besser. Und schau dich doch mal um: Ich habe genau zwei Schritte gemacht, sonst gibt es hier keine Spuren. Also beruhig dich, mehr mache ich auch nicht.«
Ein paar Minuten später waren Teile des Marktplatzes und der Kirchenvorplatz in pulsierendes blaues Licht getaucht. Die Einsatztruppe war angekommen und hatte den Schauplatz weitläufig abgesperrt. Rundherum in den Häusern und Wohnungen ging Licht an, vereinzelt wurden sogar Fenster geöffnet. Völlig egal, dass es zweistellige Minusgrade hatte.
»Was ist denn da los?«, wollten einige Leute wissen, empört über die späte Störung.
Antwort gab es keine, außer: »Kommt schon, Leute, gehts wieder schlafen. Ihr verpasst hier nix.«
Was natürlich eine glatte Lüge war. Die auch als solche verstanden wurde. Niemand schloss sein Fenster, niemand machte das Licht aus, niemand ging zurück ins Bett. Wer wollte sich schon einen Live-»Tatort« direkt vor der eigenen Haustür entgehen lassen?
Der Leo hatte die Elena in der Zwischenzeit wieder zurück in die Turmbar geschickt. Es war ihr doch zu kalt geworden, und außerdem wäre sie jetzt sowieso nur im Weg. Die Charlotte und die Andrea hatten sich in ihre Punschhütte zurückgezogen, wo sie von einem Kollegen vom Leo einvernommen wurden. Die Charlotte beschrieb das wenige, was sie zu der Geschichte aussagen konnte. Und die Spurensicherung versuchte, dem tückischen Schnee alles an Spuren zu entlocken, was möglich war.
Die Leiche des Pfarrers war inzwischen in die Gerichtsmedizin abtransportiert worden, vor Ort hatte der Polizeiarzt aber einige interessante Feststellungen gemacht. So war die Nase des Pfarrers gebrochen gewesen, obwohl Kraus mit der Seite des Kopfes aufgeschlagen war. Er führte das auf einen direkten Schlag mitten ins Gesicht zurück. Rund um den Mund fehlten dem Pfarrer büschelweise Barthaare, was darauf schließen ließ, dass sein Mund zuvor mit einem Klebeband geknebelt gewesen sein musste. Das alles sprach für einen eiskalten Mord und gegen Selbstmord. Eine Theorie, die schon die Charlotte und der Leo aufgestellt hatten, während sie auf den Rest der Truppe warteten. Die Charlotte hatte dem Leo erzählt, dass der Pfarrer ihren Stand nur wenige Stunden zuvor wie der Teufel das Weihwasser gemieden hatte. Aber sich wegen dieser Geschichte vor ein paar Tagen gleich vom Wehrturm zu stürzen?
Das mit dem ausgerissenen Bart war dem Leo zunächst gar nicht aufgefallen. Nachdem ihn der Polizeiarzt darauf hingewiesen hatte, ließ der Leo sofort das Pfarrheim absperren und durchsuchen.
Die Charlotte heftete sich an seine Fersen, als der Leo die paar Schritte hinüber zum Pfarrheim ging. Die Andrea kam gezwungenermaßen mit. Es war noch gar nicht so lange her, dass sie gemeinsam in der Wohnung vom Pfarrer Kraus gewesen waren, jetzt war sie aber kaum mehr wiederzuerkennen.
»Da hat sich jemand ganz schön zu schaffen gemacht«, stellte der Leo trocken fest.
»Weiß man schon, ob was fehlt?«
»Keine Ahnung. Wir haben seine Bedienerin noch nicht ausfindig machen können. Die wohnt doch sonst auch hier irgendwo im Haus.«
Die Charlotte wollte nicht länger warten. Vorsichtig tippelte sie an den weiß gewandeten Beamten der Spurensicherung vorbei und versuchte, sich in Erinnerung zu rufen, wie die Wohnung ausgesehen hatte, als sie den Pfarrer zuletzt besucht hatte. Der Fernseher war noch da, auch die Stereoanlage. Über fehlenden Schmuck oder Geld konnte sie natürlich nichts sagen.
»Hat man den Laptop schon gefunden?«, rief sie über ihre Schulter zum Leo. Der warf einen fragenden Blick zu einem der Spurensicherer.
»Nö, Chef. Wir haben hier schon alles durchsucht, aber einen Laptop haben wir nicht gefunden.«
Die Anwesenheit der Charlotte wunderte oder störte keinen der Beamten. Sie hatte sich in den letzten Monaten mehr als fähig und nützlich erwiesen, wenn es um die Aufklärung von Kriminalfällen ging.
»Komisch«, raunte die Charlotte dem Leo zu. »Die Einbrecher lassen den Fernseher da und offenbar auch sonst alles, aber den uralten Laptop vom Kraus nehmen sie mit?«
»Da ist noch etwas Komisches«, mischte sich der Spurensicherer wieder ein. »Wir haben eine zerstörte Marienstatue gefunden.«
»Was ist daran komisch?«, bellte der Leo zurück. »Die haben hier einfach alles zerstört. Müssen einen richtigen Hass auf den Kraus gehabt haben.«
»Aber nicht so«, erwiderte der Spurensicherer. »Wer auch immer das war, hat nämlich auf die Marienstatue gepinkelt. Wer macht denn so was?«
Ja, tatsächlich. Wer machte so etwas?
»Dann haben wir jetzt wenigstens eine DNA-Spur«, beendete der Leo das Gespräch und schaute seine Cousine von seinen eins neunzig herab ratlos an. »Lass uns rausgehen«, sagte er schließlich.
Im Stiegenhaus des Pfarrheims fragte er die Charlotte: »Was hast du dem Kollegen denn vorhin zu Protokoll gegeben? Gibt es irgendwas, was du mir noch nicht erzählt hast?«
Die Charlotte dachte kurz nach, dann sagte sie: »Ja, ich bin um zwei Uhr vor die Tür der Turmbar gegangen, da habe ich etwas gehört. Oder auch nicht. Ich bin mir nicht sicher, deshalb habe ich es auch nicht angegeben.«
»Um zwei Uhr?«
»Ja, ich weiß es noch genau, weil die Turmuhr zwei geschlagen hat.«
»Was hast du gehört?«
»Gute Frage. Ich weiß es wirklich nicht genau. Hätte ein Mensch sein können oder auch zwei streitende Katzen. Hey, du hast doch gesehen, in welchem Zustand ich vorhin war. Außerdem habe ich am ganzen Körper gezittert, weil mir so kalt war.«
»Scheint fast so, als hätte es sich um einen Menschen gehandelt«, meinte der Leo nachdenklich.
Die Charlotte nickte zustimmend. Ja, schien fast so, als hätte sie den letzten Schrei des Pfarrers gehört.
Jetzt stellte sich nur noch die Frage, ob irgendwer etwas gesehen hatte. Aber das war um diese Uhrzeit eher unwahrscheinlich.
»Wir werden uns in den Häusern am Marktplatz trotzdem mal umhören«, beschloss der Leo. Damit wandte er sich wieder seinen Kollegen zu.
Die Charlotte war inzwischen wieder so ausgenüchtert, dass sie sich zutraute, sich hinter das Steuer ihres Autos zu setzen. Wer sollte jetzt schon kontrollieren? Die Polizei war gerade anderweitig beschäftigt.
Eine halbe Stunde später fielen die Charlotte und die Andrea todmüde in ihr Bett. Es war fünf Uhr in der Früh, und der Charlotte graute schon vor dem nächsten Morgen. Was man vom Morgen selbst noch nicht behaupten konnte. Draußen war es nach wie vor stockfinster, bis zur Dämmerung waren noch über zwei Stunden Zeit.
Die Charlotte fiel in einen traumlosen Schlaf. Um zehn Uhr sperrte der Heurige auf, und sie sollte dann eigentlich so frisch wie ein Frühlingsmorgen sein, um ein Auge auf ihren Betrieb zu haben. Die Vorstellung, dass dies tatsächlich der Fall sein würde, ließ sie sogar im Schlaf herzhaft grinsen.
2
Sonntag, 14. Dezember
Völlig überraschend wachte die Charlotte ganz von selbst schon um acht Uhr wieder auf. Der Mord am Pfarrer ließ ihr keine Ruhe, er hatte sie bis in ihre Träume verfolgt. Die Andrea war da ganz anders. Sie schlief noch tief und fest, während sich die Charlotte die letzten Reste Alkohol und Nikotin aus ihren Poren duschte.
Um halb neun stand die Charlotte schon in der Frühstücksstube des Weinguts. Diese war gut gefüllt, am Vortag hatte ein Reisebus eine Ladung von zwanzig Gästen ausgespuckt, die bis nach Heiligabend bleiben wollten. Am Weihnachtsabend wurde die Christmette aus der Pfarrkirche europaweit live im Fernsehen übertragen. Um bei diesem Ereignis live dabei zu sein, hatten sich im ganzen Ort mehr Touristen als gewöhnlich angemeldet – obwohl der Platz in der Pfarrkirche natürlich begrenzt war.
Das Weingut der Nöhrers war ja inzwischen nicht nur Heuriger und Wohnhaus der Familie, denn die Charlotte hatte als eine ihrer ersten Aktionen im letzten Jahr einen Teil des alten Vierkanthofs in einen kleinen, aber feinen Hoteltrakt umgewandelt. Seitdem lief das Geschäft durchgehend, nicht mehr nur zu den Stoßzeiten, wenn der Heurigenbetrieb auch offiziell geöffnet hatte.
Durch das »Buschenschankgesetz« waren die erlaubten Öffnungszeiten für Heurige nämlich auf einige Monate pro Jahr beschränkt. Den Rest des Jahres durfte man zwar »ab Hof« verkaufen, aber das Lokal selbst nicht betreiben. Ausnahmen waren geschlossene Gesellschaften wie Hochzeitsfeiern. Aber davon allein konnte man natürlich nicht leben.
Freundlich und als wäre nicht vor wenigen Stunden der Pfarrer umgebracht worden, flanierte die Charlotte zwischen den Frühstückstischen durch. Ein »Hallo« hier, ein »Wie geht’s?« dort, dazu noch ein »Gut geschlafen?«, und die Gäste waren glücklich. Auch wenn sich die Charlotte – im Gegensatz zu ihrer Mutter – nicht in ein touristenfreundliches Dirndl gezwängt hatte, sondern lieber normal in Jeans und Pulli herumlief. Der Hoteltrakt befand sich in einem anderen Gebäudeteil des Weinguts, durch ein paar Türen gelangte die Charlotte aber rasch in den Heurigen, ohne einen Fuß ins Freie setzen zu müssen.
Der Schneefall hatte in der Früh aufgehört, der ganze Innenhof war von einer festen Schneedecke eingehüllt. Auch die kahlen Äste der hundertfünfzig Jahre alten Kastanie und das Dach des direkt darunterliegenden alten Presshauses mitten im Hof waren von einer dicken weißen Schicht bedeckt. Ein paar Meter daneben war das ausgehobene Loch für die Wiederherstellung des historischen Weinkellers mit einer dicken Plane abgedeckt, die, um das Gewicht des Schnees zu tragen, von unten mit schweren Holzpfeilern gestützt wurde.
Die Arbeiten waren vor einigen Tagen eingestellt worden, als das Wetter einfach zu schlecht geworden war. Fortsetzung im Frühjahr. Inzwischen wurde lediglich am geplanten Showroom weitergearbeitet, der auf halbem Weg zwischen Oberfläche und Weinkeller in einem Seitenarm des vorhandenen Kellerabgangs eingerichtet wurde. Da waren sich die Erdaushebungsarbeiten gerade noch ausgegangen. Jetzt konnte man sich bereits daranmachen, die notwendigen Leitungen und Anschlüsse zu verlegen, ehe – ebenfalls im Frühjahr – alles verputzt und auf Hochglanz gebracht werden würde.
Vom Himmel strahlte eine kühle Wintersonne, deren kraftlose Strahlen sich in den glasklaren Schneekristallen millionenfach widerspiegelten. Der Fernblick durch das Panoramafenster war atemberaubend, eine vorweihnachtliche Stille hatte sich über die malerische Gegend gelegt. Eigentlich ein Bild wie aus einer Tourismusbroschüre. Wäre da nicht der Herr Papa gewesen, der mit einem kleinen Schneeräumtraktor geräuschvoll einen Weg von der Einfahrt quer durch den Hof freischaufelte. Natürlich mit dem dazugehörigen Geknatter und Gebrumme. »KNIRSCH! KRATZ! KNARSCH! KNIRSCH! KRATZ! KNARSCH!«, machte die schwere Schaufel, wenn sie über den Boden schleifte. Der Herr Papa war aber nicht alleine, wie die Charlotte erkennen konnte. Der Noah, der Pflegesohn der Nöhrers mit halbseidener Vergangenheit, war mit einer normalen Schneeschaufel zugange, um die restlichen Gehwege im Hof vom Schnee zu befreien.
Die Charlotte schaute ihrem Vater durch das Fenster nach, bis er am großen Einfahrtstor angekommen war. Mittels Fernbedienung öffnete er das schwere Tor, das auch Platz für einen größeren Traktor bot, fuhr hinaus und machte sich daran, den Besucherparkplatz zu räumen. Spätestens zum Mittagstisch würde dieser gesteckt voll sein. Wie inzwischen schon traditionell bot der Nöhrer-Heurige am ersten Sonntag des Aussteckens den ganz speziellen Schweinsbraten mit Semmel- und Erdäpfelknödeln von der Omama an – zu einem Spezialpreis. Um die notwendige Menge vorzubereiten, waren die Omama und die Frau Mama den ganzen Samstag in der Küche gestanden. Die Charlotte hatte zuschauen dürfen, jedoch nichts angreifen! Die Omama liebte ihre Enkelin über alles, doch sie wusste: Die Charlotte konnte viel, nur kochen nicht. In dieser Hinsicht hatte die Charlotte sogar richtige Giftfinger. Der Ruf von Omamas Schweinsbraten war im Ort noch selten ungehört verhallt. Also hatte man sich für einen wahren Ansturm gewappnet.
Als die Charlotte in die erste Gaststube eintrat – jene, in der sich auch die Getränkeausschank und das Büfett befanden –, strömte ihr bereits der unwiderstehliche Duft des Schweinsbratens entgegen. Zu sehen war niemand. Sie ging weiter in die Küche, wo sie ihre Frau Mama und die Omama fand, die wie wild Knödel rollten, um sie in riesigen Töpfen mit köchelndem Wasser zu versenken.
»Ah, auch schon munter?«, wurde sie von der Frau Mama empfangen. Das Verhältnis zwischen den beiden war grundsätzlich nicht schlecht, aber irgendwie auch nicht … na ja, es war in letzter Zeit etwas abgekühlt. Die Frau Mama hatte zwar ohne großes Aufsehen akzeptiert, dass ihre ältere Tochter lesbisch war, ließ sie in letzter Zeit aber immer wieder spüren, dass sie sich damit schwertat, ihr zu verzeihen, dass sie von ihr keine Enkelkinder erwarten durfte.
Als die Charlotte letzten Winter wieder ins Hotel Mama eingezogen war, hatte sich das noch ganz anders angefühlt. Da war die Frau Mama heilfroh gewesen, dass die verlorene Tochter endlich wieder in den Schoß der Familie zurückkehrte. Selbst die Andrea hatte sie herzlich empfangen und als Lebensgefährtin ihrer Tochter akzeptiert. Im Lauf der Monate schien ihr aber aufgefallen zu sein, dass es halt eben doch keine »normale« Beziehung nach ihrem Weltbild war. Nicht, dass sie es die Andrea hätte spüren lassen, nein, da gab sie sich schon alle Mühe. Aber die Charlotte … das war ein ganz anderer Fall. Zum Fräulein Tochter durfte man ja doch ein wenig offener sein, nicht? Und es konnte sicher nicht schaden, wenn man ab und zu anmerkte, man wünsche sich von den eigenen Kindern eigentlich schon (»erwartete« wollte sie dann doch nicht sagen), dass sie die Eltern mal mit Enkelkindern beglückten. Wer sollte denn sonst einmal den Hof übernehmen, wenn es keine potenziellen Erben gab? Da hatte sich die Familie über Generationen die Hände wund gearbeitet, und dann kam die moderne Erziehung, und auf einmal sollten Kinder keine Priorität mehr sein? Das war die Sichtweise der Frau Mama.
Der Standpunkt der Charlotte war folgender: Wieso war Muttern überhaupt der Meinung, dass sie sich von ihr keine Enkelkinder erwarten durfte? Heutzutage gab es ja auch ganz andere Wege und Möglichkeiten, das zu bewerkstelligen. Musste ja nicht immer unbedingt durch steroidbedingte männliche Turboeinspritzung erfolgen. Diesen Gedankengang wollte sie aber nicht gemeinsam mit der Frau Mama weiterspinnen, das war ihr einfach zu mühsam. Die Omama war da ganz anders. Sie busselte die Charlotte ab, drückte sie mit ihren klebrigen Knödelmachfingern an sich und schob ihr einen Bissen eines fertigen Erdäpfelknödels in den Mund.
»Hm, köstlich«, schmatzte die Charlotte mit vollem Mund, was ihr einen liebevollen Wangenschnalzer von der Omama einbrachte.
»Wo ist denn die Flora?«, wollte sie von ihrer Mutter wissen.
»Die richtet drüben in der Stube die Tische her. Warum?«
»Ich möchte sie fragen, ob sie mich zu Mittag vertreten kann.«
»Schon wieder zu viel getrunken?«, fragte die Mama eisig. Das war auch so eine Sache. Die Frau Mama hatte überhaupt kein Verständnis, dass die Charlotte nach wie vor gerne ihr Leben lebte und in vollen Zügen genoss. Sie stammte eben noch aus einer Generation, wo man lieber gestorben wäre, als sich als Frau öffentlich betrunken sehen zu lassen.
»Auch«, antwortete die Charlotte schließlich resignierend, »aber das ist ja schon wieder alles weg.« Mein Gott, dachte sie, die Madame ist aber heute wieder mal mit dem falschen Fuß aufgestanden. »Ich möchte runter zum Sonntagsgottesdienst«, erklärte sie schließlich.
»Ach, seit wann ist dir denn das so wichtig?«
»Wieso nicht? Ab und zu kann es ja nicht schaden.«
Natürlich war die Charlotte neugierig, wie die Gemeinde mit dem Verlust ihres Pfarrers umgehen würde. Konnte man so schnell überhaupt einen Ersatz herankarren? Es mangelte schließlich sowieso an allen Ecken und Enden an Pfarrern. Wie auch immer, bis dahin war noch mehr als eine Stunde Zeit. Sie verließ die Küche, fand ihre Schwester in der anderen Gaststube und nahm ihr das Versprechen ab, für geordnete Bahnen zu sorgen, sobald der Heurige öffnete.
Auch der Flora kam es etwas eigenartig vor, dass ihre große Schwester plötzlich ganz erpicht darauf war, in die Kirche zu gehen, fragte aber nicht lange nach. Sie hatte mit dem Noah selbst eine lange und nicht ganz alkoholfreie Nacht hinter sich und war ganz froh, dass sie heroben im Warmen bleiben durfte und nicht in den Ort runtermusste, um die Punschhütte aufzusperren. Das übernahm jetzt die Charlotte. Viel war da ja nicht zu tun, die Hütte musste nur aufgesperrt, befüllt und an eine ihrer Kellnerinnen übergeben werden.
Die Charlotte wanderte quer durch das Haus zurück zu ihrer Wohnung und weckte die Andrea.
»Wohin gehen wir?«, fragte die schläfrig.
»Du hast schon richtig gehört. Wir gehen in die Kirche. Oder interessiert es dich nicht, wer den Kirchenschäfchen da heute die Leviten lesen wird?«
»Nicht wirklich«, seufzte die Andrea, rollte sich dann aber doch aus dem Bett. Am Marktplatz fanden sie schnell einen Parkplatz, von den Geschehnissen der letzten Nacht war kaum mehr etwas zu sehen. Wenn man mal die unzähligen Fußabdrücke an der Stelle, wo der Pfarrer aufgeschlagen war, außer Acht ließ. Aber das war so weit entfernt vom Kircheneingang, dass es niemandem wirklich auffiel.
Der Weihnachtsmarkt hatte noch geschlossen, am Sonntag öffnete er erst unmittelbar nach dem Ende des Gottesdienstes. Trotzdem herrschte dort schon hektisches Gewusel. Die Standbetreiber waren alle damit beschäftigt, ihre Hütten auf den Ansturm nach der Messe vorzubereiten. Kurz vor Weihnachten waren die Leute ja besonders katholisch. Und mit dem Christkind wollte es sich auch niemand verscherzen.
Die Charlotte und die Andrea schlenderten zu ihrer Hütte, wo bereits die Inaaya, eine Aushilfskellnerin, auf sie wartete. Inaaya war eine achtzehnjährige Syrerin, der die Flucht aus der Kriegshölle gelungen war und die es dann irgendwie nach Perchtoldsdorf verschlagen hatte. Das war gewesen, nachdem sich Panik und Angst in ganz Europa breitgemacht hatten und die Flüchtlingsrouten geschlossen worden waren. Aber wo ein Wille, da auch ein Weg, und so dicht konnte man die Routen gar nicht schließen, dass es ein paar ganz Desperate nicht doch nach Europa schafften. Die Inaaya und rund zwei Dutzend anderer Flüchtlinge wurden von einem privaten Verein im Perchtoldsdorfer Kulturzentrum versorgt und beraten, bis sie endlich Bescheid bekamen, ob ihre Asylanträge positiv oder negativ bearbeitet wurden. Die Inaaya konnte sich durchaus Hoffnungen machen, in Österreich bleiben zu dürfen. In der Zwischenzeit hatte sie sich bei den Nöhrers als Aushilfe verdingt.
Die Charlotte sperrte auf, kontrollierte kurz den Warenbestand und übergab dann an die Inaaya. Die machte große Augen, als sich die Charlotte und die Andrea von ihr verabschiedeten. Es war das erste Mal, dass sie alleine für die Punschhütte verantwortlich war.
»Du schaffst das schon«, sagte die Charlotte vertrauensvoll. »Außerdem geht es ja eh erst nach Ende der Messe los.«
»Danke, ich werde mir Mühe geben«, antwortete die Inaaya nahezu akzentfrei. Sie hatte in ihren ersten zwei Jahren hier in der Fremde alles darangesetzt, sich so schnell wie möglich zu integrieren, und als Erstes versucht, sich die neue Sprache anzueignen. Etwas, was man nicht von allen Flüchtlingen behaupten konnte. Faule Äpfel gab es da wie dort. Das wusste auch die Charlotte, und sie hatte die Inaaya nicht zuletzt wegen ihrer Emsigkeit ausgesucht. Aber auch wenn nicht alle Flüchtlinge einen so großen Integrations- und Arbeitswillen an den Tag legten, war die Angst- und Hasspropaganda der Rechten in den letzten Monaten doch maßlos übertrieben. »Obezahrer« und Mistviecher gab es unter der heimischen Bevölkerung ebenfalls. Das war wohl auf der ganzen Welt so.
In der Kirche wuselte es zehn Tage vor Weihnachten nur so vor Besuchern. Vor allem der Anteil an Kindern war höher als sonst während des Jahres. Geschnäuzt und gekampelt und in ihre feinsten Sonntagsanzüge und -kleider gezwängt, waren sicherlich gut drei Dutzend unter Zehnjährige in der Kirche versammelt.
Alles erweckte den Anschein, als würde der Gottesdienst abgehalten. Am Kircheneingang war kein Zettel gehangen, der etwas anderes verkündet hätte. Die Messdiener und Ministranten hatten auch schon ihre Positionen bezogen. Die Charlotte und die Andrea tupften ihren Zeige- und Mittelfinger in das Weihwasserbecken neben dem Eingangstor, bekreuzigten sich, machten einen kurzen Knicks und nahmen dann in einer der Reihen etwa in der Mitte der Kirche Platz. Es waren noch gut zehn Minuten bis zum Beginn der Messe. Pseudointeressiert blätterten die beiden in den aufgelegten Liederbüchern, und obwohl die Kirche zu gut drei Vierteln gefüllt war, war es fast schon unheimlich leise. Verhaltenes Tuscheln, ab und zu ein Quieken von einem der Kinder, aber das war es dann auch schon.