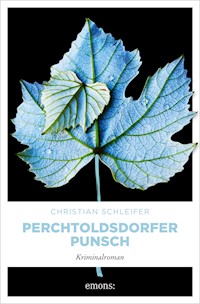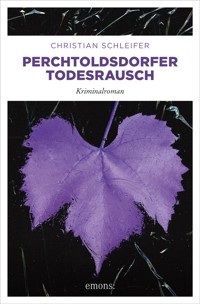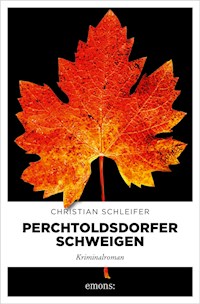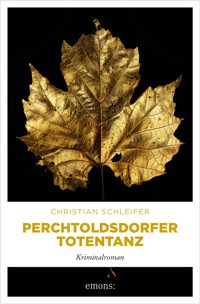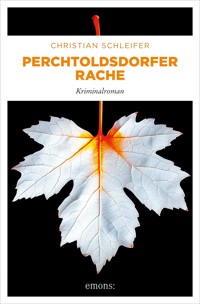
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Charlotte Nöhrer
- Sprache: Deutsch
Abrechnung in Perchtoldsdorf Eine tödliche Familienfehde wirft ihre dunklen Schatten, und die Charlotte steckt wieder mittendrin. Die Premiere des ersten internationalen Tennisturniers im beschaulichen Weinort Perchtoldsdorf wird von einer Reihe mysteriöser Morde überschattet. Die Opfer haben eines gemeinsam: Sie alle gehörten zwei prominenten Familien des Landes an, unter anderem der von Charlottes Erzfeind Adefris. Für sie ist daher klar, dass sie mit der Aufklärung des Falls nichts zu tun haben will. Aber das Leben ist nun mal kein Wunschkonzert, und so muss sich die Charlotte wohl oder übel in die Ermittlungen stürzen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christian Schleifer ist gebürtiger Perchtoldsdorfer, gefangen im Leben eines Wieners. Nach erfolgreichem Lehramtsstudium der Anglistik und Germanistik arbeitete er zwanzig Jahre lang folgerichtig als Sportjournalist bei zwei österreichischen Tageszeitungen, bevor er 2015 beschloss, sich mehr Zeit für seine Frau, die Zwillinge und das Krimi-Schreiben zu nehmen.
www.christian-schleifer.com
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© Emons Verlag GmbH
Cäcilienstraße 48, 50667 Köln
www.emons-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept
von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Uta Rupprecht
E-Book-Erstellung: Geethik Technologies Pvt Ltd
ISBN 978-3-98707-329-8
Originalausgabe
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Für Jety – einer wie keiner
Wer auch immer gesagt hat: »Es geht nichtum Gewinnen oder Verlieren«,hat wahrscheinlich verloren.
Martina Navratilova
Aufwärmen
Eigentlich hätte der Hagen Adefris diesen Ausblick ja in vollen Zügen genießen müssen. Hoch über den Dächern von Perchtoldsdorf und noch über den letzten Wipfeln der Föhren, die sich vom Rand des Ortskerns am kleinen, aber feinen Hochberg in den Himmel reckten, war das Panorama, das sich vor ihm erstreckte, wirklich beeindruckend. Blickte man nach links, dann schmiegten sich die Perchtoldsdorfer Weinberge in die sanften Hügel, die stetig steiler wurden, bis sie an der Ortschaft Gießhübl, dem höchsten Punkt im Bezirk Mödling, endeten. Und rechter Hand lag das in dieser Herrgottsfrüh noch verschlafene Wiener Becken. Sanfter Dunst hing wie ein Weichzeichner über der dösenden Hauptstadt, die von den ersten Sonnenstrahlen des Tages in ein kitschiges Pastelllicht getunkt wurde.
Geradeaus schaute der alte Adefris hinunter auf den noch verlassen daliegenden Marktplatz von Perchtoldsdorf, die Kirche und die alte Herzogsburg, wo im Burghof noch die Reste der Festspieltribüne herumstanden. Erst am Vorabend war unter tosendem Applaus die letzte Aufführung von »Einen Jux will er sich machen« zelebriert worden, diesmal ganz ohne Tote. Ganz im Gegensatz zu den Festspielen vor einem Jahr, die von zwei Morden überschattet gewesen waren. Und die – für den Adefris nach wie vor völlig unverständlich – zum gesellschaftlichen und medialen Aufstieg dieses nervigen Nöhrer-Görs geführt hatten.
Hagen Adefris wusste nicht, wieso ihm die Nöhrer gerade jetzt einfiel, denn eigentlich hatte er ganz andere Sorgen. Nein, er fragte sich nicht, welches dieser wunderbaren Landschaftsbilder er mit seiner Kamera einfangen sollte. Seine Sorgen waren viel existenziellerer Art.
Der alte Adefris war nämlich kurz davor zu sterben. Genauer gesagt, gekreuzigt zu werden. Seine Peiniger hatten sich auch wirklich alle Mühe gegeben, ihn leiden zu lassen wie einst Jesus. Erst hatten sie ihn über den vor einigen Jahren errichteten Kreuzweg mit seinen zwölf Stationen die paar Kehren vom Ortszentrum hinauf zum »Gipfel« des Hochbergs getrieben.
Bei jeder Station hatten sie ihm ein Kleidungsstück vom Körper gerissen, ihn geschlagen und getreten. Bis sie ihn, oben angekommen, auch noch seiner Boxershorts entledigten. Aber nicht, ehe ihm ein wahrer Henker von einem Mann die Shorts mit einem Ruck so hoch gezogen hatte, dass seine Beine den Bodenkontakt verloren und seine Eier so fest zusammengequetscht wurden, dass ihm schwindlig geworden war. Dann hatte er ihn einfach fallen lassen.
Zusammengekauert wie ein Embryo im Mutterbauch lag der Adefris ein paar Minuten im vom Morgentau feuchten und kalten Gras, während seine Peiniger ihre Vorbereitungen abschlossen. Er verstand nicht, was die sechs Männer miteinander redeten, sie sprachen irgendeine slawische Sprache. Was den alten Adefris nur in der Überzeugung bestätigte, dass die im Osten allesamt Un- und vor allem Untermenschen waren. Wäre es nach ihm und seinen Gesinnungsgenossen gegangen, hätte man diesem Pack schon in der »guten alten Zeit« gemeinsam mit den Juden den Garaus gemacht.
An Flucht war jedenfalls nicht zu denken. Auf dem Weg herauf hatte ihm das Ostgesindel nicht nur ein paar Rippen gebrochen, sondern auch einige Stichverletzungen mit einem Messer zugefügt. Er fühlte sich unendlich schwach und ausgeliefert. Aber er war ein Mann deutschen Bluts und würde den Teufel tun, vor diesen inferioren Ausländern um Gnade zu winseln.
Was das Tschuschenpack wahrscheinlich gar nicht wusste, war, dass der Platz hier bereits in der Bronzezeit von den alten Germanen als Kultstätte benutzt worden war. In seiner Lage fand der Adefris dies auf eine geradezu trotzige Art tröstlich. Ja, germanisches Blut, das war halt etwas anderes als dieser dünne Slawensaft. Unwillkürlich verzog der Adefris das Gesicht zu einer Art Grinsen.
In diesem Moment schaute der Henker von seiner Arbeit mit einem Schlagbohrer auf. Er marschierte zum Adefris, stemmte die Hände in die Hüften und schüttelte den Kopf. Dann schlug er dem Adefris mit dem Schlagbohrer heftig ins Gesicht, und der alte Germane verlor für ein paar Sekunden die Besinnung. Als er wieder zu sich kam, war an Grinsen nicht mehr zu denken. Auch nicht an Reden oder Um-Hilfe-Schreien (nicht, dass das Sinn gemacht hätte, es war weit und breit niemand, der die Schreie hören konnte). Schon das Schlucken fiel mit einem mehrfach gebrochenen Kiefer schwer …
Die Sonne stieg langsam höher, aber es konnte noch nicht später als fünf Uhr morgens sein. Doch rundherum erwachte nun das Tierleben.
Er hatte noch immer nicht den leisesten Schimmer, wie er überhaupt hierhergekommen war. Seine letzte Erinnerung stammte von seinem Heurigenbesuch am Vorabend. Ja, es war spät geworden, man hatte in einer Runde Gleichgesinnter vielleicht einen oder zwei oder drei über den Durst getrunken, aber keinesfalls so viel, dass er ein Blackout gehabt hätte. Der Adefris kannte seine Trinkkondition. Und trotzdem war da dieser Filmriss. Als er aufgewacht war, hatte er sich in den Fängen der sechs Ostblockler befunden und war den Kreuzweg hinaufgezwungen worden. Aber wieso gerade er? Seine Peiniger hatten keinerlei Forderungen gestellt, ihn nicht einmal beschimpft. Eigentlich hatten sie überhaupt nicht mit ihm, sondern nur untereinander geredet. Und auch da nur das Notwendigste. Ein wenig gesprächiger waren sie lediglich geworden, wenn es darum ging, ihn zwischendurch ein bisschen zu foltern.
Vier kräftige Arme zwangen den alten Adefris auf die Beine und zogen ihn zum Steinkreuz mit der Jesusfigur, wo der Henker auf einer kleinen Leiter stand. Er nahm den Adefris dort oben entgegen, als wäre er kein erwachsener Mann, sondern ein kleiner Junge. Wenig zimperlich presste er ihn mit dem Rücken gegen die steinerne Gestalt des Gekreuzigten. Dann wurden seine Arme links und rechts in die Waagrechte gezwungen (viel Widerstand leisten konnte er ohnehin nicht mehr), und es ertönte ein Geräusch, das jedem Hobbywerker die Freudentränen in die Augen getrieben hätte. Der Henker hatte den Schlagbohrer angeworfen.
Der wird doch nicht wirklich …, durchfuhr es den Adefris entsetzt. Tat er aber. Eine zehn Zentimeter lange Schraube bohrte sich in seine rechte Handfläche und eine weitere in die linke Hand. Die Schmerzen waren unerträglich, aber durch den gebrochenen Kiefer kam kein Laut.
Hingerichtet wie ein Judenhund, schoss es dem Adefris durch den Kopf, ehe der Schmerz die Herrschaft übernahm. Als Nächstes kamen seine Füße an die Reihe, für die seine Peiniger eine noch längere Schraube nahmen. Und diesmal war der Schmerz so stark, dass der Adefris die Besinnung verlor.
Als er wieder zu sich kam, standen die dunkelhaarigen Männer in einem Halbkreis um ihn herum und begutachteten ihr Werk. Dann kam noch eine siebente Person dazu. Das kann doch nicht sein, dachte der Adefris und vergaß für einen kurzen Moment jeden Schmerz. Wieso ausgerechnet der? Der Neuankömmling zückte einen großen Fotoapparat und begann, ohne ein Wort zu sagen, den nackten, geschundenen Körper des Adefris aus allen möglichen Winkeln abzufotografieren. Aus der Ferne schlug die Turmuhr halb sechs Uhr morgens.
Während der Fotoapparat unerbittlich klickte, wurden die Schmerzen beim Adefris immer schlimmer. Ganz allmählich dämmerte ihm, dass es für ihn kein Entkommen mehr gab. Und dass, wie er schon aus den Geschichtsbüchern wusste, der Tod am Kreuz ein besonders schmerzvoller war, stellte er gerade selbst fest. Es war auch ein langsamer Tod, davor graute ihm besonders. Dennoch war da in ihm auch noch der kleine Hoffnungsfunke, dass man ihn vielleicht noch rechtzeitig finden und retten würde.
Die letzte Möglichkeit schien leider auch seinen Peinigern bewusst zu sein. Als der Neuankömmling alle nötigen Bilder geschossen hatte, drehte er seinen rechten Zeigefinger einmal schwungvoll in der Luft, woraufhin der Henker vortrat.
In der rechten Hand hielt er jenes zwanzig Zentimeter lange Messer, mit dem er den Adefris schon auf dem Kreuzweg malträtiert hatte. Henker und Fotograf warfen sich noch einen Blick zu, dann nickte der Fotograf, und der Henker stach mit voller Wucht zu. Vom Bauchnabel her schlitzte er den Adefris bis nach oben hin auf.
Und in diesem Moment, während die Kamera erneut zu klicken begann, schrie der Adefris dann doch noch einmal.
Als es vorbei war, jagte ihm der Fotograf noch eine Kugel in den Kopf. Die Pistole hatte einen Schalldämpfer, sonst wäre in diesem Moment der ganze Ort wach gewesen. Die Kugel spürte der Adefris natürlich nicht mehr, denn da war sein Geist schon lange bei Odin, Wotan oder welchen Gott auch immer der alte Nazi verehrte. Noch ein paar letzte Fotos, dann verschwanden die Männer alle miteinander wieder den Kreuzweg hinab in den Ort.
Stille legte sich über den Hochberg. Ein paar Raben ließen sich auf dem Gekreuzigten nieder. Interessant, fanden sie, so etwas hatten sie hier noch nie gesehen. Vielleicht noch ein bisschen frisch, dieser Körper. Aber die Augen, da müsste doch was gehen …
1. Satz
1
Ein eiserner Griff drückte Charlottes Nacken brutal in die harte Liege. Ich werde nichts sagen, ganz sicher nicht. Keinen Laut werden sie von mir hören, schwor sich die Charlotte stolz, während ihr Schmerztränen in die Augen stiegen.
»Ahhh! Scheiße, tut das weh!« Anspruch und Realität waren dann halt doch zwei verschiedene Paar Schuhe. Sie schrie nochmals, aber auch das half nichts. Ihre Peinigerin war gnadenlos. Daumen und Zeigefinger reichten ihr, um zwei extrem empfindliche Stellen im Nacken der Charlotte zu aktivieren. War die Frau bei Mr Spock in die Lehre gegangen?, fragte sich die Charlotte. Der konnte ja mit einem einzigen Handgriff seine Gegner in den Tiefschlaf schicken. Tiefschlaf! Ja, das wäre jetzt fein. Nur nicht mehr diese Schmerzen ertragen müssen.
Als sie plötzlich auch noch ein spitzes Knie in ihrem Kreuz spürte, war es auch mit dem letzten bisschen Stolz und Tapferkeit vorbei. Wimmernd versuchte sie, die Frau von sich abzuschütteln, aber keine Chance. Sie hatte ihre Schmerzspenderin bisher nicht zu Gesicht bekommen, schätzte aber, dass es sich dabei um eine vielleicht hundert Kilo schwere Nordkoreanerin handeln musste.
Dieser mutmaßliche Schrank von einer Frau ließ sich jetzt mit voller Wucht auf das Kreuz der Charlotte fallen, dass ihr der Atem wegblieb. Noch der letzte Kubikmillimeter Luft schoss aus ihrer Lunge, es knirschte und krachte im Rückengebälk, die Augen quollen ihr aus den Höhlen. Langsam senkte sich ein dunkler Nebel über die Charlotte, sie konnte nur mehr in kurzen Atemzügen hecheln, um nicht endgültig zu ersticken. Verdammt, so etwas hatte sie überhaupt noch nie durchstehen müssen.
Aus den Augenwinkeln sah sie am Tisch daneben weitere Folterwerkzeuge liegen: Scheren, kleine Zangen, Reibeisen. Was hatten die bloß noch mit ihr vor?
Plötzlich bekam sie wieder Luft, das zentnerschwere Gewicht war von ihrem Rücken verschwunden. Ein leichtes Klatschen auf ihren nackten Po ließ sie hochfahren. Keine gute Idee, sie sah Sterne vor den Augen. Erst nach und nach kam ihr Kreislauf wieder in Schwung. Was war das jetzt? Eine kurze Pause, bevor sie erneut malträtiert wurde? Damit sie sich ein wenig erholen konnte, um die Folter noch länger hinausdehnen zu können? Kannte man ja aus einschlägigen Filmen.
»Bereit für Fußpflege?«, fragte ihre »Folterin« – ein thailändischer Laufmeter mit vierzig Kilo Lebendgewicht. Mit Schaudern betrachtete die Charlotte die Nagelscheren, Hornhauthobel und was es sonst noch so gab. Worauf hatte sie sich da nur eingelassen?
Ganz einfach: Sie hatte sich bereit erklärt, als Testperson für ein neu eröffnetes Wellnessstudio in Perchtoldsdorf herzuhalten. Hatte ja eigentlich alles super geklungen: ein Gratis-Wellnesstag mit allem Pipapo. Wohlfühlmassage, Pediküre, Maniküre, Dampfbad und so weiter. Von ostasiatischen Foltermethoden war da keine Rede gewesen.
Einen Tisch weiter lag die Andrea, die soeben dieselbe Tortur über sich hatte ergehen lassen. Sie sah aber irgendwie entspannter aus.
»Drama-Queen«, hauchte die Blondine sanft mit halb geschlossenen Augen. »So ein Gequieke! Da kann man sich ja gar nicht auf die Massage konzentrieren. Danke, Pao!«, wandte sie sich dann an ihre kleine Masseurin, die ihre Hände vor der Brust faltete und sich verneigte. Ganz so, als wäre sie es gewesen, die gerade eine Stunde lang von Kopf bis Fuß verwöhnt worden war.
»Pah!«, spuckte die Charlotte. »Deine hat dich sicher nicht so gequält.« Schwungvoll strich sie sich eine schweißverklebte kastanienrote Locke aus der Stirn.
»Du bist einfach zu wehleidig, Charly.«
»Bin ich nicht!«
»Bist du doch!«
»Nicht!«
»Doch!«
»Ni…« In diesem Moment bimmelte das Telefon der Charlotte. Eine WhatsApp-Nachricht vom Leo. »Schon wieder ein Mord«, stand da. Es gab also doch noch einen Gott.
»Tja, so ein Pech, aber wir müssen los«, erklärte die Charlotte erleichtert. Die Füße wollte sie sich von dieser Holzhackerin nun wirklich nicht »behandeln« lassen.
»Ach nö!«, raunzte die Andrea. Sehnsuchtsvoll schaute sie auf die Wanduhr über der Tür in dem Zimmer für »Partnerbehandlungen«. Sie zeigte knapp elf Uhr vormittags. »Wir hätten noch zwei Stunden, um uns verwöhnen zu lassen.«
»Verwöhnen, pff«, schnaufte die Charlotte entrüstet. »Wenn du so etwas verwöhnen nennst – das kann ich dir heute Nacht daheim auch angedeihen lassen. Normalerweise quiekst du ja schon, wenn ich dir auf deinen Knackarsch klopf.«
Jetzt war es die Andrea, die beleidigt den Kopf wegdrehte und schnaubte. Unwillig warf sie sich den geliehenen weißen Bademantel um, rutschte von der Massagebank und verließ den Raum.
Die Charlotte seufzte. »Jetzt mach doch nicht gleich einen Udo-Jürgens-Abgang.« Sie schob sich ebenfalls von der Bank, schlüpfte in einen ebensolchen weißen Bademantel und eilte ihrer Freundin nach. Die hatte bereits die Umkleide erreicht.
»Der Leo soll warten«, fauchte die Andrea, »ich muss mir erst das Massageöl runterduschen. So schlüpfe ich sicher nicht in mein Gewand.« In diesem Fall musste die Charlotte der Andrea recht geben. Es gab nichts Unangenehmeres, als frisch eingeölt in Jeans zu schlüpfen.
Unter der Dusche versöhnten sich die beiden schnell wieder, und die Charlotte wurde das eigenartige Gefühl nicht los, dass die Andrea ihren theatralischen Abgang nur deswegen inszeniert hatte. Schmeck’s! Wenn es so war, sollte es ihr recht sein. Wegen dieses dämlichen Wellnesstags hatten sie am Morgen sowieso viel zu früh aus den Federn gemusst. So kam ihr Kreislauf wenigstens in Schwung. Die eiskalte Dusche, die ihr die Andrea ganz am Ende noch angedeihen ließ, wäre aber wirklich nicht notwendig gewesen.
Ein paar Minuten später, als sie nämlich den Hochberg hinaufstiegen, war die Charlotte über die Eisdusche dann doch noch recht froh. Am Fuß des Bergs, der ja eigentlich nur ein etwas überdimensionierter Hügel war, waren sie auf Kollegen vom Leo gestoßen, die sie anstandslos durchgelassen hatten. Alle anderen Spaziergänger mussten warten, bis der Tatort wieder freigegeben wurde.
Während des fünfminütigen Fußweges hinauf auf den Hochberg hatte die Charlotte Zeit, nochmals über die abgebrochene Wellnessbehandlung nachzudenken. Eigentlich war das ja keine schlechte Idee, das wäre natürlich auch etwas für ihren eigenen Betrieb, nachdem die Pläne für die Umbauarbeiten zu einem Weinresort mit umfassendem Hotelbetrieb vor zwei Monaten auch von der Gemeinde abgesegnet worden waren. Aber, das schwor sie sich, so brutal würde es bei ihr nicht zugehen. Das würde sie schon persönlich testen und – im Notfall – abstellen. Ja, da musste schon die Chefin höchstselbst ran! Konnte man ja dem Personal nicht zumuten, sich testweise auf einen Massagetisch zu legen.
Inzwischen knallte die Sonne erbarmungslos vom mittäglichen Himmel herunter. Der Sommer war zwar nicht so ausschweifend und brütend heiß gewesen wie der vorjährige, aber er hatte es immer noch in sich. Andererseits, vor einem Jahr wäre sie noch schwitzend und keuchend den Hochberg hinaufgehechelt. Schwitzen tat sie immer noch, aber dank regelmäßigen Radfahrens war ihre Kondition inzwischen so weit brauchbar, dass sie die paar steilen Kehren des Kreuzwegs bis zum »Gipfel« problemlos erklimmen – und dabei sogar noch mit der Andrea plaudern konnte!
Ein wenig Murren musste dennoch sein. Wieso konnte sich der Mörder nicht einen etwas leichter erreichbaren Tatort aussuchen? Und mit dem Auto war es unmöglich, auf den Hochberg raufzukommen.
Demgemäß war auch der Anblick, der sich der Charlotte oben bot: jede Menge Polizisten, in Zivil, in Uniform und in den weißen Schutzanzügen der Spurensicherung, aber weit und breit kein Dienstwagen. Die waren auch unten am Start des Kreuzwegs nicht zu sehen gewesen, was aber damit zu tun hatte, dass dieser nur dreißig Meter von der Polizeiinspektion entfernt lag. Darum hatte man die Streifenwägen gleich in der Garage stehen lassen und war strammen Schrittes zum Tatort geeilt. In voller Montur war der Aufstieg bei dieser Affenhitze dann für den Leo und seine Kollegen aber trotz guter Kondition nicht gerade lustig gewesen. Vielleicht deshalb war die Miene vom Leo so finster und gequält, als er die Charlotte und die Andrea empfing.
»Schöne Sauerei, die wir hier haben«, grunzte er mit nur halber Aufmerksamkeit für die Charlotte und die Andrea.
»Hallo Leo«, grüßte die Charlotte betont liebenswürdig. Eigentlich hatte er sie ja herbestellt. Da konnte man schon etwas mehr Freundlichkeit erwarten.
»Ja, eh. Hallo«, motzte der Leo weiter und steckte sich eine Zigarette an.
Die Charlotte gab auf. »Also, was ist passiert?«
»Den Adefris hat’s erwischt.«
Die Charlotte bekam große Augen. Aber das Glitzern darin war nicht nur der Schreck. Immerhin hatte ihr der Adefris im letzten Advent übel mitgespielt.
Der Leo führte sie stumm zu einem Leichensack und zippte ihn auf. Als sie die Leiche sah, hatte sie dann aber doch etwas Mitleid mit dem Chef der Perchtoldsdorfer Ultrarechten. So ein Schicksal hatte sich niemand verdient. Eigentlich.
Der Anblick war wirklich nicht schön. Und wie das Amen im Gebet musste sich die Andrea angesichts der verstümmelten Leiche geräuschvoll übergeben.
»Schau bitte, dass du auf keine Spuren speibst«, meinte der Leo abwesend. Er wirkte mehr geschockt, als das bei einem Mordfall normal war. Aber kein Wunder, der Adefris war auch vom Nabel bis zum Hals aufgeschlitzt und ausgeweidet worden. Die Charlotte war davon so abgelenkt, dass ihr der Kopfschuss zunächst gar nicht auffiel.
»Wer … wer macht denn so was?«, stammelte sie schließlich. Mit einer Hand wehrte sie hinter ihrem Rücken die Andrea ab, die den Fehler gemacht hatte, noch einmal auf die Leiche zu schauen, und nun auch noch den Rest ihres Frühstücks auf der Wiese verteilte. Erst nach mehrmaligem Anstoßen drehte sich die Charlotte zu ihrer Freundin um.
»Taschentuch, bitte«, röchelte die Andrea, während sie versuchte, ihre blonden Haare von ihrer Kotze fernzuhalten. Die Charlotte kramte in ihrer Hosentasche, fand aber nur ein bereits benutztes Papiertaschentuch.
»Egal«, jaulte die Andrea, riss ihr das zusammengeknäulte Taschentuch aus der Hand und wischte sich den Mund ab.
»Bäh«, kommentierte der Leo.
»Ach was«, erwiderte die Andrea, »wenn du wüsstest, was ich von der Charlotte schon alles im Mund hatte …«
»Danke für die Bilder im Kopf«, meinte der Leo und drehte sich weg. Er steckte zwei Finger in den Mund und pfiff. Kurz darauf kam ein Kollege mit einer Wasserflasche für die Andrea. Dankbar spülte sie sich den Mund aus und trank den Rest des halben Liters in einem Zug aus.
»Können wir jetzt endlich weitermachen?«, fragte der Leo genervt.
Die Andrea nickte, hielt aber Abstand zur Leiche.
»Also erklär mal, Leo«, forderte die Charlotte ihn auf. Sie hatte sich von dem schaurigen Anblick ebenfalls abgewandt und schaute jetzt direkt auf das Steinkreuz mit dem gekreuzigten Jesus. Dabei fielen ihr die Blutspuren am Stein auf. Und auch die Löcher der großen Schrauben, die an den beiden Handflächen und den Füßen der Figur gut zu sehen waren. Eine üble Vorahnung stieg in ihr auf.
»Man hat ihn doch nicht …«
»… gekreuzigt?«, vervollständigte der Leo den Satz. »Doch, hat man. Ein Jogger hat ihn vor zwei Stunden gefunden und uns sofort verständigt. Hier sind Fotos.« Der Leo gab der Charlotte sein Handy. Sie wischte mit dem Finger durch ein paar Dutzend Fotos, die den Adefris aus allen möglichen Winkeln zeigten. Dabei war gut zu sehen, wie ihm die Gedärme aus dem Bauch hingen. Auch die Augen fehlten.
Ihren fragenden Blick bei diesem Bild beantwortete der Leo: »Die haben wahrscheinlich die Vögel gefressen. Der oder die Täter waren es nicht. Da hätten wir entsprechende Spuren gefunden.« Dafür waren noch andere Spuren zu sehen. Am Körper vom Adefris waren verschiedene Zettel angetackert: »Rechte Sau« und »Rache für 24/12« war darauf geschrieben. »Alles mit seinem eigenen Blut«, erklärte der Leo.
»Wovon ja reichlich da war«, meinte die Charlotte. Der Adefris war dermaßen ausgeblutet, dass sein Körper selbst für eine Leiche ungewöhnlich blass war.
»Wann ist das Ganze passiert?«, fragte jetzt die Andrea, die nicht nur als hübsches Beiwerk dabeistehen wollte. Wobei »hübsch« momentan eine Übertreibung war. Sie sah ähnlich bleich aus wie die Leiche vom Adefris.
»Unser Mediziner schätzt, dass es zwischen vier und sechs Uhr morgens passiert sein muss. Lässt sich aufgrund des hohen Blutverlusts nur schwer sagen.«
»Und da hat ihn erst am Vormittag jemand gefunden?«, warf die Charlotte ein.
»Ja, der Weg herauf ist derzeit gesperrt. Der Kreuzweg wird saniert, und deshalb herrscht eigentlich ein Begehungsverbot.«
»Und der Jogger?«
»Hat drauf geschissen. Aber wir haben es ihm durchgehen lassen. Der arme Teufel war selbst so schockiert, dass er derzeit bei uns unten in psychologischer Betreuung ist.«
»Spuren?«, hakte die Charlotte nach.
»Beim Jogger?«
»Depp. Nein, hier am Tatort.«
Der Leo schüttelte den Kopf. »Kaum welche. Nur von den ›Bohrarbeiten‹ – aber das ist eine Schraube, die es zigtausend Mal gibt. Leider kein Anhaltspunkt. Die Täter müssen Handschuhe verwendet haben. Waren auf jeden Fall Profis.«
»Was wohl eher dagegen spricht, dass es sich bei ihnen um Antifaschisten handelt.«
Der Leo nickte. »Ja, die Zetteln sind wohl nur eine Ablenkung. Aber inzwischen«, dabei warf er der Charlotte einen bedeutungsschwangeren Blick zu, »haben wir hier ja auch genug Erfahrung mit Mördern, um so etwas sofort zu erkennen.«
»Angeheuerte Profis?«
»Ob angeheuert oder nicht, das wissen wir nicht. Aber Profis auf jeden Fall. Jetzt müssen wir schauen, wer ein Interesse daran haben könnte, den Adefris ums Eck zu bringen.«
»Och, da würden mir schon ein paar Leute einfallen«, meinte die Andrea sarkastisch.
»Eh, aber ich schätze im Ort hier keinen so ein, dass er so etwas derart inszenieren würde. Bei uns würden sie ihn wohl einfach in einem Weinfass ertränken oder mit dem Traktor niederfahren.«
»Womit der Verdacht aber sofort auf einen Einheimischen fiele«, warf die Charlotte ein.
»Ich weiß, dass du weißt, dass ich weiß … und so weiter. Nein, wenn ich damit anfange, dann drehen wir uns nur im Kreis. Natürlich werden wir auch im Ort und in der Umgebung herumfragen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das da eine andere Geschichte ist.«
»Ja, das ›Rache für 24/12‹ ist schon sehr plakativ. Und dass sich da erst jetzt jemand für die Geschichte vom letzten Jahr rächen möchte? Das glaube ich auch nicht. Andererseits habe ich keine Ahnung, wieso man den Adefris gerade jetzt abgemurkst hat. Die Tochter sitzt nach wie vor im Häfn, und bei den Wahlen ist er ja auch total abgestunken. Seitdem hat er sich eigentlich kaum noch in der Öffentlichkeit blicken lassen. Also wieso gerade jetzt? Und warum?« Als Antwort gab es vom Leo und der Andrea nur leere Blicke. Letztere meldete sich dann aber doch als Erste wieder zu Wort.
»Es muss etwas Persönliches gewesen sein.«
»Warum?«, fragte die Charlotte erstaunt.
»Na, wer jagt seinem Opfer noch eine Kugel in den Kopf, nachdem es schon tot ist? Da muss der Hass schon sehr groß gewesen sein.«
»Wer sagt, dass man ihn nicht zuerst erschossen und dann aufgeschlitzt hat?«, entgegnete die Charlotte.
Der Leo mischte sich ein. »Die Andrea hat recht, er wurde zuerst erstochen, und dann hat man ihm noch die Kugel in den Kopf gejagt. So viel konnte unser Mediziner feststellen. Das ist aber nicht alles: Er hat auch noch einen gebrochenen Kiefer und kleinere Stichwunden an den Beinen, im Rücken und am … Arsch. Diese Wunden wurden ihm alle vor dem Tod zugefügt.«
»Ooookay«, meinte die Charlotte lang gezogen. Das sprach tatsächlich dafür, dass hier jemand ein bisschen einen Hass auf den alten Adefris gehabt haben dürfte. »Ein bisschen« war da sogar noch ein Euphemismus. Es war ja fast schon eine Racheaktion alttestamentarischen Ausmaßes.
Sie beutelte sich einmal ab und meinte dann: »Wie auch immer, ich weiß nicht, wie ich dir hier helfen soll. Meine Verbindungen zum Adefris sind dürftig, und das ist mir auch nur recht so. Eigentlich will ich mit diesem ganzen rechten Pack nichts zu tun haben. Vielleicht war es ja einfach eine Fehde unter denen? Am Ende zerstören sich diese Faschisten ja doch immer selbst.«
Der Leo blieb stur. »Nein, das glaube ich nicht. Da steckt etwas anderes dahinter.«
»Na, dann wünsche ich dir viel Spaß damit«, beendete die Charlotte die Diskussion. »Danke, dass du an mich gedacht hast, aber diesmal halt ich mich aus der Sache wirklich raus. Wir haben ja demnächst das Tennisturnier im Park, und da bin ich voll eingesetzt.«
»Wer’s glaubt«, schnaubte der Leo, gab seiner Cousine und ihrer Freundin ein Küsschen auf die Wange und wandte sich wieder dem Tatort zu.
Die Charlotte nahm die Andrea an der Hand, und so schlenderten sie wieder in den Ort hinunter. Bevor sie sich auf den Heimweg zum Weingut machten, zog die Andrea die Charlotte noch in den kleinen Buchladen am Rand des Marktplatzes.
»Was wird das jetzt?«, fragte die Charlotte erstaunt. Sie selbst war ja nicht die große Leserin, dafür fehlte ihr einfach die Zeit. Geschäftsfrau und so. Gut, das war in Wirklichkeit natürlich nur eine Ausrede für Ich-bin-zu-faul-ein-ganzes-Buch-zu-lesen. Die Andrea dagegen verschlang Bücher fast im Stundentakt, soweit es ihre Zeit neben der Arbeit in einer Anwaltskanzlei in Wien zuließ. Aber bislang hatte sich die Charlotte nie groß Gedanken darüber gemacht, woher die Andrea ihre Bücher bezog. Sie hatte wohl angenommen, dass sie sie übers Internet bestellte. So würde sie selbst es wenigstens machen. War ja auch viel bequemer.
»Das wird eine Überraschung«, erklärte die Andrea zweideutig. Die Buchhandlung war in einem fünfhundert Jahre alten, denkmalgeschützten Eckhaus untergebracht. Die Charlotte hatte fast das Gefühl, beim Betreten des Ladens ihren Kopf einziehen zu müssen, so niedrig war der gotische Torbogen. Und dann befand sie sich plötzlich in einer anderen Welt.
Die gotischen Gewölbe zogen sich auch im Inneren weiter. Fast wie in der Mini-mini-Version einer Kirche, nur dass hier alles viel wärmer wirkte. Was damit zu tun haben konnte, dass der Laden – wie es sich für ein Buchgeschäft gehörte – von oben bis unten mit Büchern vollgestopft war. Selbst im schmalen Gang vor zur Kassa waren noch Tische, die sich unter der Last der zur Schau gestellten Bücher bogen. Und Mini-mini war der richtige Ausdruck, denn mehr als dreißig Quadratmeter hatte der ebenerdige Teil des Ladens sicher nicht.
Zielstrebig zog die Andrea ihre Freundin in Richtung Kassa. Auch dort stapelten sich die Bücher, erst als die Buchhändlerin sich von ihrem Sessel erhob, sah die Charlotte, dass da überhaupt jemand gesessen hatte.
»Andrea! So eine Freude, deine Bestellung ist heute Vormittag gekommen. Ich wollte dir gerade ein SMS schicken.«
»Danke, Therese. Das ist übrigens die Charlotte. Sie ist hier aufgewachsen und war, soweit ich weiß, noch kein einziges Mal hier bei dir.« Die letzte Feststellung wurde von einem messerscharfen Blick in die Augen der Charlotte unterstrichen. Vom Sehen her kam die Buchhändlerin der Charlotte schon bekannt vor, aber sie konnte sie nicht richtig einordnen.
Die Therese lächelte nur milde. Die Charlotte schätzte, dass sie kurz vor der Pension stehen musste, aber sie wusste auch, wie sehr manche Leute an ihren Geschäften hingen. Bestimmt würden ihre eigenen Eltern auch noch mit siebzig im Weingarten stehen. Und wenn sie die Therese richtig einschätzte, dann war das in ihrem Fall nicht anders. Ein Analog-Nerd, quasi.
»Ich kenne das Fräulein Nöhrer, keine Sorge«, meinte die Therese wohlwollend, aber doch ein klein wenig herablassend. »Ich bin mit ihrer Mutter befreundet und auch das eine oder andere Mal schon oben beim Heurigen gewesen. Aber das Fräulein«, jetzt kam auch von ihr so ein schneidender Blick, »war meistens kaum zu sehen. Ist ja immer mit ihren Ermittlungen beschäftigt.«
Hrmpf war das Einzige, was der Charlotte dazu einfiel. Sie wandte sich ab und überflog die ausgestellten Buchtitel. Von dem einen oder anderen Autor oder Autorin hatte sie schon mal gehört, aber nie so viel, dass sie in Versuchung geraten wäre, gleich ein Buch zu kaufen. Zwei Cover, schön nebeneinander präsentiert, stachen ihr sofort ins Auge. Das schlechte Gewissen und die versteckte Schelte der Buchhändlerin ließen sie zu den Büchern greifen. Das erste zeigte eine herbstliche Schilflandschaft am Neusiedlersee. Das zweite war stilistisch komplett anders: Knallblauer Hintergrund, darauf waren wie in einem Sammelkasten verschiedene Dinge zeichnerisch dargestellt: ein Storch, ein Grabstein, ein geöffneter Kussmund …
»Das ist unser aktueller Burgenland-Schwerpunkt«, erklärte eine Verkäuferin, die der Charlotte zuvor gar nicht aufgefallen war. Sie war wie aus dem Nichts neben ihr aus dem Boden gewachsen. Erschrocken zuckte die Charlotte zusammen. »Zwei sehr unterschiedliche Krimis. Der eine spielt am Neusiedlersee, der andere im Südburgenland. Aber ich kann Ihnen beide sehr empfehlen. Sie werden richtig Sehnsucht nach dem Burgenland bekommen.«
Die Charlotte schüttelte zaghaft den Kopf. War die Verkäuferin von der Burgenlandwerbung bezahlt worden, weil sie gar so schwärmte? Und was zum Teufel war ein »Gartenkrimi«? Das stand nämlich klein auf dem Buch mit dem blauen Cover, aber die Charlotte konnte sich darunter überhaupt nichts vorstellen.
»Vielleicht als Geschenk?«
Jetzt nickte die Charlotte. Es war ihr peinlich, den Laden mit leeren Händen zu verlassen. Die Omama und die Frau Mama würden schon was mit den Büchern anzufangen wissen. Freudig grinsend nahm ihr die Verkäuferin die beiden Bücher ab.
In der Zwischenzeit schlossen auch die Andrea und die Therese ihren Deal ab, mit einem Jutesäckchen in der Hand ging es endlich – endlich! – wieder aus dem Buchladen hinaus. Die Charlotte zog ein Schnoferl, das Gesicht der Andrea war verträumt, als hätte sie gerade … nein, wurscht.
»Willst du gar nicht wissen, was ich mir gekauft habe?«, fragte die Andrea, der die Ungeduld anzusehen war. Wie ein kleines Kind rutschte sie auf dem Beifahrersitz des Autos der Charlotte herum.
»Nö, seit wann interessiert mich, was du liest?«, entgegnete die Charlotte kühl.
»Weil es vielleicht auch für dich interessant sein könnte?«
»Kann ich mir nicht vorstellen.«
»Hrmpf«, kam es diesmal von der anderen Seite.
Schweigend fuhren sie zum Weingut hoch. Dort herrschte inzwischen Hochbetrieb. Der Heurige befand sich mitten im »Ausstecken«, und das Mittagspublikum war in Scharen die Weinberge hochgepilgert. Okay, gepilgert ist vielleicht der falsche Ausdruck, wenn man mit dem Auto wo hinfährt. Aber einige hatten sich die mühsame Auffahrt auch mit dem Rad angetan. Wieder andere hatten das schöne Wetter für einen gemütlichen Spaziergang durch die Weingärten der Hagenau genützt.
Die Charlotte parkte ihren Wagen auf einem eigens für sie markierten Parkplatz vor dem Weingut. Das war inzwischen notwendig geworden, weil das Geschäft wie blöd lief. Und es ging ja nun wirklich nicht an, dass die Juniorchefin vor dem eigenen Heurigen keinen Parkplatz fand. Also, das meinte die Charlotte und hatte sich einfach den Platz gleich neben dem großen Einfahrtstor des alten Vierkanthofs rot abmarkiert.
»Bütte, bütte, bütte!« Die Andrea wollte trotz allem noch immer ihre Überraschung loswerden.
»Drinnen«, erklärte die Charlotte bestimmt und stieg aus.
2
»Drinnen«, das bedeutete dann am Mittagstisch der Familie in der privaten Küche. In der Heurigenküche herrschte Hochbetrieb, und die Omama führte ein gleichermaßen liebevolles wie strenges Regime. Gerade zu den Stoßzeiten musste jeder Handgriff sitzen.
Die Charlotte hatte den Betrieb in den letzten eineinhalb Jahren ordentlich auf Vordermann gebracht. Keine Rede mehr von verschlafener Weinort-Romantik. Wenn »der Nöhrer« ausgesteckt hatte, brummte das Geschäft. Und mittlerweile auch in den Wochen dazwischen, nachdem die Charlotte die Bed&Breakfast-Zimmer ihrer Eltern in ein richtiges Hotel umgewandelt hatte. Der frisch renovierte Weinkeller unter der hundertfünfzig Jahre alten Eiche zog nochmals ein eigenes Publikum an, und der Deal vom Herrn Papa mit dem Signore Bianchi, dem Vater vom ehemaligen Bonsai-Lover ihrer kleinen Schwester Flora, bezüglich Weinlieferungen nach Italien hatte inzwischen Ausmaße angenommen, die allein schon für die Versorgung der Familie gereicht hätten.
Und dann war da noch die Renate Obermayer, die Witwe des vor einem Jahr auf offener Bühne ermordeten Burgtheater-Schauspielers Norbert Obermayer, die der Charlotte jede Menge Catering-Aufträge im Rahmen von Kulturveranstaltungen in und um Wien zuschanzte. Aus Dankbarkeit, dass die Charlotte damals den Mord an ihrem Ehemann aufgeklärt hatte. Und ein bisschen auch, weil sie ihr den Mario, den Besitzer und Barkeeper der Turmbar unten im Ort und nunmehrigen Lover vorgestellt hatte. Zu guter Letzt gab es noch den »Schüttelwein« der Charlotte, einen Rosé Sparkling, der sich von einem Running Gag zu einem Selbstläufer und zum absoluten Bestseller des Weinguts Nöhrer entwickelt hatte.
Inzwischen stand die nächste Ausbaustufe am Programm, die Charlotte wollte aus dem Hotel- und Heurigenbetrieb ein großzügig angelegtes Wellnessresort mit angeschlossenem Bio-Hof machen. Die Weinerzeugung war schon vor Charlottes Einstieg in das Familienunternehmen auf Betreiben der Frau Mama in Richtung bio getrieben worden, die Charlotte wollte das Portfolio des Betriebs nun noch um Bio-Fruchtsäfte erweitern, weshalb man zum Gießhübl hoch eine frei gewordene Fläche in einen Obsthain umgewandelt hatte. Bis die Bäume dort allerdings ausreichend Früchte trugen, würde es noch ein Jahr dauern. Diese Zeit war auch für die nächste Ausbauphase des Weinguts vorgesehen – nämlich die Umwandlung beziehungsweise Erweiterung um ein kleines, aber feines Wellnessresort.
Die Lage des Nöhrer’schen Guts war ja von Haus aus schon ziemlich einmalig und heutzutage nicht mehr nachzustellen. Mitten in den Weingärten oberhalb von Perchtoldsdorf bot es nach Nordosten einen unvergleichlichen Blick auf das Wiener Becken (an klaren Tagen fast bis zur slowakischen Grenze), nach Südwesten sah man Weinberge, so weit das Auge reichte, am Horizont begrenzt von Wald und der Ortschaft Gießhübl. Vor allem den ersten Ausblick wollte die Charlotte nutzen: In den abschüssigen Hang unter dem Weingut sollte eine großzügige Wellnesslandschaft in zwei Etagen mit Panoramafenstern auf Wien hinaus entstehen.
Die Pläne waren fertig, das Problem war nur mehr der dafür notwendige Millionenkredit. Aber weniger vonseiten der Bank, denn die wirtschaftlichen Daten der Nöhrers waren gut genug, sondern weil der Herr Papa und die Frau Mama bei diesen Zahlen einen schummrigen Magen bekommen hatten.
Die Inaaya, eine der drei syrischen Kellnerinnen am Weingut, servierte der Charlotte und der Andrea einen Spinatstrudel von der Omama. Auf etwas Schwereres hatten die beiden bei dieser Bruthitze keinen Bock.
Das mit der Inaaya war ja so eine eigene Geschichte. Nachdem die Flora nach der Trennung vom Bonsai-Lover Luca mit dem Noah, dem Pflegesohn der Nöhrers, zarte Bande geknüpft hatte, war es im gemeinsamen Skiurlaub in Schladming zum großen Zerwürfnis gekommen: Die Flora verdächtigte die Inaaya, etwas mit dem Noah angefangen zu haben. Das hatte zwar nicht gestimmt, aber schließlich dazu geführt, dass es tatsächlich so kam. Eine Selffulfilling Prophecy, quasi. Aber nicht zuletzt auch deswegen, weil die Flora sich ihrerseits in Schladming etwas mit einem Franzosen angefangen hatte, der sich letztlich als schwul entpuppt und eigentlich etwas vom Noah gewollt hatte. Verwirrt? Gut, mission accomplished.
Wie auch immer, in den letzten Monaten hatte sich zwischen den dreien ein selbst für die Charlotte und die Andrea nicht mehr zu durchblickendes Liebesdreieck entsponnen. Soweit sie wussten, hatte der Noah abwechselnd mit beiden was. Die Charlotte hatte schon lange den Überblick verloren, wer gerade mit wem zusammen war. Noch dazu, wo sich auch die Flora nicht lumpen ließ und in den Noah-freien Zeiten mit anderen Burschen herummachte. Die einzige Arme in der ganzen Geschichte war die Inaaya, die unsterblich in den Noah verliebt war und sich um keinen Preis der Welt etwas mit einem anderen Burschen anfangen wollte. Erschwerend hinzu kam, dass sie auch noch am Weingut arbeitete und damit in ständigem Kontakt mit der Flora war. Teenagerlieben halt.
»Alles gut?«, fragte die Charlotte pflichtbewusst, als die Inaaya ihnen die großzügigen Portionen auf den Tisch stellte.
»Aber ja«, hauchte die hübsche Syrerin verträumt. Mehr brauchte die Charlotte nicht, um zu wissen, wie es derzeit gerade um ihr Liebesleben bestellt war.
Die Andrea rutschte noch immer nervös auf ihrem Sitz hin und her. Neben ihr lag das Jutesackerl mit dem Aufdruck des Buchladens, eine Hand der Andrea steckte schon im Sackerl. Die Charlotte wartete noch ein paar Sekunden, dann hatte sie endlich Mitleid mit ihrer Freundin.
»Na gut, also zeig schon her.« Strahlend wie ein Weihnachtsbaum zog die Andrea einen dicken Bildband aus dem Sackerl und knallte ihn auf den Tisch. Unabsichtlich, denn das Ding wog mindestens fünf Kilo.
»Ich warte!«, meinte die Charlotte leicht genervt. Das Buch war nämlich geschenkmäßig verpackt, und so konnte sie nicht erkennen, worum es ging.
»Na, dann pack es doch aus«, wurde sie von der Andrea gedrängt.
Betont gelangweilt zupfte die Charlotte am Geschenkband herum. Schließlich verlor sie die Geduld, schnitt das widerspenstige Teil mit einem Messer durch und fetzte die Verpackung runter. Und dann musste sie kurz einmal schlucken. Vor Rührung.
»Und? Und? Und?«, fragte die Andrea nervös wie eine Taferlklasslerin.
»Geil!«, antwortete die Charlotte. Die Andrea hatte ihr doch tatsächlich den Bildband »222 Wellness-Oasen, die man gesehen haben muss« geschenkt.
»Ist ein sogenanntes Coffee Table Book. Also eigentlich mehr so zur Deko, aber ich dachte, vielleicht sind da ein paar Ideen für den neuen Wellnessbereich drin. Ist ja nicht so, dass du damit großartig Erfahrung hättest.«
»Eh nicht«, gestand die Charlotte, »aber dafür gibt’s Spezialisten. Ich plane das ja nicht alleine. Aber vielleicht sind in diesem Wälzer ja wirklich ein paar Ideen drin, die ich bei den Planungen einfließen lassen kann.«
Damit machten sie sich über ihren Spinatstrudel her. Vor allem die Andrea musste ihren völlig entleerten Magen wieder auffüllen. Sie hatte zwar Urlaub, half aber beim Heurigen als Kellnerin aus. An einen ausgedehnten Urlaub am Meer war bei dem derzeitigen Betrieb nicht zu denken.
Der Rest des Tages verlief dann wie im Flug. Die Gäste gaben sich die Klinke in die Hand, was der Charlotte nicht nur wegen der Finanzen recht war, sondern auch, weil sie so den unangenehmen Fragen ihrer Eltern entkommen konnte.
Natürlich hatte sich der Mord am Adefris in Windeseile im ganzen Dorf herumgesprochen, aber glücklicherweise waren die Details noch nicht an die Öffentlichkeit gedrungen. Das Hallo, wenn in einem erzkatholischen Ort wie Perchtoldsdorf ein verkappter Alt-Nazi per Kreuzigung ins Jenseits befördert worden war, wollte sie sich lieber gar nicht vorstellen.
Musste sie sich am nächsten Tag dann aber doch.
Da hatte nämlich die »Heimatland« ein Foto vom gekreuzigten Adefris groß auf dem Cover der aktuellen Ausgabe, und natürlich wurde das Foto auch auf der Website des Revolverblatts gepostet. Die Charlotte hatte das zuerst gar nicht mitbekommen. Sie las die »Heimatland« nicht und surfte auch nur unter Androhung körperlicher Gewalt auf deren Website. Als ihr der Leo das Blatt aber völlig angepisst unter die Nase hielt, blieb ihr nichts anderes übrig.
Das war am Vormittag, und der Leo hatte seine Cousine im Begrischpark oberhalb des Marktplatzes abgefangen. Die Charlotte war gerade am Weg zum Tennisclub gewesen, um mit den Organisatoren des Tennisturniers einige Details zu klären. Natürlich ging es ums Catering für dieses große Event, die Charlotte war sehr stolz, den großen Auftrag ganz ohne Unterstützung der Renate Obermayer an Land gezogen zu haben. Aber was hätte ihr die Renate da schon groß helfen sollen? Sie kümmerte sich nicht um Sportveranstaltungen, sondern ausschließlich um Kulturevents und da im Normalfall nur um die Hochkultur. Was der Charlotte und ihrem Schüttelwein im letzten Jahr sogar schon Zugang zu dem einen oder anderen Event im Burgtheater und der Staatsoper beschert hatte.
Den Schüttelwein würde es nun dank Charlottes Initiative auch während dieses Tennisevents geben, aber bis dahin war noch etwas Zeit. Momentan wurden gerade die Stahlrohrtribünen für das Turnier aufgebaut. Keine einfache Aufgabe. Der Tennisclub war für solche Veranstaltungen eigentlich überhaupt nicht gedacht und auch nicht geeignet. Mit seinen vier Sandplätzen und dem kleinen, feinen Clubhaus lag er malerisch eingebettet auf einem schräg abfallenden Hang mitten im Begrischpark, umgeben von lauter Föhren. Was die Montage der Tribünen für etwas unter tausend Zuschauer natürlich nicht gerade einfacher machte, denn natürlich durfte kein Baum zu Schaden kommen. Aber das Land Niederösterreich hatte sich nun mal eingebildet, es müsste auch mal ein solches Event veranstalten, und Perchtoldsdorf war nicht zuletzt aufgrund seiner Nähe zu Wien und des damit erhofften Zuschauerzustroms als Austragungsort ausgewählt worden. Normalerweise lockte so ein Tennisevent der zweiten Ebene ja kaum einen Hund hinterm Ofen hervor. Aber diesmal wollte ein heimischer Altstar nach langer Verletzungspause sein Comeback geben, und das würden sich schon genug Leute anschauen wollen.
Nicht, dass die Charlotte von irgendeiner dieser Fakten eine Ahnung hatte. Für sie war Tennis einfach ein Sport, dass es dabei auf dem nächsthöheren Level um schwindelerregende Summen ging, war ihr relativ wurscht. Hauptsache, bei ihr selbst klingelte die Kassa.
»Lass uns reingehen«, schlug der Leo vor, dem das Gehämmer an den Tribünen auf den Nerv ging. Er konnte sein eigenes Wort kaum verstehen. Im renovierten Clubhaus war es angenehm kühl, die Klimaanlage rannte auf Hochtouren, und der Lärm von draußen wurde von den neu installierten modernen Türen und Fenstern ferngehalten.
»Was soll das ganze Theater hier überhaupt?«, meinte die Charlotte mit einem verständnislosen Blick hinaus auf die Aufbauarbeiten.
»Was heißt da ›Theater‹? Das wird eine Riesensache. Das Fernsehen kommt, und den Online-Stream vom Turnier kann man sich auf der ganzen Welt anschauen«, erklärte der Leo, der in Sachen Tennis offenbar besser bewandert war. Dunkel konnte sich die Charlotte erinnern, dass er zu Jugendzeiten selbst Tennis gespielt hatte. Allerdings nicht hier im Nobelclub, sondern eine Ortschaft weiter. Das Gelände dort war zwar auch sehr idyllisch am Rand der Weingärten und direkt an der Ortsgrenze zu Perchtoldsdorf gelegen, aber auch an der Autobahn, die nur durch eine hohe Lärmschutzwand von der Tennishalle getrennt war. »Und dann ist da auch noch der Jörg Hirzer. Allein wegen dem werden ein paar Dutzend Fans kommen. Der hat jetzt fast ein Jahr lang wegen einer Knieverletzung nicht spielen können und gibt hier sein Comeback«, erzählte der Leo mit Feuereifer. Ja, er schien durchaus an Tennis interessiert zu sein.
Und beim Namen des Altstars klingelte es ausnahmsweise auch bei der Charlotte. Jörg Hirzer war sogar ihr ein Begriff. Der hatte schon ein paar Spiele gewonnen. Oder Turniere? Die Charlotte tat sich mit der Fachterminologie ein bisschen schwer. Was ihr egal war. Je mehr Leute kamen, umso besser ihr Umsatz.
»Ich kann mir noch gar nicht vorstellen, wie die das hier alles reinbauen wollen«, meinte die Charlotte zweifelnd.
»Das kann ich dir schon erklären, meine Liebe. Hier finden ja nur die Spiele statt. Aus den vier Courts werden zwei gemacht, ein ›großer‹, quasi der Centre-Court, und daneben noch einer mit weniger Zuschauern, damit man das Programm auch durchbringt. Sind ja schon einige Spiele, die da am Programm stehen. Als Garderoben und fürs Aufwärmen verwendet man die Turnhalle drüben.«
Mit »Turnhalle« hatte der Leo ein wenig untertrieben, denn er meinte die riesige Mehrzwecksporthalle, die an das Gymnasium angeschlossen war. Glücklicherweise waren jetzt im August Sommerferien, und so konnte man, ohne den Unterricht zu stören, auf die Infrastruktur der nur hundert Meter entfernten Schule zurückgreifen.
Natürlich war das alles ein wenig improvisiert, aber es war nun mal kein ATP-Turnier, sondern nur die zweite Ebene. Hier ging es nicht um sonderlich viel Geld, aber um Punkte für die Weltrangliste, ohne die man die oberste Stufe nie erreichte. Dementsprechend hart ging es auf diesem Level auch zu. Da fighteten die hoffnungsvollen Nachwuchstalente um jeden Punkt, als wäre es ihr letztes Spiel. Natürlich gab es auch »Obezahrer«, aber solche Faulenzer wurden recht rasch aussortiert. Das Herumtingeln auf dieser Tour kostete nicht weniger Geld als bei den »Großen«, aber im Gegensatz zu den Weltstars gab es hier eben kaum Preisgeld zu verdienen. Sogar das Hotel und die Anreise mussten sich die Nachwuchshoffnungen noch selbst berappen. Deshalb wollte jeder diese Stufe so rasch wie möglich hinter sich lassen.
»Der Gästebereich wird auf jeden Fall recht hübsch«, meinte die Charlotte, um auch etwas Konstruktives zum Gespräch beizutragen. »Von hier bis zur Turnhalle rüber viele weiße Partyzelte, alles sehr offen und gemütlich.«
»Ein Alptraum, wenn es um die Sicherheit der Gäste und Spieler geht«, warf der Leo ein. »Wäre das hier ein richtig wichtiges Sportereignis, würde das so nicht durchgehen. Die Spieler müssen ja von den Kabinen bis zum Court mitten durchs Publikum gehen. Einlasskontrollen gibt es auch nicht, und Tickets werden nur für den Centre-Court verkauft.«
»Alles, um ein kleines Volksfest zu veranstalten.« Die Charlotte lächelte. »Ich kann mir vorstellen, dass sich viele Leute hierher verirren, die mit Tennis gar nichts am Hut haben und nur zum Saufen kommen.«
»Als ob dich das stören würde.«
»Nö, hab ich auch nicht behauptet. Aber zurück zum Adefris: Zeig mir noch mal die Zeitung.«
Der Leo hielt ihr das Blatt hin. Die Charlotte betrachtete das Foto auf der Titelseite, in voller Farbe und nahezu formatfüllend, wie es sich heutzutage gehörte. Das »Heimatland« kannte echt keinen Genierer. Da war der blutende Adefris in seiner vollen Herrlich- und Leblosigkeit zu sehen. Die Schmähzettel auf seinen Körper getackert, das Einschussloch in der Stirn, die vielen kleinen Stichwunden am Rest des Körpers. Dazu die wenig schmeichelnde Headline: »Irre: Rechtshetzer gekreuzigt!«
»Wie sind die denn an das Foto gekommen?«, fragte die Charlotte konsterniert. Sie war froh, dass der Leo ihr bereits am Vortag die Fotos gezeigt hatte, so drehte sich ihr wenigstens jetzt nicht der Magen um. Trotzdem blieb beim Anblick des Fotos ein schaler Geschmack.
»Das fragen wir uns auch«, gab der Leo als Antwort. »Irgendwer muss es ihnen weitergegeben haben. Auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, wer von meinen Leuten das gemacht haben soll.«
»Ich nehme an, du hast schon alle gefragt, die dabei waren?«
»Natürlich, ich bin ja kein Amateur.«
Die Charlotte zog spöttisch eine Augenbraue hoch. »Wäre ja nicht das erste Mal, dass einer deiner Leute sich zu einem Blödsinn hinreißen lässt.«
»Das war einmal. Die faulen Äpfel habe ich inzwischen alle aussortiert. Da kannst du dich drauf verlassen.«
»Anscheinend nicht, denn irgendwie muss das Schmierblatt ja an das Bild gekommen sein.« Worauf der Leo keine Erwiderung mehr hatte. Sie hatten niemanden an den Tatort gelassen, der Jogger war der einzige Zivilist, der die Leiche am Kreuz gesehen hatte. Aber der hatte kein Foto vom Adefris gemacht, die Polizei war auf Nummer sicher gegangen und hatte sein Handy kontrolliert.
»Wir gehen der Sache auf jeden Fall nach. Das Problem ist nur, dass wir die Zeitung nicht dazu zwingen können, uns den Urheber des Fotos zu nennen. Pressegeheimnis und so.«
»Wie hat der Rest der Adefris-Brut eigentlich auf den Tod des Vaters reagiert?«
Der Leo hob die Achseln. »Kühl, gefasst. Die Frau hat sich höflich bedankt und mir dann die Tür vor der Nase zugeschlagen. Von den anderen habe ich keinen gesehen. Aber wenigstens zwei der Söhne werden wir bald zu Gesicht bekommen.«
»Wieso? Hast du sie zur Vernehmung geladen?«
»Nein, wieso denn? Aber sie treten beim Turnier an. Also, in der Qualifikation.«
»Häh?«
»Ja, zwei von der riesigen Familie sind Tennisjunioren. Haben bislang noch nicht sonderlich rausgestochen, aber sie sind im Qualiraster. Keine Ahnung, wie sie es da reingeschafft haben. Muss wohl irgendwie mit Protektion zu tun haben. Ich meine, sie sind nicht schlecht, soweit ich das verfolgt habe, aber auch nicht so, dass man ihnen einen Startplatz bei so einem Turnier geben würde. Normalerweise halt«, meinte der Leo. Er stöhnte. »Komm, ich lad dich auf einen Kaffee ein, wenn ich über die Sippe rede, muss ich mir den unangenehmen Geschmack aus dem Mund waschen.«
Das »Einladen« bestand aus einem Kapselkaffee im ebenfalls im Aufbau befindlichen Pressezentrum des Turniers. Wie die Garderoben und Fitnessräume war es ebenfalls in der nahe gelegenen Mehrzweckhalle untergebracht, die durch flexible Wände in drei kleinere Turnsäle unterteilt werden konnte. Einer davon beherbergte das Pressezentrum, in dem natürlich noch kaum etwas los war. Das Turnier startete ja erst in einigen Tagen.
Lediglich der Pressechef des Turniers war da, um die Aufbauarbeiten zu überwachen. Ein ehemaliger Sportjournalist, der gegen Ende seiner professionellen Karriere die Seiten gewechselt hatte. Die Idee, in diesem Job weniger Stress ausgesetzt zu sein, hatte sich aber schon bald zerschlagen. »Wenn ich gewusst hätte, wie nervig wir Journalisten sein können, hätte ich mir das nicht angetan«, empfing er die Charlotte und den Leo.
»Charlotte, das ist der Werner Hartig, der Pressechef des Turniers«, stellte der Leo ihn seiner Cousine vor.
»Ihr könnt ruhig ›Speedy‹ zu mir sagen, das ist mein Spitzname«, besserte der Pressechef ihn aus. Die Charlotte schüttelte dem Speedy artig die Hand und stellte sich selbst vor. Daraufhin folgte die Einladung, sich an der Kaffeemaschine zu bedienen. Der Leo winkte dankend ab, er hatte einen Funkspruch reinbekommen und musste wieder hinaus.
Die Charlotte sah sich im Pressezentrum um. Gut dreißig Tische waren in dem Turnsaal aufgestellt worden, an jedem Platz war ein LAN-Kabel befestigt, zudem klebte auf jedem Platz ein Namensschild. »Sicher ist sicher«, meinte der Speedy erklärend zur Charlotte. »Meine Ex-Kollegen sind schlimmer als ein Kindergarten. Da würde sich jeder um den ›besten‹ Platz prügeln, obwohl es so was hier ja gar nicht gibt.« Über den Turnsaal verteilt waren fünf große Flatscreens aufgestellt. »Damit die Journalisten alle Spiele verfolgen können, auch wenn sie herinnen sitzen und ihre Berichte schreiben.«
»Ist das nicht alles ein bisschen viel Aufwand für so ein Pimperlturnier?«, meinte die Charlotte.
»Pimperlturnier?« Der Speedy lachte. »Nein, selbst wenn der Hirzer hier nicht mitspielen würde, wäre das kein Pimperlturnier. Also, im Vergleich zu den großen Turnieren natürlich schon, aber es geht hier ja auch um was. Und solche Spieler wie hier bei den ›Perchtoldsdorf Classics‹ hat man in der Gegend schon lange nicht mehr gesehen. Also, mal abgesehen von dem großen Turnier in der Wiener Stadthalle, aber das zählt ja nicht.«
»›Perchtoldsdorf Classics‹? Das Turnier findet doch zum ersten Mal statt, oder?«
»Und?«, antwortete der Pressechef gutmütig. »Jede Tradition beginnt mit einem ersten Mal, und irgendeinen griffigen Titel haben wir auch gebraucht. ›Open‹ und ›Cup‹ heißt ja eh jedes Turnier, also haben wir uns etwas anderes überlegt. Und das Land Niederösterreich buttert genug Geld rein, also muss das Ganze auch ein Erfolg werden.«
»Charly! Was machst du denn hier?«, wurden sie auf einmal unterbrochen. Es war die Flora, die jüngere Schwester der Charlotte. Wie ein Flummi sprang sie in der Gegend herum, völlig aufgeregt. Jaja, so viel Energie wie die Sechzehnjährige hätte die Charlotte auch gerne noch mal.
»Na, ich schau mir mal das Eventgelände an, wir müssen ja langsam anfangen, unseren Stand aufzubauen. Außerdem ist es das erste Mal seit meiner Schulzeit, dass ich wieder hier herinnen stehe. Da werden Erinnerungen wach.«
»Gute?«
Die Charlotte schüttelte den Kopf. Nein, Turnen war garantiert nicht ihr Lieblingsfach gewesen. Bei genauerem Überlegen konnte sie sich überhaupt an kein Lieblingsfach erinnern. Geografie vielleicht. Aber auch nur, weil man da rudimentäre Grundlagen der Geologie bekam, die für den Weinbauerberuf nicht ganz unwichtig waren. Auch wenn Weinbäuerin auf dem Zettel ihrer Berufswünsche eigentlich nie ganz oben gestanden hatte. Eher am anderen Ende der Skala. Aber erstens kam es immer anders und zweitens, als man denkt. Blöder Spruch, entsprach aber der Wahrheit.
»Die Frage ist eher, was machst du hier?«, konterte die Charlotte.
»Ich treffe mich hier mit dem Herrn Lanner.«
»Lanner?« Mit dem Namen konnte die Charlotte überhaupt nichts anfangen.
»Na, dem Chef von der Zeitung. Ich fange ja dort mein Ferialpraktikum an.«
»Echt?« Die Charlotte gestand sich – nicht zum ersten und ganz sicher nicht zum letzten Mal – ein, dass sie ein bisschen besser aufpassen sollte, wenn ihr die Flora aus ihrem Leben erzählte. Denn das hatte sie ihr gegenüber hundertprozentig schon mal erwähnt. Nur war es bei der Charlotte beim einen Ohr rein- und beim anderen Ohr wieder rausgegangen. Völliger kranialer Durchzug also.
»Ja, echt«, maulte die Flora, die sich über solche Unachtsamkeiten ihrer Schwester aber so was von ärgern konnte.
»Bei welcher Zeitung überhaupt?«
»Bei der ›Heimatland‹«, kam der Hartig der Flora mit der Antwort zuvor. »Die sind übrigens auch offizieller Medienpartner des Turniers.« Das war der Charlotte bislang nicht aufgefallen, aber gut, es hingen derzeit ja noch überhaupt keine Werbebanner irgendwo herum. »Ich war früher auch bei denen, bin aber froh, nicht mehr dort zu sein. Heilfroh sogar«, fügte er nachdenklich an.
»Ausgerechnet bei der ›Heimatland‹?«, fauchte die Charlotte, nachdem sie den ersten Schock verdaut hatte.
»Ach, komm doch von deinem hohen Ross runter und tu nicht so, als würdest du nur die Neue Zürcher oder die Süddeutsche lesen«, antwortete die Flora empört. Die Charlotte nahm an, dass es sich dabei um ausländische Qualitätszeitungen handeln musste, so wie die Flora ihr die Namen hingeworfen hatte. In der Hand gehabt hatte sie bisher weder die eine noch die andere. »Die Renate hat mir den Job verschafft. Geh dich doch bei ihr beschweren.«
»Die Renate? Was hat die Renate mit der ›Heimatland‹ zu tun?«, hakte die Charlotte nach.
»Was weiß ich? Vielleicht, weil man es sich in ihrem Business mit niemandem verscherzen will? Und du kennst doch die Renate. Die kann praktisch mit jedem.«
Da hatte die Kleine schon recht. Die Charlotte hatte noch niemanden getroffen, mit dem die Renate nicht ein gutes Auskommen gehabt hätte. Gut, abgesehen von den Liebhaberinnen ihres verblichenen Mannes vielleicht. Aber nobody is perfect.
»Guten Tag, die Damen«, dröhnte es da vom Eingang.
»Wenn man vom Sonnenschein spricht …«, stöhnte der Hartig resignierend.
3
Es war der Manfred Lanner, Gründer, Herausgeber, Chefredakteur der Zeitung »Heimatland« und überhaupt alles in einer Person, was mit dem Geschäft zu tun hatte. Der Auftritt hätte wohl pompös wirken sollen, quasi der alte Patriarch eines einflussreichen Unternehmens, der zu seinen Untertanen herabsteigt, aber irgendwie erschien er eher bemüht und armselig. Vor allem Letzteres. Die Haare waren so schlecht tiefschwarz gefärbt, dass man auf zwanzig Meter Entfernung die Künstlichkeit erkennen konnte. Das Monokel am rechten Auge sollte wohl Kultiviertheit signalisieren, sah allerdings völlig deplatziert aus in einem Gesicht, das auf der rechten Seite seltsam verformt nach unten hing. Kleiner Schlaganfall?, überlegte die Charlotte. Statt von dieser leichten Deformierung abzulenken, betonte es sie nur noch mehr. Die Lippen darunter waren fleischig und wulstig, das Kinn ging direkt über in den dicken Hals, und unterhalb davon wurde es nicht besser. Das hellblaue Hemd über der Wampe vom Lanner quoll über den Gürtel, dessen Schnalle von einem protzigen »LV« geziert wurde, und die Jeans sollten wohl Jugendlichkeit signalisieren, was aber von den sicherlich sündteuren Budapestern an den Füßen gleich wieder konterkariert wurde. Irgendwie passte an dem Typen nichts zusammen. Und überhaupt: Wer trug heute noch ein Monokel?
Der Lanner war der Charlotte auf Anhieb unsympathisch. Ein Eindruck, der durch die nächsten Worte des Alten verstärkt wurde. »Speedy, alter Trottel, was treibst du denn hier?«, feixte der Lanner.
Der Hartig verdrehte die Augen, blieb aber höflich. »Ich bin hier der Pressechef, Manfred.«
»Na, da werden sich die Arschlöcher von den anderen Blattln aber freuen«, meinte der Lanner weiter gut aufgelegt und sah die Flora an.
»Tourette-Syndrom?«, raunte die Charlotte dem Hartig ins Ohr. Der schüttelte den Kopf. »Wäre mir nicht bekannt, der redet mit allen Leuten so. Bisher war er eh noch freundlich. Du solltest den mal hören, wenn er sich über etwas ärgert.«
»Und wen haben wir denn da?«, süßholzraspelte der Lanner jetzt in Richtung der Flora. Die stand, völlig ungewöhnlich für sie, da wie ein kleines, schüchternes Mädchen.
»Ich bin die Flora«, sagte sie leise, »ich darf ab morgen bei Ihnen meine Ferialpraxis machen.« Der Zusatz war so leise, dass man ihn beinahe hätte überhören können.