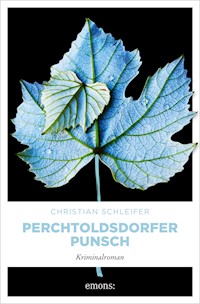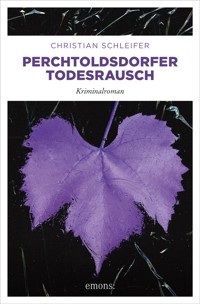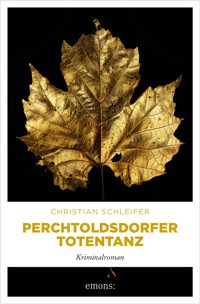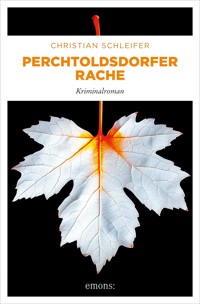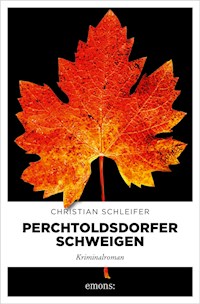
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Charlotte Nöhrer
- Sprache: Deutsch
Charlotte Nöhrer ermittelt wieder – diesmal in der eigenen Familiengeschichte. Noch vor dem Frühstück wird der Charlotte vor der eigenen Tür die erste Leiche serviert. Ein paar Stunden später stirbt ihr Erzfeind Herbert Zaitler während des Hiataeinzugs. In den Perchtoldsdorfer Weinbergen stößt die Ex-Polizistin auf einen geheimen Nazi-Bunker und die Leiche der lange verschollenen Hertha Zaitler. Grundsätzlich alles keine guten Nachrichten. Und dann noch: Wieso benimmt sich die Omama so komisch – und was verschweigt sie?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Christian Schleifer, Jahrgang 1974, ist gebürtiger Perchtoldsdorfer, gefangen im Leben eines Wieners. Nach erfolgreichem Lehramtsstudium der Anglistik und Germanistik arbeitete er zwanzig Jahre lang folgerichtig als Sportjournalist bei zwei österreichischen Tageszeitungen, bevor er 2015 beschloss, sich mehr Zeit für seine Frau, die Zwillinge und das Krimi-Schreiben zu nehmen.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2021 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: mauritius images/Clinchpics/Stockimo/Alamy
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Uta Rupprecht
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-743-9
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Für meine Mütter (in chronologischer Folge):
Liebe dein Gold wie dich selbst!
Dagobert Duck (LTB
Prolog
Zwei Wochen vor dem Hiataeinzug
Eigenartig, wie die Schritte auf den Metallstufen hallten. Es war finster. Nahezu stockdunkel. Kein Wunder, der Raum lag metertief unter der Erde. Von oben drang das Licht kaum bis hier herunter. Lampen waren ohnehin keine angedreht. Hätte noch gefehlt, dass jemand aus dem Ort mitten in der Nacht den Lichtschein hier oben in den Weinbergen sah. Die Lage war so schon exponiert genug. Eigentlich ein Wunder, dass hier noch nie Kinder eingebrochen hatten. Aber der Besitzer hatte Vorkehrungen getroffen, um genau dem vorzubeugen. Ein Königreich für eine Taschenlampe! Aber dafür war es jetzt zu spät.
Es roch modrig, wie es nun mal unter der Erde roch. Ein Geruch, den man aus Weinkellern kannte. Aber selten so intensiv. Gut, das war ja auch kein Weinkeller. Dennoch.
Die Hand glitt suchend über eine raue, jahrzehntealte Betonwand. Sie fuhr über Risse in der Wand, um die sich seit sehr langer Zeit niemand mehr gekümmert hatte. Dementsprechend schlecht war der Zustand. Weiteres Herumtasten, weiteres Suchen, immer hektischer. Hier musste er doch irgendwo sein? Erstickende Panik, ein Gefühl, eingeschlossen zu sein wie in einem Grab. Eine fast undurchdringliche, vollkommene Dunkelheit.
Die Bewegungen der Hand wurden immer hektischer. Noch mehr Tasten und Fühlen. Zentimeter um Zentimeter schob sich die Fußspitze nach vorn. Da, eine Treppe! Langsam hinunter, eine Hand am Handlauf, die andere an der Mauer. Und dann endlich – endlich! – ein alter Plastikdrehschalter. Eine halbe Umdrehung nach rechts und … nichts. Ein leiser Fluch: »Scheiße!« Noch eine halbe Umdrehung, leichter Druck auf das alte, schon ein wenig spröde Plastik und … Na also, ging ja doch! Strom floss, Neonröhren gingen an, zunächst flackernd, dann mit konstantem Licht.
Der Anblick war atemberaubend. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn am Fuß der Treppe lag ein lebloser Körper. Eine Leiche. Eindeutig schon längere Zeit tot, aber erstaunlich gut erhalten, was wohl den besonderen Bedingungen hier unten geschuldet war. War das nicht die …? Ja, schaute ganz danach aus. Trotzdem keine Spur von Panik. Nicht mehr, denn jetzt war ja alles hell erleuchtet und die Beklemmung wie weggeblasen.
Noch ein paar letzte Stufen, aus der Nähe war die Leiche noch besser zu erkennen. An dem leblosen Frauenkörper waren Nagespuren zu erkennen. Die Augen waren von Würmern und anderem Getier, das in den letzten Jahren hier eingedrungen war, herausgefressen worden. Die Nager mussten über kleine Schlupflöcher gekommen sein, denn die Leiche lag am Boden eines alten Nazi-Bunkers, der ja eigentlich so konstruiert war, dass eben niemand eindringen konnte. Aber nach all den Jahrzehnten …
Neben dem Kopf der Frau lag eine zerbrochene Weinflasche. Ihr Inhalt war längst verdunstet, hatte sich aber davor noch mit dem getrockneten Blut vermischt, das wohl aus einem großen Loch am Hinterkopf der Leiche stammte. Die Frau war offensichtlich mit der Flasche erschlagen worden. Ob sie gleich tot gewesen war? Oder hatte der Mörder sie hier verbluten lassen? Sei’s drum!
Weiter ging’s. Die Suche nach einer Leiche war nicht der Grund für den Besuch im Bunker. Aber halt, war da nicht noch was? Wieder in die Knie gehen, nur ja keine Fingerabdrücke hinterlassen … Die Leiche würde zwar sicher nicht der Polizei gemeldet werden, aber man konnte ja nie wissen.
Ein Taschentuch, um vorsichtig die Flasche zu drehen. Jetzt war das Etikett endlich lesbar. Viel war nicht mehr zu erkennen, nachdem die Flasche so lange in einer Blut- und Weinlache gelegen hatte. Mit viel Mühe ließ sich aber noch die Aufschrift in Frakturschrift entziffern: »Weingut Goldmann«. Soso. Kopfschütteln, abschütteln, aufstehen. Weitersuchen.
Der Bunker schien fast endlos zu sein. Er reichte gut dreißig Meter tief in die Weinhügel von Perchtoldsdorf. Hier und da war mal eine Neonröhre ausgefallen, und Verputz bröckelte von der gewölbten Decke, aber im Großen und Ganzen sah das Bauwerk noch recht intakt aus. Irgendwie hätte der Anblick dennoch spektakulärer sein können. Anders als in einem streng geheimen Regierungslagerhaus in einem »Indiana Jones«-Film stapelten sich hier gerade mal ein paar Dutzend Holzkisten. Die meisten mit einem Hakenkreuz versehen. Damit war zu rechnen gewesen.
Tiefer hinein ging es in den Bunker. Im Boden war ein riesiges Hakenkreuz eingelassen. Nicht aufgemalt oder eingeklebt. Nein, es war ein echtes Mosaik, das den Boden zieren sollte. In stundenlanger oder vielleicht sogar tagelanger Handarbeit verlegt. Keine Ahnung, wie lange man für so etwas benötigte.
Nicht draufsteigen! Vorsichtig herumgehen, den Blick abgewandt. Zu groß waren die Emotionen, die dieses Symbol hervorrief.
Immer noch tiefer hinein. Je weiter man vordrang, umso verwahrloster war das Interieur des einstigen Nazi-Verstecks. Am hinteren Ende angekommen, zeigte sich, dass an einer Stelle von der Bunkerwand nicht mehr viel übrig war. Das war weniger dem natürlichen Verfall geschuldet als vielmehr der Zerstörungswut des derzeitigen Besitzers. Auf dem Boden lagen große Hämmer, Brecheisen, Schlagbohrer und anderes schweres Werkzeug, mit dem der Bunkerwand zu Leibe gerückt worden war.
Mit Erfolg. Wo einst der Bunker in einer soliden Betonwand geendet hatte, befand sich nun ein mannsgroßes Loch, das von einer schnell zusammengenagelten Holztür nur notdürftig verschlossen wurde. Aber wieso hatte man hier überhaupt ein Loch in die Wand geschlagen?
Egal. Eine Schulter gegen die Tür, leicht angeschoben, und schon ging sie auf. Dahinter offenbarte sich ein unterirdischer Gang, der allerdings längst keinen so stabilen Eindruck machte wie der Nazi-Bunker. Es war ein einfacher Erdtunnel, von Hand gegraben und alle paar Meter mit Holzbalken gegen einen möglichen Einsturz gesichert. Das Licht aus dem Bunker reichte ein paar Meter weit in den Tunnel hinein und ließ erkennen, dass an der Wand Vorrichtungen angebracht waren, in die man einst Kerzen oder Fackeln gesteckt hatte.
Eine leichte Brise war zu spüren. Ein noch stärkerer modriger Geruch, wieder das Gefühl, bei lebendigem Leib begraben zu sein. Schütteln, abbeuteln. Immerhin bedeutete der Luftzug, dass es irgendwo noch mindestens einen weiteren Ausgang geben musste. Kurzes Nicken. Nachdenken. Vor sich hin murmeln: »Also stimmen die Geschichten doch. Es gibt tatsächlich ein unterirdisches Tunnelnetz in den Weinbergen.«
Tür wieder zu. Die Entdeckung des Tunnelnetzes war ein weiterer Bonus, aber auch nicht das eigentliche Ziel der Suche. Also wieder zurück in den Bunker und Latexhandschuhe angezogen, jetzt ging es ans Eingemachte. Was war bloß in den Holzkisten versteckt?
Zunächst ging es den wenigen Kisten an den Kragen, die nicht mit einem Hakenkreuzsymbol versehen waren. Sonderliche Gewalt war nicht notwendig, die meisten Kisten waren vom Besitzer des Nazi-Bunkers bereits mit einem Brecheisen aufgebrochen worden. Man musste nur noch den Deckel zur Seite schieben.
Der Inhalt der ersten Kiste war eine echte Überraschung. Ein kurzer Griff, und schon war eine uralte Flasche Grüner Veltliner aus ihrem dunklen Versteck befreit. Praktisch unversehrt und nicht einmal sonderlich staubig. Diesmal war das Etikett besser lesbar. Wieder stand in Frakturschrift »Weingut Goldmann« darauf. Es war kein edler Tropfen. Ein Grüner Veltliner würde das nie sein, aber er war wohl trotzdem jede Menge Geld wert. Der Jahrgang war nämlich 1940. Und dafür würde ein Weinsammler unter Umständen sogar töten, auch wenn der Wein inzwischen wohl ungenießbar war. Aber wer wusste das schon? Er war jahrzehntelang optimal gelagert gewesen. Im schlimmsten Fall taugte er wenigstens als edler Salatessig. Vor ein paar Jahren hatten Wein-Connaisseurs das auch von den neuen Weißen im Ort behauptet. Diese Zeiten waren glücklicherweise vorüber.
Vorsichtig wurde die Flasche zurück in die Kiste gestellt. Eine stichprobenartige Prüfung der anderen Flaschen ergab, dass sie alle vom Weingut Goldmann stammten. Ein Weingut, das es seit Jahrzehnten nicht mehr gab. Angeblich sogar niemals gegeben hatte. Unter den Weinen fanden sich auch ein paar rote, die wahrscheinlich sogar noch genießbar waren. Die Versuchung war groß, eine Flasche mitzunehmen, letztlich landeten aber alle wieder in ihrem dunklen Versteck, und die Kiste wurde geschlossen.
Der große Moment, inzwischen schon über eine halbe Stunde hinausgezögert, war nun gekommen. Es ging nicht mehr anders. Jetzt wurden die Kisten geöffnet, die mit dem Nazi-Hakenkreuz gebrandmarkt waren.
Bingo! Ein sanfter goldener Schimmer leuchtete aus der Holzkiste entgegen. Ein Griff, und schon glänzte ein schwerer Goldbarren im sterilen Licht der Neonröhren. Auch er war mit einem Hakenkreuz gekennzeichnet. Offensichtlich hatte sich schon einmal jemand hier bedient, denn aus der Anordnung der Goldbarren in der Kiste war zu erkennen, dass gut ein Dutzend der wertvollen Stücke fehlte. Daneben noch eine weitere Kiste mit Goldbarren. Und noch eine. Es war ein veritabler Goldschatz, der hier unter den Perchtoldsdorfer Weinbergen versteckt war.
Weiter ging es mit der Schatzsuche. Allerdings nur in jenen Kisten, die bereits mit einem Brecheisen aufgebrochen worden waren. Nur ja keine Spuren hinterlassen!
Gold fand sich keines mehr. In erster Linie waren es alte Akten und Aufzeichnungen, die hier unten gebunkert waren, im wahrsten Sinne des Wortes. In einer der Kisten waren Wehrmachtspistolen verstaut. Ansonsten: noch mehr Akten, noch etwas Wein, Alltagsgegenstände. Am wichtigsten war jedoch das Gold gewesen. Aber war es das auch wert, um das Vorhaben in die Tat umzusetzen? Würde diese Menge Goldes die Wunden der Vergangenheit schließen? Konnte Gold das überhaupt?
Niedersetzen, durchatmen, nachdenken. Noch einmal das eigene Gewissen prüfen. Befragen. Durchkalkulieren. Das kalte Gitter der Metalltreppe drückte sich unangenehm ins Hinterteil. Ellbogen auf die Knie, Kopf in die Hände gestützt. Nachdenken, überlegen. Zwischen zwei Metallstiegen fiel der Blick auf etwas bislang Unentdecktes. Eine weitere Kiste. Versteckt unter den Metallstiegen, die von weiter oben tief ins Innere der Erde führten. Aufstehen, vorsichtig die Leiche umrunden, bücken. Mit zitternden Händen den kleinen Metallkasten hervorziehen. Er war weder versperrt noch sonst wie gesichert. Lediglich ein Klappverschluss. Schnapp, schon stand das Kistchen offen. Der Inhalt wirkte wie eine göttliche Offenbarung, in Sekundenschnelle formte sich ein Plan. Ja, das Gold allein war es wert, den Plan weiterzuverfolgen. Das Gold war ohnehin nur ein Bonus, eigentlich ging es immer noch um Rache. Und das Schicksal hatte soeben für das notwendige Werkzeug zur Umsetzung des Plans gesorgt.
In der Schatulle befand sich ein Dutzend der unter Waffenliebhabern so begehrten Nazi-Dolche.
Erster und letzter Teil
Was war,was ist,
1
Am Anfang war das Wort. Um genau zu sein, waren es diesmal sogar zwei Wörter, und das noch dazu auf Italienisch. »Che cazzo! – Was zum Teufel!« Ausgerufen vom Luca Bianchi, dem sechzehnjährigen italienischen Lover von Flora Nöhrer, der kleinen Schwester der Charlotte. »Oh Scheiße!«, hätten wohl die Flora oder die Charlotte gerufen, hätten sie die zweifelhafte Ehre gehabt, die entstellte Leiche mitten im Innenhof des Weinguts aufzufinden.
So aber hatte es den Luca getroffen, der mit seinem Vater die Herbstferien nutzte, um seiner Freundin im Norden wieder einmal einen Besuch abzustatten. Hatte ja niemand ahnen können, dass er nach der Geschichte im Frühsommer gleich bei seinem nächsten Besuch in Perchtoldsdorf schon wieder mit einer Leiche konfrontiert wurde.
Die morgendliche Kälte und der Schock ließen dem Luca das Blut in den Adern gefrieren, er konnte keinen Schritt mehr machen. Erst nach einigen Momenten ging er wie ferngesteuert auf den Körper zu. Es war wirklich kein schöner Anblick. Der Luca erkannte nur, dass es sich um einen Mann handeln musste. Am Hinterkopf klaffte ein riesiges Loch, das Gesicht war bis zur Unkenntlichkeit von Messerschnitten entstellt. Der Luca hielt sich die Hand vor den Mund und bemühte sich nach Kräften, das üppige Abendessen vom Vorabend bei sich zu behalten. Endlich löste sich der Krampf in seinem Bauch, er machte auf der Stelle kehrt und lief zurück ins Haus.
Laufen, laufen … Ja, er hatte eigentlich einen Morgenlauf machen wollen, aber so hatte er sich das nicht vorgestellt. Schon gar nicht gestern Abend, als er mit seinem Papa im Porsche Panamera aus Italien zu seiner Flora ins normalerweise recht beschauliche Perchtoldsdorf hinaufgedüst war.
Am frühen Samstagabend waren die beiden Italiener eingerauscht und hatten ihr Zimmer im Weingut der Familie Nöhrer bezogen. Obwohl – eigentlich hatte das nur der Papa Bianchi getan. Der Luca hatte sich schnurstracks bei seiner Flora einquartiert.
Was sollten die Eltern der beiden schon groß tun? In wenigen Tagen feierte die Kleine ihren sechzehnten Geburtstag, und dann konnten sie es sowieso nicht mehr verhindern. Für irgendwelche Ferkeleien aber war a) die Flora zu beschäftigt mit ihrem Schulprojekt und b) der Luca nach der gut neunstündigen Autofahrt zu geschlaucht (auch wenn er in seinem Alter noch nicht selbst lenken durfte). Nach einem feierlichen Willkommensabendessen (das hatte sich die Nöhrer-Mama keinesfalls nehmen lassen) waren alle todmüde ins Bett gefallen und hatten bis zum nächsten Morgen durchgeschlafen.
Der Luca war um sechs in der Früh aufgewacht und wollte sich mit einem kurzen Morgenlauf die Müdigkeit aus den Beinen schütteln. Das schien ihm passend, vor allem in der eisigen Morgenluft dieses Novembermorgens. Weit war er aber nicht gekommen. Eigentlich nur ein paar Schritte. Denn kaum hatte er den Wohntrakt des Weinguts verlassen, war ihm sofort der reglose Körper aufgefallen, der vor dem Eingang zum alten Weinkeller mitten im Innenhof des Nöhrer’schen Weinguts lag.
»Lass mich!«, murrte die Flora verschlafen, als er sie rüttelte, um sie aufzuwecken.
»Nein, nein, du musst mitkommen!« Luca beharrte darauf, dass sich seine Freundin gefälligst aus dem Bett kämpfen und anziehen sollte. Immerhin konnte er sich inzwischen halbwegs verständigen, schließlich machte der Luca seit dem Winter, in dem er die Flora im Skiurlaub kennengelernt hatte, einen Deutschkurs. Wozu einen die Liebe nicht alles trieb …
Er wusste ohnehin nicht, an wen er sich sonst hätte wenden sollen. Die Charlotte aufwecken? Nein, das traute er sich nicht. Außerdem hatte die ältere Schwester von der Flora am Vorabend bei der Hiataeinzug-Vorfeier der jungen Weinhauer mitgemacht. Und die hatte wohl mit einem gewaltigen Kater geendet.
Den Noah alarmieren? Das ebenso wenig. Der neue Mitbewohner und Ziehsohn der Nöhrers war ihm nach wie vor etwas suspekt, auch wenn sich ihr Verhältnis während der Shakespeare-Morde im Sommer etwas gebessert hatte. Ganz recht war es ihm dennoch nicht, dass da jetzt ein Siebzehnjähriger unter demselben Dach schlief wie seine Flora. Noch dazu ein ehemaliger Stricher und Junkie. Also blieb nur die Flora. Sie wusste sicher, was zu tun war. Musste es einfach wissen. Aber zuerst musste er sie erst einmal richtig wach bekommen.
»Gnnnnhmmm«, stieß die Flora aus und wehrte sich gegen das frühe Aufstehen an diesem Sonntag. In ein paar Stunden begann der Hiataeinzug, und da wollte sie voll fit sein. Der Tag würde lange dauern, mit viel Alkohol und einer Afterparty, die in der ganzen Umgebung legendär war. Weinort, Volksfest und so weiter, da nahm man es mit den Jugendschutzbestimmungen nicht immer so genau. Schon gar nicht, wenn es sich um die Tochter eines der größten Weinbauern in der Gegend handelte.
Der Luca kannte aber keine Gnade. Schwungvoll zog er seiner Freundin die Decke weg, und jetzt war die Flora endlich wach. Und stinksauer.
»Was soll das?«, stöhnte sie und rieb sich die Augen.
»Im Hof. Ein Toter!«, hechelte der Luca aufgeregt.
»Ein Toter? Du spinnst ja! Wo soll der denn herkommen?«
»Keine Ahnung«, antwortete der Luca ehrlich. »Was sollen wir machen?«
Statt einer Antwort warf sich die Flora in ihr Gewand vom Vortag. Jetzt war keine Zeit, frische Kleider herauszusuchen. Eine Minute später stand sie zitternd und bibbernd im Hof. Vielleicht hätte sie sich doch die Zeit nehmen sollen, in einen Pulli zu schlüpfen. Nur so im T-Shirt war es schon saukalt. Vor ihr lag die Leiche, auf der Leiche ein beschmierter Zettel (der dem Luca zuvor gar nicht aufgefallen war) und gleich dahinter der Eingang zum alten Weinkeller, der das neueste Projekt ihrer großen Schwester war. Über ihnen breitete sich das Astgerippe des hundertfünfzig Jahre alten Kastanienbaums aus, der den Mittelpunkt des Innenhofs markierte.
»Oh Scheiße!«, fluchte die Flora (womit auch elegant die Brücke zum Anfang geschlagen wäre). Worauf der Luca nur bestätigend nicken konnte. Dann sagte er: »Wir müssen die Charlotte holen. Das ist eine Nummer zu groß für uns.«
»Hättest du das nicht gleich machen können?«, schimpfte die Flora. »Wieso weckst du mich dann überhaupt auf?«
Der Luca druckste herum und rückte schließlich doch heraus: »Hab mich nicht getraut.«
Die Flora schüttelte den Kopf. Klar, in der Früh nach einer durchzechten Nacht war mit ihrer großen Schwester nie gut Kirschen essen. Aber ein Toter im Hof? Da hätte sie dem Luca das Aufwecken garantiert verziehen.
Die beiden eilten zurück zum Wohntrakt und eine Treppe nach oben, dann standen sie vor dem Eingang zum Wohnbereich der Charlotte und der Andrea, ihrer Freundin. Die Flora kannte in einer solchen Situation keine Gnade und klopfte ein paarmal lautstark an die Tür. Nachdem keine Antwort kam, riss sie sie einfach auf und stürmte durch das kleine Vorzimmer mitten hinein ins Schlafzimmer ihrer Schwester. Die lag noch im Tiefschlaf und in den Armen von der Andrea.
»Aufstehen!«, schrie die Flora der Charlotte ins Ohr. Die fuhr erschrocken auf, knallte der Flora eine und drehte sich wieder um.
»Ja, spinnst du?«, schimpfte die Kleine, rieb sich die Wange und machte es dann wie zuvor der Luca bei ihr: Sie zog ihrer Schwester einfach die Decke vom Körper. Der Luca lief hochrot an, als er seine potenzielle Schwägerin völlig nackt erblickte. Zum Glück (?) wurden die Brüste seiner Schwägerin in spe durch ihre langen kastanienroten Locken verdeckt. Rasch wandte er seinen Blick zur Seite. Auch nicht besser und nicht weniger peinlich, denn die Charlotte hatte sich mit der Andrea eine Decke geteilt, und die Blondine zeigte sich nun ebenfalls von ihrer – bildlich gesprochen – besten Seite. Und bei ihr fielen die blonden Haare nicht über die Brust …
Der kleine Italiener hatte schon bei seinem letzten Besuch im Frühsommer festgestellt, was für einen Riesenverlust es für den männlichen Teil der Bevölkerung bedeutete, dass ausgerechnet die Andrea bisexuell war. Und die Flora hatte ihren Bonsai-Latin-Lover nicht nur einmal dabei erwischt, wie er der Andrea gierige Blicke nachgeworfen hatte. Okay, so ein Bonsai war er inzwischen gar nicht mehr. Seit dem letzten Winter hatte er einen gewaltigen Wachstumsschub durchgemacht. Für die Charlotte würde er aber ewig der »Bonsai-Lover« bleiben.
Der Luca musste alle Kraft aufwenden, um den inneren Schweinehund niederzuringen und nicht noch einmal zur Andrea hinüberzulugen. Nach ein paar Sekunden war der Kampf beendet. Mit einem K.-o.-Sieg für den Schweinehund. Gut, dass die Flora zu beschäftigt war, um zu merken, wie ihr Freund die nackte Andrea angaffte.
Daran verschwendete die Kleine gerade eben aber keinen Gedanken. Sie wollte nur endlich ihre Schwester aus dem Bett bekommen. Und sich irgendwie für die Ohrfeige von zuvor revanchieren. Auch wenn ihr klar war, dass sie nur eine Affektreaktion gewesen war, weil ihre Schwester vom Vorabend noch so einen grauslichen Kater hatte. Also kniff sie ihrer bald nur mehr vierzehn Jahr älteren Schwester fest in den Po, und damit war auch die Charlotte endlich wach. Die Andrea zog sich derweil im Halbschlaf wieder die Decke über den Kopf.
Der Luca atmete tief durch und konzentrierte sich auf die Charlotte. Keine gute Idee, die war ja auch noch immer nackt. Er beschloss, dass es jetzt genug war, und zog sich ins Vorzimmer zurück. Sollten die ragazze die Sache doch unter sich ausmachen. Was sie auch taten.
Fünf Minuten später erschienen die Flora und die Charlotte im Vorzimmer. Die Charlotte sah aus wie der Tod auf zwei Beinen: Ihre kastanienroten Locken fielen in ein bleiches Gesicht, in dem nur die schwarzen Augenringe strahlten – jeder Pandabär wäre stolz auf diesen Look gewesen. Ihre grünen Augen waren blass, die Lippen zu einem schmalen Strich zusammengekniffen. Die Flora musste ihre rauschige Schwester stützen, damit sie heil in den Hof gelangte.
Beim Anblick der Leiche war dann auch die Charlotte geschockt, aber nicht aus dem gleichen Grund wie zuvor der Luca und die Flora. Als ehemalige Polizistin war sie den Anblick eines Toten durchaus gewohnt. Was sie schockierte, war, dass die Leiche ausgerechnet in ihrem Hof lag. Noch dazu vor dem alten Weinkeller, den sie seit Kindheitstagen liebte und den sie bis zum nächsten Frühjahr zu einem modernen Showkeller für Führungen, Weinverkostungen und Firmenfeiern umbauen lassen wollte.
Der Tote kam ihr irgendwie bekannt vor – was in einem relativ kleinen Ort wie Perchtoldsdorf, wo nach wie vor fast jeder jeden kannte, wenig verwunderlich war. Aber sie konnte nicht den Finger darauf legen, an wen er sie genau erinnerte. Das Gesicht war völlig zerstört und nicht zu identifizieren. Auch sonst waren auf den ersten Blick keine Auffälligkeiten wie Tätowierungen oder Piercings zu sehen. Die Kleidung ließ ebenfalls keine Rückschlüsse zu: Sneakers, Jeans und ein schwarzes T-Shirt hatte hier im Ort schnell einmal jemand an. Es handelte sich um Dutzendware, also nichts, was einen Hinweis auf die Identität der Leiche gegeben hätte. Klar war nur, dass es sich um einen Mann handelte.
»Wir müssen den Leo rufen«, stellte die Charlotte schließlich fest und sah die Flora an. »Hast du dein Handy bei der Hand? Meins ist noch am Zimmer.« Die Flora schüttelte den Kopf. »Okay, dann hole ich es halt«, stöhnte die Charlotte und stapfte zurück in ihre Wohnung. »Nichts anrühren, verstanden?«, rief sie noch über ihre Schulter hinweg. Kurz darauf war sie wieder zurück, das Handy und ihren Cousin, den Chefinspektor des Orts, am Ohr.
»Ja, Leo. Eine Leiche. Nein, ich habe gestern nicht zu viel getrunken. Was soll das heißen, du warst ja dabei? Und? Du warst genauso hinüber! Nein, ich habe auch sonst nichts eingeworfen. Ja, spinnst du denn komplett? Hör zu, Cousin. Ich weiß, es ist früh. Ich weiß, in ein paar Stunden ist der Hiataeinzug, und da habt ihr alle Hände voll zu tun. Aber ich weiß auch, dass ich hier bei mir im Hof eine Leiche liegen habe. Also schwing deinen Polizistenarsch gefälligst zu uns herauf!« Damit beendete sie das Gespräch.
»Und jetzt?«, fragte die Flora.
»Jetzt warten wir. Was sollen wir schon groß tun? Das ist Sache der Polizei.«
»Obwohl dir jemand eine Leiche geradewegs vor die Tür gelegt hat?« Die Flora kannte ihre Schwester nur zu gut. Und wirklich, die Charlotte blinzelte ihr zu und lächelte. Ihr Blick fiel wieder auf die Leiche. Erst jetzt fiel ihr auf, dass auf der Brust ein halb zerknüllter und beschmierter Zettel lag, ein gelbes Post-it. Sie beugte sich zu dem Toten hinunter. »›Charlotte, das hast du zu verantworten‹«, las sie den hingekritzelten Text laut vor.
»Du?«, fragte die Flora erstaunt.
»Okay, jetzt wird’s tatsächlich persönlich«, murmelte die Charlotte vor sich hin. Wieso sollte sie eine ihr unbekannte Leiche zu verantworten haben, die ein offenbar Irrer in ihrem Hof abgelegt hatte? Klar, seit ihrer Übernahme des Weinguts im Frühjahr hatte sie sich mit etlichen Modernisierungsmaßnahmen jede Menge Ungemach und Ärger bei den alteingesessenen Weinhauern zugezogen. Aber an einen Todfeind wollte sie einfach nicht glauben. Der alte Zaitler wäre dem noch am nächsten gekommen, aber diese Geschichte war ja seit dem Sommer auch gegessen. Und sonst war da niemand, dem sie zutraute, jemanden umzubringen, um ihr damit eine makabere Botschaft zu senden.
Ein paar Minuten später bremste sich in der Schottereinfahrt vor dem Weingut ein Polizeiwagen ein. Die Charlotte öffnete das Tor, und der Leo betrat mit einem Kollegen den Hof. »Der Rest ist auch schon unterwegs«, sagte ihr Cousin mürrisch statt einer Begrüßung und marschierte schnurstracks auf den alten Weinkeller zu. »Gäste?«, fragte er die Charlotte im Vorbeigehen.
»Ja«, antwortete die Charlotte. »Alle zehn Zimmer sind belegt. Sind wegen des Hiataeinzugs da, schlafen aber noch. Wäre also toll, wenn ihr möglichst unauffällig vorgehen könntet. Und übrigens, guten Morgen«, pflaumte sie zurück. Der Leo nickte beiläufig und sah sich die Leiche an. Ihm fiel der Zettel auf der Brust sofort auf. Er zog ein Paar Latexhandschuhe an und griff vorsichtig danach. Zwei, drei Mal musste er den Text lesen, ehe er die Nachricht vollständig verarbeitet hatte. Seinen fragenden Blick konnte die Charlotte lediglich mit einem ratlosen Schulterzucken beantworten.
Da kam auch schon der Rest der Mannschaft angerauscht, allen voran die Spurensicherung. Der Bereich rund um den Weinkeller wurde mit einem Polizeiband abgesperrt, die Leiche aus allen möglichen Winkeln abfotografiert.
»Immerhin ist klar, dass der Mann nicht hier umgebracht wurde«, meinte der Leo zur Charlotte, während er seinen Mitarbeitern zusah.
»Weil?«, fragte sie. Darüber hatte sie sich noch gar keine Gedanken gemacht.
»Weil es so gut wie keine Blutspuren gibt. Ohne dem Gerichtsmediziner vorgreifen zu wollen, ist der Typ meiner Meinung nach erschlagen worden. Dafür spricht das Loch am Hinterkopf. Aber, und jetzt wird’s interessant, da ist kein Blut auf dem Boden rund um die Leiche. Er muss woanders ermordet und dann hierhergeschleppt worden sein. Ist dir das nicht aufgefallen?«
»Nein, aber ich gebe zu, dass ich nicht so drauf geachtet habe. Hallo? Irgendwer hat mir eine Leiche direkt vor die Tür gelegt. Glaubst du, da habe ich einen Kopf für solche Details?«
Der Leo ignorierte den angepissten Ton seiner Cousine. »Stellt sich nur noch die Frage, wie der Täter mit der Leiche hier hereingekommen ist. Oder könnte es vielleicht einer der Gäste gewesen sein?«
Die Charlotte schüttelte entschieden den Kopf. »Nein, alle Zimmer sind von Japanern belegt. Und der Tote ist ganz sicher kein Japaner.«
»Gut. Über die Mauer kann er die Leiche auch nicht gebracht haben. Der Tote ist ein ganz schönes Bröckerl. Den hebt man nicht so einfach mal da drüber.«
»Das können wir sogar überprüfen. Seit der Geschichte mit der zerschnittenen Leinwand im Sommer habe ich überall Bewegungsmelder und Videokameras anbringen lassen. Wenn sich in der Nacht einer dem Weingut nähert, geht Licht an, und es wird alles aufgezeichnet.«
»Können wir uns das Video von heute Nacht einmal anschauen?«
Die Charlotte führte ihren Cousin ins Innere des Weinguts und eine Treppe hinunter in den Keller. Dort war die gesamte Technik des Gutes untergebracht, darunter auch das Video-Equipment für die Überwachungskameras. Von der letzten Nacht existierte aber keine Aufzeichnung.
»Das bedeutet, dass sich niemand dem Weingut genähert hat«, erklärte die Charlotte. »Der Täter muss also irgendwie anders reingekommen sein.«
»Gilt das auch für das vordere Tor oder nur für das hintere, das zur Wiese führt?«
»Das gilt für den gesamten Hof. Alle vier Seiten werden von unserer Sicherheitsanlage abgedeckt.«
»Vielleicht hat der Täter die Aufzeichnungen gelöscht?«
Die Charlotte verneinte. »Du hast ja gesehen, dass abgesperrt war. Außer mir und dem Papa hat niemand einen Schlüssel.«
»Wie ist der Täter dann reingekommen?«
»Das ist die Frage aller Fragen«, sagte die Charlotte resignierend.
Die beiden stiegen wieder nach oben und gesellten sich zu den anderen im Hof. Dort hatte die Spurensicherung ihre Arbeit beinahe abgeschlossen.
»Was könnt ihr mir erzählen?«, fragte der Leo einen der in weiße Schutzanzüge gekleideten Spezialisten.
»Nicht viel«, antwortete der. »Die Leiche war schon kalt, als man sie hierherbrachte. Du siehst ja selbst, dass da kaum Blut ist. Durch die niedrigen Temperaturen lässt sich auf die Schnelle auch nicht sagen, wie lange der Typ schon tot ist.
»Fußabdrücke?«
»Nichts. Was nicht mit Terrakottafliesen ausgelegt ist, ist gefrorener Rasen oder Schotter, über den ein paar ganz intelligente Leute schon drübergerannt sind.« Dabei warf der Spurensicherer den Nöhrers einen bitterbösen Blick zu. Der ließ die Charlotte aber kalt. Da musste sie ausnahmsweise mal den Luca und die Flora in Schutz nehmen. Vor allem der Luca hatte in der Früh ja nicht ahnen können, dass er über eine Leiche stolpern würde.
»Wirklich keine Ahnung, wie lange der Typ schon tot ist?«
»Das muss der Gerichtsmediziner feststellen. Wie gesagt, je nachdem, wie lange die Leiche hier heraußen in der Kälte gelegen ist. Geschätzt aber …« Der Spurensicherer blickte auf seine Armbanduhr. »Jetzt ist es sieben Uhr. Ich würde sagen, sicher schon gute neun Stunden, vielleicht ein bisschen mehr oder etwas weniger.«
»Habt ihr vielleicht eine Idee, wie die Leiche hierhergekommen sein könnte?«
»Tut mir leid, aber da bin ich überfragt. Aber nachdem sie direkt vor der Weinkellertür liegt …«
»Charlotte?«, sagte der Leo.
»Ja?«
»Wo führt der Weinkeller hin?«
»In die Erde.«
»Sehr lustig. Und weiter?«
»Was, weiter? Er geht zwanzig Meter weit in die Erde und Schluss.«
»Scheiße!« Der Leo drehte sich um, steckte zwei Finger in den Mund und pfiff ein paar Kollegen zu sich. »Ich will das trotzdem abchecken«, erklärte er seiner Cousine und schickte die beiden Uniformierten in den Weinkeller. Die Charlotte erklärte den beiden Polizisten, wo im vorgelagerten Presshaus der Lichtschalter zu finden war. Nach ein paar Minuten kamen die beiden mit langen Gesichtern wieder zurück. »Nichts«, erklärten sie ihrem Chef. »Da unten ist nur jede Menge Gerümpel, ein paar alte Weinflaschen, kaputte Fässer und leere Kartons. Keine Tür oder irgendein Ausgang.«
»Hab ich dir ja gesagt«, meinte die Charlotte ein wenig eingeschnappt. Sie kannte doch wohl noch ihren eigenen Weinkeller. Zugegeben, sie war seit Jahren nicht mehr unten gewesen, weil er nicht mehr verwendet wurde, aber das war hier noch immer ihr Grund und Boden!
Sie ging zurück ins Haus und überließ die Polizei ihrer Arbeit. Sie musste sich um andere Sachen kümmern. Zum Glück ging ein Großteil der Hotelzimmerfenster auf die andere Seite hinaus. Die Gäste würden in den nächsten Minuten aufwachen, und das Letzte, was sie jetzt sehen sollten, war ein Großaufgebot der Polizei im Innenhof. Das Problem war eher der Frühstücksraum, durch dessen großes Panoramafenster man direkt auf den Innenhof sehen konnte.
Ihre Eltern waren bereits wach und verfolgten das Spektakel aus ebenjenem Frühstücksraum. »Wir wollten nicht stören«, erklärte die Frau Mama aufgeregt. »Wir haben gesehen, dass du draußen bist, und wussten, dass die Situation unter Kontrolle ist.« Bei so viel Lob wurde die Charlotte rot im Gesicht. »Kannst du uns vielleicht erklären, was hier los ist?«
»Wir haben eine Leiche im Hof«, erwiderte die Charlotte trocken. Hatte ja keinen Sinn, groß um den heißen Brei herumzureden. Die Mama riss erschrocken die Augen auf, der Herr Papa schüttelte entsetzt den Kopf. »Egal, erklär ich euch später genauer. Jetzt müssen wir was unternehmen, damit unsere Gäste nichts mitbekommen.«
Unerwartet rasch hatte sich die Mama wieder gefangen. Gefasst sagte sie: »Wir lassen die Jalousien runter und erklären, dass draußen gerade gearbeitet wird. Ein Wasserrohrbruch oder was Ähnliches«, schlug sie vor. Erstaunt blickte die Charlotte ihre Mama an. So viel Kalkül hatte sie ihr in einer solchen Situation nicht zugetraut.
»Werden sie uns das glauben?«, fragte sie.
»Es sind Japaner«, erklärte die Mama. »Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber im Urlaub glauben die doch alles, was man ihnen erzählt.« Sie ließ die Jalousien herunter, und damit war die Diskussion beendet. Gut, so viel mehr Möglichkeiten hatten sie sowieso nicht. Als die ersten fernöstlichen Gäste im Frühstücksraum eintröpfelten, setzte die Mama hochprofessionell ihr freundlichstes Gesicht auf. Die Japaner merkten gar nicht, dass es sich um übertriebene Höflichkeit handelte. Die waren das aus ihrer Heimat so gewohnt, da war eher alles, was weniger höflich war, ungewöhnlich.
Die Charlotte nützte die Gelegenheit, um sich wieder in den Hof hinauszuschleichen. Dort hatte die Polizei ihre Arbeit zum Glück bereits so gut wie beendet und packte zusammen. Nachdem es sich nicht um den Tatort handelte, war nicht viel zu finden gewesen. Auf der Leiche – ja, das schon. Rundherum nicht so viel. Wie die Leiche hergekommen war, blieb weiter ein Rätsel. Mit einem Hubschrauber hatte man sie wohl nicht abgelegt. So etwas hätte selbst die komatöse Charlotte nicht überhören können.
Als die Charlotte wieder ins Haus gehen wollte, ertönte von der Einfahrt her lautes Hupen.
»Herrgott noch mal!«, fluchte sie und eilte zum Einfahrtstor. Es war der Leichenwagen, der gekommen war, um den Toten abzutransportieren.
»Leise«, zischte sie dem Fahrer zu, »wir haben Gäste. Die müssen das nicht mitbekommen.«
Der Fahrer nickte und wartete, bis die Charlotte das Tor ganz geöffnet hatte. Dann rollte er im Schritttempo in den Hof. Die Leiche wurde in einen anonymen grauen Sarg gepackt und in den Wagen verfrachtet. Nachdenklich blickte die Charlotte dem Leichenwagen nach, als dieser sich rückwärts aus dem Hof schob.
»Ich weiß nicht«, sagte sie zu ihrem Cousin, der neben ihr stand und dem Wagen ebenfalls nachsah. Auch er musste sich erst daran gewöhnen, dass im sonst so beschaulichen Perchtoldsdorf seit dem Sommer offenbar »das echte Leben« mit Mord und Totschlag Einzug gehalten hatte. »Irgendwie kam mir der Tote bekannt vor«, sagte sie dann nachdenklich. »Ich bin mir sicher, dass ich ihn kenne, aber es will mir nicht einfallen, wer es sein könnte.«
Der Leo schwieg ein paar Sekunden, dann sagte er: »Wir werden es schon herausfinden. Wenn er dir bekannt vorkommt, wird es wohl ein Einheimischer sein. Dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis es eine Vermisstenanzeige gibt. Spätestens dann wissen wir mehr.«
»Habt ihr noch irgendwas an der Leiche gefunden?«
»Fehlanzeige«, schnaufte der Leo. »Keinen Ausweis, keine Geldbörse, gar nix.«
»Besondere Merkmale am Körper?
Der Leo zuckte mit den Schultern. »Wir haben die Leiche ja nicht ausgezogen, das passiert erst in der Gerichtsmedizin. Aber auf den ersten Blick konnte ich keine Tätowierungen oder Ähnliches entdecken. Falls du das gemeint hast.«
Keine Antwort der Charlotte, die auch nicht wusste, was sie sich da jetzt eigentlich erwartet hatte.
»Wie auch immer, Cousinchen«, sagte der Leo und blickte auf die Uhr. »Es wird langsam Zeit für das Spektakel. Leiche hin oder her, der Hiataeinzug findet statt. Und das bedeutet für mich, dass ich jetzt in den Ort runtermuss. Ein paar tausend Leute wollen in Zaum gehalten werden.« Er blickte nochmals auf die Stelle, wo bis vor wenigen Minuten die mysteriöse Leiche gelegen hatte. »Kommst du trotzdem?«
Die Charlotte nickte. »So etwas kann mich doch nicht abhalten. Wer weiß? Wenn der Täter eine Rechnung mit mir offen hat, lässt er sich bei so einem Ereignis vielleicht zu irgendeinem Blödsinn hinreißen. Außerdem liegen mein Dirndl und mein Gstanzl schon bereit. Das mag ich mir doch nicht entgehen lassen.«
»Du willst dem alten Zaitler unbedingt noch eine mitgeben, gell?«
Die Charlotte kniff die Augen zornig zusammen und nickte. »Ja, das muss noch sein. Nach allem, was er sich im Sommer geleistet hat, hat er sich das verdient.«
»Charlottchen, der Weinbauverein hat ihn doch schon als Obmann abgesetzt. Sein Ruf ist auch im Arsch. Was willst du noch mehr?«
»Nenn mich kleinlich, aber ich möchte ihm noch persönlich was nachrufen. Ich kann ihm ja sonst nix antun. Es mag schon sein, dass er mit seinem Leben genug geschlagen ist. Aber diese Genugtuung brauche ich einfach.«
Dem Leo war das Thema sichtlich unangenehm. »Ein Gutes hat es, wenn man beim Hiataeinzug arbeiten muss«, sagte er, um die Charlotte abzulenken. »Ich muss mir wenigstens keine Lederhose anziehen.«
»Da hast du recht.« Die Charlotte lachte laut auf. Jetzt blickte auch sie auf die Uhr. »Acht Uhr schon. Eigentlich Zeit fürs erste Gläschen. Wir haben unsere Kostproben für den Hiataeinzug hergerichtet. Willst probieren?«
»Ach, Cousine!«, stöhnte der Leo, der die Charlotte um gut einen Kopf überragte. »Ich bin doch im Dienst.«
»Leo!«
»Na gut, rück schon rüber. Nach so einem Start in den Tag kann ein kleiner Schluck nicht schaden. Außerdem ist heute sowieso Ausnahmezustand.«
Die Charlotte eilte ins Kühlhaus und kam mit einem kleinen Plastikcontainer zurück. Sie drückte dem Leo einen Pappbecher in die Hand und schenkte großzügig ein. Damit war der inoffizielle Startschuss für den Hiataeinzug gefallen.
2
Nachdem sich auch der letzte Polizist vom Acker gemacht hatte, ging die Charlotte zurück ins Haus. Im Frühstücksraum fühlte sie sich wie in »Madame Butterfly«. Wie erwartet war der Raum gerammelt voll. Kein Platz war mehr frei, die Japaner hatten alles okkupiert. Und das war auch gut so. Um diese Jahreszeit war ja sonst kaum mit Gästen zu rechnen.
Perchtoldsdorf lag an den südwestlichen Ausläufern Wiens, und Winterzeit bedeutete hier nicht Skifahren, sondern – nichts. Früher, ja früher, da war das anders gewesen. Da gab es in der Umgebung sogar noch den einen oder anderen Skilift. Aber das war schon Jahrzehnte her. Bevor der Klimawandel gnadenlos zugeschlagen und Träume von weißen Weihnachten eben dazu gemacht hatte – zu Träumen. Gut, Eislaufen konnte man heute noch. An zwei, drei Tagen im Winter vielleicht noch rodeln im Begrischpark. Aber das war’s dann auch schon. Und deshalb verirrte sich im Spätherbst oder Winter normalerweise kein (Touristen-)Schwein hierher.
Nachdem der Hiataeinzug aber ins UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen worden war, hatte sich die Situation ein wenig geändert. Seither schafften es Touristen auch im November in den Weinort. Dank der guten Kontakte der Renate Obermayer hatte nun auch die Familie Nöhrer davon profitiert. Die Kulturmanagerin hatte eine Busladung voller Japaner, die in erster Linie wegen der Staatsoper und des Burgtheaters in Wien waren, kurzerhand umgeleitet und bei der Charlotte einquartiert. Eines von mehreren kleinen »Dankeschöns« für die Aufklärung des Mordes an ihrem Mann im Sommer.
Die Charlotte nickte ihren Gästen freundlich zu und rollte die Jalousie hoch. »Everything okay. The workers are gone«, säuselte sie mit einem aufgesetzten Lächeln. Die Gäste bewunderten kurz den Ausblick auf den verlassenen Hof und machten sich dann wieder über ihr Frühstück her. Es war ein witziger Anblick, denn die Japaner waren bereits komplett aufgebrezelt für den Hiataeinzug. Sprich: die Damen im Dirndl, die Männer in Lederhose. Klar, bei einem so traditionellen und jahrhundertealten Erntedankfest der Perchtoldsdorfer Weinbauern musste man sich schon passend kleiden. Da war es auch gar nicht wichtig, dass der Großteil der jungen Einheimischen auf die Tradition pfiff und sich einfach nur in Jeans in das, sind wir ehrlich, Sauffest warf. Andererseits – seitdem der Volksdodel-Rocker von Wien bis Norddeutschland Stadien und Hallen füllte, war auch in der Jugend – ländlicher und urbaner Natur – Tracht plötzlich wieder schwer angesagt.
Nach einem weiteren Kontrollblick wurde die Charlotte von ihrer Mama aus dem Frühstücksraum gescheucht. »Ich hab das schon im Griff. Schau lieber zu, dass du dich fertig machst«, wies sie ihre Tochter an. Die Mama war natürlich ebenfalls schon in Tracht. Aber das war nun wirklich kein Wunder. Sie war ja auch schon seit geraumer Zeit wach und hatte, im Gegensatz zu ihrer Tochter, nicht einen derartigen Kater im Nacken sitzen.
Die Aufregung des frühen Morgens fiel nun endgültig von der Charlotte ab. Plötzlich völlig geschlaucht, schleppte sie sich die Treppen hinauf in ihre Wohnung und ließ sich neben ihrer noch schlafenden Freundin ins Bett fallen. Die Ruhe hielt circa eine Minute, dann bimmelte ihr Handy. Es war die Flora.
»Was?«, seufzte die Charlotte genervt ins Telefon.
»Duhu?«
»WAS?«
»Ich bräuchte deine Hilfe, Schwesterherz. Der Luca schafft es nicht, mein Dirndl zuzuknöpfen.«
Die Charlotte stöhnte laut auf, gab aber nach. »Beim Aufmachen ist er wohl geschickter, gell? Ist schon gut, ich bin gleich bei dir.«
Sie rollte sich wieder aus dem Bett und zog dabei die Decke mit. Mit voller Absicht. Jetzt sollte gefälligst auch endlich die Andrea aufstehen.
»Gnnghhmpf«, murmelte die. Ein Klaps auf den Po, und die Blondine fuhr hoch. »Was?«, fragte sie, auch ein wenig angefressen.
»Zeit zum Aufstehen«, antwortete die Charlotte kühl. »Außerdem hatten wir heute früh schon eine Leiche im Hof.«
»Wie bitte? Das war kein Scherz vorhin?«
»Erzähl ich dir nachher. Ich muss jetzt der Flora helfen. Komm in die Gänge, wir müssen dann runter in den Ort. Der Hiataeinzug fängt bald an.«
Sie eilte hinaus, hinunter ins Erdgeschoss und ins Zimmer der Flora. Die stand recht verloren mitten in einem Kleiderhaufen. Immerhin hatte sie das Dirndl schon bis über die Schultern gezogen. Die unzähligen Knöpfe am Rücken waren aber allein schlicht und ergreifend nicht zuzuknöpfen. Vom Luca war nichts zu sehen.
»Komm schon her, Kleine«, forderte die Charlotte ihre Schwester versöhnlich auf. Die Flora schlurfte herüber und wandte ihr den Rücken zu. Mit ein paar geübten Handgriffen hatte die Charlotte das Dirndl zugeknöpft. Als Nächstes war die Schürze an der Reihe. »Auf welcher Seite willst du die Masche?«, fragte die Charlotte hämisch.
»Rechts natürlich!«, antwortete die Flora ein wenig empört. »Schließlich ist der Luca ja auch mit!«
»Als ob der eine Ahnung hätte, was die Position der Schleife bedeutet. Egal, ich hätte sie dir eh nicht links gemacht. Mir war da mehr die Mitte vorgeschwebt.«
»Charlotte!«
»Na ja, von wegen Jungfrau und so …«
»Charlotte!«
»Schon gut, schon gut. Geht mich ja nichts an. Wo ist denn dein Lover überhaupt?«
»Im Bad. Der versucht gerade, sich in seine Lederhose zu zwängen. Nachdem er gehört hat, dass du rüberkommst, wollte er sich nicht vor dir zum Kasperl machen.«
»Er hat eine Lederhose?«
»Tja, Schwesterherz, hättest du im Sommer ein bisschen mehr Zeit mit uns verbracht, statt deinem Mörder nachzujagen, hättest du gemerkt, dass sich die ganze Familie Bianchi bei einem unserer Wienausflüge mit Tracht eingedeckt hat.«
»Auch der Papa Bianchi?«
»Welchen Teil von ›die ganze Familie‹ hast du nicht verstanden? Ja, auch der Emanuele. Schade, dass die Aurora diesmal nicht mitgekommen ist.«
»Wieso eigentlich nicht?«
»Der Luca hat gemeint, dass seine Mama die Aufregung vom letzten Besuch noch nicht ganz verkraftet hat. Da bleibt sie lieber daheim und passt auf die Firma auf.«
Die Charlotte hatte die Masche der Schürze inzwischen wie gewünscht auf der rechten Seite gebunden (was anzeigte, dass ihre Schwester »vergeben« war), und die Flora stand in einem Alptraum aus Grün und Rosa vor ihr. Die Charlotte verkniff sich einen sarkastischen Kommentar. Die Kleine musste damit auf die Straße gehen, nicht sie. Im selben Moment klopfte es an der Tür des Badezimmers, es krachte drinnen, dann sprang die Tür auf, und der Luca stolperte mit halb hochgezogener Lederhose ins Zimmer. Wo er der Länge nach hinfiel und seinen blanken Po offenbarte. Der gewaltige Wachstumsschub der letzten Monate hatte sich beim Luca auch in seiner Koordinationsfähigkeit niedergeschlagen. Negativ natürlich.
»Ausgleichende Gerechtigkeit«, schmunzelte die Charlotte. Ausnahmsweise gab es dafür einmal keinen bösen Blick ihrer pubertierenden Schwester. »Ich lass euch zwei jetzt allein. Schau, dass du deinen Bonsai-Lover irgendwie in seine Hose reinbekommst. In einer halben Stunde ist Aufbruch.«
Zurück in ihrem Zimmer, hatte die Andrea gerade ihre morgendliche Dusche beendet. Die Charlotte ging ins Bad und sah ihrer Freundin zu, wie die sich trocken rieb. Auf schmutzige Gedanken kam die Charlotte dennoch nicht, dafür war sie nach dem vergangenen Abend und den Aufregungen dieses Morgens einfach noch viel zu geschafft. Stattdessen scheuchte sie die Andrea aus der Dusche. Sie wollte sich auch noch frisch machen, bevor dieser lange, lange Tag so richtig anfing.
Fünfzehn Minuten später halfen sich die beiden gegenseitig in ihre Dirndl. Die Andrea trug eines dieser neumodischen kurzen Dinger in Schwarz mit giftgrüner Schürze. Eigentlich nicht so die Sache der Charlotte, aber sie musste zugeben, dass ihre Freundin darin tatsächlich rattenscharf aussah.
»Wohin mit der Schürzenmasche?«, fragte sie zum Spaß.
»In die Mitte natürlich!«, antwortete die Andrea.
»Genau. Und ich werde heute Abend mit dem alten Zaitler Bruderschaft trinken …«
Aus Protest schnürte sich die Charlotte ihren Knoten dann selbst und brachte ihn an der linken Seite an. Was signalisiert hätte, dass sie noch zu haben sei. Da spielte aber die Andrea nicht mit. Sie schmiegte sich von hinten an die Charlotte, fummelte ein bisschen an ihrem hochgepressten Dekolleté herum und rückte die Masche dann kurzerhand auf die rechte Seite. »So nicht«, hauchte sie der Charlotte ins Ohr und gab ihr einen Klaps auf den Po.
Für ein ausgiebiges Frühstück reichte die Zeit nicht mehr. Ein Butterbrot und eine Tasse Kaffee mussten reichen. Der Frühstücksraum hatte sich inzwischen glücklicherweise geleert, die Japaner waren mit ihrem Reisebus bereits hinunter in den Ort gekarrt worden. Die Familie hatte den Raum also für sich, und die anderen waren bereits anwesend. Die Charlotte musste zugeben, dass sich der Bianchi-Papa durchaus gut in Lederhose, Lodenjanker und Haferlschuhen machte. Seinen Schnurrbart hatte er links und rechts aufgezwirbelt, da wäre sogar ein Bayer neidisch geworden. Ihr eigener Papa stand dem Besucher aus Italien natürlich in nichts nach – abgesehen vom Schnurrbart, den sich der Rudi Nöhrer auf Bitten seiner Frau schon vor Jahren abrasiert hatte. Er trug den klassischen blauen Trachtenjanker der Perchtoldsdorfer Weinbauern, dazu einen schwarzen Hut mit dunkelgrünem Hutband. Die Mama hatte ihr übliches traditionelles Dirndl an, genau wie die Omama, deren Dirndl so original war, dass es die Jahrzehnte nur durch mehrmaliges Stopfen und Ausbessern überlebt hatte. Selbst der Noah sah in seiner frisch zugelegten Tracht nicht wie ein Fremdkörper aus. Und die Charlotte? Die fiel irgendwo zwischen die Extreme ihrer Frau Mama und der Andrea. Ihr Dirndl reichte zumindest über die Knie, war aber bei Weitem nicht so lang wie das der Mama, das fast bis zum Boden ging. Die Farbe war Tannengrün, das hervorragend mit ihren kastanienroten Haaren kontrastierte.
»Gut schau ma aus«, meinte die Omama hochzufrieden und drückte dem Zimmermädchen, das an diesem Tag Dienst hatte (Kellnerinnen waren keine da, weil der Heurigenbetrieb erst demnächst wieder aufgenommen wurde), ihr Smartphone in die Hand. Die Omama mochte zwar alt sein, aber sie ging immer mit der Zeit. Oft mehr als die Frau Mama.
»Familienfoto«, quietschte sie so vergnügt wie ein kleines Kind. Keiner brachte es übers Herz, der Matriarchin diesen Wunsch abzuschlagen. Also nahm man die Omama in die Mitte, und nach einigen Fehlversuchen war es endlich geschafft: Alle lächelten, und niemand hatte die Augen geschlossen. Eine Meisterleistung, wenn man bedachte, dass da neun Leute mitspielen mussten.
Mit dem Firmenlieferwagen ging es hinunter in den Ort. Man konnte natürlich nicht bis zum Marktplatz fahren, weil wegen des Hiataeinzugs der Großteil der Straßen rund um das Ortszentrum und die Zufahrten gesperrt waren. Also lenkte der Papa den Wagen über Schleichwege (ja, zugegeben, ein breiter Gehsteig mitten durch den Park oberhalb des Marktplatzes, zwischen Sportplatz und Herzogsburg, war auch dabei) bis in den Burghof, wo vor ein paar Monaten noch die Bühne des Sommertheaters gestanden hatte. Seit August gab es im Burghof keine kulturellen Schmankerl mehr, sondern wieder gediegenen Sechs-, Acht- oder Zwölf-Zylinder-Sound. Den Rest des Jahres musste der Burghof nämlich als öffentlicher Parkplatz herhalten.
Die Familien Nöhrer und Bianchi quollen aus dem Wagen und machten sich auf den kurzen Weg hinunter zum Marktplatz. Wegen der Aufregungen des Morgens hatte man den traditionellen Umzug bereits versäumt. Der Höhepunkt stand aber sowieso noch bevor, wenn nämlich der Festzug am Marktplatz eintraf. Dann wurden von den versammelten Weinhauern Gstanzln gesungen (launige Vierzeiler, die mehr oder weniger freundlich mit den Leistungen der lokalen Politiker im letzten Jahr abrechneten), und vor allem tanzte die »Pritschn«. Die Pritschn war ein rund achtzig Kilo schweres und zweieinhalb Meter hohes Gestell aus Holz, das mit Eichenlaub und einem goldenen Herz aus Nüssen geschmückt war. Von der Form her durfte man sich das Ding in etwa wie einen ausgehöhlten Christbaum vorstellen. Ausgehöhlt deshalb, weil die Pritschn ja auch von jemandem getragen werden musste, der sie dann eben »tanzen« ließ. Natürlich machte das im Normalfall einer der jungen, kräftigen Weinhauer-Söhne. Heuer hatte sich aber der »Hiatavater« höchstpersönlich das Recht dazu genommen. Der Hiatavater wurde alljährlich aus dem Kreis der Weinhauer gekürt. Bei seinem Heurigen nahm der Festzug seinen Anfang, und auch ansonsten hatte er allerlei Aufgaben zu erledigen. Heuer fiel diese Ehre dem Herbert Zaitler zu. Nach seinem ausgeuferten Streit mit der Charlotte im Sommer hatte man ihn zwar als Weinbauverein-Obmann abgesetzt, aber man wollte ihm für die langjährige Arbeit im Verein doch noch ein passendes Abschiedsgeschenk machen.
Männerseilschaften halt. Statt in Schimpf und Schande davongejagt zu werden, durfte er also noch einmal den Hiatavater geben. Als die Charlotte von dieser Entscheidung erfuhr, hätte sie am liebsten gekotzt. Sie hatte sogar den Herrn Papa zur Rede gestellt, der bei dem ganzen Theater ja mitgestimmt hatte. Der hatte ihre Einwände aber nur abgewehrt und gemeint: »Schätzchen, du hast ja keine Ahnung, was da sonst noch dahintersteckt. Das sind ja alles auch politische Geschichten.« Mehr war ihm nicht zu entlocken, und eigentlich war es der Charlotte auch egal. Es gab bloß keinen Grund auf der Welt, wieso dem alten Zaitler nach dem letzten Sommer noch einmal so eine Ehre zukommen sollte.
Eitel, wie der alte Zaitler nun einmal war, ließ er es sich nicht nehmen, dieses Abschiedsgeschenk auch gleich dazu zu missbrauchen, sich noch einmal so richtig ins Rampenlicht zu stellen. Und wie wäre das besser gegangen, als selbst im fortgeschrittenen Alter noch seine Männlichkeit zu beweisen und die sauschwere Pritschn tanzen zu lassen. So wie zuletzt vor vielen, vielen Jahren, als er noch grün hinter den Ohren gewesen war und unter der Fuchtel des strengen Vaters gestanden hatte.
Gut, noch war es aber nicht so weit. Als die Nöhrers und Bianchis am Marktplatz vor der großen Pfarrkirche eintrafen, kam der Erntedankzug gerade aus der Richtung von Marios Turmbar anmarschiert. Vorneweg ritten drei Weinhauer auf ihren Pferden, dahinter folgten zu Fuß die anderen Weinhauer. Normalerweise hätte da auch die Charlotte oder ihr Herr Papa mitmarschieren sollen, aber der Papa hatte wegen des Besuchs aus Italien seine Teilnahme frühzeitig abgesagt, und die Charlotte wäre selbst ohne den Toten in ihrem Hof nach der durchzechten Nacht nicht in der Lage gewesen, schon so früh durch halb Perchtoldsdorf zu marschieren.
Vor dem Rathaus war eine kleine Bühne aufgebaut. Der Charlotte stand als Juniorchefin des Familienheurigen eigentlich ein Platz auf dieser Bühne zu, sie hatte sich aber entschieden, sich mit dem Rest der Familie unter die Tausende von Zuschauern zu mischen. Das war allerdings auch ein bisschen eine Flucht, denn sie hatte ihr Gstanzl in der Hektik des verspäteten Aufbruchs daheim vergessen und konnte sich beim besten Willen einfach nicht mehr an den genauen Wortlaut ihres Vierzeilers erinnern. Was bitter war, denn eigentlich wollte sie mit dem Gstanzl dem alten Zaitler ja noch einen »gebührenden« Abschied verschaffen. Darauf musste sie nun schweren Herzens verzichten.
Das Wetter war prächtig (wenn auch saukalt) und die Stimmung ausgelassen. Letzteres vor allem deshalb, weil vom ganz jungen Wein überall am Marktplatz Gratisproben kredenzt wurden. Mit Blasmusik kam der Umzug endlich bei der Pestsäule an, die das Zentrum des Marktplatzes bildete. Von hier ging es dann noch ein paar Meter den Hügel hinauf zur Pfarrkirche, in der in wenigen Minuten die Erntedankmesse anstand. Erst wenn die Weinhauer und alle Kirchgänger wieder herausströmten, folgte das finale Highlight des Hiataeinzugs – das Gstanzlsingen. Und danach stand dann der ausgelassenste Teil des Festes auf dem Programm: von Heurigen zu Heurigen ziehen und sich ganz traditionell und gepflegt ins Koma saufen. Alle, die am Abend noch halbwegs auf zwei Beinen stehen konnten, trafen sich dann noch beim Winterbauer-Heurigen zur »Afterparty« (im Ernst, heißt heutzutage wirklich so). Dort kam man regulär allerdings nur als Weinhauer oder Angehöriger rein. Oder man nutzte den Illuminierungsgrad der Türsteher und mischte sich einfach unauffällig unters Wein produzierende Volk (was eine erstaunlich einfache Sache war).
Vor dem Kirchgang stand aber noch der erste Höhepunkt des Vormittags bevor: das Tanzen der Pritschn. Der Zaitler, einer der drei Reiter, schwang sich vom Pferd und schritt würdevoll zu dem Anhänger, auf dem die Pritschn durch den Ort transportiert worden war. Dort flüsterte ihm ein anderer Weinhauer etwas ins Ohr. Von ihrer Position aus konnte die Charlotte natürlich nicht hören, was genau da geflüstert wurde, sie nahm aber an, dass es ein letzter Versuch war, den alten Deppen von seinem Vorhaben abzuhalten. Achtzig Kilo waren schon ein ordentliches Gewicht. Die Vermutung der Charlotte wurde durch ein ärgerliches Kopfschütteln vom Zaitler bestätigt. Von zwei Hiatabuam ließ er sich die Pritschn umhängen, denn ein Ledergeschirr half dem Pritschnträger, das schwere Ding auf den Schultern zu tragen. Das untere Ende des Stocks, der im Inneren der Pritschn angebracht war, wurde in eine Halterung unterhalb des überhängenden Bauchs vom alten Zaitler gesteckt, und endlich konnte es losgehen. Der Zaitler sollte mit der Pritschn hinauf bis zur Kirche marschieren. Zugleich war es seine Aufgabe, die Holzkonstruktion zu heben und zu drehen – sie »tanzen« zu lassen.
Vielen der Zuschauer war nicht klar, was für eine körperliche Leistung der alte Zaitler da zu erbringen hatte, so schwer sah die hölzerne Pritschn nämlich gar nicht aus. Und in den ersten Minuten ließ der Zaitler das Teil auch wirklich wie einen Derwisch tanzen. Da merkte man ihm sein Alter gar nicht an. Auf halbem Weg zur Kirche passierte es dann aber: Der alte Zaitler wurde von der Pritschn praktisch verschluckt, »erschlagen« sollte es später im Polizeibericht heißen. In diesem Moment sah es aber nur so aus, als hätte sich die Pritschn einfach über ihn drübergestülpt.
Die Musik hörte auf zu spielen. Es war mucksmäuschenstill auf dem Marktplatz.
Fast schon gespenstisch, wie ruhig rund fünftausend Menschen auf einem Fleck verharren konnten. Sekunden vergingen, und die Stille wurde immer unangenehmer, erdrückender.
Einer der Hiatabuam überriss die Situation am schnellsten. Er rannte zur Unglücksstelle und bemühte sich, das schwere Teil vom alten Zaitler runterzuheben. Was ihm allein aber nicht gelang. Endlich kamen ein Zweiter und ein Dritter dazu, und zu dritt schafften sie es schließlich, den alten Zaitler von der Pritschn zu befreien. Der Vierte, der an der Unglücksstelle anlangte, war der Leo. In voller Montur bahnte er sich einen Weg durch die Menschenmenge, sein Funkgerät in der Hand. Er drängte die Hiatabuam zur Seite und beugte sich über den reglosen Körper vom Zaitler. Aus gut hundert Meter Entfernung konnte die Charlotte lediglich erkennen, dass er den Kopf schüttelte, was ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigte. Im nächsten Moment hörte man auch schon die Sirenen eines Rettungswagens.
Die anderen Polizisten drängten die Menschenmenge so gut es ging auseinander, um eine Gasse für die Rettung zu bilden. Im Schritttempo rollte der Rettungswagen zur Unglücksstelle. Ein Notarzt untersuchte den Zaitler an Ort und Stelle, bevor er ihn auf einer Trage abtransportieren ließ. Die Pritschn beschlagnahmte der Leo und ließ sie von zwei Kollegen in die Polizeistation ganz in der Nähe bringen. Dann wandte er sich per Megafon an die schaulustige Menge.
»Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste des Hiataeinzugs. Es tut mir leid, dass Sie Zeugen dieses Unfalls werden mussten. Herr Zaitler ist auf dem Weg ins Krankenhaus, und wir hoffen, dass es ihm in Bälde wieder gut geht.« Er schaute zu einem der Weinhauer, der ihm zunickte. Dann fuhr der Leo fort: »Die Veranstaltung geht nun wie geplant weiter. Nach dem Gottesdienst findet hier am Marktplatz wie üblich das Gstanzlsingen statt. Wir wünschen Ihnen nun trotz allem viel Vergnügen und einen unterhaltsamen Vormittag.«
Tragisch, aber wahr: The Show must go on. Das hatte die Charlotte schon bei den Sommerfestspielen feststellen müssen, als trotz mehrerer Morde auf offener Bühne keine einzige Vorstellung gestrichen wurde.
Allmählich kam wieder Leben in die Menge. Aus dem Fernsehen war man schlimmere Sachen gewohnt. Wie leicht man doch abstumpfte. Aber was hätte man schon groß tun können? Die Antwort lag auf der Hand: sich weiter betrinken natürlich. Die Kirche war ohnehin komplett überfüllt – so viel Begeisterung hätte sich Pfarrer Richard Kraus an jedem anderen Sonntag von seinen Schäfchen gewünscht –, also konnte man sich die Stunde, bis der Tross wieder aus der Kirche herauskam, auch mit Trinken vertreiben.
»Ich muss noch wohin«, raunte die Charlotte der Andrea ins Ohr.
Die warf ihr einen wissenden Blick zu und flüsterte zurück: »Ich kümmere mich um die Kleinen.«