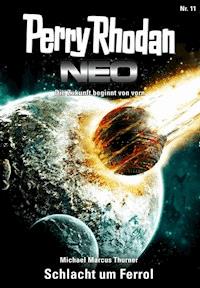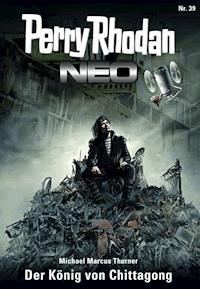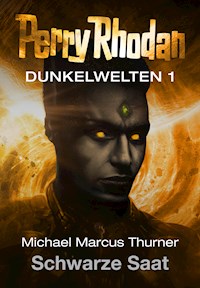Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Perry Rhodan digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Perry Rhodan-Erstauflage
- Sprache: Deutsch
In der Milchstraße schreibt man das Jahr 2072 Neuer Galaktischer Zeitrechnung. Dies entspricht dem Jahr 5659 nach Christus. Über dreitausend Jahre sind vergangen, seit Perry Rhodan seiner Menschheit den Weg zu den Sternen geöffnet hat. Noch vor Kurzem wirkte es, als würde sich der alte Traum von Partnerschaft und Frieden aller Völker der Milchstraße und der umliegenden Galaxien endlich erfüllen. Die Angehörigen der Sternenvölker stehen für Freiheit und Selbstbestimmtheit ein, man arbeitet intensiv zusammen. Doch entwickelt sich in der kleinen Galaxis Cassiopeia offensichtlich eine neue Gefahr. Dort ist FENERIK gestrandet, ein sogenannter Chaoporter. Nachdem Perry Rhodan und seine Gefährten versucht haben, gegen die Machtmittel dieses Raumgefährts vorzugehen, bahnt sich eine unerwartete Entwicklung an: FENERIK stürzt auf die Milchstraße zu. Während Rhodan dem Chaoporter nacheilt, versucht er, mehr über dieses Gebilde herauszufinden, und hat über den Quintarchen Farbaud bereits tiefe Einblicke erhalten, die aber noch zusammenhanglos wirken. Nun erfährt er Neues durch DIE TELEPATHISCHE ALLIANZ ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nr. 3174
Die Telepathische Allianz
An der Aberrationszone – zwei ungewöhnliche Terraner im Einsatz
Michael Marcus Thurner
Cover
Vorspann
Die Hauptpersonen des Romans
1. Gillian Wetherby
2. Adomeit Schott
3. Gillian Wetherby
4. Adomeit Schott
5. Gillian Wetherby
6. Adomeit Schott
7. Gillian Wetherby
8. Adomeit Schott
9. Gillian Wetherby
10. Adomeit Schott
11. Gillian Wetherby
12. Adomeit Schott
13. Gillian Wetherby
14. Adomeit Schott
15. Gillian Wetherby
16. Adomeit Schott
17. Gillian Wetherby
18. Adomeit Schott
19. Gillian Wetherby
20. Adomeit Schott
Stellaris 87
Vorwort
»Das Daidalos-Prinzip« von Thorsten Schweikard
Leserkontaktseite
Glossar
Impressum
In der Milchstraße schreibt man das Jahr 2072 Neuer Galaktischer Zeitrechnung. Dies entspricht dem Jahr 5659 nach Christus. Über dreitausend Jahre sind vergangen, seit Perry Rhodan seiner Menschheit den Weg zu den Sternen geöffnet hat.
Noch vor Kurzem wirkte es, als würde sich der alte Traum von Partnerschaft und Frieden aller Völker der Milchstraße und der umliegenden Galaxien endlich erfüllen. Die Angehörigen der Sternenvölker stehen für Freiheit und Selbstbestimmtheit ein, man arbeitet intensiv zusammen.
Doch entwickelt sich in der kleinen Galaxis Cassiopeia offensichtlich eine neue Gefahr. Dort ist FENERIK gestrandet, ein sogenannter Chaoporter. Nachdem Perry Rhodan und seine Gefährten versucht haben, gegen die Machtmittel dieses Raumgefährts vorzugehen, bahnt sich eine unerwartete Entwicklung an: FENERIK stürzt auf die Milchstraße zu.
Während Rhodan dem Chaoporter nacheilt, versucht er, mehr über dieses Gebilde herauszufinden, und hat über den Quintarchen Farbaud bereits tiefe Einblicke erhalten, die aber noch zusammenhanglos wirken. Nun erfährt er Neues durch DIE TELEPATHISCHE ALLIANZ ...
Die Hauptpersonen des Romans
Gillian Wetherby – Eine Terranerin muss sich an eine neue Zeit gewöhnen.
Adomeit Schott – Ein Mann fürchtet, dass keine Zeit mehr bleibt.
Perry Rhodan – Zurzeit agiert der Unsterbliche unter falschem Namen.
Rivel
1.
Gillian Wetherby
Alarm!
Gillian Wetherby warf das Besteck auf den Tisch, sprang auf, sah sich um. Drei ihrer Leute saßen in der Kantine verteilt.
»Mitkommen!«, befahl sie. »Das gilt uns.«
Senora Allbing, ihre Stellvertreterin, reagierte behäbig. Sie benötigte stets einige Zeit, um in Fahrt zu kommen. Wetherby hätte sie längst abkommandiert, aber in Einsatzsituationen lieferte sie stets bemerkenswerte Leistungen.
Wetherby verfiel in Laufschritt, umkurvte einen Servoroboter, der mehrere voll beladene Tabletts jonglierte, und eilte den Gang entlang. Hinter sich hörte sie Klirren und Gefluche, es scherte sie nicht weiter. Der an- und abschwellende Ton des Alarms verfolgte sie.
Den Antigrav hinab. Über sich sah sie mehrere ihrer Leute schweben. Sie kamen aus allen möglichen Decks. Manche hatten geschlafen, andere ihre Freizeit irgendwo im Schiffsinneren verbracht. Sie nestelten nervös an ihrer Bekleidung und unterhielten sich angespannt.
Die untere Hangargalerie war erreicht. Wetherby verließ den Antigrav und lief auf ihre ZALTERTEPE-Jet zu. Sie liebte das kleine, handliche Schiff. Wetherby hatte ihre Privilegien als Befehlshaberin des Beibootgeschwaders geltend gemacht und die Space-Jet für sich ausgesucht, statt, ihrem Rang entsprechend, eine Korvette zu kommandieren.
»Was ist geschehen?«, rief sie.
Die Schiffspositronik der RIBALD CORELLO antwortete augenblicklich. »Ein Geschwader unbekannter, diskusförmiger Schiffe ist in wenigen Lichtstunden Entfernung zu uns aus dem Linearraum gefallen. Ein Typus, wie ich ihn nie zuvor geortet habe. Die energetische Streukennung ist unbekannt. Die Schiffe beschleunigen auf Angriffsgeschwindigkeit. Die Manöver deuten darauf hin, dass sie die RIBALD CORELLO einkesseln und unter Beschuss nehmen wollen.«
»Was macht Shanwar?«
Shanwar Faharani war die Kommandantin des Mutterschiffs und damit ausschließlich Perry Rhodan gegenüber verantwortlich.
»Sie hat Fluchtgeschwindigkeit befohlen. Wir ziehen uns zurück. Allerdings gibt es Anzeichen dafür, dass ein zweites und ein drittes feindliches Geschwader eingreifen könnten.«
»Anzeichen?«, hakte Wetherby nach.
»Der Kantor-Sextant meldet ungewöhnliche Aktivitäten, wie sie auch beim Erscheinen des ersten Geschwaders aufgetreten sind.«
Wetherby erreichte ihre Jet, stieg in den Schacht des Antigravs, ließ sich hochtragen. Zu ihrer Überraschung war Karaktakus Bevin bereits an Bord. Damit war die Besatzung des Schiffs komplett. Mehr als zwei Leute waren für die Steuerung des 35-Meter-Raumers nicht erforderlich.
Bevin initialisierte die Startsequenz. Wetherby setzte sich neben ihn. Angespannt starrte sie in ein Holo, das mehrere Rechenmodelle entwickelte. Jedes einzelne ging davon aus, dass es sich bei den Diskusraumern um Schiffe von Aggressoren handelte. Sie meldeten sich nicht auf Funksprüche, waren in feuerrote Schutzschirme gehüllt und machten sich allem Anschein nach feuerbereit.
»Durchmesser jeweils achtzig Meter«, sagte Bevin. »Flink, wendig, mit beachtlichen Beschleunigungswerten. Habe ich Starterlaubnis?«
»Ja«, antwortete Wetherby und betrachtete eine Detailanalyse, die ihr zugänglich gemacht wurde. »Die Rechner der RIBALD CORELLO sehen ein unbekanntes Bedrohungsszenario, dem wir mit möglichst viel Feuerkraft und auf breiter Front begegnen müssen.«
Nacheinander bestätigten alle anderen Space-Jets und die sechs Korvetten der MAHARANI-Klasse die Einsatzbereitschaft. Wetherby gab den Befehl zu einem Manöver, das die insgesamt 30 Schiffe in eine komplexe Startsequenz zwang. Sie schossen aus den Hangars wie aufgescheuchte Fliegen, die sich zusammentaten und dann wieder voneinander lösten, um letztlich in kleinen Pulks davonzurasen, drei von ihnen auf das feindliche Geschwader zu. Drei weitere Kleingeschwader verhielten sich abwartend. Jedem einzelnen Flottenteil an Space-Jets war eine Korvette beigestellt. Die 60-Meter-Raumer verfügten über eine höhere Feuerkraft, waren aber auch schwerfälliger.
»Alles funktioniert wie gewünscht«, sagte Bevin mit angespannter Stimme. »Die Diskusraumer reagieren nicht. Sie können sich keinen Reim auf unser Verhalten machen.«
»Laurin-Modus aktivieren!«, befahl Wetherby.
Der Rechnerverbund der ZALTERTEPE-Jet reagierte. Das Schiff verschwand aus der Wahrnehmung ihrer Gegner. Die leistungsfähigen Deflektoren, die Laurin-Antiortung und die chromatovariable Beschichtung des Schiffs machten es möglich.
»Die Disken nähern sich der Kernschussreichweite«, sagte Bevin. »Sie ignorieren vorerst unsere Beibootflotte und konzentrieren sich auf die RIBALD CORELLO. Sie sind sich ihrer Sache sehr sicher, scheint's.«
»Wir wissen nicht, wo die Grenze der Kernschussreichweite unserer Gegner ist, Bevin. Geh nicht von den Werten terranischer Schiffe aus, sonst ...«
Eine Alarmmeldung. Mehrere zusätzliche Bildschirme erwachten zum Leben. Sie vermittelten Daten, die auf den Beginn der Schlacht hinwiesen.
Die Schutzschirme der RIBALD CORELLO leuchteten auf. Wetherby hörte Kommandantin Shanwar Faharani Anweisungen über Funk geben, ruhig und bestimmt. Der Paratronschirm hatte die energetische Wucht der ersten Schusssalven ihrer Gegner problemlos geschluckt.
»Ausschwärmen!«, befahl Wetherby jenen Pulks, die sich den Diskusschiffen näherten. »Manöver Palmer.«
Palmer gehörte zu einer Reihe von unkonventionellen Angriffsszenarien, ähnlich wie Asmav und Lemmev, die Wetherby mit ihren Leuten während der letzten Wochen immer und immer wieder trainiert hatte. In den Simulatoren und im freien Raum. Palmer umfasste heikle Flugmanöver, die ein Überraschungselement enthielten und von den Besatzungen der Space-Jet die Gabe zur Improvisation erforderten – und Mut. Sie mussten auf engstem Raum agieren, die Schiffe immer wieder neu organisieren, wiederholt ausfächern und wieder zusammenfinden. Mit dem einzigen Ziel, die gegnerischen Rechner zu verwirren und für einige Zehntelsekunden aus dem Konzept zu bringen.
»Elf Space-Jets sind zu wenig, um etwas auszurichten«, sagte Bevin.
»Wir sollen nichts ausrichten, Karaktakus. Hast du das noch immer nicht kapiert? Unsere Aufgabe ist, der RIBALD CORELLO die Gelegenheit zu geben, ihre schweren Waffen einzusetzen. Erst, wenn das Mutterschiff Treffer gesetzt hat, werden wir wirklich aktiv. Das ist das Kernelement von Manöver Palmer. Senora Allbing ist für diesen Part verantwortlich. Schon vergessen?«
»Unsere Schiffe kommen der gegnerischen Flotte zu nahe. Wir werden sie verlieren.«
»Womöglich einige von ihnen, ja.«
»Aber ...«
»Dies ist keine Übung, verdammt noch mal! Dies ist der Ernstfall. Unsere Aufgabe ist, die RIBALD CORELLO und deren Besatzung zu schützen. Also konzentrier dich gefälligst auf deine Aufgabe! Die beiden anderen Flottenteile unserer Gegner können jede Sekunde auftauchen.«
Bevin fluchte, seine Finger huschten unruhig über die Befehlsterminals. Eigentlich war es nicht notwendig, dass er irgendetwas manuell tat. Der Logik-Programm-Verbund der Space-Jet reagierte auf Zuruf. Die Kampfmanöver, Angriff und Verteidigung erledigten die Rechner ohnedies in Eigenregie.
»Die gegnerischen Flottenverbände Zwei und Drei sind in der Ortung aufgetaucht«, meldete Bevin.
»Sie können uns dank des Schattenmodus nicht orten. Wir kümmern uns um Verband Zwei. Die restlichen Einheiten greifen Drei an.«
»Wir allein gegen sieben – nein, acht! – Diskusraumer mit unbekannten Möglichkeiten?«
2.
Adomeit Schott
Die Sonne Benwetter ging wie gemalt unter. Rotes Licht ergoss sich über die Wipfel der ausgedehnten Wälder.
Schott hörte das bedächtige Klopfen eines Wickwack-Kuckucks. Er hieb mit seinem Hammerschädel mehrmals gegen Holz, bevor er seine Flügel ausbreitete und hochstieg, um mit mächtigen Flügelschlägen der Sonne zu folgen. Er würde seine Jagd nach dem Dämmerlicht mindestens zwölf weitere Stunden fortsetzen. Immer in diesem kleinen Bereich zwischen Tag und Nacht dahinschwebend.
Kein Bewohner Frenshauns wusste viel über die Wickwack-Kuckucke, die in Erdhöhlen bis zum nächsten Sonnenuntergang ruhten.
»Ich ahne zumindest, was sie antreibt«, sagte Schott leise zu sich selbst.
Wie von selbst ging seine Rechte zu den Pflastern in der Hosentasche. Er war unendlich müde und erschöpft. Er benötigte Hilfe. Umgehend.
Doch er durfte sich nicht auf die medikamentöse Wirkung der Pflaster einlassen, nicht an diesem Tag.
Er befahl der Antigravplattform, zwischen den östlichsten Ausläufern des Frenshaun-Waldes abzusinken. Das rötliche Licht wurde weniger, die dichtwüchsigen Nadelbäume nahmen allmählich Schotts gesamtes Blickfeld ein. Es dauerte wie immer eine Weile, bis er sich an die veränderten Lichtverhältnisse gewöhnt hatte.
Er stieg von der Plattform und sank zentimetertief in der dicken Schicht abgefallener Nadeln ein. Darunter fühlte er dünne, aber starke Wurzelstränge. Sie schienen einander zu umklammern.
Er schaltete alle Hilfen weg. Er benötigte keinen Kompass, keinen Funk, keine Plattform. Inmitten der Wälder Frenshauns kam es ausschließlich auf seine sechs Sinne an.
Schott schöpfte Wasser aus einem leise gluckernden Bach und spritzte es sich ins Gesicht. Es war eiskalt.
Er ging weiter. Tat einige vorsichtige Schritte in diese Richtung und kehrte wieder um, um es zur anderen Seite hin zu versuchen.
Noch hatte Schott nicht den richtigen Platz gefunden. Wie immer dauerte es eine Weile, bis er sich eingependelt hatte, und er wusste, was ihm der Wald mitteilen wollte. Er musste Geduld haben und die schlechter werdende Sicht ignorieren.
Trotz des unwegsamen Gebietes mit den vielen Bodenspalten, einigen Arten heimtückischer Bodenranken und den wechselnden Wetterbedingungen war Schott sicher. Frenshaun beschützte ihn. Er war ein Freund des Waldes. Gefahr drohte lediglich von den hiesigen Raubtieren.
Illustration: Swen Papenbrock
Er erreichte eine Anhöhe. Zwischen roten, kerzengerade wachsenden Stämmen auf dem kleinen Hügel waren die letzten Strahlen der Sonne zu erahnen. Unter ihm, Richtung Westen, erstreckte sich ein kleines, dicht bewachsenes Plateau.
Dies war der geeignete Ort. Er hatte seinen Warteplatz für diesen Tag gefunden.
Also machte er sich an den Abstieg, durch Kletthecken und Ringelmausern, vorbei an blühenden Watterichen und den dornigen Tiefbutten. Er erreichte sein Ziel, ein kleines Stück kaum bewachsenen Landes. Tierlosung und Bissspuren an Jungbäumen wiesen darauf hin, dass dieser Fleck auch von den friedlichen Bewohnern des Waldes zum Rasten genutzt wurde.
Schott setzte sich auf einen Findling und atmete tief durch. Erneut dachte er an die Pflaster. An die Erschöpfung, die auf ihm lastete und die jeden Schritt zur Mühsal werden ließ.
Er atmete tief durch. Die Luft war würzig und ungewöhnlich trocken. Bald würde die Temperatur auf unter zehn Grad Celsius fallen, doch er hatte sich vorsorglich die Chem-Wärmwäsche angezogen. Ein wenig Bewegung würde reichen, um die Reibeenergie in Wärme umzuwandeln und sie lange Zeit aufrechtzuerhalten.
Der Wald erwachte. Er lüsterte, wie er es oft tat. Adomeit Schott hörte so gut zu, wie es ihm möglich war. Noch verstand er nicht, was ihm die Bäume mitteilen wollten. Wie immer musste er sich in Geduld üben.
Also blieb er sitzen, aß einen fruchtigen Wopfel und trank ein wenig Wasser. Ein Traumsieder ließ sich nur wenige Meter entfernt von seinem Lebensbaum fallen, pickte einige Würmer aus dem Untergrund und kroch dann auf allen sechsen wieder den Stamm hoch. Der harte Hornhautbauch scharrte dabei laut über die Rinde des Baums.
Schott bekam eine Ahnung dessen vermittelt, worüber der Wald mit ihm reden wollte. Wie so oft während der letzten Monate und Jahre wirkte er beunruhigt.
Eine Herde Schaftiger zog laut brüllend umher. Das Leittier war dampfig und besonders unruhig. Was der Wald tat, hatte unmittelbaren Einfluss auf die Tiere, die in ihm lebten.
Schott packte die Schalen des Wopfels sorgfältig weg. Sie hatten hier nichts zu suchen. Jegliche Verunreinigung sorgte für Irritationen beim Kollektiv des Frenshaun-Waldes. Er war womöglich der einzige Bewohner des Planeten, der ganz genau wusste, wie sensibel die Baumriesen auf Veränderungen reagierten.
Er lehnte sich zurück, kreuzte die Hände über dem Kopf und starrte auf das Stück Himmel, das zwischen den Baumwipfeln zu erkennen war. Die Sterne blinkten schwach, der Mond Perness war halb voll. Irgendwo in diesem gesprenkelten Teppich der Milchstraße verbarg sich Sol. Das Licht der Heimat seiner Vorfahren benötigte 4601 Jahre, um bis nach Frenshaun zu gelangen. Zu einer der ältesten Kolonien Terras, gegründet im Jahr 2121 alter Zeitrechnung.
Die Wälder hummten und summten. Sie waren bald bereit für den Kontakt. Noch aber konnte er seine Gedanken schweifen lassen.
Falsch: Der Wald forderte, dass er sich für eine Weile mit sich selbst beschäftigte. Der Verbund wollte, dass er zu sich selbst fand und alle Probleme abschüttelte, die sich während eines Tages anhäuften. Dass er die Symptome seiner Depressionen bestmöglich beiseitedrängte und sich auf seine Aufgabe konzentrierte.
Er hatte einen Streit mit Luva gehabt, seiner ehemaligen Lebensabschnittspartnerin. Sie waren ein Herz und eine Seele gewesen, bis sie kein Herz und keine Seele mehr gewesen waren. Seit dem Ende dieser anstrengenden und unendlich fordernden Beziehung machte sie sich einen Spaß daraus, ihm in sein Leben zu pfuschen. Und, wie Schott sich selbst gegenüber zugeben musste, tat er es ihr gegenüber genauso.
Klimbo, sein ältester Sohn, wollte wieder mal nichts von ihm wissen, und Livea, seine jüngste Tochter, hatte ihn in einer Trivid-Unterhaltung einen alten, aufgeblasenen Sturschädel genannt, bevor sie die Verbindung unterbrochen hatte.
Jedes einzelne Problem belastete ihn. Jedes Hindernis, das sich ihm in den Weg stellte, wurde zum schier unüberwindbaren Bergmassiv. Müdigkeit, Erschöpfung, Resignation, Trauer, gefolgt von gelegentlichen und hysterischen Phasen höchster Euphorie ... Dies war der Rhythmus seines Lebens, wenn er die Medikamentenpflaster nicht regelmäßig auflegte.
Er nahm alle Kraft zusammen, die ihm geblieben war, und konzentrierte sich auf die bevorstehende Aufgabe. Er musste die Last, die er mit sich schleppte, beiseiteschieben und für kurze Zeit vergessen. Nur dann konnte er mit dem Wald kommunizieren.
Schott fühlte mit einem Mal Unruhe. Er richtete sich auf. Die Augen hatten sich längst an die Dunkelheit gewöhnt. Er sah eine Bewegung zu seiner Rechten. Ein Schemen, etwa schulterhoch, die Vorderläufe gespreizt und die Sprungbeine ins Unterholz gestemmt.
Ein Schaftiger. Ein Einzelgänger, dessen massiver Schädel hin und her pendelte.
Schott kam auf die Beine und blieb wackelig stehen. Ihn schwindelte. Seine mentalen Probleme wirkten sich meist auch körperlich aus.
Er hatte gehofft, eine friedliche Unterhaltung mit dem Wald führen zu können. Doch der Jungbulle durchkreuzte seine Absichten. Das Erwachen der Bäume hatte nun mal Auswirkungen auf alles Leben in seinem Inneren.
Schott ging in die Hocke und tastete um sich, ohne die Blicke von dem angriffsbereiten Tier zu lassen. Es scharrte mit einem Bein und schnaubte kräftig durch die Nasenlöcher. Der Schaftiger wusste, dass er entdeckt worden war.
Schott griff sich einen Ast. Einen Knüppel, so dick wie ein Unterarm, und gut eineinhalb Meter lang. Fast zu schwer, um ihn schwingen und als Waffe einsetzen zu können.
Diese Viecher waren klug, kräftig und bösartig. Eine Kombination, die sie zu den erfolgreichsten Jägern in den kaum besiedelten Teilen Frenshauns machte. Normalerweise bewegten sie sich in friedlichen Herden, die sich von Aas ernährten. Doch Einzelgänger wie dieser waren immens gefährlich.
Schott spürte die Anspannung. Das Adrenalin.
Es tat gut. Es ließ ihn vergessen, wie mies er sich eigentlich fühlte.
»Lass es bleiben!«, sagte er und durchbrach damit die Stille des Waldes. »Du kannst mir nichts tun. Ich werde vom Wald geduldet und geschätzt. Richtest du dich gegen mich, richtest du dich gegen ihn.«
Der Schaftiger gab ein aggressives Knurren von sich, die Hinterläufe scharrten heftiger.
Für einen Augenblick fühlte Schott Bedauern, dass er seine Ausrüstung hinter sich gelassen hatte. Doch er wollte mit dem Wald in Kontakt treten, also war es erforderlich gewesen.
Er holte tief Luft und brüllte, so laut er konnte: »Verschwinde von hier! Verschwinde!«
Der Schaftiger zuckte zusammen, die Vorderläufe gingen hoch. Er erschrak und wollte seinen Körper wenden – und überlegte es sich dann doch. Die Gier überkam ihn. Die Aussicht auf einen Kampf und auf Fleisch.
Also ließ er die Vorderbeine wieder hinab, spannte seine Muskeln an und stürmte los. Auf Schott zu. Das Tempo überraschte, obwohl er auf den Angriff vorbereitet gewesen war.
Schott wich zurück. Er wusste einen der größeren Bäume in seinem Rücken. Mit aller Kraft trieb er eine Seite des Knüppels in den Erdboden, sodass er in einem 45-Grad-Winkel abstand und die vordere Spitze in Richtung des heranstürmenden Tiers zeigte.
Kleine, blutunterlaufene Augen waren in dem riesigen Schädel zu sehen. Die kaum zehn Zentimeter langen Hörner waren belanglos. Ein Schaftiger tötete mit der Wucht seines Schädels.
Schott fühlte den Boden erbeben und er meinte, den Dampf nach Schweiß und Urin zu riechen. In letzter Sekunde warf er sich beiseite. Der Schaftiger rammte sich den Ast in die Brust. Er drang tief in den Leib ein und brach ab, Blut platzte aus der Wunde.
Mehr konnte Schott nicht sehen. Er rollte über den Boden, kam so rasch wie möglich wieder auf die Beine und presste seinen Körper eng gegen den Stamm des Baums. Er fühlte sich warm an, warm und gütig.
Schott rückte ein wenig zur Seite, um den Gegner sehen zu können. Der Bulle stand keine zehn Meter von ihm entfernt, heftig atmend und mit geschwollenen Muskeln. Der Ast steckte tief in seinem Leib, doch die Wunde war nicht tödlich.
Der Schaftiger brummte, als er Schott entdeckte, und drehte den Körper in dessen Richtung. Er hatte nicht genug. Er würde nochmals angreifen. Das Tier war im Blutrausch und würde sich nicht aufhalten lassen.
Es war Schotts mittlerweile dritte Begegnung mit einem Einzelgänger. Er war kein sonderlich mutiger und auch kein kräftiger Mann. Aber er hatte gelernt, mit der Gefahr zu leben, seitdem er sein besonderes Talent erkannt hatte.
Er verfügte über eine Gabe wie kein anderer Mensch auf Frenshaun. Mit dieser Gabe kam große Verantwortung und auch das Risiko, jene Tiere, die in unmittelbarer Nähe des Waldes lebten, gegen sich aufzuhetzen. Schaftiger, Klimbos und Hängepasterer veränderten sich, sobald der Wald erwachte. Sie fühlten die tiefe Unruhe der Bäume und wehrten sich dagegen, aus ihrer stumpfen, tierischen Beschaulichkeit gerissen zu werden. Insbesondere Einzelgänger wie dieser Bulle waren anfällig für das gedankliche Wispern der Bäume.
»Ganz ruhig!«, sagte Schott so sanft wie möglich. »Bleib stehen, wo du bist! Es ist nicht wichtig, was ich zu sagen habe. Hauptsache ist, du hörst meine Stimme und rührst dich nicht von der Stelle.«
Der Schaftiger atmete schwer. Er hatte viel Energie in seinen Angriff investiert. Diese Tiere waren nicht für ihre Ausdauer bekannt. Sie gehörten zwar zu den kräftigsten Räubern des Planeten, mussten ihre Beute aber beim ersten oder spätestens zweiten Angriff töten. Andernfalls erschöpften sie sich zu Tode. Das Herz war zu klein für den massigen Körper.
»Lass es bleiben! Denk nicht mal daran, es nochmals zu versuchen. Es ist alles gut. Du musst dich beruhigen.«
Der Bulle streckte den Schädel weit in die Höhe und röhrte auf. Er war weit davon entfernt, die Jagd auf Schott aufzugeben. Die Unsicherheit und die Wut waren zu groß.
Der Schaftiger schüttelte sein zottiges Fell und wollte erneut die Vorderläufe in die Höhe werfen, um Schwung für den zweiten Angriff zu nehmen.
Er scheiterte. Er schaffte es nicht, die Beine aus dem Unterholz zu lösen.
Der Wald hielt ihn fest. Je fester der Schaftiger rüttelte und je panischer er sich zu befreien versuchte, desto unerbittlicher wurde die Umklammerung durch die Baumwurzeln.
»Beruhige dich!«, wiederholte Schott und trat näher an den Jungbullen heran. »Wenn du einfach nur stehen bleibst und die Dinge geschehen lässt, kannst du dich in einer Stunde von deinen Fesseln lösen und deines Weges gehen. Ich bin mir sicher, dass irgendwo im Wald eine bildhübsche Kuh auf dich wartet ...«
Das Tier unternahm einen Befreiungsversuch, verhedderte sich aber bloß weiter in den Flachwurzeln der Frenshaun-Bäume. Es wehrte sich verzweifelt, mühte sich ab, geriet immer weiter in Panik.
Der Schaftiger fiel schwer zu Boden und rammte sich dabei den abgebrochenen Knüppel nur umso tiefer in seinen Leib. Das Schnaufen klang heftig, aus den absurd kleinen Nasenlöchern spritzte Schaum. Die Flanke hob und senkte sich rasch. Die Beine zuckten. Der Bulle unternahm letzte Versuche, sich zu befreien.
»Ich habe dir gesagt, dass du ruhig bleiben sollst«, murmelte Schott.
Ein erbärmliches Klagen drang aus dem Maul des Schaftigers, dann erschlaffte sein Körper abrupt. Das Herz, der Schwachpunkt des Tiers, hörte auf zu schlagen. Die Panik hatte ihn getötet.
»Es tut mir leid. Aber der Wald duldet keine Unruhe. Nicht jetzt, da er sich mit mir und mit ... anderen unterhalten möchte. Du warst zur falschen Zeit am falschen Ort.«
Ein letztes Zucken ging durch den Leib des Schaftigers, Luft entwich aus seinem weit geöffneten Maul. Das Tier stank bestialisch.
Schott atmete erleichtert durch. Erst dann fühlte er Angst, die Knie zitterten ihm.
Er wusste, dass er sich auf den Wald verlassen konnte. Doch der reagierte meist träge und nicht immer so, wie er es erwartete.
Schott streichelte den Kopf des toten Tiers und murmelte einige Worte, die er irgendwann und irgendwo einmal aufgeschnappt hatte. Er war nicht religiös. Aber er wusste sehr gut, dass etwas existierte. Etwas, das über das Verständnis eines Terraners hinausging, aber definitiv existierte.
Die Erschöpfung kehrte zurück. Tränen schossen ihm in die Augen, rannen ihm die Wangen herab, und Verzweiflung breitete sich in ihm aus. Die riesengroße Frage nach dem Warum seines Lebens wurde immer dominanter und füllte ihn aus.
Er heulte und schluchzte und japste. Es tat gut, den Emotionen freien Lauf lassen zu können, denn das bedeutete, dass die große Dunkelheit nicht völlig von ihm Besitz ergriffen hatte.
Also weinte er, bis die Tränen versiegten und ihn sonderbare Ruhe überkam. Es tat gut, sich wieder selbst zu fühlen und etwas ... geschafft zu haben.
Schott kam müde auf die Beine und putzte sich ab. Der Schaftiger lag mit verdrehten Gliedern da, die gebrochenen Augen in den Himmel gerichtet. Der Wald und seine Bewohner erledigten schon bald den Rest. In wenigen Tagen würden von dem Kadaver nur noch bleiche Knochen übrig sein.