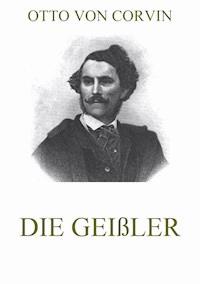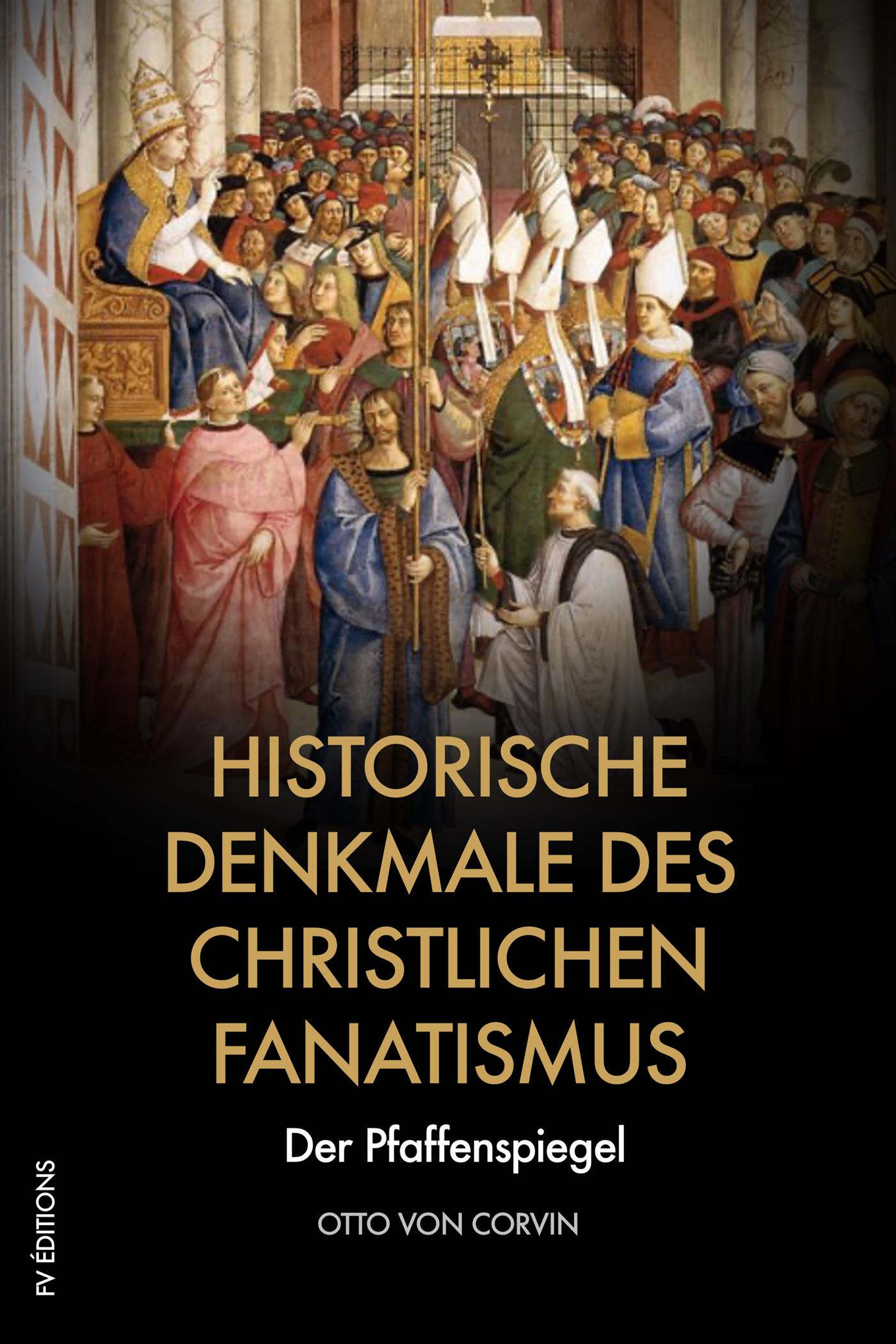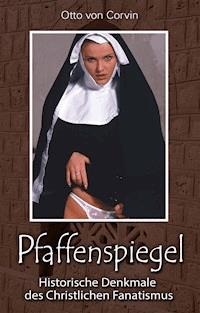
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Stephenson, C
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Erschreckend und teilweise sogar schockierend, aber auch hochinteressant sind die Tatsachen, über die Otto von Corvin in diesem bereits 1845 unter dem Titel 'Historische Denkmale des Christlichen Fanatismus' veröffentlichten Buch berichtet: Er blickt hinter die Kulissen der römisch-katholischen Kirche und weist auf die Missstände hin, die sich von den Anfängen des Christentums bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts dort zugetragen haben. Seine Kritik reicht vom überzogenen Heiligenkult, der allzu oft in geradezu heidnische Götzenanbetung ausartete, über den Ablasshandel und die damit verbundene Sittenlosigkeit vieler Geistlicher bis zu den zügellosen Aus- schweifungen mancher Päpste und den höchst verwerflichen Zuständen in den damaligen Klöstern. Der 'Pfaffenspiegel' ist ein kulturgeschichtliches Werk, dessen großes Ziel Aufklärung heißt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 439
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Titelbild steht in keinem Zusammenhang mit dem Inhalt des Buches.
© Carl Stephenson Verlag, Schäferweg 14, 24941 Flensburg
Alle Rechte vorbehalten einschließlich der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Medien
E-Mail: [email protected] Internet: www.stephenson.de
Besuchen Sie uns auf www.stephenson.de Ein großes, erotisches Verlagsprogramm erwartet Sie dort.
E-Book: ISBN 9783798603790
Pfaffenspiegel
Historische Denkmale des Christlichen Fanatismus Otto von Corvin
Originaltitel: »Historische Denkmale des Christlichen Fanatismus« Gebauer’sche Buchhandlung, Leipzig 1845
Dank dem BRITISH MUSEUM, London für die Überlassung des historischen Materials
Einleitung
Hermann Schla lerm an, hat piepen, lat trummen, Jesuiten sind kummen, Met Speeren un Stangen De Frieheit tau fangen.
(Volkslied)
Die Welt ist schon oft mit einem Narrenhaus verglichen worden. Der Vergleich ist für uns nicht schmeichelhaft, aber leider ist er passend. Schauen wir nur um uns! Wo wir hinsehen, finden wir die charakteristischen Kenn zeichen eines Tollhauses; überall rennen wir gegen verschlossene Türen, überall erblicken wir vergitterte Fenster und drohend geschwungene Peitschen eines Aufsehers, wenn wir etwas zu unternehmen trachten, was gegen die Hausordnung verstößt. Doch das alles hat die Welt auch mit einem Zuchthause gemein; das Treffende des Vergleichs wird uns erst klar, wenn wir ihre Bewohner, die Menschen, in ihrem Treiben beobachten. Dort erblicken wir hochmütige Narren, die sich für die Herren der Welt halten und fest und steif glauben, Gott habe dieselbe mit allen Menschen nur zu ihrem Privatvergnügen geschaffen; vor ihnen liegen Millionen noch größerer Narren im Staube, die ihnen glauben und demutsvoll gehorchen.
Dort sitzt ein anderer und nennt sich Vizegott. Er liebt das Geld wie ein altrömischer Statthalter, und die Menge rennt herbei und füllt ihm die Taschen mit Gold, wofür er ihr Einlaßkarten – zum Himmel gibt! Dort knien Tausende anbetend vor einer Bildsäule, dort vor einer Schlange, dort vor einem Ochsen. Jene beten die Sonne an, diese den Mond.
Seht euch diese Leute genauer an, denn von ihnen handelt dieses Buch. Ihr findet unter ihnen Wahnsinnige von allen Graden, vom rasend Tollen bis zum armen Blödsinnigen, der unter Zittern und Zagen seinen Rosenkranz betet und beständig fürchtet, der Teufel möchte ihn holen. Wie mannigfach sind nicht die Äußerungen ihres Wahnsinns, oft grauenerregend, oft lächerlich, oft Abscheu und Zorn, oft mitleiderweckend. Diese Religionstollheit verdient schon eine genaue Betrachtung, denn sie ist über die ganze Erde verbreitet und hat unsägliches Elend über die Menschen gebracht. Und ist dann diese Krankheit unheilbar? O nein!, aber die Ärzte, die es vermöchten, sie zu heilen, meinen es nicht ehrlich, denn sie beuten dieses Übel des Menschengeschlechtes zu ihrem Vorteil aus und fürchten ihre Macht zu verlieren, wenn die Welt von diesem Joch befreit wird. Andere meinen es ehrlich; aber Machthaber fesseln ihnen nicht allein die Arme, sondern versiegeln ihnen auch den Mund.
Vor 2.000 Jahren wurde zum Glücke der tollen Menschheit der Welt ein Heiland geboren. Er war ein großer Arzt, und wer seine Mittel gebrauchte, der genas von der Religionstollheit, die schon von Anbeginn unter dem Menschen geschlechte wütete. Aber er fiel als ein Opfer seiner Menschenfreundlichkeit und wurde ans Kreuz gehängt.
Seine Schüler schrieben die Lehren des Meisters nieder, so gut sie dieselben begriffen, aber sie taten es in der überschwenglichen Ausdrucksweise des Morgenlandes, und das war es, was das Abendland noch toller machte, als es vorher war. Hier verstand man den Geist der Sprache nicht, man hielt sich an den Wortlaut, fing an zu drehen und zu deuteln, und in die ganze Heilmethode kam grenzenlose Verwirrung. Die gute Absicht des großen Arztes, die Menschheit aus den Fesseln des Wahns zu erlösen, ging verloren, die geistige Finsternis wurde immer dichter, und die Menschen sind nach 2.000 Jahren noch verrückter, als sie es vorher waren. Doch ich will diese Bildersprache aufgeben und sie denjenigen überlassen, welche eine Menge von der Romantik des Christentums zu fabeln wissen. Ich will nun weiter kein Blatt vor den Mund nehmen, sondern gerade und deutsch meine Meinung sagen.
Es ist meine ehrliche und aufrichtige Meinung, daß das Christentum unendliches Elend über die Welt gebracht hat. Das Gute, welches es erzeugte, wäre auf anderen Wegen gewiß weit herrlicher erreicht worden, und dann steht es mit dem Bösen, dessen Ursache es war, in gar keinem Verhältnis.
Rom und Griechenland sind ohne Christentum groß geworden, und welcher christliche Staat kann so herrliche Beispiele von Bürgertugend und wahrer Mannesgröße aufweisen? Was hätte aus dem trefflich begabten deutschen Volke werden können, wenn es sich auf ähnlichem Wege wie das griechische entwickelt hätte oder auch – wenn ihm Christi Lehre in ihrer reinen Gestalt überliefert worden wäre! Aber was hat die christliche Kirche mit Christus gemein? Er predigte die Freiheit – sie die Sklaverei. Was haben die Deutschen durch das von den Pfaffen verpfuschte Christentum gewonnen? – Sie, die sonst frei waren, wurden durch dasselbe Sklaven und sind es geblieben bis auf den heutigen Tag. Statt hölzerner und steinerner Götzenbilder, die keinen Schaden taten, bekamen sie lebendige Pfaffen.
Die Verteidiger des Christentums rühmen, daß es die Barbaren entwilderte. Ich will zugeben, daß dies für den Augenblick geschah, allein wie bald zerknickte nicht das Papsttum die durch die neue Lehre hervorgerufenen dürftigen Blüten der Kultur und versenkte ganz Europa in eine Barbarei, die weit finsterer war, als sie es zu heidnischer Zeit jemals gewesen. Die heidnischen Preußen waren so dumm nicht, als sie den «heiligen» Adalbert totschlugen, und verdienten weit eher das Denkmal, welches nun diesem gesetzt werden soll. Papst Alexander VI. sagte: «Jede Religion ist gut, die beste aber – die dümmste.» Er sprach es aus, was alle Päpste vor ihm und nach ihm dachten. «Rom kann nur herrschen, wenn die Welt dumm ist», das stand als unumstößlicher Grundsatz in ihrer Seele geschrieben, und deshalb schickten sie ihre Apostel aus, welche die Menschheit systematisch verdummen mußten.
2.000.000 Kuttenträger – so hoch belief sich die päpstliche «Armee» – flatterten fortan über die in der Dämmerung liegende Welt.
Völker und Fürsten lagen vor den Päpsten im Staube. Das Weltreich, welches sie errichteten, und sein Bestehen bis auf den heutigen Tag ist das größte Wunder, welches die Geschichte kennt. Des großen Alexanders Reich zerfiel; das der alten Römer und das Napoleons ging in Trümmer; sie waren gebaut auf die Gewalt der Waffen. Aber das Reich von Neu-Rom besteht schon fast anderthalbtausend Jahre und wird wer weiß noch wie lange bestehen, denn es ruht auf dem solidesten Fundament – auf der Dummheit der Menschen. Man schämt sich, ein Mensch zu sein, wenn man überdenkt, durch welche Mittel es den Päpsten gelang, die Geister der Menschen in das Joch zu schmieden. Der große Betrug, der nichtswürdigste Eigennutz lagen so klar und offen da, daß es fast unbegreiflich erscheint, wie sie nicht auf der Stelle und selbst von dem Dümmsten erkannt wurden, besonders da die Pfaffen sich nicht einmal große Mühe gaben, ihr Tun und Treiben zu verbergen. Mit der schamlosesten Frechheit wurde die dummgläubige Christenheit geplündert, denn Geld, Geld, das war die Losung Roms. Scharen feister Mönche und Nonnen mästeten sich von dem sauer erworbenen Sparpfennig der Armen, die um so mehr bereit waren, die Koffer der Pfaffen zu füllen, weil es ihnen hier auf Erden so schlecht ging und sie sich doch wenigstens nach dem Tode ein bequemes Plätzchen sichern wollten. Der Klerus nahm lachend das gute Geld, welches ihm die Leicht gläubigen zahlten, und gab dafür Wechsel aufs Jenseits, die bis heute ihren Kredit behielten, da Tote bekanntlich stumm sind. Die schändlichsten Verbrechen, welche sich die Zunge zu nennen sträubt, konnten mit Geld gebüßt werden; aber wer an dem Glauben rüttelte, der büßte in den Flammen!
Der über alle Erwartung gute Erfolg und die unerhörte Leichtgläubigkeit der christlichen Herde hatten die Päpste und Pfaffen zu sicher gemacht. Ihre Geldgier wie ihre Üppigkeit und Liederlichkeit überschritten alle Grenzen. Einzelne sahen ein, daß der zu scharf gespannte Bogen brechen mußte; aber alle ihre Warnungen waren vergebens. Kardinal Johann, ein Engländer, sagte zu Innocenz IV.: «Bileams Eselin ließ sich lange mißhandeln, aber endlich fing sie an zu reden.» Der Kardinal hatte richtig prophezeit. Die Eselin redete; aber als sie geredet hatte, da schwieg sie wieder und blieb nach wie vor – eine Eselin.
Von allen Seiten erhoben sich Stimmen gegen das tolle Pfaffenunwesen; sie wurden in Flammen erstickt, und bornierte Fürsten halfen getreulich die Ketzer vertilgen. Aber jeder vergossene Blutstropfen schien dem Pfaffentum einen neuen Feind zu gebären, und nun begann der Kampf Roms mit der Vernunft, welche es schon längst erstickt zu haben meinte.
Wie ein Riese hieb der deutsche Grobian Luther die italienischen Finten durch; «Aber ach», sagt sein Zeitgenosse Caspar von Schwenkfeld, «Luther hat uns aus Ägypten geführt und durch das Rote Meer, aber in der Wüste sitzenlassen und Israel nicht ins gelobte Land gebracht.» Und heute, nach 300 Jahren, ist der Josua noch nicht erschienen!
Wer wollte die großen Verdienste Luthers verkennen! Die von ihm hervorgerufene Reformation war auf den sittlichen Zustand der Welt von unendlich großem Einfluß. Zahlen sprechen am klarsten. Wilberforce beweist uns, daß schon dreißig Jahre nach der Reformation die Zahl der in England hingerichteten Verbrecher sich von 2.000 auf 200 jährlich verminderte! Luther hat wahrlich genug getan, er hatte seinen Verfolgern eine Gasse geöffnet. Aber auch in Luther ging erst allmählich das Licht auf; er war Mönch gewesen und zu Rom die Treppe der Peterskirche auf den Knien andächtig hinauf- und hinuntergerutscht. Bis zum Ende seines Lebens konnte er seinen Geist nicht ganz von der Mönchskutte befreien. An seinen Schülern war es, auf dem von Luther gelegten Fundament zeitgemäß fortzubauen; aber es ging ihnen wie den Christen der ersten Jahrhunderte; sie klebten an den Worten ihres Meisters und blieben Lutheraner. Luther selbst klagt schon: «Ich wollte, daß sie (nämlich die von ihm geschriebenen Bücher) alle zu Pulver verbrannt wären; wollt’ Lust machen zur Heiligen Schrift, nun hängen sie bloß an meinen Büchern; ich wollte, daß sie alle zu Pulver verbrannt wären.» Dieses starre Festhalten am Wort hat uns unendlich geschadet! Den Sieg, den die Vernunft durch die Reformation erfochten hat, ist wahrlich nicht so groß, als ihn eifrige Lutheraner gern machen möchten. Den besten Beweis dafür liefert das protestantische Glaubensbekenntnis, welches von jedem bei der Konfirmation heruntergebetet wird. Der gar zu laut schreiende Unsinn ist daraus verschwunden, aber es ist noch genug darin geblieben, was vor der Vernunft nicht bestehen kann, um es nicht härter auszudrücken. Luther hat gesagt: «Man muß die Vernunft unter die Bank stecken.» Ja, die Vernunft unter die Bank stecken! Das ist die Zauberformel, die Rom groß gemacht hat! Die protestantischen Pfaffen gelüstet es nach derselben Macht in ihrem Bezirk, denn «es ist kein Pfäfflein so klein, es steckt in ihm ein Päpstlein!» Darum eifern sie mit Händen und Füßen dagegen, wenn sich die Vernunft an ihren Glaubenssätzen vergreifen will. Der gelehrte, unglückliche Abeilard aber meint: «Je erhabener göttliche Dinge sind, je ferner sie von der Sinnenwelt abliegen, desto mehr muß sich das Streben unserer Vernunft nach ihnen richten; der Mensch wird wegen der ihn auszeichnenden Vernunft mit dem Bilde Gottes verglichen: daher soll der Mensch sie auf nichts lieber richten als auf den, dessen Bild er durch sie vorstellt.» Der weise Seneca sagt: «Laßt uns nicht gleich dem Vieh dem Troß derjenigen nachgehen, welche vor uns wandeln, und statt dahin zu gehen, wohin wir zu gehen haben, dahin laufen, wohin eben alles läuft.» Die Gebildeten haben schon längst nur eine Religion, und darum laßt uns die unwürdige Heuchelei über Bord werfen und frank und frei die Flagge der Vernunft aufziehen. Was Katholiken, was Protestanten, was Papst, was Luther! Die Vernunft sei unser Papst, sie sei der Reformator des 19. Jahrhunderts. Laßt uns alle Protestanten sein, Protestanten gegen jeden mystischen Unsinn und gegen alles Sektenwesen. Jesus, der Weise von Nazareth, sei unser Führer und nächst ihm die älteste heilige Urkunde, die wir haben – die Vernunft.
Der große Friedrich sagte: «In meinem Lande kann jeder nach seiner Façon selig werden.» Ging Preußen wegen dieser Glaubensfreiheit zugrunde? Stand es mit seiner «Potsdamer Wachparade» etwa weniger achtungsgebietend da als andere viel größere und mächtigere Reiche?
– O warum sind doch die großen Fürsten so selten, und warum erscheinen sie noch viel seltener im richtigen Augenblick? Alle Fürsten trachteten nach Ansehen, Macht und Ruhm; aber sie sollten besser die Geschichte studieren, um zu lernen, daß die Fürsten nie groß wurden, die sich dem Geiste der Zeit und des Volkes entgegensetzten. Hätte Kaiser Karl V. sich an die Spitze der Reformation gestellt, anstatt sie zu bekämpfen, er wäre der größte Fürst geworden, den die Geschichte kennt. Dies war nicht allein der Weg zum höchsten Ruhm, sondern auch zur höchsten Macht; er schlug den entgegengesetzten Weg ein, und nach 40jähriger Regierung hatte er die Erfahrung gemacht, daß er vergebens gekämpft, daß Freiheit und Wahrheit sich wohl aufhalten, aber nicht unterdrücken lassen. Wodurch wurde der kleine Schwedenkönig Gustav Adolf so groß? Warum lebt sein Name noch heute in dem Munde der dankbaren Menschen, während das Volk nichts mehr von dem mächtigen Kaiser Karl V. weiß, in dessen Reich die Sonne nicht unterging? Wäre heute ein Fürst großherzig genug, veraltete Vorurteile abzustreifen, und klug genug, den Geist der Zeit zu erkennen; wäre er entschlossen genug, sich wie ein zweiter Gustav Adolf an die Spitze der Bewegung zu stellen – alle Herzen würden ihm entgegenfliegen, alle Arme sich für ihn und die gute Sache bewaffnen, er würde der größte und mächtigste Fürst werden, und sein Thron wäre fester gegründet als jeder andere, der sich auf eine Armee und auf wurmstichige Pergamente stützt, denn er wäre erbaut für die Ewigkeit in den Herzen vieler Millionen dankbarer Menschen.
Doch die königlichen Ehebetten gleichen der Aloe, aus der, wie man sagt, nur alle 100 Jahre einmal eine Blüte emporsteigt und die in der Zwischenzeit nur bittere Blätter und Stacheln hervorbringt. Preußen hat seinen Friedrich gehabt, Österreich seinen Joseph – wir Deutschen werden uns also wohl noch gedulden müssen! Ich sehe wenigstens nirgends eine Hoffnung. Staatsmänner, die es mit dem Volke schlecht meinten, haben es mit der Religion stets so gehalten: Glauben oben, Verstand unten, so regiert es sich am besten, das ist der alte Grundsatz der Despoten. Die Bewegungen der neueren Zeit mißfallen ihnen, sie fürchten, der Zeitgeist gehe mit der Freiheit schwanger, und trachten danach, die Frucht zu ersticken oder abzutreiben, ehe es zu spät wird.
Aber leider erscheint dem Despotismus die Beschränkung der Pressefreiheit als seine kräftigste Stütze, und der Nuntius des Papstes Hadrian VI. wußte wohl, was er tat, als er zu Nürnberg auf Zensur bestand und dabei blieb, daß darauf alles ankomme. «Große Männer wie unsere Josephe und Friedriche haben die Pressefreiheit nicht gefürchtet – aber je kleiner der Gewaltsmann, desto mehr haßt er das Licht.»
Sind Regierungen so verblendet, daß sie den bescheidenen und vernünftigen Wünschen des Volkes entgegenstreben, nun, so muß ein jeder sich selbst helfen, so gut er es kann, ohne die Gesetze zu verletzen. Muß auch jeder äußerlich tun, wozu ihn die Obrigkeit zwingt, «die Gewalt über ihn hat», so kann er doch sein Haus, seine Familie von dem Gifte frei halten, welches ein böser Wind über die Alpen auch nach Deutschland geweht hat. Die römischkatholische Kirche ist noch dieselbe, welche sie vor 1.000 Jahren war, und es ist eben ihr Stolz, daß sie unverändert geblieben ist. Sie verfolgt noch dieselben Zwecke, und wenn sie die Reformation auch erschreckte, so hat sie sich längst doch schon wieder von dem Schrecken erholt – da wir 300 Jahre lang schliefen. Die alten erprobten Mittel zur Verdummung der Menschen, die sich früher so erfolgreich bewährten, sie werden geöffnet und speien ihren Segen über die Welt aus – mit welchem Erfolge, lehrt die heilige Rockfahrt nach Trier. Ich werde mich also in dem nachfolgenden Werk damit begnügen, diejenigen Begebenheiten der Geschichte der Wahrheit getreu zu schildern, bei denen sich die schrecklichen Wirkungen der Intoleranz und des christlichen Fanatismus in ihrem grellsten Lichte zeigen. Da es nun aber zum Verständnis dieser historischen Gemälde durchaus nötig ist, einige Kenntnis davon zu haben, wie sich die christliche Kirche im Laufe der Jahrhunderte gestaltete und wie allmählich die Reformation hervorgerufen wurde, so sehe ich mich genötigt, eine Skizze davon gleichsam als Einleitung vorangehen zu lassen, da ich eine solche Kenntnis bei meinen Lesern nicht allgemein voraussetzen kann. Man erwarte indes kein geordnetes Ganzes und am allerwenigsten einen trockenen historischen Abriß, der die Leser nur langweilen würde, im Gegenteil, ich fürchte, oft nur zu spaßhaft werden zu müssen, wenn ich mich auch nur einfach darauf beschränke, das zu berichten, was Heilige, Päpste und andere Priester sich nicht schämten zu tun und zu sagen. Sind ihre Taten und Worte lächerlich und nicht immer anständig – so ist es meine Schuld nicht.
Leipzig, im Februar 1845
Corvin
1. Kapitel Wie die Pfaffen entstanden sind
Hüte Dich vor dem Hinterteil des Maultiers, vor dem Vorderteil des Weibes, vor den Seiten des Wagens und vor allen Seiten eines Pfaffen. (Altes Sprichwort)
Die Götter der alten Welt hatten ihren Kredit verloren; auch die Religion der Juden war zu einem bloßen Zeremoniendienst herabgesunken, welcher Geist und Herz der Menschen leer ließ und nur die Priester profitieren ließ. Da trat Jesus auf. Er wollte der Luther des Judentums werden und wurde Christus, der Stifter einer neuen Religion. «Es gibt nur einen Gott und dieser ist ein Gott der Liebe, kein rachedurstiger und zorniger Jehova, sondern ein gütiger Vater aller Menschen. Der Aufenthalt auf dieser Erde ist nur eine Vorbereitung für ein ewiges Leben, und es ist in die Hand eines jeden gegeben, dies zu einem freudenreicheren zu machen. Könige und Sklaven sind vor Gott gleich und werden vor dessen unparteiischem Richterstuhl nicht nach dem irdischen Ansehen ihrer Person, sondern nach ihren Taten gerichtet werden.» Diese Lehre klang wie eine Himmelsbotschaft in das Ohr der Armen und Unterdrückten; denn sie gab ihnen die Gewißheit von einem besseren Leben nach dem Tode, welches sich nicht durch Opfergaben, sondern nur durch ein tugendhaftes Leben gewinnen läßt. Diese Gewißheit gab ihnen Kraft, alle Leiden des Lebens selbst mit einer Art von Freudigkeit zu ertragen. Von allen Religionen, die es gibt und die es jemals gegeben hat, eignet sich die Jesu einzig und allein zur Weltreligion. Sie ist durchaus vollkommen, weil sie durchaus vernünftig ist und für alle Völker und alle Verhältnisse paßt; weil sie so einfach ist, daß auch der beschränkteste Verstand ihre Lehren begreifen kann, die sich in den wenigen Worten zusammenfassen lassen: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Christus mußte sterben, weil er in einem unterjochten Lande die Freiheit predigte. Er starb auch für unsere Freiheit, und der schönste Name, durch den wir sein heiliges Andenken ehren können, ist Erlöser. Denn wenn auch sein Erlösungswerk durch Dummheit und Eigennutz bis jetzt verhindert wurde, so besitzen wir doch, trotz aller Versuche, sie uns zu entwenden, in seiner Lehre den Schlüssel zu den Fesseln, in welche Priester- und Despotentyrannei die Menschheit geschlagen haben. Die Sage umschwebt die Wiege aller großen Männer und besonders phantastisch liebt sie es, das Leben derjenigen zu durchweben, die von den Zeitgenossen unbeachtet blieben und erst von der Nachwelt als groß erkannt wurden. Jesus ist den Geschichtsschreibern jener Zeit, wenn sie beiläufig seinen Namen erwähnten, nichts als ein jüdischer Schwärmer, der wegen erregter Unruhen von Rechts wegen den beschimpfenden Tod durch Henkershand erdulden mußte. Jesus selbst hat nichts geschrieben und daher keine Schuld an den Wundern, mit welchen ihn die Sage im Munde seiner schwärmerischen Anhänger vielleicht in der besten Absicht und dem Geiste der Zeit huldigend umgab. Alle diese Wunder von Christi Geburt, von seinem Leben und von seinem Tode vermögen es nicht, weder seine eigene, noch die Vortrefflichkeit seiner Lehre zu erhöhen; für den Vernünftigen sind sie in religiöser Hinsicht von durchaus keiner Bedeutung. Vor und nach Christus sind viele edle Männer für das, was sie für wahr erkannten, ebenso mutvoll wie er gestorben, und in den Körpern dieser Männer wohnten doch nur menschliche Seelen. Diejenigen also, welche Jesus zu einem Gotte machen, setzen sein Verdienst herab, indem sie es zu erhöhen meinen. Die Mehrzahl der ersten Anhänger Jesu hielt ihn für einen bloßen Menschen, und als einige Schwärmer unter ihnen die Ansicht aussprachen, daß er nur die Gestalt eines Menschen angenommen habe, so wurden sie deshalb von seinem Freunde und Schüler Johannes getadelt. Christus selbst sagte, als er den vor ihm niedergefallenen römischen Hauptmann Cornelius aufhob: «Stehe auf, ich bin ja auch nur ein Mensch!» Jesu Lehre verbreitete sich mit wunderbarer Schnelligkeit. Die Apostel und deren Schüler verkündeten sie nicht allein in Judäa und den benachbarten Ländern, sondern sie machten zu diesem Zwecke weitere Reisen und trugen «die frohe Botschaft» (Evangelium) von dem Erlöser der Welt in die fernsten Länder. Die Zahl der Anhänger, die sie gewonnen, war außerordentlich groß und besonders unter der ärmeren Volksklasse, aus der Christus und die Apostel selbst hervorgegangen waren. Nachdem Jerusalem etwa 70 Jahre nach Christi Geburt von dem nachherigen römischen Kaiser Titus zerstört worden war, wurden die stets zum Aufruhr geneigten Juden über das ganze römische Reich zerstreut und mit ihnen die Christianer – so nannte man damals die Anhänger der Lehre Jesu –, welche von den Römern als eine jüdische Sekte betrachtet wurden, wie es deren mehrere gab. Dies trug sehr viel zur schnellen Ausbreitung des Christentums bei, und gewiß nicht weniger wirkten dafür die zahlreichen Christen unter den römischen Legionen, die den Krieg bald in dieses, bald in jenes Land führte. Zur Zeit der Apostel und kurz nach derselben führten die Christen ein Leben, wie es den Lehren ihres Meisters würdig war; aber bald artete die Begeisterung, die sie beseelte und ohne welche keine gute Sache gedeihen kann, in religiöse Schwärmerei aus. Man wollte sich gleichsam selbst in Frömmigkeit überbieten und kam auf wunderliche Auslegungen der verschiedenen durch die Apostel aufbewahrten Aussprüche Jesu. Wo er weise Mäßigung empfahl, da glaubte man in seinem Sinne zu handeln, wenn man gänzlich entsagte, und so entstand allmählich die verkehrte Ansicht, daß die Freuden dieses Lebens verwerflich und eines Christen unwürdig wären. Indem man alle Genüsse mied und sich selbst quälte, glaubte man die Sündhaftigkeit der menschlichen Natur zu überwinden und dem Himmelreich näher zu kommen. Mit dieser Ansicht verband sich bald eine Art von geistlichem Hochmut. Der roheste Christ hielt den gebildetsten und tugendhaftesten Nichtbekenner Jesu für einen Verworfenen; ja er glaubte sich durch jede nähere Gemeinschaft mit den Heiden zu verunreinigen. Aus diesem Grunde sonderten sich die Christen bald ganz und gar von diesen ab, zerrissen die zwischen ihnen bestehenden Verwandtschafts- und Freundschaftsverhältnisse und flohen alle Lustbarkeiten und Feste gleich Verbrechen. Mit einem Wort, trotz aller Tugendhaftigkeit und Rechtschaffenheit ihres Lebens fingen sie an, kopfhängerische, trübselige, fromme Narren zu werden. Die mit ungeheurer Schnelligkeit anwachsende Menge der Christen, ihr menschenfeindliches, abgesondertes Wesen, ihre geheimnisvollen Zusammenkünfte, denen die Verleumdungen der jüdischen und heidnischen Priester bald politische und verbrecherische Zwecke unterlegten, ihr feindseliges Benehmen gegen die Heiden – alles dies erregte zwar die Aufmerksamkeit der römischen Regierung; aber sie hatte die vernünftige Politik, sich nicht um die Religion ihrer Untertanen zu kümmern, wenn diese nicht die Veranlassung wurde zu Feindseligkeiten gegen die Einrichtungen des Staates und seine Gesetze. Die Christen hätten also ungestört unter der römischen Herrschaft leben können, wenn sie sich von solchen Verbrechen, die kein Staat unbestraft lassen kann, ferngehalten hätten. Dies taten sie aber nicht, sondern in ihrem fanatischen Eifer forderten sie gleichsam die Regierung heraus. Sie verweigerten auf Grund ihrer Religion die allgemeinen Bürgerpflichten, wollten weder in den Krieg ziehen, noch öffentliche Ämter annehmen und bewiesen den Kaisern Verachtung, anstatt ihnen die herkömmlichen Ehren zu bezeigen. Da erkannten diese die Sekte der Christen für staatsgefährlich und beschlossen, sie zu zwingen, den Gesetzen des Staates gemäß zu leben. Da nun die Christen dies mit ihrer Religion nicht für vereinbar hielten, so beharrten sie in ihrem Widerstande gegen die Gesetze, und es begannen die blutigen Christenverfolgungen. Der Gesamtwille der Gemeinschaft, die einen Staat bildet, und die Gesetze, welche durch denselben gegeben werden, stehen über der Religion, zu der sich einzelne Staatsbürger bekennen, und die durch das Volk bevollmächtigten Repräsentanten des Staates haben unzweifelhaft das Recht, diese ohne Rücksicht auf ihre Religion mit aller Strenge für die Übertretung der Gesetze zu bestrafen, denn die Religion ist eine reine Privatsache. Insofern nun die römischen Kaiser als Repräsentanten und Oberhäupter des Staates betrachtet wurden, so hatten sie nicht allein das Recht, sondern sogar die Pflicht, die widerspenstigen Christen zu verfolgen. Grade die vortrefflichsten Kaiser, die sich für das Wohl ihres Staates am meisten besorgt zeigten, waren die eifrigsten Christenverfolger. Sie erreichten aber ihren Zweck nicht, sondern bewirkten gerade das Gegenteil von dem, was sie bewirken wollten. Die Verachtung des Lebens und aller Leiden war bei den schwärmerischen Christen so hoch gestiegen, daß sie den Tod als höchst wünschenswert betrachteten, sich scharenweise den Händen ihrer Verfolger überlieferten und diese durch ihren herausfordernden Trotz zur größten Grausamkeit anregten. Die Standhaftigkeit, mit welcher die Geopferten den qualvollsten Tod ertrugen, und die religiösen Ehren, welche die Gemeinde ihrem Andenken widmete, fachten die Schwärmerei der Christen zum Fanatismus an. Der Märtyrertod erschien als das höchste Glück, weil man glaubte, daß er alle Sünden tilge und sogleich zu Christus in das Paradies führe. Die Märtyrerschwärmerei nahm so überhand, daß die Besonneneren unter den Christen, welche das Unmoralische einer solchen Lebensverachtung einsahen, vergeblich dagegen ankämpften. Die Heiden, welche Zeugen von der Standhaftigkeit und Freudigkeit waren, mit welcher die Christen die ärgsten Qualen und den Tod erduldeten, wurden mit der größten Bewunderung erfüllt für eine Religion, die solche Kraft gab, und bekannten sich in großer Menge zu ihr. Die Zahl der Christen wuchs bald zu Millionen und gewann immer mehr Eingang auch unter den höheren Ständen und bald selbst am Hofe der Kaiser. In gar kurzer Zeit kam es dahin, daß Kaiser Konstantin, der 324 bis 337 nach Christi Geburt regierte, es aus politischen Gründen für gut hielt, die christliche Religion zur Staatsreligion zu machen. – Die ersten Christen zur Zeit der Apostel hatten sich von der Gemeinschaft der Juden nicht getrennt, denn sie betrachteten sich vielmehr als die wahren Israeliten und Jesus als den längst erwarteten Messias. Endlich zwang sie aber die Feindseligkeit der Juden, eine eigene Gemeinde zu bilden. Die Verfassung dieser ersten christlichen Gemeinde war die einer jeden Gesellschaft, die aus gleichstehenden Mitgliedern besteht, denn alle Christen nannten sich Brüder. Keiner hatte vor dem andern einen Vorrang, sondern ihre Pflichten und Rechte waren gleich. Zu ihren Vorstehern wählte die Gemeinde einige in allgemeiner Achtung stehende Männer, welche Presbyteren (Älteste) oder auch Bischöfe (episcopi, Aufseher) genannt wurden. Ihr Amt war es, Ruhe, Eintracht und Ordnung in der Gemeinde zu erhalten, ohne daß sie deshalb einen höheren Rang eingenommen hätten als den, welchen ihnen die Achtung der übrigen Brüder einräumte. Den Presbyteren zur Seite standen Diakonen (Helfer), welche die reichlich fließenden Almosen an die ärmeren Gemeindemitglieder austeilten und andere kleine Geschäfte übernahmen, welche nicht schon von den Ältesten verrichtet wurden. Kurz, die Gemeinden der ersten Christen waren vollkommene Republiken, und selbst die Apostel, welche mehrere derselben stifteten und eine Art von Oberaufsicht über sie führten, maßten es sich nicht an, eigenmächtig über die Gesellschaft betreffende Einrichtungen zu bestimmen, sondern begnügten sich damit, den Gemeinden mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Apostel Petrus macht es den Ältesten ausdrücklich zur Pflicht, dass sie über die Gemeinde nicht herrschen, sondern sie durch ihr gutes Beispiel leiten sollten. Das taten auch die Presbyteren der alten Zeit; sie betrachteten sich als die Diener der Gemeinde, welche sie für ihre Dienste durch Geschenke belohnte. Einen äußerlichen Gottesdienst kannte man nicht; die religiösen Versammlungen der apostolischen Christen fanden statt ohne alle Zeremonien und auf die Sinne berechneten Gebräuche. Man kam zusammen in irgendeinem geräumigen Saale, ohne denselben weder zu diesem Zwecke auszuschmücken, noch ihm eine besondere Weihe und Heiligkeit beizumessen, denn dergleichen erschien den Christen als heidnischer Wahn. Diese Versammlungen waren einzig und allein der Bekehrung und Erbauung gewidmet. Man las in ihnen die Briefe der umherreisenden Apostel vor oder Stellen aus den heiligen Büchern der Juden. Dann folgte ein belehrender Vortrag, den wohl meistens einer der Presbyteren hielt oder auch irgendein Mitglied der Gemeinde, welches sich dazu geeignet und berufen glaubte. Das Gehörte wurde dann besprochen und den Unwissenden das erklärt, was sie etwa nicht verstanden. So waren diese Versammlungen der Christen der apostolischen Zeit die ersten Volksschulen. Nach der Besprechung setzte man sich zu einem gemeinsamen Mahle nieder – welches Liebesmahl hieß –, und am Schluß oder auch am Anfang wurde Brot und Wein herumgereicht und beim Genüsse desselben mit Rührung und Dankbarkeit des für die Wahrheit gestorbenen Jesus gedacht, wobei auch wohl die Worte wiederholt wurden, die er bei der Einführung dieses schönen Gebrauches sprach. Den Schluß der Versammlung machte eine Beisteuer für die Armen. Leider änderte sich aber dieser würdige und einfache Zustand der christlichen Gemeinden sehr bald und ging endlich in die Form der heutigen katholischen Kirche über. Es wird für unsern Zweck genügen, es nur in leichten Umrissen anzugeben, wie eine so auffallende Umformung bewerkstelligt werden konnte. Wir haben oben gesehen, daß die Presbyteren mit der Leitung der Gemeindeangelegenheiten beauftragt waren. Bei ihren Beratungen führte anfangs der Älteste den Vor sitz; aber dieser war oft eben wegen seines Alters dazu nicht immer der tauglichste, und so zogen es denn die Presbyteren vor, den Tüchtigsten aus ihrer Mitte zum Präsidenten zu erwählen, welcher, da er über alles die Aufsicht führte, zur Unterscheidung von seinen ihm gleich gestellten Kollegen vorzugsweise der Bischof genannt wurde. Diese Bischöfe maßten sich bald einen höheren Rang an als ihre Kollegen, und wir erblicken sie in den Versammlungen auf einem erhabenen Sessel, während die anderen Presbyteren auf niedrigen Stühlen rings um sie her sitzen, hinter denen die Diakonen, gleich den dienenden Brüdern in den Synagogen, stehen. Die Gemeinden gewöhnten sich bald daran, in dem von ihren Vorstehern so ausgezeichneten Bischof ihren geistlichen Oberherrn zu sehen. Besondere Umstände trugen auch dazu bei, das Ansehen dieser Bischöfe zu vermehren. Die Christen auf dem Lande hatten sich anfangs den Gemeinden in den Städten angeschlossen; als ihre Zahl sich aber vermehrte, wünschten sie eigene Gemeinden zu bilden, wenn sie auch die Gemeinschaft mit denen der Städte nicht aufgeben wollten, da ihnen dieselben besonders zur Zeit der Verfolgungen und überhaupt von Nutzen war. Sie baten daher die Stadtbischöfe, sie mit Lehrern und Vorstehern zu versehen, und dieser schickte ihnen gewöhnlich einen seiner Presbyteren. Dieser Landbischof hatte nun zwar dieselbe Gewalt über seine Gemeinde wie der Stadtbischof über die seinige; aber er war in vielen Beziehungen von diesem abhängig. Dadurch bekam der Stadtbischof einen Kirchsprengel oder, wie es damals hieß, Diözese (Bezirk) oder Parochie. So wurde also schon in der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts nach Christi Geburt der Grund zur kirchlichen Aristokratie gelegt. Nachdem man nun einmal den Anfang damit gemacht hatte, jüdische Einrichtungen auf das Christentum anzuwenden, so ging dieser Unfug mit um so schnelleren Schritten vorwärts, als er der Eitelkeit und der Herrsch sucht derjenigen nützte, die sich bald der Leitung aller christlichen Gemeindeangelegenheiten zu bemächtigen wußten. Am Anfang des dritten Jahrhunderts war es schon so weit gekommen, daß man die Gewalt der Bischöfe aus dem Priesterrechte des alten Testamentes herleitete und alles, was Moses über Priesterverhältnisse festsetzte, ohne weiteres auf Bischöfe und Presbyteren anwendete. Bis dahin waren diese noch immer als das, was sie auch in der Tat waren, als Diener der Gemeinde betrachtet worden; aber ihr Stolz lehnte sich dagegen auf, und gegen Ende des dritten Jahrhunderts hatten sie schon geschickt den Glauben verbreitet, daß sie nicht von der Gemeinde, sondern von Gott selbst eingesetzt wären zu Lehrern und Aufsehern derselben; daß sie also nicht Diener der Gemeinde, sondern Gottes wären, und daß daher sowohl das Lehramt wie auch der Dienst der neuen Religion nur von ihnen allein versehen werden könne; weshalb sie einen von der Gemeinde abgesonderten, vorzüglicheren Stand bilden müßten. Um die immer noch Zweifelnden vollends zu berükken, griffen die Bischöfe zu einem andern Mittel, ihnen das, was sie wollten, begreiflich zu machen. Wenn die Apostel einen Lehrer oder Presbyter bestellten, legten sie ihm die Hand auf das Haupt und riefen Gott an, daß er ihm zu seinem Amte auch den Verstand geben möge. Diese Sitte hatten sie aus dem jüdischen Ritus entnommen, ohne daran zu denken, welchen Mißbrauch ihre dereinstigen Nachfolger damit treiben würden. Die Bischöfe behaupteten nämlich, daß durch dieses Handauflegen der den Aposteln einwohnende heilige Geist auch auf die Geweihten übergegangen sei und daß diese auch die Kraft hätten, ihn auf dieselbe Weise an andere zu übertragen. Es gelang ihnen vortrefflich, diese Ansicht unter den Christen populär zu machen, und gegen Ende des dritten Jahrhunderts glaubte man allgemein daran und sah in den Bischöfen, Presbyteren und Diakonen Wesen ganz anderer Art und fand es nun ganz natürlich, daß sie einen Stand für sich bildeten. So bedeutend nun auch der Einfluß der Bischöfe auf die Gemeinden schon war, so hatte die demokratische Verfassung derselben doch noch keineswegs aufgehört. Die Bischöfe konnten in den religiösen Angelegenheiten keineswegs nach Gefallen schalten und walten, sondern waren an die Einwilligung der Presbyteren und der ganzen Gemeinde gebunden. Dies war ihnen sehr unbequem, da sie nach unumschränkter Gewalt strebten. Zur Erlangung derselben benutzten sie die Provinzialsynoden. Wir haben schon früher beiläufig erwähnt, wie falsch die Aussprüche und Lehren Jesu häufig von den Christen verstanden wurden. Es entspannen sich über deren Auslegung bald Streitigkeiten, und schon im zweiten Jahrhundert finden wir, daß sich mehrere Gemeinden vereinigten, um dieselben durch gemeinschaftliche Beratung auszugleichen. Als diese Streitigkeiten sich mit der Zeit vermehrten, fühlte man die Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit solcher schiedsrichterlichen Versammlungen und ordnete sie für die Gemeinden eines bestimmten Bezirkes oder Landes regelmäßig und wenigstens einmal im Jahre an. So entstanden die Provinzial-Kirchenversammlungen. Die Gemeinden wurden auf denselben durch Abgeordnete vertreten, welche aus den Bischöfen, Presbyteren, Diakonen und einigen andern Gemeindemitgliedern bestanden. So bedeutend nun auch der Einfluß der Bischöfe auf die Beschlüsse dieser Kirchenversammlungen war, so stand ihnen noch immer die große Zahl der anderen Abgeordneten der Gemeinde entgegen, und es wurde vorerst die Aufgabe der Bischöfe, diese von den Kirchenversammlungen zu entfernen. Zuerst gelang es ihnen mit den Diakonen und Mitgliedern der Gemeinde und endlich auch mit den Presbyteren, so daß die Gesamtheit der christlichen Gemeinden auf den Synoden einzig und allein durch die Bischöfe vertreten wurde. Dies war zwar ein bedeutender Gewinn, denn nun konnten diese beschließen, was sie in ihrem Interesse für nötig hielten; aber noch immer bedurften die Beschlüsse die Zustimmung der Gemeinde. Um diesen lästigen Zwang zu entfernen, erfand man ein eigentümliches Mittel, welches wir einen plumpen und ungeschickten Betrug nennen würden, wenn er nicht gelungen wäre. Es war nämlich bei den Christen Gebrauch geworden, jede Versammlung mit der Bitte an Gott zu eröffnen, daß er die Anwesenden durch seinen Geist erleuchten und bei ihren Beratungen helfen möge. Diese Sitte wurde auch bei Eröffnungen der Kirchenversammlungen befolgt, und nun erzeugten die Bischöfe bei den nur zu gläubigen Christen den Wahn, daß durch dieses Gebet der Heilige Geist auch wirklich veranlaßt werde, bei der Synode gleichsam den Vorsitz zu führen, so daß alle ihre Beschlüsse als Aussprüche des Heiligen Geistes, also Gottes selbst, zu betrachten wären, die der Bestätigung nicht bedürften! Durch diese lächerliche List waren die christlichen Gemeinden um den letzten Rest ihrer Freiheit gebracht und der eigennützigen Willkür ihrer Bischöfe preisgegeben. Nachdem diese einmal so weit gekommen waren, gingen sie in ihren unverschämten Anmaßungen immer weiter, und es kam bald eine Zeit, wo die vor kurzem noch so ehrwürdigen Vorsteher der christlichen Gemeinden größtenteils die eigennützigsten, schamlosesten und verworfensten Menschen waren. «Aus den hölzernen Kirchengefäßen wurden goldene, aber aus den goldenen Bischöfen hölzerne.» Als Kaiser Konstantin die christliche Religion zu der des Staates machte, da erlitten alle Verhältnisse der christlichen Kirche eine bedeutende Veränderung. Die Kaiser betrachteten sich als Oberhäupter derselben; sie beriefen nicht nur nach ihrem Gefallen Kirchenversammlungen, leiteten die Wahlen der Bischöfe oder ernannten diese geradezu, sondern entschieden auch theologische Streitigkeiten nach ihrem Gutdünken. Dadurch gingen viele der angemaßten Rechte der Bischöfe für den Augen blick verloren; aber die Vorteile, die sie auf der andern Seite gewannen, waren so groß, daß sie sich ganz außerordentlich fügsam zeigten, und so geschah es, daß alles in der Kirche nach dem Willen der Kaiser ging. Der Kaiser war der Gnadenborn, aus dem auf seine Günstlinge Ehren und Reichtümer strömten, und die Bischöfe und Geistlichen wetteiferten in niedriger Schmeichelei, um deren möglichst viel zu erschnappen. Die Armut der Kirche und ihrer Diener hatte ein Ende. Schon Kaiser Konstantin bestimmte einen Teil der Staatseinkünfte zum Unterhalte der Geistlichen und begnadigte sie mit wichtigen Vorrechten. Das allereinträglichste war aber das Ge setz, durch welches er sie für berechtigt erklärte, Schenkungen anzunehmen, welche ihnen durch testamentarische Verfügungen gemacht wurden, was nach dem Gesetze des Kaisers Diokletian keinem Verein gestattet war. Nun war der Habgier der Geistlichkeit ein weites Feld geöffnet. Die niedrigsten und verächtlichsten Mittel wurden angewandt, um die bereits in Aberglauben aller Art versunkenen Christen zu reichen Schenkungen zu zwingen, und bereits nach zehn Jahren wagte es niemand mehr zu sterben, ohne der Geistlichkeit ein Legat zu vermachen. Diese betrieb ihr Geschäft auf so schamlose Weise, daß nicht sehr lange darauf sich die Kaiser Gratian und Valentinian gezwungen sahen, durch Gesetze der Erbschleicherei der Geistlichen Einhalt zu tun. Hieronymus, der Geheimschreiber des römischen Bischofs Damasus, der Zeuge war von dem nichtswürdigen Treiben der Pfaffen, rief bei der Bekanntmachung des Gesetzes: «Ich bedaure nicht des Kaisers Verbot, sondern mehr das, daß meine Mitbrüder es nötig gemacht haben!» Diese schildert er auf wenig schmeichelhafte Weise, indem er sagt: «Sie halten kinderlosen Greisen und alten Matronen den Nachttopf hin, stets geschäftig um ihr Lager; mit eignen Händen fangen sie ihren Auswurf auf, und Witwen heiraten nicht mehr, sie sind weit freier, und Priester dienen ihnen um Geld.» Selbst der Bischof des Hieronymus, Damasus, hatte sich den Beinamen Ohrenkratzer der Damen erworben. Als Kaiser Julianus zur Regierung kam (361 n. Chr.), da geriet der ganze Pfaffenschwarm in große Bestürzung, denn ihm wollte das bereits durch Aberglauben aller Art verunstaltete Christentum nicht behagen; er trat wieder zur Religion seiner Väter über und erwarb sich dafür den Beinamen Apostata (Abtrünniger). Die Christen waren selbst daran schuld, indem sie ihre reine Lehre durch Wundermärchen und läppische Fabeln verunstalteten. Vor der ersten allgemeinen Kirchenversammlung von Nicäa (325 n. Chr.) gab es an die 50 Evangelien, die bis auf die noch vorhandenen reduziert wurden, wahrscheinlich weil die andern den Heiden doch gar zu viel zu lachen gaben. Aus dem, was uns davon übriggeblieben ist, ersehen wir, daß ihre Verfasser mit den Familienverhältnissen Jesu weit genauer bekannt waren als die der uns erhaltenen. Wenn sie auch mit seiner Mutter nicht so vertraut waren wie jener Portugiese, der ein «Leben Jesu im Bauche der Maria» schrieb, so erzählen sie uns doch, daß dem frechen Menschen, der es wagte, die Maria unzüchtig anzufassen, sogleich die Hand verdorrte. Auch einige Wunder von Jesus berichten sie. Einst habe derselbe als Kind mit den andern Kindern gespielt und mit ihnen aus Ton Vögel gemacht, als die seinigen plötzlich fortgeflogen wären. Als er größer geworden, habe er einst einen Tisch gemacht, der zu kurz gewesen, weshalb er von seinem Vater gescholten worden sei; sogleich habe er an dem Tische gezogen und ihn so lang gemacht, wie Meister Joseph ihn wollte. Kaiser Julianus versuchte es, das Christentum zu stürzen, wenn er auch die Christen nicht verfolgte. Zur Freude der Pfaffen fiel er schon nach zwei Jahren im Kriege gegen die Perser. Sein Liebling, der Philosoph Libanius, fragte einst spöttisch einen christlichen Lehrer zu Antiochien: «Was macht des Zimmermanns Sohn?» Er erhielt zur Antwort: «Einen Sarg für deinen Schüler.» Bald darauf starb der Kaiser. Libanius vermutete, vielleicht eben wegen dieser Äußerung, daß er durch irgendeinen fanatischen Christen seinen Tod fand. Sterbend unterhielt sich der Kaiser über die Erhabenheit der menschlichen Seele, aber die Christen erzählen, er habe eine Hand voll Blut gen Himmel gespritzt und ausgerufen: «Du hast gesiegt, Galiläer.» Mit Julian starb der letzte heidnische Kaiser; unter seinen Nachfolgern wurde die Macht der Pfaffen immer größer.
2. Kapitel Die lieben, guten Heiligen
Zu alten Zeiten hieß heilig, wenn der Fliegen, der Heuschrecken fraß und jener gar mit seinem heil‘gen Hintern in einem Ameisenhaufen saß, um voller Andacht drin zu überwintern
Die Protestanten haben die Heiligen abgeschafft, aber der gläubige Katholik betet noch heute vor dem Bilde des Heiligen, in dessen Departement er oder die Bitte gehört, deren Erfüllung erwünscht. Der Adel steht unter der besonderen Protektion von St. Georg, St. Moritz und St. Michael; der Patron der Theologen ist seltsamerweise der ungläubige St. Thomas und der Schutzheilige der Schweine ist St. Antonius; die Jurisdiktion über die Juristen hat St. Ivo, über die Ärzte St. Cosmus und St. Damian, über die Jäger St. Hubertus; die Trinker stehen unter dem Schutze St. Martins. So hat auch jedes Gewerbe seinen besonderen Heiligen, wie auch jede Nation ihren besonderen Schutzheiligen hat. Die Portugiesen haben St. Anton, die Spanier St. Jacob, die Franzosen St. Denis, die Engländer St. Georg, die Venetianer St. Marcus, die Russen St. Nicolaus; die Frommen in Preußen beten zu St. Thieleus, dessen Fürbitte als besonders kräftig gerühmt wird; die Deutschen, ach ja so, die haben keinen Nationalheiligen, weil sie nie eine Nation waren. St. Thieleus bitt’ für sie! Auch haben einige Heilige, die mit der Leitung von Nationen und besonderen Ständen nicht zu sehr beschäftigt sind, ihre Muße im Himmel benutzt, einige Übel der armen Erdenwürmer besonders gründlich zu studieren, und der liebe Gott, der doch nicht alles selbst tun kann, hat ihnen nach dem Glauben vieler Katholiken erlaubt, ihm hier und da auszuhelfen. St. Aja hat die Rechtswissenschaft studiert und hilft in Prozessen, St. Cyprian beim Zipperlein, St. Florian bei Feuersgefahr, St. Nepomuk gegen Wasserflut und – Verleumdung, St. Benedict gegen Gift, St. Hubertus gegen die Tollwut, St. Petronella im Fieber, St. Rochus gegen die Pest, St. Ulrich gegen Ratten und Mäuse, St. Apollonia gegen Zahnweh, wenn es nicht von der Schwangerschaft kommt, denn in diesem Falle muß man sich an St. Margaretha wenden, welche auch bei schweren Geburten hilft. St. Blasius vertreibt das Halsweh, St. Valentin die Fallsucht, St. Lucia Augenübel, und der Vieharzt im Himmel ist St. Leonhardt. Alle diese Heiligen, verlaßt euch fest darauf, helfen ebenso sicher gegen die genannten Übel wie St. Thieleus gegen geheimes Gerichtsverfahren und gegen Zensur! Auch die Heiden hatten Heilige, nur waren die ihren durch große Taten ausgezeichnete Helden, während die der römischen Kirche nur ausgezeichnete Helden im Glauben waren; das ist der ganze Unterschied. Viele der ersten Christen wurden durch das Lesen der Evangelien rein himmeltoll und meinten, das Paradies zu erstürmen, wenn sie alle Aussprüche Christi im strengsten Sinne und den Worten nach befolgten. Diese Aussprüche hatten aber die Apostel niedergeschrieben, die bekanntlich keine großen Schriftsteller waren und ihren Meister oft selbst nicht verstanden. Weil Jesus es für nötig hielt, 40 Tage in die Wüste zu gehen – zu welchem Zwecke, hat er niemand gesagt –, so meinten die Schwärmer nun auch in die Wüste laufen und ihren Leib durch Fasten und allerlei Qualen kasteien zu müssen, denn Christus hatte gesagt: «Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir!» und ferner: «Willst du vollkommen sein, so gehe hin und verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben – komm und folge mir nach.» Die Idee von der Verdienstlichkeit, körperliche Martern mit Freudigkeit zu ertragen und sich selbst zu schaffen, kam erst recht zur Geltung, als die während der Verfolgungen unter Diokletian und Decius hingerichteten Christen durch ihre Standhaftigkeit so hohen Ruhm ernteten. Mögen sich auch die Kirchenschriftsteller nicht immer von Übertreibung ferngehalten haben, wenn sie die Leidensgeschichte der Märtyrer erzählen, so verdienen sie doch im allgemeinen Glauben, denn es ist eine bekannte Erfahrung, daß der Mensch, der sich in bedeutender geistiger Aufregung befindet, den Schmerz fast gar nicht fühlt, wie mancher alter Krieger bezeugen kann, der es in der Hitze des Kampfgewühls nicht gewahr wurde, daß ihm eine Kugel die Knochen zerschmetterte. Diese Schwärmerei nahm besonders im vierten Jahrhundert überhand, und das, was Zeno, Bischof von Verona (um 360 n. Chr.), sagte, war ziemlich der allgemeine Glaube: «Der größte Ruhm der christlichen Tugend ist es, die Natur mit Füßen zu treten!» Diese düstere Ansicht verbreitete über das ganze Christentum eine Melancholie, an der wir noch heute zu kauen haben. Die frommen Christen hielten sich nicht für wert, daß sie die Sonne beschien, sie betrachteten sich als wahre Teufelsbraten. Später gestaltete sich zwar, wie wir sehen werden, alles weit lustiger in der christlichen Kirche, aber da gab Luther den Leuten die Bibel und sie richtete ungefähr wieder dasselbe Unheil an, als zur Zeit, da sie den Christen zuerst bekannt wurde. Beweise dafür finden wir genug in der Geschichte, wie auch in den Predigten und anderen geistlichen Schriften aus der Zeit nach der Reformation; besonders reich daran sind die Gesangbücher, in denen sich oft nicht weniger seltsame Verse vorfinden wie die folgenden, die wörtlich einem alten Breslauer Gesangbuch entnommen sind:
Ich bin ein altes Raben-Aas, Ein rechter Sünden-Krüppel, Der seine Sünden in sich fraß, Als wie den Rost der Zwibbel. 0 Jesus, nimm mich Hund am Ohr, Wirf mir den Gnadenknochen vor, Und schmeiß mich Sündenlümmel In deinen Gnadenhimmel.
Doch kehren wir wieder zu unseren heiligen Weisen zurück, die sich besonders die Wüsteneien in Ägypten und Syrien zum Schauplatz ihrer Narrheit ausersehen hatten. Sie strebten alle danach, die Natur mit Füßen zu treten, und es gelang ihnen so vortrefflich, daß uns dabei die Haut schauert. Einer dieser Heiligen lebte 50 Jahre lang in einer unterirdischen Höhle, ohne jemals das freundliche Licht der Sonne wiederzusehen! Andere ließen sich bei der größten Hitze bis an den Hals in den glühenden Sand graben; noch andere in Pelze einnähen, so daß nur ein Loch zum Atmen frei blieb. Bei der afrikanischen Sonnenhitze eine treffliche Sommerkleidung! Aber doch noch erträglicher als der Burnus, den sich ein anderer aus Felsen aushieb und beständig mit sich herumschleppte. Auch ein ungenähter Rock! Sehr viele behängten sich mit schweren eisernen Ketten und Gewichten; der heilige Eusebius trug beständig 260 Pfund Eisen an seinem Körper. Einer dieser Narren namens Thaleläus klemmte sich in den Reifen eines Wagenrades und brachte in dieser angenehmen Stellung zehn Jahre zu, worauf er sich, zur Belohnung für seine Ausdauer, in einen engen Käfig zurückzog. Das war in der Tat ein rarer Vogel! Einige taten das Gelübde, jahrelang kein Wort zu reden, niemand anzusehen oder auf einem Beine umherzuhinken oder nur Gras zu fressen, und was des Unsinns mehr ist. St. Barnabas hatte sich einen scharfen Stein in den Fuß getreten; er litt die entsetzlichsten Schmerzen, aber er ließ sich den Stein nicht herausziehen. Wieder andere schliefen auf Dornen, ja manche versuchten, gar nicht zu schlafen, und hungern konnten sie wie die Schlangen in unseren Menagerien oder wie die deutschen Dichter der guten alten Zeit. Es ist eine bekannte Erfahrung, daß Wahnsinnige sehr lange den Hunger ertragen können. Simeon, der Sohn eines ägyptischen Hirten, aß nur alle Sonntage und hatte seinen Leib mit einem Stricke so fest zusammengeschnürt, daß überall Geschwüre hervorbrachen, die so entsetzlich stanken, daß es niemand in seiner Nähe aushalten konnte. Dieser Simeon glaubte immer, sich noch nicht genug zu quälen, und erfand etwas ganz Neues. Er stellte sich nämlich auf die Spitze einer Säule und blieb hier jahrelang stehen. Die erste Säule, die er sich errichtete, war nur vier Ellen hoch, aber je höher sein Wahnsinn stieg, desto höher wurden auch seine Säulen. Als seine Tollheit den Gipfelpunkt erreicht hatte, war seine Säule 40 Ellen hoch; auf dieser stand er 30 Jahre! Wie er es eigentlich anfing, nicht hin unterzufallen, wenn ihn der Schlaf überkam, das mag der Himmel wissen! Aber die Pferde schlafen ja auch im Stehen, warum sollte es nicht ein solcher heiliger Esel können. Eine seiner Lieblingsunterhaltungen war es, sich beim Gebet bis auf die Erde zu bücken. Er muß einen noch weit geschmeidigeren Rücken gehabt haben als unsere Kammerherren, denn ein Augenzeuge berichtet, daß er bis 1.244 Bücklinge gezählt habe, der Heilige aber noch unendlich lange in seiner equilibristischen Übung fortgefahren sei. Simeon brachte es dahin, daß er 40 Tage hungern konnte! Als seinem ausgemergelten Körper die Kraft zum Stehen fehlte, ließ er auf seiner Säule einen Pfahl errichten und sich an denselben mit starken Ketten in aufrechter Stellung befestigen. Diese Säulentollheit fand viele Nachahmer, besonders im warmen Morgenlande; im Abendlande ist nur ein Säulenheiliger bekannt, und dieser war aus – Trier! Der damalige Bischof war aber noch nicht so tief in den Geist der christlichen Kirche eingedrungen wie der jetzige hochwürdigste Bischof dieser gottesfürchtigen Stadt, sonst hätte er seinen Säulenheiligen für Geld sehen lassen, anstatt daß er die Säule umwarf und den Narren zum Teufel jagte. Das anschaulichste Bild von dem Leben dieser «Väter der Wüste» gibt uns folgende Schilderung eines Mannes, der ihr Leben und Treiben einen ganzen Monat lang als Augenzeuge beobachtet hat: «Einige stehen mit gen Himmel gerichteten Augen, mit Seufzen und Winseln, Barmherzigkeit; andere, mit auf den Rücken gebundenen Händen, halten sich in der Angst ihres Gewissens nicht für würdig, den Himmel anzuschauen; andere sitzen auf der Erde, auf Asche, verbergen ihr Gesicht zwischen die Knie und schlagen ihren Kopf gegen den Boden; andere heulen laut wie beim Tode geliebter Personen; andere machen sich Vorwürfe, nicht Tränen genug vergießen zu können, Ihr Körper ist, wie David sagt, voll Geschwüre und Eiter; sie mischen ihr Wasser mit Tränen und ihr Brot mit Asche; ihre Haut hängt an den Knochen, vertrocknet wie Gras. Man hört nichts als Wehe! Wehe! Vergebung! Barmherzigkeit! Einige wagen kaum ihre brennende Zunge mit ein Paar Tropfen Wasser zu erfrischen, und kaum haben sie einige Bissen Brot genossen, so werfen sie das Übrige von sich, im Gefühl ihrer Unwürdigkeit. Sie denken nichts als Tod, Ewigkeit und Gericht! Sie haben verhärtete Knie, hohle Augen und Wangen, eine durch Schläge verwundete Brust und speien oft Blut; sie tragen schmutzige Lumpen voll Ungeziefer, gleich Verbrechern in Gefängnissen, oder wie Besessene. Einige beten, sie ja nicht zu beerdigen sondern hinzuwerfen und verwesen zu lassen wie das Vieh!» – Wer von diesen Einsiedlern noch nicht verrückt war, mußte es bei der oben geschilderten Lebensweise fast notwendig werden. Das Beispiel reizte die Eitelkeit auf, und einer suchte den anderen an Strenge und Selbstquälerei zu übertreffen. Da es ihr höchstes Ziel war, die Natur mit Füßen zu treten, so suchten sie natürlich auch den Geschlechtstrieb zu unterdrücken. Der Kampf mit diesem mächtigsten der Triebe kostete aber die allergrößte Mühe. St. Hieronymus (geb. 330 u. gest. 422 n. Chr.) erzählt ganz kalt, daß dieser Kampf mit der Natur Jünglingen und Mädchen Gehirnentzündungen und oft den Wahnsinn gebracht habe! Die armen Narren, die ihren Leib kasteiten, um den Unzuchtsteufel in sich zu demütigen, machten dadurch das Übel nur immer ärger, denn der Teufel – der überall seine Hand im Spiele hatte – führte ihnen die üppigsten Bilder vor die Phantasie. Einige bestrichen, um sich den Kampf zu erleichtern, ihre rebellischen Glieder mit Schierlingssaft, andere machten der Sache völlig ein Ende, indem sie die Wurzel des Übels ausrotteten. Da hört freilich alles auf und auch die Versuchung. Dies tat auch der sonst so vernünftige Kirchenvater Origenes; aber seine Tat war keineswegs originell, da heidnische Priester der syrischen Göttin Zybele diese Operation sehr häufig mit sich vornahmen. Leontius, ein Priester zu Antiochien, Jakobus, ein syrischer Mönch, und noch viele andere unter den Priestern und Laien folgten diesem Beispiel, was daraus hervorgeht, daß ein Gesetz gegen diese Kapaunisierwut gegeben werden mußte. Nun, Gott sei Dank, vor der Rückkehr dieses Fanatismus sind wir sicher! Andere, welche sich zu einer solchen Radikalkur nicht entschließen konnten oder die durch ihre Frömmigkeit davon abgehalten wurden, litten Höllen qualen. Den heiligen Pachonius trieb das innerliche Feuer in die Wüste, weil er es hier leichter zu ersticken meinte als in der Welt, wo so viel zweibeiniger Zündstoff umherläuft. Er kämpfte oft mit sich, ob er seinen entsetzlichen Qualen nicht durch den Tod ein Ende machen solle. Einst legte er sich nackt in eine Höhle, welche von Hyänen bewohnt wurde. Diese Bestien beschnupperten ihn, ließen ihn aber ungefressen liegen, wahrscheinlich abgeschreckt durch den Heiligkeitsgeruch. Einige Tage danach gesellte sich zu dem geplagten Manne ein schönes ägyptisches Mädchen, setzte sich auf seinen Schoß und reizte ihn so sehr, daß er wirklich glaubte zu tun, was jeder nicht so heilige Mann in seiner Lage unfehlbar getan haben würde. Als er dies erkannte, merkte er sogleich, was die Glocke geschlagen hatte, und gab dem Mädchen als Honorar eine ungeheure Maulschelle. Und richtig, es war der Teufel in eigener Person, denn Pachonius’ Hand stank von der Berührung ein ganzes Jahr lang so entsetzlich, daß er fast ohnmächtig wurde, wenn er sie der Nase zu nahe brachte.