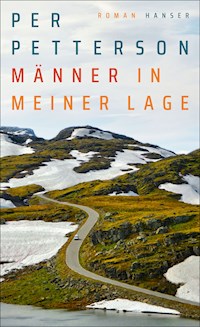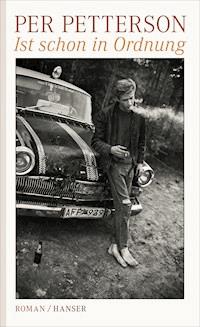Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Norwegen im Sommer 1948: Der fünfzehnjährige Trond verbringt die Ferien in einer Hütte nahe der schwedischen Grenze. Als in der Nachbarsfamilie ein schreckliches Unglück geschieht, entdeckt der Junge das wohlgehütete Lebensgeheimnis seines Vaters. In den Kriegsjahren hatte dieser zusammen mit der Nachbarin politisch Verfolgte über den Fluss gebracht. Und sich dabei für immer in diese Frau verliebt. Noch ahnt Trond nicht, dass er seinen Vater nach diesem gemeinsamen Sommer nie wiedersehen wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanser E-Book
Per Petterson
Pferde stehlen
Roman
Aus dem Norwegischen
von Ina Kronenberger
Carl Hanser Verlag
Die Originalausgabe erschien erstmals 2003 unter dem Titel Ut og stjæle hester bei Oktober in Oslo.
Die Übersetzung wurde von NORLA in Oslo gefördert.
ISBN 978-3-446-24666-9
© Forlaget Oktober as, Oslo 2003
Alle Rechte der deutschen Ausgabe
© Carl Hanser Verlag München 2006
Satz: Satz für Satz. Barbara Reischmann, Leutkirch
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Für Trond T.
I
1
Anfang November. Neun Uhr. Die Kohlmeisen knallen gegen das Fenster. Manchmal fliegen sie nach dem Zusammenprall wie benommen davon, dann wieder fallen sie in den Neuschnee und mühen sich ab, bevor sie erneut auf die Flügel kommen. Ich weiß nicht, was ich habe, das sie haben wollen. Ich sehe aus dem Fenster hinüber zum Wald. Über den Bäumen zum See hin scheint ein rotes Licht. Wind kommt auf. Ich sehe die Form des Windes im Wasser.
Hier wohne ich jetzt, in einem kleinen Haus an einem See ganz im Osten des Landes. In den See fließt ein Fluß. Es ist ein kleiner Fluß, der im Sommer wenig Wasser führt, aber im Frühjahr und Herbst munter strömt, und es gibt tatsächlich Forellen darin. Ich habe schon welche gefangen. Die Mündung ist nur wenige hundert Meter von hier entfernt. Wenn die Birken ihr Laub abgeworfen haben, kann ich sie aus dem Küchenfenster gerade noch sehen. Wie jetzt im November. Am Fluß steht eine Hütte, die ich sehen kann, wenn ihre Fenster erleuchtet sind und ich mich draußen auf die Treppe stelle. Dort wohnt ein Mann, der, wie ich glaube, älter ist als ich. Es wirkt so. Doch vielleicht liegt es auch daran, daß mir nicht klar ist, wie ich selbst aussehe, oder daran, daß das Leben härter zu ihm war als zu mir. Das will ich nicht ausschließen. Er hat einen Hund, einen Border Collie.
Ich habe ein Futterbrett auf einer Stange ein Stück weiter hinten im Hof. Morgens, wenn das Licht kommt, sitze ich mit einer Tasse Kaffee am Küchentisch und sehe, wie die Vögel herbeiflattern. Ich habe auf dem Brett acht verschiedene Arten gezählt. Mehr als an allen anderen Orten, an denen ich jemals gewohnt habe, doch nur die Kohlmeisen fliegen gegen das Fenster. Ich habe schon an vielen Orten gewohnt. Jetzt wohne ich hier. Wenn das Licht kommt, bin ich seit Stunden wach. Habe schon Feuer gemacht. Bin umhergelaufen, habe die Zeitung von gestern gelesen, den Abwasch von gestern gemacht, es war nicht sehr viel. BBC gehört. Das Radio läuft fast den ganzen Tag. Ich höre Nachrichten, kann es mir nicht abgewöhnen, aber ich kann nichts mehr mit ihnen anfangen. Man sagt, siebenundsechzig sei noch nicht alt, heutzutage nicht, und es fühlt sich auch nicht so an, ich fühle mich fit. Aber wenn ich die Nachrichten höre, nehmen sie in meinem Leben nicht länger den gleichen Platz ein. Sie verändern nicht mehr wie früher meinen Blick auf die Welt. Vielleicht stimmt etwas mit den Nachrichten nicht, mit der Art, wie sie wiedergegeben werden, vielleicht sind es zu viele. Der Vorteil von BBC World Service, einem Programm, das frühmorgens gesendet wird, ist, daß alles anders klingt, daß überhaupt nichts über Norwegen gesagt wird und daß ich mich über das Kräfteverhältnis zwischen Ländern wie Jamaika, Pakistan, Indien und Burma in einem Sport wie Kricket auf dem laufenden halten kann, einem Sport, den ich noch nie auf einem Spielfeld gesehen habe und auch nie sehen werde, wenn es nach mir geht. Mir ist allerdings aufgefallen, daß das »Mutterland« England ständig Prügel bezieht. Das ist schon mal was.
Ich habe auch eine Hündin. Sie heißt Lyra. Welcher Rasse sie angehört, ist schwer zu sagen. Und auch nicht wichtig. Wir waren schon draußen unterwegs, mit der Taschenlampe, haben den Weg genommen, den wir immer nehmen, hinter dem See mit millimeterdünnem Eis auf dem Wasser, wo das herbstgelbe, tote Schilf steif am Ufer steht, und der Schnee fiel leise und dicht aus dem dunklen Himmel, und Lyra mußte vor Freude niesen. Jetzt liegt sie neben dem Ofen und schläft. Es schneit nicht mehr. Im Laufe des Tages wird alles schmelzen. Das sehe ich am Thermometer. Die rote Säule steigt mit der Sonne.
Mein ganzes Leben lang habe ich mich danach gesehnt, allein an einem Ort wie diesem zu sein. Auch in schönsten Zeiten, und die waren nicht selten. Soviel kann ich sagen. Daß sie nicht selten waren. Ich hatte Glück. Doch auch dann, zum Beispiel inmitten einer Umarmung, wenn mir jemand Worte ins Ohr flüsterte, die ich gerne hörte, konnte ich mich plötzlich weit weg sehnen an einen Ort, an dem es einfach nur still war. Es konnten Jahre vergehen, ohne daß ich daran dachte, aber das heißt nicht, daß ich mich nicht danach sehnte. Und jetzt bin ich hier, und es ist fast genau so, wie ich es mir vorgestellt habe.
In knapp zwei Monaten ist dieses Jahrtausend zu Ende. Dann gibt es in der Gemeinde, zu der ich nun gehöre, ein Fest mit Feuerwerk. Dorthin werde ich aber nicht gehen. Ich bleibe mit Lyra hier im Haus, mache vielleicht einen Spaziergang zum Wasser hinunter, um zu sehen, ob das Eis schon hält, ich stelle mir zehn Grad minus und eine Mondnacht vor, und dann werde ich Feuer machen und mich mit einer Flasche, die ich im Schrank habe, ein bißchen betrinken und eine Platte von Billie Holiday auf den alten Plattenspieler legen – ihre Stimme gleich einem Flüstern –, wie damals, als ich sie in den fünfziger Jahren im Colosseum in Oslo gehört habe, fast ausgebrannt und doch magisch. Wenn die Platte zu Ende ist, werde ich zu Bett gehen und so fest schlafen, wie man nur kann, ohne tot zu sein, und zu einem neuen Jahrtausend erwachen und ihm nicht die geringste Bedeutung beimessen. Darauf freue ich mich.
Bis dahin nutze ich die Zeit, um diesen Ort hier herzurichten. Es gibt nicht wenig zu tun, ich habe ihn billig bekommen. Um ehrlich zu sein, war ich darauf vorbereitet gewesen, noch einige Scheine draufzulegen, um mir das Haus mit Grundstück zu sichern, aber es gab nicht viel Konkurrenz. Ich weiß jetzt auch warum, aber das macht nichts. Ich bin auch so zufrieden. Ich versuche, das meiste selbst zu machen, obwohl ich durchaus einen Schreiner bezahlen könnte, ich bin keineswegs knapp bei Kasse, aber dann ginge es zu schnell. Ich will mir die Zeit nehmen, die es braucht. Zeit ist jetzt wichtig für mich, denke ich. Nicht daß sie schnell oder langsam vergeht, sondern die Zeit an sich, etwas, worin ich lebe und das ich mit physischen Dingen und Aktivitäten füllen kann, um sie aufzuteilen, so daß sie für mich deutlich wird und nicht verschwindet, ohne daß ich es merke.
Heute nacht ist etwas passiert. Ich hatte mich in die Kammer neben der Küche gelegt, wo ich unter dem Fenster ein provisorisches Bett gebaut habe, und war eingeschlafen, es war nach Mitternacht, pechschwarz und kalt. Das fiel mir auf, als ich ein letztes Mal draußen war, um hinter dem Haus zu pinkeln. Das erlaube ich mir. Vor allem, weil es bisher nur ein Plumpsklo im Freien gibt. Es sieht ohnehin kein Mensch. Die Bäume im Westen stehen sehr dicht.
Ich wurde von einem schrillen, hohen Ton geweckt, der sich in kurzen Abständen wiederholte, bevor es still wurde und dann von neuem begann. Ich setzte mich im Bett auf, öffnete das Fenster einen Spaltbreit und sah hinaus. In der Dunkelheit konnte ich etwas weiter unten auf dem Weg zum Fluß den gelblichen Strahl einer Taschenlampe erkennen. Derjenige, der die Taschenlampe in der Hand hielt, gab zweifellos das Geräusch von sich, das ich hörte, mir war aber nicht klar, was für ein Geräusch es war und wie er es machte. Falls es ein er war. Dann schwenkte der Lichtstrahl ziellos nach rechts und nach links, hilflos fast, und in einem Moment erhaschte ich einen Blick auf das zerfurchte Gesicht meines Nachbarn. Im Mund hatte er etwas, das wie eine Zigarre aussah, und dann war das Geräusch wieder da, und mir wurde klar, daß es eine Hundepfeife war, obwohl ich bisher noch nie eine solche Pfeife gesehen hatte. Und er begann nach dem Hund zu rufen: Poker, rief er, Poker – so hieß der Hund –, komm, Junge, rief er, und ich legte mich wieder ins Bett und schloß die Augen, aber ich wußte, daß ich nicht mehr einschlafen würde.
Eigentlich wollte ich nur noch schlafen. Ich achte sehr auf die Stunden, die ich zum Schlafen brauche, es sind nicht mehr so viele, aber ich brauche sie ganz anders als früher. Eine Nacht ohne ausreichend Schlaf wirft noch tagelang Schlagschatten, macht mich reizbar und bremst meinen Schwung. Dazu fehlt mir die Zeit. Ich muß mich konzentrieren. Dennoch setzte ich mich wieder auf, schwang die Beine aus dem Bett, stellte die Füße auf den Boden und suchte im Dunkeln nach meinen Kleidern, die über dem Rücken eines Sprossenstuhls hingen. Ich hielt die Luft an, als ich merkte, wie kalt sie waren. Dann lief ich durch die Küche in den Gang, zog die alte Seemannsjacke über, nahm die Taschenlampe vom Brett an der Wand und ging hinaus auf die Treppe. Es war stockdunkel. Ich machte die Tür noch einmal auf und schaltete die Außenbeleuchtung an. Das half. Die rote Wand des Geräteschuppens warf einen warmen Widerschein auf den Hof.
Ich hatte Glück, dachte ich. Ich kann zu einem Nachbarn, der seinen Hund sucht, in die Nacht hinausgehen, und es dauert nur wenige Tage, bis ich wieder fit bin. Ich machte die Taschenlampe an und ging den Weg hinunter auf ihn zu, der immer noch auf dem sanften Abhang stand und die Lampe schwenkte, so daß der Lichtstrahl langsam in einem Kreis zum Waldrand glitt, über die Straße, am Flußufer entlang und zum Ausgangspunkt zurück. Poker, rief er, Poker, und dann blies er in die Pfeife, und das Geräusch erklang in unangenehm hohen Frequenzen in der stillen Nacht, und sein Gesicht, sein Körper waren in der Dunkelheit verborgen. Ich kannte ihn nicht, hatte nur ein paar Mal mit ihm gesprochen, auf dem Weg an seiner Hütte vorbei, wenn ich mit Lyra draußen war, gern am frühen Morgen, und ich hatte plötzlich Lust, wieder hineinzugehen und alles zu vergessen. Was konnte ich schon ausrichten? Aber jetzt hatte er bestimmt das Licht meiner Taschenlampe gesehen, und es war zu spät, und außerdem hatte sie etwas, diese einsame Gestalt, die ich in der Nacht kaum sehen konnte. Er sollte nicht auf diese Weise allein sein. Das war nicht richtig.
»Hallo«, rief ich leise, aus Respekt vor der Stille. Er drehte sich um, und für einen Augenblick sah ich nichts, denn er schickte mir den Lichtstrahl direkt ins Gesicht, und als ihm das klar wurde, ließ er die Taschenlampe sinken. Ich blieb noch einige Sekunden stehen, bis sich meine Augen wieder an die Dunkelheit gewöhnt hatten, dann ging ich zu ihm hinunter, und wir standen zusammen da, jeder mit seinem Lichtstrahl, der auf Hüfthöhe in die Landschaft zielte, und nichts sah so aus wie am Tag. Ich habe mich an die Dunkelheit gewöhnt. Ich weiß nicht mehr, ob ich jemals Angst vor ihr hatte, das hatte ich bestimmt, aber jetzt fühlt sie sich natürlich und sicher und vor allem übersichtlich an, egal, was sich eigentlich darin verbirgt. Das ist nicht wichtig. Nichts kann mit der Freiheit und Leichtigkeit des Körpers konkurrieren, keine definierte Höhe, keine klar abgegrenzte Entfernung, denn in der Dunkelheit gibt es nichts davon. Nur einen großen Raum, in dem man sich bewegt.
»Er ist wieder abgehauen«, sagte mein Nachbar. »Poker. Mein Hund. Das tut er manchmal. Er kommt zwar immer wieder zurück. Aber ich kann nicht gut schlafen, wenn er weg ist. Es gibt ja heutzutage Wölfe im Wald. Auch kann ich die Tür nicht zumachen, denke ich.«
Er wirkte ein wenig verunsichert. Das würde mir wohl ebenso gehen, wenn mein Hund einfach abhauen würde, und ich weiß nicht, was ich täte, wenn es um Lyra ginge, ob ich allein in die Nacht hinausginge, um sie zu suchen.
»Wissen Sie, daß der Border Collie als der intelligenteste Hund der Welt gilt?« fragte er.
»Das habe ich gehört«, sagte ich.
»Poker ist schlauer als ich, und das weiß er auch.« Mein Nachbar schüttelte den Kopf. »Er übernimmt bald das Ruder, fürchte ich.«
»Das ist bestimmt nicht gut«, sagte ich.
»Nein«, sagte er.
Mir fiel ein, daß wir uns einander nie richtig vorgestellt hatten, deshalb streckte ich die Hand aus, strahlte sie mit der Lampe an, damit er sie sah, und sagte:
»Trond Sander.« Das verwirrte ihn. Er brauchte ein paar Sekunden, bis er die Taschenlampe in die linke Hand genommen hatte, meine rechte mit seiner rechten ergriff und sagte:
»Lars, Lars Haug. Mit g.«
»Sehr erfreut«, sagte ich, und es klang ebenso sonderbar und fremd in der dunklen Nacht wie damals, als mein Vater vor vielen, vielen Jahren bei einer Beerdigung tief im Wald »Herzliches Beileid« sagte, und ich bereute sofort, daß ich diese zwei Worte ausgesprochen hatte, aber Lars ließ sich nichts anmerken. Vielleicht schien es ihm völlig angemessen, und er fand die Situation nicht merkwürdiger als jede andere, wenn zwei erwachsene Männer sich draußen bei der Arbeit vorstellen.
Um uns herum war es still. Tagelang, ja ganze Nächte hatte es geregnet und gestürmt und unablässig in den Kiefern und Fichten gerauscht, aber jetzt war es mucksmäuschenstill im Wald, kein Schatten bewegte sich, und wir standen ganz still da, mein Nachbar und ich, und starrten in die Dunkelheit, und dann war ich plötzlich sicher, daß da hinter mir etwas war. Ich konnte gegen das jähe Gefühl von Kälte im Rücken nichts machen, und auch Lars Haug spürte es: Er richtete den Lichtstrahl auf einen Punkt ein paar Meter neben mir, ich drehte mich um, und dort stand Poker. Ganz steif und auf der Hut. Ich hatte das schon einmal gesehen, daß ein Hund Schuldgefühle kennt und zeigt, und wie die meisten Menschen mochte auch er es nicht sonderlich, und erst recht nicht, als der Besitzer nun in einem fast kindlichen Ton zu ihm sprach, der so überhaupt nicht zu dem wettergegerbten, zerfurchten Gesicht eines Mannes paßte, der zweifellos nicht zum ersten Mal in einer Winternacht draußen war und mit widerspenstigen Dingen zu tun hatte, komplizierten Dingen, denen er im Gegenwind und mit hohem Einsatz widerstand, das konnte ich spüren, als wir einander die Hand gaben.
»He, wo warst du nur, Poker, du dummer Hund, warst ungehorsam zu deinem Papa, pfui, du böser Junge, das sollst du nicht«, und er machte einen Schritt auf den Hund zu, und dieser begann leise und tief in der Kehle zu knurren, er legte die Ohren an. Lars Haug hielt sofort inne. Er ließ die Lampe sinken, bis sie direkt auf den Boden schien und ich kaum noch die weißen Stellen im Fell des Hundes erkennen konnte, die schwarzen verschwanden in der Nacht, und es sah merkwürdig zufällig und asymmetrisch aus, während die leisen Kehllaute jetzt von einem noch unbestimmteren Punkt kamen, und mein Nachbar sagte:
»Ich habe schon mal einen Hund erschossen, und ich habe mir damals geschworen, es nie wieder zu tun. Aber ich weiß nicht.« Er war nicht sehr zuversichtlich, das war leicht zu erkennen, er wußte nicht, was er als nächstes tun sollte, und er tat mir plötzlich furchtbar leid. Es war ein Gefühl, das von, ich weiß nicht wo, in mir hochstieg, irgendwoher aus der Dunkelheit vielleicht, wo etwas in einer völlig anderen Zeit passiert war, oder von einem Moment in meinem eigenen Leben, den ich längst vergessen hatte, und das machte mich verlegen und betroffen. Ich räusperte mich und sagte mit einer Stimme, über die ich nicht ganz die Kontrolle hatte:
»Was war das für ein Hund, den Sie erschießen mußten?« Obwohl ich nicht glaube, daß ich mich ausgerechnet dafür interessierte, mußte ich doch etwas sagen, um das überraschende Zittern in meiner Brust zu beenden.
»Ein Schäferhund. Aber es war nicht meiner. Es passierte auf dem Hof, auf dem ich aufgewachsen bin. Meine Mutter hatte ihn zuerst gesehen. Er lief frei am Waldrand und machte Jagd auf Rehe: zwei völlig verängstigte, fast schon ausgewachsene Kitze, die wir seit Tagen aus dem Fenster beobachtet hatten, wie sie im Dickicht am Rand der oberen Wiese grasten. Sie waren die ganze Zeit zusammen, und das waren sie auch an jenem Tag, und der Schäferhund jagte sie, kreiste sie ein, schnappte nach ihren Läufen, und sie waren allmählich ziemlich erschöpft, sie hatten keine Chance, und meine Mutter konnte es nicht länger mitansehen, also rief sie den Dorfpolizisten an und fragte, was sie tun sollte, und er sagte: Erschießen Sie ihn einfach.«
»›Das ist was für dich, Lars‹, sagte sie, nachdem sie aufgelegt hatte, ›schaffst du das, was meinst du?‹ Ich hatte keine Lust, das muß ich sagen, ich rührte dieses Gewehr so gut wie niemals an, aber mir taten die Rehkitze ziemlich leid, und ich konnte meine Mutter schlecht bitten, es selbst zu erledigen, und sonst war niemand zu Hause. Mein großer Bruder war auf See und mein Stiefvater im Wald, fällte Bäume für den Großbauern, wie er es um diese Jahreszeit immer tat. Daraufhin nahm ich das Gewehr, ging nach draußen und über den Acker zum Wald. Als ich dort angelangt war, konnte ich den Köter nirgendwo sehen. Ich blieb stehen und horchte. Es war Herbst, ganz klare Luft mitten am Tag, es war so still, daß es fast unangenehm war. Ich drehte mich um und sah über den Acker zum Haus, wo, wie ich wußte, meine Mutter am Fenster stand und jede meiner Bewegungen genau verfolgte. Ich konnte mich nicht drücken. Ich sah wieder in den Wald, über einen Pfad, und von dort rannten plötzlich die beiden Rehe auf mich zu. Ich kniete mich hin, nahm das Gewehr hoch, legte an, und die großen Kitze waren so verschreckt, daß sie mich nicht sahen oder nicht die Kraft hatten, sich noch um einen weiteren Feind zu kümmern. Sie änderten ihren Kurs überhaupt nicht, sondern hielten direkt auf mich zu und rasten wenige Zollbreit von meiner Schulter entfernt an mir vorbei, ich hörte sie schnaufen und sah, wie ihre aufgerissenen Augen weiß glänzten.«
Lars Haug hielt einen Augenblick inne, nahm die Lampe hoch und strahlte Poker an, der sich hinter mir nicht von der Stelle gerührt hatte. Ich drehte mich nicht um, hörte den Hund jedoch leise knurren. Es war ein unangenehmes Geräusch, und der Mann vor mir biß sich auf die Lippen und fuhr sich mit den Fingern der linken Hand unsicher über die Stirn, bevor er weitersprach:
»Dreißig Meter dahinter kam der Schäferhund. Ein riesiges Vieh. Ich schoß sofort. Ich bin sicher, daß ich ihn getroffen hatte, aber er änderte weder Tempo noch Richtung, vielleicht ging ein Zucken durch seinen Körper, ich war beileibe nicht sicher, also schoß ich noch einmal, und er sank auf die Knie, kam wieder hoch und lief weiter. Ich war völlig verzweifelt und gab noch einen Schuß ab, er war nur noch wenige Meter von mir entfernt, und dann stürzte er vornüber, die Beine in der Luft und rutschte bis an meine Stiefelspitze. Aber er war nicht tot. Mit lahmen Beinen lag er da und sah zu mir auf, und plötzlich tat er mir leid, das muß ich zugeben, also beugte ich mich vor, um ihm einen letzten Klaps auf den Nacken zu geben, doch da knurrte er und schnappte nach meiner Hand. Ich zuckte mächtig zusammen, wurde zornig und verpaßte ihm zwei weitere Schüsse, direkt in den Kopf.«
Lars Haug stand mit dem Gesicht im Schatten, die Taschenlampe hing ihm müde in der Hand und schickte lediglich eine kleine gelbe Scheibe auf den Boden. Tannennadeln. Kleine Steine. Zwei Kiefernzapfen. Poker stand ganz still und gab keinen Laut von sich, und ich fragte mich, ob Hunde die Luft anhalten können.
»Verdammt aber auch«, sagte ich.
»Ich war gerade achtzehn geworden«, sagte er. »Es ist lange her, aber das werde ich nie vergessen.«
»Dann verstehe ich, daß Sie nie wieder einen Hund erschießen wollen«, sagte ich.
»Wir werden sehen«, sagte Lars Haug. »Aber jetzt gehe ich mit dem Hund besser rein. Es ist spät. Komm, Poker«, sagte er, hatte plötzlich eine strenge, würdige Stimme und setzte sich langsam in Bewegung. Poker folgte gehorsam ein paar Meter hinter ihm. Als sie zu der kleinen Brücke kamen, blieb er stehen und winkte mit der Lampe.
»Danke für die Gesellschaft«, sagte er laut in die Dunkelheit. Ich winkte mit meiner Lampe zurück, drehte mich um, ging das sanft ansteigende Stück hinauf zum Haus, machte die Tür auf und trat in den erleuchteten Gang. Aus irgendeinem Grund schloß ich die Tür hinter mir ab, was ich, seit ich hier eingezogen bin, noch nie getan habe. Es gefiel mir nicht, daß ich es tat, aber ich tat es trotzdem. Ich zog mich aus, legte mich ins Bett, deckte mich zu, starrte an die Decke und wartete auf die Wärme. Ich fühlte mich ein wenig dumm. Dann schloß ich die Augen. Irgendwann, während ich schlief, begann es zu schneien, und ich bin sicher, daß ich im Schlaf wußte, daß das Wetter umschlug und es kälter wurde, und ich wußte, daß ich mich vor dem Winter fürchtete, und ich fürchtete mich vor dem Schnee, sollte es viel davon geben, und davor, daß ich mich in eine ausweglose Situation begeben hatte, als ich hierhergezogen war. Also träumte ich entschlossen vom Sommer und hatte ihn noch im Kopf, als ich erwachte. Ich hätte von jedem beliebigen Sommer träumen können, aber ich tat es nicht, ich träumte von einem ganz bestimmten Sommer, und ich denke noch immer an ihn, während ich hier am Küchentisch sitze und das Licht über die Bäume am See kommen sehe. Nichts sieht mehr so aus wie heute nacht, und mir fällt kein Grund dafür ein, weshalb ich die Tür abgeschlossen habe. Ich bin müde, aber nicht so müde, wie ich befürchtet hatte. Ich halte bis zum Abend durch, das spüre ich. Ich stehe etwas steif vom Tisch auf, mein Rücken ist nicht mehr das, was er einmal war. Lyra liegt neben dem Ofen, hebt den Kopf und sieht mich an. Wollen wir noch mal nach draußen? Das wollen wir nicht, noch nicht. Ich habe genug zu tun mit diesem Sommer, der mich plötzlich wieder heimsucht. Das hat er jahrelang nicht getan.
2
Wir wollten los und Pferde stehlen. Das sagte er, als er vor der Tür zu der Hütte stand, in der ich in diesem Sommer zusammen mit meinem Vater wohnte. Ich war fünfzehn. Es war das Jahr 1948 und einer der ersten Tage im Juli. Drei Jahre zuvor hatten die Deutschen das Land verlassen, aber ich kann mich nicht erinnern, daß wir noch über sie redeten. Mein Vater zumindest nicht. Er redete nie über den Krieg.
Jon kam häufig an unsere Tür, früh, aber auch spät, und wollte, daß ich mitkomme: um Hasen zu schießen, um im fahlen Mondlicht, wenn es mucksmäuschenstill war, durch den Wald zu laufen und den Bergkamm zu erklimmen, um im Fluß Forellen zu angeln, um auf den gelbglänzenden Baumstämmen zu balancieren, die nach wie vor mit der Strömung zu unserer Hütte getrieben wurden, lange nachdem die letzten Fällarbeiten abgeschlossen waren. Es war gefährlich, aber ich sagte nie nein und sagte meinem Vater nie, was wir trieben. Wir konnten vom Küchenfenster aus ein Stück vom Fluß sehen, aber dort vollführten wir unsere Kunststücke nicht. Wir begannen immer weiter unten, einen Kilometer fast, und manchmal ging es so schnell, und wir kamen so weit auf den Stämmen, daß wir, wenn wir schließlich wieder an Land geklettert waren, triefnaß und zitternd, eine Stunde brauchten, um durch den Wald zurückzugehen.
Jon wollte nur mit mir zusammen sein. Er hatte zwei jüngere Brüder, die Zwillinge Lars und Odd, aber er und ich waren gleich alt. Ich weiß nicht, mit wem er das restliche Jahr verbrachte, wenn ich in Oslo war. Davon erzählte er nie etwas, und ich sagte nie, was ich in der Stadt machte.
Er klopfte nicht an, kam nur leise über den Trampelpfad vom Fluß, wo sein kleines Boot am Ufer lag, und wartete vor der Tür, bis ich merkte, daß er da war. Es dauerte selten lange. Sogar frühmorgens, wenn ich noch schlief, spürte ich manchmal eine Unruhe mitten im Traum, als müßte ich auf die Toilette, und ich rang mit dem Schlaf, bevor es zu spät wäre, und wenn ich die Augen aufschlug und mir klar wurde, daß es das nicht war, ging ich sofort zur Tür, machte sie auf, und dann stand er da. Er lächelte fast unmerklich und kniff die Augen zusammen, wie immer.
»Kommst du mit?« fragte er. »Wir wollen los und Pferde stehlen.«
Es zeigte sich, daß mit wir nur er und ich gemeint waren, wie gewöhnlich, und käme ich nicht mit, wäre er allein, und das würde keinen Spaß machen. Außerdem war es schwierig, allein Pferde zu stehlen. Unmöglich eigentlich.
»Wartest du schon lange?« fragte ich.
»Ich bin gerade gekommen.«
Das sagte er jedesmal, und ich wußte nicht immer, ob es stimmte. Ich stand nur in Unterhosen bekleidet in der Tür und sah über seine Schulter. Über dem Fluß hingen Nebelfetzen, und es war schon hell und noch etwas kalt. Das würde sich in den nächsten Minuten geben, aber jetzt spürte ich, wie sich eine Gänsehaut auf Oberschenkeln und Bauch ausbreitete. Trotzdem blieb ich stehen, starrte hinunter zum Fluß und sah, wie er glänzend und sanft aus dem Dunst an der Biegung weiter oben auftauchte und schließlich hier vorbeiströmte. Ich kannte seinen Verlauf genau. Ich hatte den ganzen Winter hindurch von ihm geträumt.
»Welche Pferde denn?« fragte ich.
»Die von Barkald. Sie grasen auf der Koppel hinterm Hof.«
»Das weiß ich. Komm rein, ich muß mich noch anziehen.«
»Ich warte hier«, sagte er.
Er kam nie mit mir rein, vielleicht wegen Vater. Er redete nie mit meinem Vater. Grüßte ihn nicht. Sah zu Boden, wenn sie sich auf dem Weg zum Laden begegneten. Dann blieb mein Vater für gewöhnlich stehen, drehte sich nach ihm um und fragte:
»War das nicht Jon?«
»Doch«, sagte ich.
»Was hat er denn?« fragte mein Vater jedesmal, irgendwie unangenehm berührt, und jedesmal antwortete ich:
»Ich weiß es nicht.«
Und ich wußte es auch nicht, und ich dachte nie daran, ihn zu fragen. Jetzt stand Jon auf der Stufe vorm Haus, die nur aus einer Steinplatte bestand, und starrte hinunter zum Fluß, während ich meine Kleider von einem der aus Baumstämmen gefertigten Stühle nahm und sie so schnell wie möglich überstreifte. Ich mochte es nicht, wenn er draußen warten mußte, obwohl ich die Tür offen gelassen hatte, damit er mich die ganze Zeit sah.
Ich hätte natürlich merken müssen, daß an diesem Julimorgen etwas anders war, etwas, was vielleicht mit dem Nebel über dem Fluß und dem Dunst über den Berghängen zusammenhing, mit dem weißen Licht am Himmel, mit der Art, wie Jon sagte, was er zu sagen hatte, oder mit der Art, wie er sich bewegte oder dort aufrecht auf der Steinplatte stand. Aber ich war erst fünfzehn, und das einzige, was mir auffiel, war, daß er das Jagdgewehr nicht mithatte, das er sonst immer bei sich trug, für den Fall, daß ein Hase angerannt käme, aber das war nicht wirklich merkwürdig, bei der Pferdejagd wäre es nur im Weg. Wir wollten die Pferde ja auch nicht schießen. Soweit ich sehen konnte, war er wie immer: ruhig und intensiv zugleich, die Augen zusammengekniffen, auf unser Vorhaben konzentriert, ohne Zeichen von Ungeduld. Für mich war das in Ordnung, denn es war kein Geheimnis, daß ich im Vergleich zu ihm bei den meisten Dingen hinterherhinkte. Er hatte jahrelanges Training. Lediglich bei unserem Baumstammritt den Fluß hinunter war ich wirklich gut, ich hatte ein angeborenes Gleichgewichtsgefühl, ein Naturtalent, meinte Jon, auch wenn er dieses Wort nicht benutzte.
Was er mir beigebracht hatte, war, es drauf ankommen zu lassen. Wenn ich locker blieb und nicht schon vorher so viel darüber nachdachte und mich innerlich bremste, konnte ich Dinge schaffen, von denen ich nicht einmal geträumt hätte.
»Auf die Plätze, fertig, los«, sagte ich.
Wir liefen den Pfad hinunter zum Fluß. Es war frühmorgens. Die Sonne stieg mit einem Fächer aus Licht hinter dem Berg auf und tauchte alles um uns herum in eine neue Farbe, und was vom Nebel noch übrig war, schmolz über dem Wasser und verschwand. Ich spürte die plötzliche Wärme durch den Pullover, schloß die Augen und ging weiter, ohne ein einziges Mal zu stolpern, bis ich wußte, daß wir das Ufer erreicht hatten. Dort öffnete ich die Augen wieder, kletterte über die vom Wasser umspülten Steine und setzte mich hinten in das kleine Boot. Jon stieß ab und sprang hinterher, nahm die Riemen in die Hand und ruderte mit kurzen harten Schlägen quer über das fließende Wasser, ließ das Boot ein Stück treiben, ruderte erneut, bis wir das gegenüberliegende Ufer circa fünfzig Meter weiter unten erreicht hatten. Gerade weit genug, daß das Boot von der Hütte aus nicht zu sehen war.
Dann kletterten wir die schmale Uferböschung hinauf, Jon zuerst, ich hinterher, und gingen am Stacheldrahtzaun der Koppel entlang, wo das Gras hoch unter hauchdünnen Teppichen aus Nebel stand und bald gemäht und auf Reuter gehängt werden sollte, damit es in der Sonne zu Heu trocknete. Es war, als würde man durch hüfttiefes Wasser gehen, nur ohne Widerstand, wie in einem Traum. Ich träumte häufig von Wasser, das Wasser war mein Freund.
Die Koppel gehörte Barkald, und wir waren diese Strecke schon oft gegangen, zwischen den Feldern hindurch zur Straße, die zum Laden führte, um Comics oder Bonbons und andere Dinge zu kaufen, für die unser Geld reichte: Münzen zu ein, zwei, manchmal gar fünf Öre, die bei jedem Schritt in der Tasche klimperten, oder wir gingen zu Jon nach Hause, in die entgegengesetzte Richtung, wo seine Mutter uns mit überströmender Herzlichkeit begrüßte, wenn wir durch die Tür traten, als wäre ich der norwegische Kronprinz oder etwas in der Art, während sich sein Vater in die Lokalzeitung vertiefte oder in der Scheune verschwand, um etwas zu erledigen, was plötzlich ganz dringend anlag. Irgend etwas war da, was ich nicht verstand. Es störte mich jedoch nicht. Meinetwegen konnte er gern in der Scheune bleiben. Mir war das egal. Wenn der Sommer vorbei war, fuhr ich sowieso wieder nach Hause.
Barkalds Hof lag auf der anderen Straßenseite, oben am Waldrand, hinter ein paar Feldern, auf denen Barkald abwechselnd Hafer und Gerste säte. Die Scheune stand im Winkel dazu, und im Wald ließ er auf einem weiten Gelände, das er mit Stacheldraht von Baum zu Baum auf zwei Höhen eingezäunt hatte, seine vier Pferde grasen. Ihm gehörte der Wald, und es gab viel davon. Er war der größte Grundbesitzer der Gegend. Wir konnten den Mann nicht ausstehen, ich weiß jedoch nicht genau, warum. Er hatte uns nie etwas getan oder ein unfreundliches Wort zu uns gesagt, nicht daß ich wüßte. Aber er hatte einen großen Hof, und Jon war der Sohn eines Kleinbauern. Fast alle am Flußufer in diesem Tal, nur wenige Kilometer von der Grenze zu Schweden entfernt, waren Kleinbauern, und die meisten lebten noch immer von dem, was sie auf ihren Höfen produzierten, von der Milch, die sie an die Molkerei lieferten, und saisonal als Holzfäller im Wald. In Barkalds Wald, aber auch in dem, der einem reichen Kerl aus Bærum gehörte: Hunderte von Hektar, die sich nach Norden und Westen erstreckten. Geld war nicht viel da, oder ich merkte nichts davon. Vielleicht hatte Barkald welches, aber Jons Vater hatte nichts, und mein Vater hatte überhaupt nichts, zumindest war mir nichts davon bekannt. Woher er das Geld genommen hatte, um die Hütte zu kaufen, in der wir in diesem Sommer wohnten, ist mir noch immer ein Rätsel. Um ehrlich zu sein, war mir nicht immer klar, womit mein Vater seinen Lebensunterhalt verdiente, seinen und unter anderem auch meinen, denn es wechselte häufig, aber immer waren viele Werkzeuge involviert und kleine Maschinen, und manchmal waren viele Planungen und Überlegungen erforderlich, mit dem Bleistift in der Hand, und Reisen zu allen möglichen Orten in Norwegen, an denen ich noch nie gewesen war und von denen ich mir nicht vorstellen konnte, wie sie aussahen, aber er stand auf niemandes Gehaltsliste mehr. Oft gab es viel zu tun, andere Male weniger, aber egal wie, er hatte genug Geld, und als wir im letzten Jahr zum ersten Mal hierherkamen, lief er durch die Gegend, sah sich um, lächelte listig, gab den Bäumen einen freundschaftlichen Klaps, setzte sich auf einen großen Stein am Ufer, das Kinn in die Hand gestützt, und sah über das Wasser, als wären alle Dinge alte Bekannte. Das konnten sie aber doch nicht sein.
Jon und ich nahmen den Pfad über die Wiese und gingen die Straße hinunter, und obwohl wir diesen Weg schon viele Male gegangen waren, war es diesmal anders. Wir wollten Pferde stehlen, und wir wußten, daß das zu sehen war. Wir waren Verbrecher. Das veränderte die Leute, das veränderte ihren Blick und verlieh ihnen eine eigene Gangart, an der man nichts ändern konnte. Und Pferdestehlen war das allerschlimmste. Wir kannten das Gesetz westlich des Pecos, wir hatten Cowboyhefte gelesen, und obwohl man vielleicht behaupten konnte, wir befänden uns östlich des Pecos, war es doch so weit östlich, daß man ebenso gut das Gegenteil behaupten konnte, es kam darauf an, wie man die Welt sehen wollte, und dieses Gesetz war unerbittlich. Wurde man erwischt, ging es direkt an den Baum mit einem Strick um den Hals: grober Hanf auf der weichen Haut, jemand verpaßte dem Pferd einen Schlag auf den Hintern, so daß es unter deinen Beinen verschwand, und du ranntest um dein Leben, mit den Beinen in der Luft, während eben jenes Leben in immer schwächeren Bildern Revue passierte, bis auf den Bildern von dir und allem, was du gesehen hattest, nichts mehr zu erkennen war, nur noch Nebel, und sie schließlich schwarz wurden. Fünfzehn Jahre nur, dachtest du als letztes, das war nicht viel, und das für ein Pferd, und dann war es zu spät. Barkalds Haus stand massiv und grau am Waldrand und wirkte bedrohlicher denn je. Die Fenster waren so früh am Morgen dunkel, aber vielleicht stand er drinnen, schaute zur Straße hinunter, sah, wie wir uns bewegten, und wußte Bescheid.
Doch jetzt gab es kein Zurück mehr. Wir gingen mit ziemlich steifen Schritten ein paar hundert Meter den Schotterweg hinunter, bis das Haus hinter einer Biegung verschwand, dann wieder einen Pfad hinauf, über eine weitere Wiese, die ebenfalls Barkald gehörte, und in den Wald. Zuerst war es dunkel und eng zwischen den Fichtenstämmen ohne jedes Dickicht, nur tiefgrünes Moos auf der Erde in einem großen Teppich, der weich war, denn das Licht drang nie ganz bis hierher, und wir gingen hintereinander auf dem Pfad und spürten, wie es jedesmal nachgab, wenn wir die Füße aufsetzten. Jon zuerst und ich mit abgelaufenen Turnschuhsohlen hinterher, und dann gingen wir nach rechts, schlugen gewissermaßen einen Bogen, und langsam wurde es lichter über uns, bis das Licht in dem doppelten Stacheldraht blinkte, und wir am Ziel waren. Wir sahen ein abgeholztes Waldstück, aus dem alles entfernt worden war außer Zapfenkiefern und Birken, die seltsam groß waren und einsam ohne Rückendeckung dastanden, und einige davon hatten sich gegen den Nordwind nicht behaupten können und waren der Länge nach umgefallen, die Wurzeln in der Luft. Doch zwischen den Baumstümpfen wuchs das Gras saftig und dicht, und hinter ein paar Büschen, ein Stück weiter weg, sahen wir die Pferde stehen, nur die Hinterbacken waren sichtbar, und die Schweife schwangen wegen der Fliegen und Bremsen hin und her. Es roch nach Pferdemist und sumpfigem Moos, und wir atmeten den süßen, kräftigen, alles umfassenden Geruch von etwas ein, das größer war als wir und was wir fassen konnten: von Wald, der nicht mehr aufhörte und ewig weiterging, Richtung Norden, bis nach Schweden und hinüber nach Finnland und weiter bis nach Sibirien, und man konnte sich in diesem Wald verlaufen, und Hundertschaften suchten wochenlang das Gelände ab und hatten keine Chance, einen zu finden, und das war wohl nicht das schlimmste, dachte ich, hier zu verschwinden, doch ich wußte nicht, wie ernst der Gedanke war.
Jon bückte sich und kletterte zwischen den beiden Stacheldrähten hindurch, wobei er den unteren mit der Hand nach unten drückte, wogegen ich mich auf den Boden legte und darunter durchkroch, und beide schafften wir es ohne Risse in Hose oder Pullover. Wir standen vorsichtig auf und gingen durch das Gras auf die Pferde zu.
»Die Birke da vorne«, sagte Jon und zeigte sie mir, »auf die kletterst du drauf.« Nicht weit von den Pferden stand eine große, einsame Birke mit starken Ästen, und der unterste davon hing gut drei Meter über dem Boden. Ich ging langsam, aber ohne zu zögern auf die Birke zu. Die Pferde hoben die Köpfe und sahen zu mir herüber, wie ich dort lief, aber sie blieben stehen, kauten weiter und nahmen nicht einmal einen Huf hoch. Jon lief von der anderen Seite her im Kreis um sie herum. Ich streifte die Turnschuhe ab, umfaßte die Birke mit beiden Händen, fand Halt in der spröden Rinde, stemmte mich mit einem Fuß dagegen, hob dann den anderen, setzte ihn ebenfalls mit der ganzen Sohle gegen den Stamm und kletterte langsam wie ein Affe nach oben, bis ich mit der linken Hand den Ast zu fassen bekam, lehnte mich hinüber, faßte auch mit der rechten danach und ließ die Füße von dem rauhen Stamm gleiten, so daß ich einen Augenblick lang nur noch mit den Händen an dem Ast hing, bevor ich mich nach oben schwang und dort mit baumelnden Beinen sitzen blieb. Das konnte ich damals.
»Okay«, rief ich leise. »Fertig.«
Jon war fast direkt vor den Pferden in die Hocke gegangen und sprach ganz leise mit ihnen. Sie rührten sich nicht, wandten ihm die Köpfe zu, hatten die Ohren aufgestellt und lauschten dem, was fast ein Flüstern war. Ich, der ich auf dem Ast saß, konnte nicht hören, was er sagte, aber nachdem ich mein »okay« gerufen hatte, sprang er plötzlich auf und schrie:
»Ho!«, fuchtelte dabei wild mit den Armen, und die Pferde drehten sich jäh um und trabten los. Nicht sehr schnell, aber auch nicht sehr langsam, zwei rannten nach links, und zwei kamen direkt auf meine Birke zu.
»Sei bereit«, rief Jon und hielt wie zum Pfadfindergruß drei Finger in die Luft.
»Allzeit bereit«, rief ich zurück, drehte mich um, legte mich bäuchlings quer über den Ast, hielt mit den Händen das Gleichgewicht und spreizte die Beine wie eine Schere in der Luft. Ich spürte ein schwaches Beben in der Brust von dem Hufgetrappel auf dem Boden, das durch den Baum ging, und ein Zittern, das ganz woanders herkam, tief aus meinem Innern, es begann im Bauch und ging dann in die Hüften über. Aber ich konnte nichts dagegen tun und dachte nicht weiter darüber nach. Ich war bereit.
Und dann kamen die Pferde. Ich hörte sie keuchen, und das Zittern im Baum wurde stärker, und das Geräusch von Hufen erfüllte meinen Kopf, und sobald ich die Nüstern des einen unter mir sah, rutschte ich vom Ast, die Beine zur Seite gestreckt, ließ los und landete auf dem Pferderücken, etwas zu weit oben auf dem Hals, und die Schulterknochen trafen mich im Schritt und schickten einen Strahl der Übelkeit durch meinen Hals. Es sah so leicht aus im Film, wenn Zorro es machte, aber jetzt flossen die Tränen, und ich mußte mich erbrechen und mich zugleich mit beiden Händen an der Mähne festhalten, und ich beugte mich vor und preßte die Lippen fest zusammen. Das Pferd schüttelte wie wild den Kopf, der Pferderücken traf mich immer wieder hart im Schritt, und es verfiel in gestreckten Galopp, das andere Pferd tat es ihm nach, und zusammen preschten wir zwischen den Baumstümpfen hindurch.
»Juhuu!« hörte ich Jon hinter mir rufen, und ich wollte selbst schreien, triumphierend, aber ich schaffte es nicht, der Hals war so voller Erbrochenem, daß ich nicht atmen konnte, und dann machte ich den Mund auf und ließ es auf den Nacken unter mir rinnen. Jetzt roch es schwach nach Erbrochenem und stark nach Pferd, und ich hörte Jons Stimme nicht mehr. Nur noch ein Rauschen, und die Hufschläge entfernten sich, und der Pferderücken ging durch meinen Körper wie meine eigenen Herzschläge, und dann war ich plötzlich von einer Stille umgeben, die sich auf alles ausdehnte, und in dieser Stille hörte ich die Vögel. Ich hörte deutlich die Schwarzdrossel auf einem Tannenwipfel und ganz klar die Lerche hoch oben und andere Vögel, deren Namen ich nicht wußte, und es war so merkwürdig, es war wie ein Film ohne Ton, über den ein anderer Ton gelegt worden war, ich war an zwei Orten gleichzeitig, und nichts tat mehr weh.
»Juhuu!« schrie ich und konnte meine Stimme gut hören, obwohl es schien, als käme sie von weit her, aus dem großen Raum, in dem die Vögel sangen, ein Vogelschrei aus der Stille, und einen Augenblick lang war ich völlig glücklich. Meine Brust dehnte sich wie der Faltbalg einer Ziehharmonika, und bei jedem Atemzug gab sie Töne von sich. Und dann glitzerte es zwischen den Bäumen vor mir, es war der Stacheldraht, wir waren quer über die Koppel galoppiert und näherten uns in hohem Tempo dem Zaun auf der anderen Seite, und der Pferderücken traf mich hart im Schritt, und ich klammerte mich fest und dachte: Jetzt springen wir. Aber wir sprangen nicht. Direkt vor dem Stacheldraht machten beide Pferde abrupt kehrt, und physikalische Gesetze rissen mich vom Pferderücken und schickten mich zappelnd weiter, geradeaus durch die Luft, bis kurz hinter den Zaun. Ich spürte, wie der Stacheldraht den einen Ärmel aufriß, spürte einen stechenden Schmerz, und dann lag ich im Heidekraut und mit einem Schlag wich alle Luft aus meinem Körper.
Ich glaube, ich war für einige Sekunden weg, denn ich weiß noch, daß ich die Augen aufschlug wie zu einem Neubeginn: Nichts von dem, was ich sah, war mir vertraut, das Gehirn war leer, keine Gedanken, alles rein und der Himmel durchscheinend blau, und ich wußte nicht, wie ich hieß, und konnte nicht einmal meinen Körper spüren. Ich schwebte namenlos durch die Luft und sah die Welt zum ersten Mal und fand sie seltsam erleuchtet und gläsern schön, und dann hörte ich ein Wiehern und Hufgetrappel, und alles kam auf einmal zurück wie ein schwirrender Bumerang und traf mich an der Stirn, und ich dachte, verflucht, ich bin gelähmt. Ich sah auf meine nackten Füße, die aus dem Heidekraut aufragten, und zwischen ihnen und mir bestand keinerlei Verbindung.