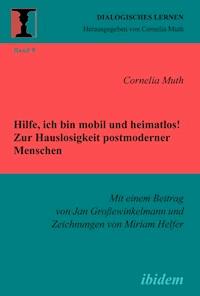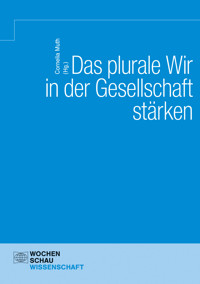16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Bildung
- Serie: Body-Feeling und Body-Bildung
- Sprache: Deutsch
Praxisentwicklungsforschung ist unbequem. Sie entzieht sich dem neoliberalen Warencharakter der Wissenschaften. Im phänomenologischen Modus ist ihr Geschehen „auf die wirkende Wirklichkeit des Jetzt und Hier“ (Martin Buber) fokussiert. Die zu spürende Kraft wächst aus der dialogischen Beziehung. An ihr kann und muss ich als Mensch unmittelbar teilnehmen, will ich sie erleben. Der entstehende Prozess ist dabei methodologisch unverfügbar. In dieser Paradoxie stehen phänomenologische Praxisentwicklungsforscher*innen: Sie beforschen Praxis, ohne diese kontrollieren zu können, oder anders: Sie begegnen Praktiker*innen auf Augenhöhe und werden somit auch Objekt wie Subjekt der Forschung. Sie verschriftlichen ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse und spüren, wie erlebte Wirklichkeit mit Worten nicht einzufangen ist. So stellt auch das Bild auf der Titelseite des vorliegenden Bandes einen Versuch dar, die komplexe Beziehungswirklichkeit mit ihren vielfältigen Zwischen-Räumen als kreative Verwurzelung darzustellen. Und doch gewinnen die Praxisentwicklungsforscher*innen eine „erneute Beziehung zur Wirklichkeit“ (Buber). Als intentionales Bewusstsein geschieht dieser Vorgang in unserem „persönlichen Dasein“ absichtslos: „Das Dasein ist nicht auf diese Wirkung gerichtet, es ist nur eben, wie es ist, und darum wirkt es, was es wirkt“ (Buber). Hervordringen können dann wahrzunehmende Wahrheit und echtes Vertrauen als Ausdruck einer dialogischen Zwischenmenschlichkeit. Auf dieses Zwischen vertraut Praxisentwicklungsforschung und gibt den teilnehmenden Menschen Raum, die Verantwortung für den eigenen Lebensweg bewusster wahrzunehmen. Der vorliegende Band zeigt Wege auf, den konzeptionellen Zugang zum Verfahren der Praxisentwicklungsforschung zu erleichtern, und konkretisiert die Anwendung durch zwei Beispiele aus der dialogorientierten Erlebnispädagogik für Kindertageseinrichtungen sowie durch eine Evaluation Dialogischer Lehre an der Hochschule.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Vorwort
Insbesondere Reinhard Fuhr (Universität Göttingen) hat das Verfahren der Praxisentwicklungsforschung Ende des letzten Jahrhunderts entwickelt. Sein zu früher Tod hat die Weiterarbeit an der Methodologie gestoppt. Der vorliegende zweite Band zur Praxisentwicklungsforschung gibt eine Kurzdefinition, beinhaltet die wissenschaftstheoretischen Grundlagen der Konzeption und zeigt zwei Anwendungsbeispiele.
Die praktische Lehr-Evaluation fand auch im Rahmen meiner Seminare zur qualitativen Sozialforschung an der Fachhochschule Bielefeld statt. Sehr dankbar bin ich den damaligen Studentinnen Mareike Rosteck, Liska Sehnert und Oxana Wottschel für ihr außergewöhnliches Engagement, aber auch den namentlich unerfassten Seminarteilnehmer*innen.
Eine besondere Anerkennung möchte ich den studentischen Mitarbeiterinnen aussprechen: Zahide Gök, Isabell Harstick – sie hat auch Impulse für mein Manuskript gegeben –, Elisa Langsenkamp und Ines Wagner. Sie haben die Protokolle der Forschungsgespräche erstellt.
Schließlich bin ich auch der Präsidentin unserer Hochschule und dem Dekan unseres Fachbereichs dankbar. Ohne die Zusage eines Forschungssemesters wäre der zweite Band nicht erschienen.
Last but not least gilt mein größter Dank Frau Valerie Lange, der Lektorin dieses Werkes.
Für die Herausgeberinnen
Cornelia Muth, Sommer 2019
Inhalt
Phänomenologische Praxisforschung
Dialogische Gestaltberatung im Kontext von Sozialer Arbeit. Eine phänomenologische Annäherung
Elisa Langsenkamp
Hinführung: Zur phänomenologischen Arbeitsweise
1 Einleitung
2 Zum theoretischen Zusammenhang von Gestalt und Dialog: Menschenbild(er)
3 Einstellung der Lebenswelt: Verortung von (Gestalt)Beratung in der Sozialen Arbeit
4 Phänomenologische Einstellung: Das Geschehen zwischen beratender und ratsuchender Person in dialogischer Gestaltberatung
5 Transzendentale Subjektivität: Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem zwischenmenschlichen Beratungsgeschehen über die Beratungssituation hinaus?
Resümee und Ausblick
Zur Konzeptionalisierung einer dialogorientierten Erlebnispädagogik für Kindertageseinrichtungen
Julia Brockmeyer
1 Einleitung
2 Grundlagen der Praxisentwicklungsforschung
3 Praxisentwicklungsforschung Teil I. Von der Praxis zur Theorie
4 Praxisentwicklungsforschung Teil II.Von der Theorie zur Praxis
5 Prozessreflexion
Praxisentwicklungsforschung als Lehr-Evaluation
1 Zum Gewahrsein von Anfängen und Schlusssituationen
Zahide Gök
2 Bewusstseinsprozesse von Studierenden in Projektseminaren am Fachbereich Sozialwesen der Fachhochschule Bielefeld
2.1 Eine forschungskennzeichnende Einleitung
2.2 Was bedeutet Lehr-Evaluation?
2.3 Zum Verfahren Praxisentwicklungsforschung
2.4 Zur Ausgangssituation der Forscherin
2.5 Eine Dialog-Phänomenologin in Aktion
2.6 Epistemischer Exkurs
2.7 ... die Ambivalenz der Forscherin, mein Handeln in der heiligen Unsicherheit
2.8 Die Forschungsergebnisse nach der Objektiven Hermeneutik
2.9 Phänomenologisches Fazit
Phänomenologische Praxisforschung
Bei der phänomenologischen Praxisforschung oder auch Praxisentwicklungsforschung, kurz PEF, handelt es sich um ein qualitatives Forschungsverfahren, in welchem sich Theorie und Praxis in einem wechselseitigen Prozess bewegen und der/die Forscher*in neue Erkenntnisse sowohl für das eine als auch für das andere entwickeln kann. Methodologisch orientiert sich die Praxisentwicklungsforschung an der Phänomenologie. Die forschende Person bezieht sich und sein „Zur-Welt-Sein“ also bewusst mit in die Untersuchung ein (vgl. Muth 2010 und 2014). Das Verfahren geht auf den Gestalttherapeuten und Pädagogen Reinhard Fuhr zurück. Er hat es in Zusammenarbeit mit dem Erziehungswissenschaftler Heinrich Dauber im Jahr 2002 erstmalig veröffentlicht. Es wird vornehmlich im pädagogischen Bereich eingesetzt.
Intentionen der PEF
Wie die Wortzusammensetzung bereits zeigt, möchte PEF Forschung, praktisches Handeln und persönlich bedeutsames Lernen miteinander verbinden. Aufgabe ist somit nicht nur die Gestaltung alltäglicher pädagogischer Praxis, sondern vielmehr die Entwicklung einer neuen Praxis. Dadurch, dass die Forschenden sich mit ihrer ganzen Person, im Erleben und Denken, auf den Prozess einlassen und sich mit diesem multiperspektivisch auseinandersetzen, geschieht eine Verknüpfung von Praxisgestaltung, Innovation und Erkenntnis. (s. ausführlich Fuhr/Dauber 2002, 77ff. und Matt-Windel/Muth/Peter 2013, 45f.)
Vorgehensweise
PEF ist ein komplexes Verfahren, welches durch sein rekursives sowie induktives Vorgehen Ganzheitlichkeit anstrebt. Aufgrund der phänomenologischen Vorgehensweise legt es dabei besonderen Wert auf die Bewusstheit der Prozesse. Das ist durch bewusstes Gewahrsein möglich. Fuhr (2002, 82ff.) hat als Rahmen für die teils schwierig zu bewältigenden Vorgänge ein Orientierungsmodell entwickelt, welches aus acht Elementen besteht und dem Forscher als Leitfaden dienen kann. Diese lauten wie folgt:
Aufgabenstellung und Vorgehensweise (Projektauftrag)
Kontextbeschreibung und -analyse
Theoretische Grundlagen
Pädagogisch-didaktische Prinzipien
Anregungsmodelle/-konzepte
Eigenes Praxiskonzept
Planung, Durchführung und Auswertung der Praxis
Fazit, Prozessreflexion und Perspektiven (s. Fuhr/Dauber 2002, 82)
Um die Dokumentation und Wissenschaftlichkeit sicherzustellen, ist es erforderlich, dass alle acht Elemente von der forschenden Person berücksichtigt werden (vgl. Fuhr/Dauber 2002, 101). Auch müssen beide in einem Sinnzusammenhang bearbeitet werden, sodass das Verfahren für Außenstehende verstehbar nachzuvollziehen ist. Im gesamten Verlauf wird ebendieser nicht nur reflektiert und evaluiert und in hermeneutischer Weise überprüft, sondern ebenso reflektiert der Forscher sich selbst, seine Vorgehensweise sowie seine Vorannahmen. Es ist dabei hilfreich und notwendig, dass der Forscher durch einen oder mehrere Begleiter, beispielsweise in Form von Supervision, professionell unterstützt wird (vgl. Fuhr/Dauber 2002, 101f.). Gerade in diesem Aspekt wird das Dialogische, hier im expliziten Sinn, und dadurch multiperspektivische Prinzip der Praxisentwicklungsforschung deutlich.
Eine besondere Bedeutung kommen in dem Orientierungsmodell den pädagogisch-didaktischen Prinzipien zu, welche Fuhr auch als „Ethos“ (2002, 90) bezeichnet. Sie fungieren als Scharnier zwischen praxisnahen Überlegungen und deren theoretischen Fundierungen.
Erträge und Bedeutung der PEF
Die Forschenden verstehen sich in einer relationistischen Haltung zur wissenschaftlichen Wahrheitssuche, also in der Rolle eines Lernenden (vgl. Matt-Windel/Muth/Peter 2013, 50). Mit dieser Perspektive werden auch die Ergebnisse eines Projekts im Rahmen der Praxisentwicklungsforschung gesehen. Erkenntnisse ergeben sich aus dem prozessorientierten Vorgehen; der Forscher ordnet sich also nicht der Frage unter „Was sollte ich wissen?“, sondern fragt „Was habe ich gelernt?“.
Indem die Prozesse in der Praxisentwicklung sowie Forschung offen gelegt werden, also intersubjektiv erfassbar, und – durch qualitative und/oder quantitative Methoden – evaluiert werden, kann die PEF ein Stück weit Objektivität und dadurch Wissenschaft ermöglichen; jedoch bleibt der Forscher sich immer seiner restlichen Unwissenheit und damit Offenheit bewusst (vgl. Fuhr/Dauber 2002, 104f.). PEF versteht sich also als eine Möglichkeit, einen Teilbereich der vielschichtigen Wirklichkeit durch Multiperspektivität und Lebensweltbezug zu erfassen und verstehbar zu machen (vgl. Muth 2014). Gerade in diesem Zusammenhang kann sie wie Aktionsforschung (vgl. Moser 2008) als Wissenschaftsberatung dienen, um Praxis weiterzuentwickeln.
Konkrete Erträge sind nach Fuhr (2002, 103) zum einen die neu gewonnenen Erkenntnisse und das teils neu entwickelte Praxiskonzept, welches nachfolgenden Praktiker*innen und Forscher*innen als Anregungsmodell dienen kann. Zum anderen ergeben sich neue Fragen, welche wiederum zu einer neuen Theorieentwicklung führen können. Als letzter wichtiger Ertrag besteht der persönliche Lernprozess für den/die Praxisentwicklungsforscher*in.
Literatur
Fuhr, Reinhard, Dauber, Heinrich (Hrsg.) (2002): Praxisentwicklungsforschung im Bildungsbereich – ein integraler Forschungsansatz. Julius Klinkhardt: Rieden.
Matt-Windel, Susanna, Muth, Cornelia, Peter, Sabine (2013): Dialogische Pädagogik in Lehre und Forschung – dargestellt am Dante-Projekt zur Gewaltprävention an der Fachhochschule Bielefeld/D. In: Heimgartner, Arno, Lauermann, Karin, Sting, Stefan (Hrsg.): Soziale Arbeit – Social Issues. Perspektiven der AkteurInnen in der Sozialen Arbeit. Bd. 17. LIT-Verlag: Wien, S. 43–53.
Moser, Heinz (2008): Aktionsforschung unter dem Dach der Praxisforschung: Methodologische Herausforderungen und Lösungsansätze. In: Unger von, H., Wright, T. W. (Hrsg.): „An der Schnittstelle von Wissenschaft und Praxis“ – Dokumentation einer Tagung zu partizipativer Forschung in Public Health. WZB-Forschungsdokumentation: Berlin, S. 58–66.
Muth, Cornelia (Hrsg.) (2014): Ein Wegweiser zur dialogischen Haltung. Dialogische Praxisforschung in Arbeitsfeldern von Sozialer Arbeit und Pädagogik der Kindheit. ibidem: Stuttgart.
Muth, Cornelia (2013): Interkulturelles Lernen und Forschen in transkulturellen Dialoggruppen. In: Spetsmann-Kunkel, Martin, Frieters-Reermann, Norbert (Hrsg.): Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft. Verlag Barbara Budrich: Leverkusen, S. 55–63.
Muth, Cornelia (2012): Phänomenologische Praxisentwicklungsforschung I. Reihe Body-Feeling und Body-Bildung. Band 4. ibidem: Stuttgart.
Muth, Cornelia (2010): Intersubjektives Forschen auf Dantes Spuren. In: Muth, Cornelia, Nauerth, Annette (Hrsg.): Vertrauen gegen Aggression. Das dialogische Prinzip als Mittel der Gewaltprävention. Wochenschau-Verlag: Schwalbach am Taunus, S. 27–57.
Weblinks:
http://www.corneliamuth.de
http://www.heinrichdauber.de
https://www.matt-windel.de
Dialogische Gestaltberatung im Kontext von Sozialer Arbeit. Eine phänomenologische Annäherung
Elisa Langsenkamp
Hinführung: Zur phänomenologischen Arbeitsweise
„Die Ganzheit der Person und durch sie die Ganzheit des Menschen erkennen kann er [der philosophische Anthropologe] erst dann, wenn er seine Subjektivität nicht draußen läßt und nicht unberührter Betrachter bleibt“ (Buber 1942 zit. nach Reichert 1996, 19).
Die Phänomenologie habe ich als tragende Denk- und Schreibweise für diese Arbeit gewählt, da sie mir zum einen erlaubt, mich als Autorin in Ich-Perspektive miteinzubringen sowie meinen Erkenntnisprozess mit Lesern und Leserinnen auf diese Weise anschaulich zu teilen (vgl. zusammenfassend Zahavi 2007, 17–21). Zum anderen erscheint sie mir die klügste und authentischste Weise, das Thema „dialogische Gestaltberatung“ in Worte zu fassen; beides – die Dialogphilosophie und der Gestalt-Ansatz – sind wissenschaftlich und von der Idee her mit der Phänomenologie verwoben, was sich im Laufe dieser Studie zeigen wird.
Was bedeutet es genau, einen phänomenologischen Schreibstil zu wählen? Zu Beginn sei gesagt: „‚Die‘ Phänomenologie gibt es nicht“ (Matt-Windel 2014b, 32). Die „Phänomenologie im strengen Sinn“ (Danner 2006, 135) wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von Edmund Husserl (1859–1938) entwickelt, welcher unter der Prämisse „Zu den Sachen selbst“ (ebd., 132) ein neues Fundament für alle Wissenschaften zu begründen intendierte. Seither wurde und wird sie in verschiedene Richtungen weiterentwickelt, verändert, prägt das geisteswissenschaftliche Denken und wurde auch für die Sozialwissenschaften als Methode fruchtbar gemacht1. Grundlegend – wie sie auch weiter ausgelegt sein mag – ist ihre Denkweise: Mensch und Welt hängen unumkehrbar miteinander zusammen; Welt bedingt Mensch-Sein, und nur durch Mensch-Sein und seinem Verhältnis zur Welt lässt sich diese verstehen (vgl. Buber 1942 zit. nach Reichert 1996, 19). Sie untersucht mittels bewusster Wahrnehmung Gegenstände auf dem Hintergrund und dem Weltbild des „Zusammenhang[s] zwischen Subjektivität und Welt“ (Zahavi 2007, 19f.) und ist sich diesem in jeder Forschung gewahr. Phänomenologie verläuft demnach zuwider der traditionellen, rein rationalistischen Auffassung von Wissenschaft, welche von einer klaren Objekt-Subjekt-Trennung und zumeist auch Geist-Körper-Seele-Spaltung ausgeht und dies folglich von der forschenden Person verlangt (vgl. Danner 2006, 134f.). Hingegen weiß die phänomenologisch forschende Person, dass sie zum Großteil die Bedingungen des Forschungskontextes konstituiert und zieht ihre Wahrnehmung demgemäß mit in Betracht – um sich überhaupt den subjektiven Einflüssen bewusst werden und sich ein Stück weit von ihnen frei machen zu können. Phänomenologisch ausgedrückt: Die Eingebundenheit meines Selbst als Forscherin ist bedingt durch Intentionalität, meine Wahrnehmung ist auf etwas, hier den Gegenstand „dialogische Gestaltberatung“, ausgerichtet2.
Phänomenologie als wissenschaftliche Methode angewandt bedeutet ein theoretisches Arbeiten in Praxis, darauf will ich mich einlassen. Ich weiß darum, dass ein Gegenstand immer „von jemandem beobachtet und erkannt“ (Matt-Windel 2014a, 96)wird, d.h., ich schreibe diese Arbeit „im Wissen um nachzeitiges und unvollständiges Beschreiben“ (ebd., 96) und mit der Erkenntnis, dass diese selbst immer ein Geschehen darstellt, dass wenn ich recherchiere, lese, schreibe mein Denken schon wieder zu Gedachtem wird und ich mit Neuem konfrontiert bin. Ichschreibe über dialogische Gestaltberatung, also auf theoretisch-abstrakter Ebene, welche in der Praxis von dem tatsächlichen Zusammenkommen zweier leibhaftiger Menschen lebt und konstituiert wird. Ein dreidimensionales Geschehen wird also auf etwas Zweidimensionales reduziert, um es beschreibbar zu machen.
Die Auffassung, auch das Verfassen einer theoretischen Studie als Forschung zu verstehen, bringt für mich Gründlichkeit und Offenheit mit sich – und die Nähe zum dialogischen und gestalterischen Denken und Tun: Meine Schreibweise ist auch bedeutsam für den Inhalt, über den ich schreibe. Klarer nachzuvollziehen wird dies in Kapitel 2.
Eines wird schon jetzt erkenntlich: Phänomenologisch arbeiten bedeutet immer eine Forschung in prozesshafter Suchbewegung, auf der ich Erkenntnisse machen und Antworten finden, aber besonders und stetig noch Fragen um Fragen in der Weite und Tiefe begegnen, fragen und erörtern kann.
Ich gehe nun zu einer Einleitung zum inhaltlichen Vorgehen über.
1 Einleitung
Soziale Arbeit in der Praxis bedeutet immer eine Arbeit mit und am Menschen. Sie will Erziehung, Bildung, politische Weichenstellungen und vor allem Hilfe und Unterstützung für sozial benachteiligte Menschen leisten. Ihre Handlungsfelder sind demnach von Vielfalt geprägt. Ihr wichtigstes Medium ist die Kommunikation, meist das Gespräch. In dieser Arbeit will ich das Handlungsfeld dialogische Gestaltberatung in ihren Hauptmerkmalen ergründen. Dialog und Gestalt ergeben ein Gefüge, das eine „Querfront“ (Muth/Nauerth 2008, 25) zum heutigen an Ökonomik, und damit Materialismus und Schnelllebigkeit, ausgerichteten Zeitgeist bildet. Beide Theoreme pointieren den Menschen mit seinen Entwicklungsmöglichkeiten von (geistiger) Reife, Menschlichkeit, Selbstkenntnis und Verantwortung. Das erfordert Zeit wie Muße und hat im besten Fall wenig mit Dinghaftem und Effizienz zu tun. Nach Martin Buber führt ein auf Dingen und Machbarkeit fokussierter Lebensstil zur Entfremdung des Menschen von sich selbst, seiner originären Lebendigkeit, zwischenmenschlicher Zugewandheit und Potenzialität (vgl. u.a. Buber 2009; Reichert 1993). Dialogische Gestaltberatung arbeitet auf Grundlage dieser humanistisch ausgerichteten Werte und bietet damit einen Weg, Menschen in ihrer Existenz in das Zentrum helfender Arbeit zu rücken: In der dialogischen Gestaltberatung steht das Gespräch zwischen Professionellem/Professioneller und ratsuchendem Menschen im Mittelpunkt des Geschehens. Sie möchte einen Raum der Zwischenmenschlichkeit ermöglichen, in welchem der ratsuchende Mensch sich durch Kontakt mit der beratenden Person (wieder) nahe kommen kann und sich selbst – durch das Sich-nah-Sein – zu helfen vermag.
Diese Studie behandelt die Fragen, wie dieser Raum aussehen kann, was er braucht, um zustande zu kommen, und welche Chancen er birgt. Ich werde dafür ‚zwiebelförmig‘, angelehnt an Husserls methodologischem Vierschritt, vorgehen (vgl. Danner 2006, 142ff.):
Dafür werde ich zunächst die anthropologischen Grundannahmen erläutern. Es ist bedeutsam, sie offenzulegen, wenn von Hilfe am Menschen gesprochen wird, denn das Verständnis vom Menschen(bild) ist das Apriori für das Verständnis von Hilfe an ihm.
Im darauffolgenden Kapitel (3) blicke ich weniger aus theoretischer denn aus praxisorientierter Perspektive, der „natürliche[n] Einstellung“ (Danner 2006, 142), auf den Gegenstand. Ausgehend von Beratung als generellem Handlungsfeld in Sozialer Arbeit werde ich dialogische Gestaltberatung näher definieren, um ihren wesentlichen Merkmalen näher zu kommen.
In Kapitel 4 gelange ich zum Kernstück dieser Arbeit, ich vollziehe die „Wesensschau“ (Danner 2006, 142) des Gegenstandes:
Ich beschreibe die vielfältigen, wesentlichen Aspekte des zwischenmenschlichen Raumes in der Beratungssituation. Es geht darum, was sich im Gespräch zwischen beratendem und ratsuchendem Menschen ereignen kann und welche Elemente aus Gestalt und Dialog dafür gegeben sein müssen.
Daraufhin reflektiere ich meinen bis dahin erarbeiteten Wissensstand und ziehe Konsequenzen für eine beratende Person in dialogischer Gestaltberatung. Ich überlege überdies, welche (Denk)Möglichkeiten dieser Beratungsansatz für eine sozialkritische Soziale Arbeit offerieren könnte. Abschließen möchte ich mit einem kurzen Resümee, in welchem ich zentrale Erkenntnisse und die Bedeutung der Inhalte dieser Arbeit für mich als angehende Sozialarbeiterin offenlege.
Es sei darauf hingewiesen, dass ich die Ausdrucke ‚dialogische Gestaltberatung‘ und ‚Gestaltberatung‘ größtenteils synonym verwende.
Um alle Geschlechter neben Mann und Frau gleichermaßen zu berücksichtigen, verwende ich die Schreibform des Gender-Sternchens, außer in Zitaten, um deren Sinn nicht zu verfälschen.
2 Zum theoretischen Zusammenhang von Gestalt und Dialog: Menschenbild(er)
Angelehnt an den Schritt der „theoretischen Welt“ (Danner 2006, 142) der phänomenologischen Methode dient dieses Kapitel dazu, die „Landkarte“ (Fuhr/Gremmler-Fuhr 2002, 58) zu beschreiben, von welcher ich dialogische Gestaltberatung aus betrachte und von welcher diese wiederum Mensch und Welt sieht. Menschenbilder stehen im engen Zusammenhang zu sozialphilosophischen Fragen – also zu Inhalten, die ergründen wollen, was den Menschen ausmacht, wie er Wirklichkeit versteht, was diese überhaupt ist und wie Menschen ihr Zusammenleben (gerecht) gestalten können. Wie kann der Mensch Sinn in seinem Leben erfahren? Inwiefern kann eine Person die Wirklichkeit eines anderen Menschen nachvollziehen? Wann gilt er als gesund, wann als krank? Es sind Fragen, die auch im Hintergrund von helferischer Praxis eine Rolle spielen.
„Die Antworten, die wir uns auf diese Frage geben […], bestimmen unsere Haltungen und Handlungen in der Beziehung zu unseren PatientInnen/KlientInnen und die Sprache, in der wir mit ihnen und über sie reden […]“ (Nausner 1999, 464).
Aus diesem Grund und um diesen Beratungsansatz in seiner Fülle nachvollziehbar machen zu können, stelle ich mir ähnlichen Fragen hinsichtlich des Gegenstandes. Wie versteht dialogische Gestaltberatung den Menschen, ihn in seinem Verhältnis zur Welt und wie Menschen in ihrem Zusammensein? Auf welche Theorien beruft sie sich dabei? Um diesen Aspekten nachzugehen, möchte ich die anthropologischen Grundannahmen von dialogischer Gestaltberatung in ihren Grundzügen erarbeiten. Beginnen werde ich erneut mit der Phänomenologie, mit Fokus auf ihrer Denkweise und dem daraus resultierenden Menschenbild. Dies wird auch hilfreich sein, um den Duktus dieser Arbeit besser nachvollziehen zu können. Danach gehe ich auf die Hauptwurzeln von Dialog und Gestalt ein.
Ich möchte darauf hinweisen, dass alle drei Theorien miteinander verwoben sind: So schreiben dialogische Denker*innen häufig in phänomenologischer Schreibweise (vgl. u.a. Schriften von C. Muth, S. Matt-Windel, D. Bohm und M. Buber selbst), viele Phänomenolog*innen gehen ähnlich des Gestalt- und dialogischen Denkens von einem ganzheitlichen Menschenbild aus, und Vertreter*innen des Gestalt-Ansatzes, geschichtlich die jüngste Theorie, beziehen sich in ihren Ausführungen auf beide Philosophien. Ich werde diesen drei Theorien in ihrer Vielfalt, Tiefe und Bandbreite nicht gerecht werden können, doch möchte ich die Aspekte erörtern und zusammenzuführen, die ich als Grundlage von dialogischer Gestaltberatung im Kontext von Sozialer Arbeit für wesentlich erachte.
2.1 Phänomenologische Grundannahmen
Die Inhalte zur Phänomenologie gliedere ich in zwei Abschnitte. Im ersten beleuchte ich vornehmlich die phänomenologische Methode Husserls, welche die Vielfältigkeit menschlicher Bewusstseinstätigkeit auszudrücken vermag und damit auch eine maßgebliche Rolle in Gestalt-Arbeit darstellt. Er dient zudem der Klärung meines methodologischen Vorgehens.
Im zweiten Teil gehe ich anhand der Überlegungen von Maurice Merleau-Ponty näher auf die anthropologischen Grundzüge ein.
2.1.1 Wissenschaftlicher Erkenntnisvorgang
„Phänomenologie ist, wenn man so will, eine endlose Meditation […][,]eine unaufhörliche Bewegung“ (Zahavi 2007, 42 mit Zitaten von Merleau-Ponty).
Wie zu Beginn meiner Arbeit angeklungen, gelingt mit der Phänomenologie hinsichtlich des Wissenschaftsverständnisses eine Verschmelzung von Erkenntnistheorie und Ontologie. In Dan Zahavis (2007) Worten passend ausgedrückt:
„Die Welt erscheint, und die Struktur ihrer Erscheinung ist bedingt und ermöglicht vom Subjekt, das sich seinerseits jedoch nur in seinem Verhältnis zur Welt verstehen lässt“ (ebd., 20).
Es wird von einer gegebenen Welt ausgegangen, doch kann sie in ihren Erscheinungen nur vom Subjekt, vom Menschen, erkannt werden, welcher wiederum sein Dasein nur durch die Welt erhält.
Nach dem Begründer Edmund Husserl geht es ihr darum, das Wesen der Dinge zu erfassen, wie es jedem Einzelnen von uns gegeben ist, gereinigt von Vorurteilen und Interpretationen. Das Wie geschieht dabei durch selbst-reflexive Wahrnehmung, Anschauung und Reflexion der Bewusstseinsakte anhand der vorgegebenen Reduktionen.
Husserl hat entlang dieser Enthaltungen vier methodische Schritte entwickelt, welche bei Durchleben zur transzendentalen Subjektivität führen, auf welcher Ebene „Welt konstituiert [wird]“ (Danner 2006, 152).
Die erste Ebene ist die der theoretischen Einstellung, welche sich als die durch allgemeingültige Regeln, Traditionen und Sichtweisen konstruierte Welt verstehen lässt. Bezogen auf diese Arbeit stelle ich gerade das abstrahierte, „unnatürliche“ (Danner 2006, 144), da rein modellhafte Abbild der Weltanschauung dialogischer Gestaltberatung vor.
Es folgt die erste „Epoché“ (ebd., 142) zur natürlichen Einstellung. Diese meint unsere persönliche, spontane Wahrnehmung der Welt. In ihr konstituiert Mensch seine Lebenswelt. Nach Merleau-Ponty können Menschen sich aufgrund ihrer „Leiblichkeit“ (ebd., 153) nie gänzlich von ihr lösen. Folglich bin auch ich als Forschende immer in ihr verhaftet, da ich aus meinem „Leib“ (Nausner 1999, 478) nicht entfliehen kann, nur er ermöglicht es mir zu denken, zu lesen und zu schreiben. Die Erste-Personen-Perspektive macht mein Denken aus ebendiesem „Sinnesfundament“ (Danner 2006, 153) transparent. Weiter im Text werde ich näher auf die Bedeutung der ‚Leiblichkeit‘ eingehen.
Im nächsten Schritt wird die forschende Person unbeteiligte Beobachterin ihrer selbst, sie begibt sich durch die Enthaltung ihres gewöhnlichen In-der-Welt-Seins auf die Ebene der „phänomenologischen Einstellung“ (ebd., 146). Husserl nennt dies phänomenologische Reduktion. Dabei bleibt das natürliche Ich ganz aktiv und wird zugleich vom Selbst in seinen Denkprozessen und seinem Erfahren durch Anschauung erfasst. Auf dieser Bewusstseinsebene kann der forschende Mensch als nächstes eine Eingrenzung des Gegenstandes vornehmen: In der „eidetische[n] Reduktion“ (Danner 2006, 138) wird durch die Wahrnehmung der vielfältigen Arten, in dem das Phänomen sich zeigt, das Beständige, Invariante erkannt: Der/die Beobachter*in gelangt zur Wesensschau. So werde ich versuchen, in Kapitel 3 ‚das, was wirklich geschieht‘, in diesem Fall die – möglichst dialogische – Interaktion zwischen Gestaltberater*in und Mandant*in5 zu beschreiben.
Schließlich folgt die letzte Stufe: Die forschende Person erreicht die „transzendentale Subjektivität“ (Danner 2006, 151). Sie erkennt, wie die Welt sich aus ihr erschafft, und umgekehrt, wie sie aus der Welt schöpft. Sie kann erfahren, „was die Welt im Innersten zusammenhält“ (Danner 2006, 151). Von dieser Bewusstseins- und Seins-Ebene ausgehend erklärt sich nun, dass Husserl mit der Phänomenologie die Basis für wissenschaftliches Denken etablieren wollte, denn die letzte Stufe wirkt wieder auf die erste Stufe, wie Welt gemeinhin gesehen wird, zurück. In dieser Arbeit möchte ich somit in Kapitel 5 eine Reflexion der bis dahin gemachten Überlegungen vornehmen und Bezüge zum heutigen Zeitgeist herstellen.
2.1.2 Anthropologisches Verständnis
Mit dem französischen Philosophen Maurice Merleau-Ponty (1908–1961) erhält die Phänomenologie eine Ausrichtung, die mich einer Antwort auf die Frage ‚Was ist der Mensch‘ auf einem weniger abstrakten Niveau näher bringt. Ging Husserl von der Möglichkeit einer reinen Erkenntnis von Welt aus – obgleich der Verbindung des intentionalen Bewusstseins zu ihr –, setzt Merleau-Ponty die Lebenswelt als „Sinnesfundament“ (Danner 2006, 154) für jegliche Wissenschaft in das Zentrum seiner Philosophie. Das sinnliche Erfahren des Menschen geht seinem Bewusstsein voraus: Merleau-Ponty kehrt den maßgeblichen philosophischen Leitsatz ‚cogito ergo sum‘ (lat. ‚ich denke, also bin ich‘) in ‚sum ergo cogito‘ um, was bedeutet, dass „[d]ie Weise meiner Existenz [mein Denken bestimmt]“ (Danner 2006, 154). Was kann ich nun unter Existenz verstehen? Dafür möchte ich auf den Begriff der ‚Leiblichkeit‘ eingehen:
Der Ausdruck ‚Leib‘ akzentuiert, dass der Mensch immer – und nach Merleau-Ponty zuerst – auch Körper ist, durch den er seine Existenz, sein Dasein, erhält6. Der menschliche Leib fungiert als Sinnesorgan, durch den jede*r Welt erfährt; sein*ihr sinnliches Wahrnehmen ist sein*ihr Zugang und Kontakt zur Welt. Somit ist ein Mensch, der Erkenntnisse erlangt, immer im Vollzug des Erfahrens, das nicht von reinem Bewusstsein geleitet ist. Folglich kann Wissenschaft nie gänzlich rein, absolut oder objektiv sein, da ihre Grundlage – die Erfahrung entsprungen in der Lebenswelt – ein Apriori ist und nicht durch sie geschaffen werden kann. Sein Leib verleiht dem Menschen die Möglichkeiten und Grenzen seines Erlebens, er ist durch ihn orts- und zeitgebunden; er erinnert ihn auch an seine Endlichkeit7. Der menschliche Leib ist stetig in Kommunikation mit und gleichzeitig selbst in der Welt verankert. Demnach sei und bleibe diese undurchdringbar, da jede*r durch sein*ihr Leib-Sein mit ihr verwachsen sei: „[J]a, Leib und Welt sind aus einem ‚Stoff‘: Fleisch“ (Nausner 1999, 479). In diesen Aspekten lässt sich die Nähe der Phänomenologie zum Existenzialismus entdecken:
Mensch wird nicht bloß als ein Wesen der Vernunft – welche seit der Zeit der Aufklärung und der Philosophie Immanuel Kants maßgeblich (wissenschaftliches) Denken bestimmte (vgl. Höll 2014, 58f.) –, sondern vielmehr als eine Existenz in seiner Leiblichkeit verstanden (vgl. u.a. Blankertz/Doubrawa 2005, 62f.).
Was kann ich aus diesem Wissenschaftsverständnis und Menschenbild schlussfolgern? Auf wissenschaftstheoretischer Ebene finde ich nochmals die Bestätigung und Betonung, dass es beim Beschreiben und Diskutieren von Gegenständen der Ersten-Personen-Perspektive bedarf, um das Verständnis der Untrennbarkeit von Welt und Subjekt nicht zu unterlaufen. Merleau-Ponty bringt mir die Lebendigkeit auch von wissenschaftlichen Arbeiten nahe: Alles, auch Erkenntnis, ist durch mein Erfahren gegeben, bedingt durch meine vom Leib ermöglichte und ausgehende Wahrnehmung. Worte erfassen meist nur die kognitive Dimension. Trotz der Differenz zu Husserls Sicht, der den Fokus auf die geistige Denktätigkeit setzt und die seelisch-körperliche Dimension weitestgehend ausklammert, ist seine Methodologie hilfreich, um meiner Wahrnehmung eine Struktur zu geben beziehungsweise die Struktur von meiner Wahrnehmung erfassen zu können; später in dieser Arbeit wird sich die Bedeutsamkeit dieses Aspektes für die gestalterische Praxis zeigen8. Dreh- und Angelpunkt ist dabei das Sich-bewusst-Sein: Je bewusster ich wahrnehme, was ich wahrnehme, desto klarer kann ich fassen, d.h. für mich introspektiv merken und spüren und für andere beschreiben, was sich ereignet, was ist.
Abschließend zum Menschenbild der Phänomenologie möchte ich die Gedanken zusammenführen: Menschen sind zu Bewusstsein fähige, in der Welt verankerte Wesen. Angelehnt an Merleau-Ponty bringt das zwei Implikationen mit sich: Zum einen die Überwindung des Dualismus von Bewusstsein und unserem So-Sein, sie sind aneinander gekoppelt, der Mensch ist eine Körper-Geist-Seele-Einheit. Zum Zweiten sind Subjekt und Objekt, Mensch und Welt, nicht getrennt voneinander, sondern nur in ihrem Zusammenhang zu verstehen, die Verbindung bildet dabei das intentionale Bewusstsein, welches leiblich durch Erfahrung gegeben ist (vgl. Nausner 1999, 476f.).
Ich wende mich im nächsten Punkt dem Denken und Menschenbild im Gestaltansatz zu, in welchem das Verhältnis zwischen Mensch und (Um)welt ebenfalls eine zentrale Rolle spielt und m.E. von einem erweiterten Blickwinkel und wieder mit anderen Begrifflichkeiten betrachtet wird.
2.2 Gestalt-Ansatz9: Grundbegriffe der Gestalttherapie hinsichtlich ihrer Anthropologie
„Struktur und Gestalt […] verkörpern [...] die ursprüngliche Organisation der Wirklichkeit selber. Dementsprechend ist auch das Verhalten [einer Person] weder bloßes Ding, nämlich ein Komplex von Körpermechanismen, noch bloßes Bewußtsein, nämlich geistige Tätigkeit, sondern es bedeutet zunächst einen Prozeß der Selbstorganisation, der sich spontan vollzieht“ (Waldenfels 1987 zit. nach Nausner 1999, 478).
Mit Gestalt wage ich mich nun in eine Denkweise vor, die mir in ihrer Gesamtheit als ein schwer zu erfassendes, konfuses und gleichzeitig innovatives Feld erscheint. Und schaue ich in die Literatur, zeigt sich, dass der Gestalt-Ansatz bereits in den Ursprüngen seiner theoretischen und wissenschaftlichen Fundierungen von Vielfalt geprägt ist. In die Theorie der Gestalttherapie fließen „[…] Erkenntnisse der Gestaltpsychologie, der Feldtheorie, Phänomenologie, Hermeneutik sowie philosophische Grundannahmen des Existenzialismus und östliche Meditationsformen […]“ (Bünte-Ludwig 1984, 217) mit hinein, sowie der Psychoanalyse, Kybernetik und heute Konzepte der Neurowissenschaften, Quantenphysik und Bewusstseinstheorien (vgl. Hartmann-Kottek 2014). Mit ihrem positiven Menschenbild, „das auf Selbstverwirklichung, Ganzheitlichkeit und Gleichberechtigung aufbaut“ (Blankertz/Doubrawa 2005, 155) und auf das die Therapie ausgerichtet ist, zählt sie in ihren Grundsätzen zu den „humanistischen Psychotherapien“ (ebd., 155).
In ihrem Ursprung geht sie auf die als Psychoanalytiker*innen ausgebildeten Laura (ursprünglich Lore) und Fritz (ursprünglich Friedrich) Perls zurück10. In einem gemeinsamen Schreibprozess mit dem Psychologen Ralph F. Hefferline und dem avantgardistischen Schriftsteller Paul Goodman entwickelten sie das Grundlagenwerk „Gestalt-Therapy. Excitement and Growth in the Human Personality“11, das erstmals 1951 in New York publiziert wurde. Seither gibt es eine Vielzahl an Weiterentwicklungen und Strömungen. Als grundlegend gilt die Unterscheidung in den an Fritz Perls orientierten als konfrontativ geltenden Westküstenstil sowie den eher politischen und theoretischen Ostküstenstil, der von Laura Perls und Paul Goodman geprägt ist (vgl. Rosenblatt et al. 2003, 177ff.)12. Aus zweiterem entstand mit der Zeit eine dialogische Gestalttherapie, welche dieser Tage in den USA von Gestalttherapeut*innen wie u.a. Erving und Miriam Polster, Gary Yontef, Lynne Jacobs, Rich Hycner und in Deutschland Frank-M. Staemmler, Erhard Doubrawa, Reinhard Fuhr (†) und Martina Gremmler-Fuhr vertreten wird. Sie beziehen sich explizit auf Martin Bubers Dialogphilosophie (für die therapeutische Beziehung) und die daraus entwickelte dialogische Psychotherapie durch insbesondere Hans Trüb und Maurice Friedmann. Diese Strömung bildet mit ihren Konzepten und Gedanken die Grundlage für mein Verständnis und meine Überlegungen zu Gestaltberatung13. Ich beziehe mich in dieser Arbeit oft auf das von Fuhr/Gremmler-Fuhr (2002) verfasste Buch „Gestalt-Ansatz“, in welchem Arbeiten aus Bewusstseins- und Entwicklungstheorien hinzugezogen werden, um Gestalt aus und in einem größeren Bezugsrahmen zu betrachten. Die beiden Autor*innen lehnen das entworfene „neue Paradigma“ (Fuhr/Gremmler-Fuhr 2002, 29) an den Konstruktivismus an, welcher aus einer wissenschaftstheoretischen Perspektive betrachtet in einem Spannungsverhältnis zur Phänomenologie steht, auf welches ich, um im Rahmen dieser Arbeit zu bleiben, nicht näher eingehen werde14. Nichtsdestotrotz erscheint es mir als eines der aktuelleren Grundlagenwerke zur Theorie der Gestalttherapie inhaltlich auch aus phänomenologischer Sicht nachvollziehbar, detailliert und umfassend, um anthropologische Grundgedanken des Gestalt-Ansatzes darlegen zu können15. Zudem ist es übergreifend für Gestalttherapie, -pädagogik und -beratung verfasst worden.
Ähnlich der Phänomenologie wird im Gestalt-Ansatz deutlich, dass ein Entwurf eines Menschenbildes an eine Denkweise gebunden ist. Ich möchte mich dieser nun annähern. Der Begriff ‚Gestalt‘ gibt mir bereits Anregungen, um die Sichtweise auf den Zusammenhang von Mensch und Welt nachvollziehen zu können: Etymologisch stammt ‚Gestalt‘ ursprünglich von der mittelhochdeutschen Verbform ‚stellen‘ ab, was ein Tun von Jemandem impliziert. Die Bedeutungen des Begriffs sind heute vielseitig: Er wird als Synonym für „eine unbekannte, nicht näher zu identifizierende Person“ (Duden 2015) – ähnlich einer Schatten- oder zwielichtigen Gestalt, „von einem Dichter [geschaffenen] Figur“ (ebd.) –, was auf eine kreierte Persönlichkeit hinweist, oder auch für eine „Form, die etwas hat, in der etwas erscheint[…]“ (ebd.), benutzt. Zudem wird mit ‚Gestalt‘ häufig Kunst und ein Schaffensprozess assoziiert. Bemerkenswert finde ich, dass eine Wurzel des Begriffs auf Goethe zurückzuführen ist, der sich in seinen Werken oft mit Ganzheit beschäftigte (vgl. Staemmler 2009, 59f.). All diese Aussagen geben mir Hinweise darauf, wie die Anschauungsart des Gestaltdenkens in der Theorie zu verstehen ist.
Angelehnt an die Erkenntnisse der Gestaltpsychologie16 geht es in der „Gestaltbildung oder Gestaltwerdung“ (Blankertz/Doubrawa 2005, 71) um einen Wahrnehmungsprozess, welcher auf einer abstrakten Ebene und in Verbindung mit der Feldtheorie des Gestaltpsychologen Kurt Lewins ebenso auf das Menschen- und Weltbild bezogen werden kann. Die Gestalttherapie geht von dem Konzept des „Figur/Grund-Prozess[es]“ (ebd., 71) aus: Auf Basis des ‚Grundes‘ als unstrukturierte, „amorphe Masse“ (ebd., 71) heben sich prägnante ‚Figuren‘ als Sinneinheiten hervor. Je nachdem, worauf eine Person die eigene Aufmerksamkeit richtet (schon hier lässt sich eine Verbindung zur Intentionalität der Phänomenologie entdecken), können sich verschiedene Formen bilden; so lässt sich in Abbildung 1 entweder eine Vase oder zwei sich anschauende Gesichter entdecken. Aus Figur und Grund im Wechselspiel entsteht eine Gestalt. Jede Gestalt bildet demnach eine Ganzheit, die mehr beziehungsweise verschieden zu der Summe ihrer Teile ist (vgl. Gremmler-Fuhr 1999b, 222ff.).
Abbildung 1: Das Figur-Grund-Prinzip
Ein treffendes Beispiel ist eine Melodie, deren Töne nur in ihrem Zusammenspiel – nicht bloß als zusammengesetzte Einzeltöne – diese Sinneinheit von Melodie ergeben (vgl. Bünte-Ludwig 1984, 222). Überdies bleibt die Melodie erkennbar, selbst wenn einzelne der Töne leicht verändert sind. In der Gestaltpsychologie wurden diese Gesetze mit „Übersummativität und Transponierbarkeit“ (Bünte-Ludwig 1984, 222) benannt. Ich erkenne Bezüge zu den oben genannten Wortbedeutungen:
Mittels meiner eigenen Wahrnehmung kann ich gesamtheitliche Formen schöpfen, die ihre Bedeutung jeweils nur aus dem Horizont erhalten. Wahrnehmen ist demnach ein aktiver und durchaus kreativer Prozess, welcher ein Subjekt erfordert. Nach Polster/Polster (1975) ist „die Figur-Grund-Auflösung die grundlegende Dynamik unseres Bewußtseins“ (ebd. zit. nach Fuhr/Gremmler-Fuhr 2002, 54), durch welche der Mensch seine „Wirklichkeiten erschafft“ (Fuhr/Gremmler-Fuhr 2002, 65). Dieser maßgeblich im Bewusstsein und Denken stattfindende Gestaltbildungsprozess steht in enger Beziehung zum Konzept des „Organismus/Umwelt-Feld[es]“ (Blankertz/Doubrawa 2005, 196). Es bietet ein hilfreiches Schema, welches das Verhältnis zwischen Mensch und Welt abzubilden vermag. Ein ‚Organismus‘ ist als Begriff mit diversen Bedeutungen füllbar. Er kann für eine gesamte Person, aber auch nur für ein Körperteil stehen – die Bedeutung hängt von seiner Relation zum ‚Umweltfeld‘ ab, in welches er immer eingebettet ist (vgl. Fuhr/Gremmler-Fuhr, 65f.)17. Grundsätzlich und zur Vereinfachung verstehe ich unter Organismus mit Fuhr/Gremmler-Fuhr (2002) die abstrakte Form eines „Ich“ (ebd., 65) in Abgrenzung zu einem „Nicht-Ich“ (ebd., 65). Dieser Differenzierungsprozess wird maßgeblich von der Art beeinflusst, wie eine Person den Gestaltbildungsprozess vornimmt, in diesem Fall in ihrem Bewusstsein eine Grenze zwischen sich und Umgebung (‚Nicht-Ich‘) zieht. Hier zeigt sich die Analogie von durch Wahrnehmung kreierter Gestaltbildung und der Gestalt im Feld: „Die Organismus-Umwelt-Differenzierung spiegelt also die Figur-Hintergrund-Dynamik auf die Leinwand unserer Existenz zurück“ (Gremmler-Fuhr 1999, 355).
Die Feldtheorie nach Lewin erweitert und vertieft meine Auffassung von Organismus und Umwelt. Ein Feld ist „eine Ganzheit gleichzeitig bestehender Tatsachen, die als gegenseitig voneinander abhängig begriffen werden[…]“ (Lewin 1969 zit. nach Fuhr/Gremmler-Fuhr 2002, 66). Diese ‚Tatsachen’ sind als meist polare Kräfte aufzufassen, die in wechselseitigem Austausch zueinander stehen. Demnach ist ein Organismus eine Manifestation einer im Feld wirkenden Kraft. Diese Idee steht Merleau-Pontys „être-au-monde“ (ebd. zit. nach Bünte-Ludwig 1984, 247) sehr nahe: Organismus und Feld bilden eine Einheit und sind nur in ihrem Verhältnis zueinander zu verstehen, sie bilden ein reflexives „Wirkungsgefüge“ (Fuhr/Gremmler-Fuhr 2002, 66). Das Medium, durch das ihre Beziehung zustande kommt, wird in Gestalt-Termini mit „Kontakt“ (ebd., 87) bezeichnet: Dieser ist „Abgrenzung zu und Berührung mit“ (ebd., 87) Organismus und Feld und findet in einer Art Grenzlinie/-raum statt. Für den Organismus dient er als „Lebenselixier“ (ebd., 79), da er jegliche Nahrungsaufnahme (im metaphorischen Sinn gemeint, also neben Essen und Trinken auch Geborgenheit, Wärme etc.) möglich macht18. Allerdings – ausgehend von dem Gedanken der Einheit – ist Kontakt „jede Art von lebendiger Beziehung, bei der zeitweise eine Kontaktgrenze zwischen Organismus und Umweltfeld geschaffen wird“ (Fuhr/Gremmler-Fuhr 2002, 86). Die Grenze ist also nicht per se gegeben, sondern muss erst kreiert werden. Deswegen kann sie auch als „Grenzbildung“ (ebd., 87 [Hervorhebung d. Verf.]) bezeichnet werden. ‚Kontakt‘ ist in der Gestaltliteratur ein schillernder Begriff und wird viel diskutiert. Ich gebrauche ihn in dieser Arbeit als Ausdruck für zum einen den Vorgang, durch welchen die Differenzierung zwischen Organismus und Umwelt zustande kommt, und zum anderen denjenigen, mit welchem ein Prozess der „Interaktion“ (Blankertz/Doubrawa 2005, 198) zwischen Organismus und Umwelt geschieht. Das Zweite wird in der Literatur durchgängig mit dem „Kontaktzyklus“ (Fuhr/Gremmler-Fuhr 2002, 92) oder der „Gestaltwelle“ (Blankertz/Doubrawa 2005, 122) bezeichnet. In diesem Prozess wird beschrieben, wie sich ein Organismus mittels seiner „Aggression“ (ebd., 122), einer kraftvollen Energie, Nahrung aus der Umwelt verschafft. Dabei durchlebt er verschiedene „Stadien des Kontaktes“ (ebd., 122), in denen „Erregung“ (ebd., 123) und Intensität ansteigen, bis es zur Nahrungsaufnahme und ‚Kontaktvollzug‘ kommt. Danach nähert er sich wieder einem Ruhemodus an. Ist die Verdauung abgeschlossen, schließt sich auch die Gestalt, Organismus und Umwelt bilden (für kurze Zeit) wieder ein einheitliches Ganzes. Ich werde den Kontaktzyklus in Kapitel 4 nochmals aufgreifen, um das Kommunikationsgeschehen zwischen beratender und ratsuchender Person darzulegen.
Der Mensch in seiner Gesamtheit wird im Gestalt-Ansatz im Konzept des „Selbst“ (Fuhr/Gremmler-Fuhr 2002, 165) elaboriert. Das Selbst besteht, verkürzt dargestellt, aus den drei Funktionen ‚Es‘ (die diffusen Bedürfnisse), ‚Ich‘ (der Wille) und der ‚Persönlichkeit‘, die den Aspekt der Verantwortungsübernahme verkörpert (vgl. ebd., 174ff.). Das Selbst-Konzept ist in der Gestaltliteratur vielfach modifiziert worden und die Definitionsbestimmung noch nicht abgeschlossen. Ich verwende Fuhr/Gremmler-Fuhrs (2002) Auffassung:
„Das Selbst tritt immer nur in personaler Form in Erscheinung, wie umfassend die aktuellen persönlichen, die überpersönlichen und die umfassenden Anteile des Selbst auch sein mögen. Das, was wir als Selbst bezeichnen, ist Ausdruck der Einzigartigkeit jedes Einzelnen im jeweiligen Kontaktgeschehen […], auch wenn gleichzeitig etwas durch dieses Selbst hindurchschimmert, was personenübergreifend und universal ist […]“ (ebd., 170).
Das Selbst verkörpert demzufolge etwas Kontinuierliches und gleichsam Dynamisches, sich stets Wandelndes. Es realisiert sich und drückt sich aus im Kontaktprozess und ist folglich eng verflochten mit dem Prinzip des Organismus-Umweltfeldes. Bedeutsam zu verstehen ist – gerade im Hinblick auf einen gelingenden Therapie- beziehungsweise Beratungsprozess –, dass das „Selbstverständnis“ (ebd., 171) einer Person von ihren Modi des Bewusstseins, also auch ihrer Gestaltbildung, abhängig ist. Je gewahrer sie sich dieser ist, desto weiter wird das Verstehen ihres und ihrer Selbst und ihrem Sein in der Umwelt. Je mehr es zu einer Integration der Funktionen des Selbst kommt, desto mehr lässt sich von ‚Wachstum‘ oder vielmehr „Persönlichkeitsentwicklung“ (Fuhr/Gremmler-Fuhr 2001, 87) einer Person sprechen – die Person lernt zunehmend ihr Selbst spontan und kreativ – je nach Umfeldbedingungen – zu verwirklichen. Diese Begrifflichkeiten werde ich im Verlauf dieser Arbeit in Zusammenhang mit dem ‚dialogischen Prinzip‘ Martin Bubers wieder aufgreifen.
Hinzu kommt das Konzept der „organismische[n] Selbstregulation“ (Fuhr/Gremmler-Fuhr 2002, 135). Angelehnt an die ursprünglich aus der Physiologie stammenden Theorien der Autopoesie und Kybernetik geht das Gestaltdenken davon aus, dass Systeme (im weitesten Sinn) von innen heraus, aus einer ihr ihnen inhärenten Kraft und Struktur, zu einer Ordnung finden (vgl. Fuhr/Gremmler-Fuhr 2002, 135f.). Das selbstorganisierte Regulieren verläuft im Wechselspiel von Anspannung und Erregung/Chaos und Entspannung eines Organismus in seiner Umwelt, somit entlang eines gelingenden Kontaktprozesses.
„Damit [der schöpferischen Anpassung] ist ein dynamisches Gleichgewicht gemeint, also die Herstellung bestmöglicher Beziehungen zwischen den Bedürfnissen und Interessen des Organismus und der Wahrnehmung der Strukturen des Feldes“ (ebd., 137).
Aus diesem Verständnis heraus wird heute zunehmend der Begriff der „schöpferische[n] Anpassung“ (ebd., 137) verwendet, da er die Interdependenz von Organismus zur Umwelt einbezieht. Er verdeutlicht überdies, dass es sich um einen Prozess von Kreativität handelt: Ein Organismus ist etwas, dem der Drang zum Gestalten und Tun innewohnt. Bezogen auf den Menschen bedeutet dies, dass ihm Eigensinn, die Fähigkeit zur Autonomie und gleichsam Sozialität zugesprochen werden. Besonders Paul Goodman setzte sich für den „Gemeinschaftsanarchismus“ (Fuhr/Gremmler-Fuhr, 137) ein, eine soziale Ordnung ohne Herrschaft, welche die politische Konsequenz aus der Selbstorganisationstheorie wäre. Doch dazu mehr im letzten Kapitel.