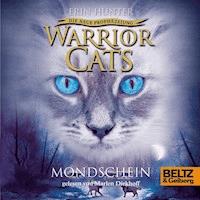3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Reclams »Fremdsprachen-Lektüreschlüssel« folgen dem bewährten Aufbau- und Darstellungsprinzip der Lektüreschlüssel zur deutschen Literatur. Sie beziehen sich auf den fremdsprachigen Originaltext (wenn möglich in Reclams Roter Reihe), sind aber auf Deutsch verfasst und unterstützen ebenso die Lektüre der deutschen Übersetzung. Eine Checkliste enthält Aufgaben zur Verständniskontrolle in der Fremdsprache. Unter dem Darstellungstext stehen Übersetzungshilfen und Schlüsselbegriffe in der Fremdsprache, um die Bearbeitung dieser Aufgaben und ein fremdsprachiges Referieren über das Werk zu erleichtern. Jeder Band enthält: Erstinformationen zum Werk – Inhaltsangabe – Personen (Konstellationen) – Werk-Aufbau (Strukturskizze) – Wortkommentar – Interpretation – Autor und Zeit – Rezeption – Checkliste zur Verständniskontrolle – Lektüretipps mit Filmempfehlungen – Raum für Notizen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Philippe Grimbert
Un secret
Von Pia Keßler
Reclam
Dieser Lektüreschlüssel bezieht sich auf folgende Textausgabe in der Originalsprache: Philippe Grimbert: Un secret. Hrsg. von Wolfgang Ader. Stuttgart: Reclam, 2007. (Universal-Bibliothek. 19731.)
2014 Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2018
RECLAM ist eine eingetragene Marke
der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN 978-3-15-960596-8
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-05441-0
www.reclam.de
Inhalt
1. Erstinformationen zum Werk
2. Inhalt
3. Personen
4. Struktur und Erzähltechnik
5. Interpretation
6. Autor und Zeit
7. Rezeption
8. Dossier pédagogique
9. Lektüretipps/Medienempfehlungen
Anmerkungen
Hinweise zur E-Book-Ausgabe
1. Erstinformationen zum Werk
Es kommt gar nicht so selten vor, dass sich Kinder in einem bestimmten Alter ein Geschwisterkind, einen Hund, einen Freund, eine Freundin, neue Eltern oder Verwandte erfinden. In der Psychoanalyse nennt man das »DissoziationDissoziation im Kindesalter«. Ebenfalls relativ häufig nehmen diese erfundenen Gefährten im Kopf der Kinder sehr realeZüge an, fangen an, für sie zu existieren. Das kann so weit gehen, dass sie ihm/ihr einen Platz im Auto neben sich freihalten, den Tisch für eine Person decken, die nur in ihrer Kinderwelt existiert. So ist es auch nicht ganz ungewöhnlich, dass der Ich-Erzähler des Romans sich einen Bruder erfindet. Zumal er Einzelkind ist, ist es verständlich, dass er gern ein Geschwister haben möchte, einen Bruder, an dem er sich messen kann, dem er Dinge erzählt, die er seinen Eltern nicht erzählen kann. Er erfindet sich einen älteren Bruder, einen, der größer, schöner und stärker ist. Außergewöhnlich ist, dass Philippe sich einen Bruder erfindet, der tatsächlich existiert hat.
Im Kindesalter merkt der Ich-Erzähler, dass es ein Geheimnis in seiner Familie gibt, er spürt ein Schweigen, das ihn Ungewissheit und Vorahnungverunsichert, ihm Angst einjagt und ihn sensibel für Beobachtungen macht. Er will das Geheimnis, das er spürt, aufdecken.
Der Erzähler präsentiert die Eine FamiliengeschichteFamiliengeschichte zweimal; die erste Fassung ist seine Wunsch- und Phantasieversion, eine Version, die typisch ist für Kinder, die sich eine ideale Familie wünschen, die ihre Eltern als Helden sehen wollen und sich selbst als geliebtes Kind. Es ist die seiner Eltern, die ihn als erstes und einziges Kind nach einer Liebesheirat bekommen haben.
Er erfindet sich die Geschichte ihres Kennenlernens, ihrer Liebe, ihrer ersten Begegnungen und macht dies fest an den wenigen Fakten, die die Eltern ihm erzählen. Der Krieg spielt kaum eine Rolle in dieser Fassung. Er macht sie fest an einzelnen Fotos und ergänzt den Rest mit Hilfe seiner Die PhantasieversionPhantasie.
Die zweite Version ist die Die wahre Geschichtewahre Geschichte. Das Geheimnis, das auf der Familie lastet, wird entdeckt und führt den jungen Philippe zu den schrecklichen Wahrheiten des Krieges, des Holocaust, des Schicksals der Juden. Es ist die Geschichte eines einzelnen Schicksals, aber eines, das es so mehrfach gegeben haben könnte. Philippe hatte diesen Bruder tatsächlich; es war ein Halbbruder, der mit seiner Mutter, der ersten Frau seines Vaters, in Auschwitz ermordet worden ist. Die Kriegsgeschichte holt seine Realität ein.
Im Alter von 15 Jahren erfährt er die Wahrheit. Der Auslöser kommt von außen, eine Filmvorführung zum Holocaust macht ihm unbewusst klar, dass er sich dieser Realität nicht mehr entziehen kann. Der Ich-Erzähler erkennt, dass es für ihn wichtig ist, möglichst viel zu erfahren, und er macht genau das Gegenteil von dem, was seine Eltern gemacht haben.
Er verdrängtDas Ende der Verdrängung nicht, er will möglichst viel wissen, er will Informationen über die Zeit, den Krieg, das Leben des Halbbruders und dessen Mutter. Er will diesem toten Bruder eine Identität geben, um sich selbst und die Familie durch die Aufarbeitung der Vergangenheit zu befreien. Vor allem gelingt ihm das durch die Psychoanalyse. Erst viel später wird er das Schweigen brechen. Er wird Psychoanalytiker und therapiert sich selbst und seine Eltern. Der Roman ist eine Autofiktion, die Grundkonstellation und der Tod in Auschwitz entsprechen der biographischen Wirklichkeit des Autors, die Geschichte einer großen Leidenschaft, die er erzählt, entspringt eher seiner literarischen Phantasie.
Philippe Grimbert hat diesen Roman nicht geschrieben, um Schuldzuweisungen vorzunehmen, sondern zum einen, um das Geschehen schreibend zu verarbeiten, zum anderen, um ein literarisches Zeugnis abzulegen von einer Geschichte, wie sie so kein Einzelfall war und die schrecklichen Auswirkungen des Krieges verdeutlicht. Dem Psychoanalytiker Grimbert geht es darum, deutlich zu machen, wie sich Verdrängung und Verschweigen physisch und psychisch auswirken, und zu zeigen, wie sich die Wahrheit Bahn bricht und wie die Kenntnis der Wahrheit schlussendlich auch zu ihrer Das SchreibmotivVerarbeitung führen kann. Grimbert zeigt auch, dass dies manchmal erst in der nächsten Generation passiert. Der letzte Satz des Romans fasst seine Motivation zusammen: »Ce livre serait sa tombe.«
2. Inhalt
Kapitel I
Philippe wünscht sich während seiner Kindheit immer einen Bruder, und da er Einzelkind ist, erfindet er sich diesen Gefährten. Eines Tages findet er auf dem Speicher einen Plüschhund, den er SimSim nennt, und ist erstaunt über die sehr emotionale Reaktion seiner Mutter, die nicht will, dass er ihn mitnimmt, was ihn wiederum glauben lässt, dass dieser Plüschhund ihm Aufschluss geben kann über ein Geheimnis, das auf seiner Vergangenheit lastet.
Er versucht, die HerkunftPuzzleteile zusammenzusetzen, erzählt von seiner christlichen Taufe trotz der an ein jüdisches Ritual erinnernden Beschneidung, von der veränderten Orthographie des Familiennamens (Grimbert statt Grinberg).
Philippes Eltern sind extrem sportlich, wohingegenKörperliche Konstitutioner eher schwach und kränklich ist. Sie betreiben ein Sportartikelgeschäft in der rue du Bourg-l’Abbé in Paris in direkter Nachbarschaft zur Physiotherapiepraxis von Mademoiselle Louise, einer praktisch zur Familie gehörenden Frau, die nicht zuletzt wegen ihrer eigenen körperlichen Defizite zu Philippes engster Vertrauter wird.
Kapitel II
Philippe konstruiert aus Versatzstücken von Erzählungen seiner Eltern, Maxime, Tania und PhilippeTania und Maxime, die Vergangenheit und spürt doch immer, dass auf dieser ein Schweigen lastet, ein Schatten, den er sich nicht erklären kann. Maxime, hervorragender Sportler und Frauenheld, verliebt sich in die wunderschöne, sportliche Tania, die mit ihrer Mutter allein lebt und als Modezeichnerin tätig ist. Philippe stellt sich ihre Treffen vor – im Schwimmbad, auf dem Tennisplatz, ihre Hochzeit in Zeiten des Krieges.
Philippe bemerkt die besondere Bedeutung, die der kleine Ort Saint-Gaultier für die Eltern hat, wo diese während der Schatten der Vergangenheit Besatzungszeit zwei Jahre verbracht haben – zwei Jahre, in denen sie verschont blieben von den Kriegswirren. Kurz nach ihrer Rückkehr nach Paris ins noch intakte Geschäft in der rue du Bourg-l’Abbé wird Philippe geboren, ein schwacher, kränklicher Junge, bei dessen Anblick Maxime vom ersten Moment an eine Art Bitterkeit empfindet.
Kapitel III
Von Anfang an hat Philippe ein Ziel: Er will die Aufmerksamkeit seiner Eltern erregen. Er ist ein MusterkindMusterkind, ein Musterschüler, der im Kreise seiner Familie aufwächst: Außer seinen Eltern sind dies der Großvater Joseph (Maximes Vater), die Großmutter Martha (Tanias Mutter), die Onkel Georges und Marcel, Maximes Brüder, deren Frauen Esther und Élise. Seine engste Vertraute ist Louise, die Nachbarin. Louise erzählt ihm vom Krieg, von dem seine Eltern nie reden. Philippe bemerkt, dass der Vater mit verstärkten Anstrengungen in seinem Sportraum trainiert, weil er sich eine Fernsehübertragung über die Kriegsperiode nicht ansehen will, in der Philippe zum ersten Mal Bilder von der Judenverfolgung sieht.
Eines Tages sieht Philippe in der Schule eine Dokumentation über den Holocaust Holocaust, und als ein Mitschüler sich über die ausgemergelten Leichen lustig macht, überfällt Philippe eine unbekannte Wut, er stürzt sich auf den Mitschüler und verprügelt ihn. Als er Louise davon erzählt, bemerkt diese, dass sie nicht mehr schweigen kann.
»Le lendemain de mes quinze ans, j’apprenais enfin ce que j’avais toujours su« (70,1 f.). Er lernt die Geschichte seines Halbbruders kennen. Er erfährt, dass es ihn gegeben hat, und er hört erstmals seinen Namen: Simon und Hannah Simon.
Kapitel IV













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)