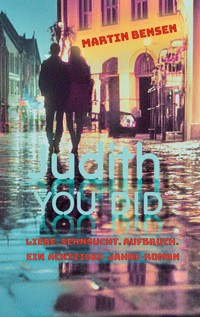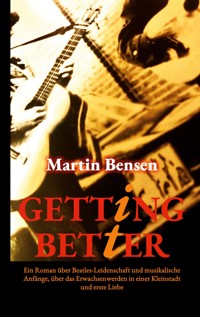Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Peter kann sein Glück kaum fassen. Nicht nur, dass der schwerkranke Journalist seinen geliebten Freund und Blutsbruder aus Kindertagen nach einem halben Jahrhundert endlich wiedersieht. Mit dem Einzug in dessen Villa direkt über dem ligurischen Meer erfüllt sich auch ein langersehnter Traum. Peter schöpft neue Hoffnung, auch deshalb, weil sein Freund und Gastgeber ein berühmter Mediziner ist. Doch mitten im Paradies macht der neue Bewohner der Villa eine verstörende Entdeckung. Die Idylle trügt, seltsame Dinge passieren, und allmählich wird Peter klar, dass das Ziel, an dem er sich und sein Leben wähnt, in Wahrheit der Beginn einer unheilvollen Geschichte ist - einer Geschichte von Freundschaft, Liebe und Tod.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Buch:
Peter kann sein Glück kaum fassen. Nicht nur, dass der schwerkranke Journalist seinen geliebten Freund und Blutsbruder aus Kindertagen nach einem halben Jahrhundert endlich wiedersieht. Mit dem Einzug in dessen Villa direkt über dem ligurischen Meer erfüllt sich auch ein langersehnter Traum. Peter schöpft neue Hoffnung, auch deshalb, weil sein Freund und Gastgeber ein berühmter Mediziner ist. Doch mitten im Paradies macht der neue Bewohner der Villa eine verstörende Entdeckung. Die Idylle trügt, seltsame Dinge passieren, und allmählich wird Peter klar, dass das Ziel, an dem er sich und sein Leben wähnt, in Wahrheit der Beginn einer unheilvollen Geschichte ist – einer Geschichte von Freundschaft, Liebe und Tod.
Autor:
Martin Bensen, Jahrgang 1962, hat in Münster Germanistik und Philosophie studiert. Seit 1989 lebt und arbeitet er in Stuttgart.
Hinweis:
Die Personen und die Handlung des Romans sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten, Umständen und lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig.
Zum Sterben schön, dachte ich.
Genau dafür war ich hergekommen.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
1
Ihr Anblick raubte mir den Atem. Mein Freund hatte mir nicht zu viel versprochen, regelrecht untertrieben hatte er. Die Villa, die an diesem felsigen Stück Küste im Licht der ersten Sonnenstrahlen vor uns aufragte, war der Traum schlechthin. Zum Sterben schön, dachte ich. Genau dafür war ich hergekommen.
Wir näherten uns ihr vom Meer aus, Paul hatte darauf bestanden, dass wir seine Motorjacht nehmen.
»Lieber, du musst sie so sehen, als kehrtest du von einer langen Seereise heim, nur so wird sie dir ein wahres Refugium werden.« Seine Stimme hatte in diesem Moment salbungsvoll geklungen, auf eine aufrichtige Weise feierlich, und ich spürte, wie stolz er war, mir, seinem ältesten Freund, die Welt – seine Welt – zu Füßen zu legen.
Wir kannten uns seit der ersten Klasse, wurden schnell die dicksten Freunde. Peter und Paul – fast ehrfürchtig sprach unsere fromme Lehrerin unsere Namen aus, so, als gehörten sie untrennbar zusammen. Genauso fühlten wir es auch. Leider wollte das Schicksal es anders und brachte uns noch im Kindesalter auseinander. Beim Anblick der zauberhaften Villa dort oben auf dem Felsen, der Villa meines Freundes, fühlte ich mich wieder wie der kleine Peter von damals. An diesem Morgen ließ ich mich anstecken von der gelösten Stimmung Pauls, der versonnen und auch ein wenig schelmisch hinter dem Ruder lächelte. Selbst nach dieser langen Zeit der Trennung wusste er noch genau, wie er mich kriegte, das hatte er schon bei unserer ersten Begegnung gekonnt, in der Grundschule, als wir Erstklässler Hand in Hand in Zweierreihe Aufstellung nehmen mussten und er mich im Gewusel der Aula einfach zu den Schülern der Parallelklasse zog, die bereits frei hatten und nach Hause strebten. So wie er mich gleich zu Beginn unserer Freundschaft zum Schuleschwänzen verführte, so nahm er mich auch jetzt an die Hand, um mich nur wenige Stunden nach unserem Wiedersehen dorthin zu geleiten, wo ich meine neue, meine letzte Heimat finden sollte.
***
»Aus den Federn, Peter, die Villa wartet.« Es war noch dunkel gewesen an diesem Morgen, als Paul mich für die Ausfahrt weckte. In seinem weißen Pyjama wirkte er eher ein Geist. Ganz anders am Abend zuvor, als er mich nach meiner Anreise nicht schon an der Villa am Meer, sondern zunächst auf seinem weitläufigen Anwesen oberhalb von Genua begrüßt hatte. Er hatte darauf bestanden, ich würde schon noch sehen, warum. Nicht einmal die Adresse wollte er mir vorher verraten, er machte es richtig spannend, bat mich deshalb zuerst zu sich nach Hause. So nannte ich dem Taxifahrer seine Adresse in Genua.
Paul wartete bereits draußen vor der Haustür seines erstaunlicherweise gar nicht mal so großen Landhauses. Wie ein feiner Conte sah er aus, wenn auch deutlich zu groß für einen typischen Italiener. Sein volles, fast weißes Haar trug er inzwischen länger und nach hinten gekämmt und er hatte sich einen gepflegten Van-Dyke-Bart stehen lassen, was ihn mir fremd, fast abweisend erscheinen ließ. Doch sobald er mich erblickte, erschien auf seinem braun gebrannten Gesicht dasselbe vertraute, schalkhafte Lächeln, mit dem er mich und die meisten anderen Menschen schon als kleiner Lausbub um den Finger gewickelt hatte. Da stand er, sichtlich auch nicht mehr der Jüngste, sogar ein wenig verlebt, und lächelte die beinahe fünfzig Jahre einfach weg, die wir getrennt gewesen waren. Bis heute.
Zum Ende der Grundschulzeit war Pauls Familie aus unserem grauen Westfalen weit weg ins sonnenverwöhnte Süddeutschland gezogen. Schon damals empfand ich unsere Trennung als endgültig und tatsächlich haben wir uns all die Jahre nicht wiedergesehen. Nicht weil wir es so wollten, sondern weil gleich einem Bann oder einem Fluch immer etwas dazwischen kam. Unsere Absagen, oft erst in letzter Minute, nahmen wir, zuletzt beinahe heiter, als unabänderliche Gesetzmäßigkeit. Und doch blieben wir bis heute in Kontakt. Aus dem noch ferneren hohen Norden, in den es mich nach dem Studium in Berlin verschlagen hatte, verfolgte ich, wie Paul Karriere machte, sah ihn sogar im Fernsehen, wo er bald ein häufig gebuchter Gast war, denn er hatte sich einen Namen als Mediziner und Forscher gemacht. Anders als viele seiner ähnlich kompetenten Kollegen war er nicht nur telegen. Mit seiner gewinnenden Art verstand er sich auf die Kunst der Unterhaltung, war kein Fachidiot wie viele seiner Zunft. Ich traute ihm sogar eine Karriere als Moderator oder Entertainer zu. Als Redakteur eines recht angesehenen Hamburger Nachrichtenmagazins verfasste ich einmal einen Artikel über ihn. Trotzdem blieb mir letztlich verschlossen, über was genau Paul forschte.
Einmal wäre ich beinahe zu ihm nach München gereist – ich sollte ein Interview mit ihm führen –, als mich meine Chefin im letzten Moment zurückpfiff und einer jüngeren Kollegin den Auftrag gab. Damals wurde der populäre Professor gerade als heißer Kandidat für den Nobelpreis gehandelt. Ich weiß, Paul meinte es nicht böse, aber er verstärkte meine Demütigung noch, als er mir einige Tage später in einer Mail von der überaus kompetenten und attraktiven Kollegin vorschwärmte, die mich recht erbaulich vertreten habe. Ich fand seine Anspielung arrogant und sexistisch, schrieb ihm keine Antwort und war dann doch etwas versöhnt, als er sich bei meiner Chefin über die in seinen Augen verfälschende Fassung des Interviews beschwerte und mich in Blindkopie nahm. Anders als meine Kollegin hätte ich zu verhindern gewusst, dass die Schlussredaktion meinen Text noch einmal durch den vermeintlich auflagensteigernden Fleischwolf dreht.
»Nun also sehen wir uns endlich wieder«, sagte Paul bei meiner Ankunft. Der Empfang war warmherzig, fast stürmisch, wir fielen uns in die Arme und waren einander sofort wieder so vertraut, als wären wir nie getrennt gewesen. Er hielt mich auch dann noch im Arm, als wir in sein Haus traten.
Der schwere Rotwein, der das äußerst schmackhafte Abendessen abgerundet hatte, wirkte noch nach. Ich brauchte einen Moment, um aus dem Bett zu kommen, wusste auch nicht mehr, wo das Bad war. Mein erster Versuch führte mich an eine verschlossene Tür. Sie trug die Aufschrift Studio medico. Praktizierte er also doch noch? War es wohl doch nichts mit dem Ruhestand, dachte ich. Hatte er am Telefon nicht gesagt, dass er jetzt nur noch Wein, Weib und Gesang genießen wolle? Die zweite Tür war die richtige. Ich beließ es bei einer Katzenwäsche, stand alsbald in der Kleidung vom Vortag und mit meiner kleinen Reisetasche in der Wohnküche.
»Keine Zeit mehr für Kaffee«, sagte Paul und griff nach seiner Bootstasche, »Wir sollten rechtzeitig vor Sonnenaufgang am Hafen sein.«
2
Er hatte nicht einen Moment gezögert, als ich ihn anrief. »Komm«, hatte er gesagt. »Klar helfe ich dir! Alles weitere später. Aber komm gleich!« Das ließ ich mir nicht zweimal sagen. Meine Tasche stand bereits fertig gepackt im Flur meiner Hamburger Wohnung. Viel hatte ich nicht mitzunehmen, es ging ja in den Süden und es war Sommer. Außerdem konnte ich mir jederzeit neue Sachen kaufen, für meine Durchschnittsgröße fand ich immer etwas Passendes. Anders mein groß gewachsener Freund, der allerdings genügend Geld besaß, um sich seine Garderobe maßanfertigen zu lassen. Ich buchte online einen günstigen Flug mit Zwischenstopp in Frankfurt. In Genua gönnte ich mir ein Taxi. So stand ich binnen weniger Stunden vor dem Landhaus meines Freundes.
Wir hatten eine Menge nachzuholen. So viel gab es zu erzählen, dass nicht nur der gute Rotwein in Strömen floss, sondern am Ende auch kaum noch Zeit zum Schlafen blieb. Nach dem überaus köstlichen Abendessen, das mein Freund sich aus einem Ristorante hatte kommen lassen, begaben wir uns in ein gemütliches Lesezimmer mit Kamin. Obwohl es draußen noch warm war und eine besondere Lichtstimmung herrschte, wollte mein Gastgeber nicht auf die Terrasse, von der man einen wunderschönen Blick auf die Bucht hatte. Das Haus war bei Weitem kein Palast, aber ähnlich einem solchen lag es auf einem Hügel oberhalb der Stadt, umgeben von einem respektablen Pinienwäldchen, das zum Meer hin talwärts abfiel und so eine grandiose Aussicht freigab. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass die Villa, von der Paul so schwärmte, sein Anwesen noch übertreffen sollte. Dass er mir die Aussicht hier vorenthielt, nährte meine Zweifel.
»Morgen wirst du wissen, warum ich dir den Blick von hier oben nicht gönne«, sagte er und schaute mich verschwörerisch an. »Vertrau mir, Peter!«
Wie konnte ich nicht? Wir setzten uns nebeneinander vor den Kamin, die Sessel aus feinem braunem Leder waren äußerst bequem. Auf einem Tischchen zwischen uns hatte Paul den Rotwein und zwei Gläser platziert, außerdem ein paar Knabbereien. Schon während des Abendessens hatten wir die Zeit und fast das Essen selbst vergessen, so wissbegierig fragten wir einander Löcher in den Bauch, so ausladend erzählten wir uns abwechselnd unsere Leben, zwei halbe Jahrhunderte, die zusammen ein ganzes ergaben und doch unterschiedlicher nicht hätten verlaufen können. Jetzt vor dem Kamin ging es geradewegs so weiter. Und es war, als ob mit jedem Scheit, den mein Freund in die Flammen legte, auch unser Gespräch immer neue Nahrung bekam. Ein Wort gab das nächste, unsere Lebensgeschichten sprudelten nur so aus uns heraus, fanden hier, im Hause meines Freundes, wieder zusammen, beseelten uns und am Ende war es, als wären die jeweiligen Erinnerungen zu gemeinsamen geworden.
So viel wir lachten, so oft waren wir auch den Tränen nahe. Bei allen Erfolgen und Freuden hatte uns beiden auch das Schicksal mitgespielt. Mir war keine längere Beziehung vergönnt gewesen, vielleicht war ich einfach zum Einzelgänger geboren. Ich hatte wenige schöne, dafür umso mehr hässliche Episoden erlebt. Meinen Eltern blieb mein unglückliches Liebesleben nicht verborgen, sie grämten sich deswegen, hätten sich so sehr eine Schwiegertochter und Enkelkinder gewünscht. Ich war ihr einziges Kind. Zum Glück musste ich mich um meine Eltern nie sorgen, beide waren bei guter Gesundheit, lebten in einer schönen Einrichtung für betreutes Wohnen in unserer Heimatstadt.
Paul hatte es schlimmer getroffen: Sein Umzug nach Genua hatte einen traurigen Grund: Nur wenige Monate zuvor hatte er seine Frau verloren. Es war schon seine dritte, doch diese hat er nach eigenem Bekunden geliebt wie keinen Menschen zuvor.
»Abgesehen von dir natürlich«, sagte er mit einem feinen Lächeln und feucht glitzernden Augen. Ich streckte meinen Arm aus, legte meine Hand auf seine, spürte seinen großen Siegelring, der mir bereits bei meiner Ankunft aufgefallen war – ein Erbstück seines Vaters, der viel zu früh an einem Krebsleiden starb und dem seine Mutter nur zwei Wochen später auf rätselhafte Weise in den Tod folgte. Der doppelte Schicksalsschlag traf Paul zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, er befand sich mitten in den Abiturprüfungen. Weil er wie ich Einzelkind war und seine spärliche Verwandtschaft bestenfalls dritten Grades war, noch dazu irgendwo auf der Welt verstreut, musste er sich trotz aller Anspannung um alle Formalitäten kümmern. Glücklicherweise fand er in einem Lehrer einen väterlichen Unterstützer, außerdem gab es keine finanziellen Probleme – ganz im Gegenteil: Als alleiniger Nachkomme erbte er ein beträchtliches Vermögen. Die Trauer über den Tod seiner Eltern hielt sich in Grenzen. Seit der fünften Klasse waren sie ihm weniger eine Familie als die Gemeinschaft im Internat, in das es ihn nach dem schmerzvollen Wegzug aus dem Münsterland zog. Nicht nur aus kindlichem Trotz, sondern aus einem beinahe sadistisch anmutenden Rachegefühl. Die Eltern widerstanden nur halbherzig, ließen ihren Sohn ziehen – unter der einzigen Bedingung, dass er in ihrer Nähe blieb. Das Internat war ein Glücksfall für Paul, es förderte ihn nach seinen Stärken und es bot ihm zugleich die Geborgenheit einer großen Familie, die ihn den Trennungsschmerz bald überwinden ließ. Auch jetzt hatte die Schulleitung großes Verständnis für seine Situation. Sie befreite ihn sofort von den noch verbliebenen Prüfungen und ließ ihn diese nach den Sommerferien komplett nachholen. Wie ein Besessener wiederholte er den gesamten Stoff der Oberstufe, lernte Tag und Nacht, schlief und aß wenig, erschien schließlich zu den Prüfungen wie ein Schatten seiner selbst – und schloss mit dem besten Abitur ab, das seine Schule je gesehen hatte.
Er habe am Grab seiner Eltern alles vor sich gesehen, gestand er mir an diesem Abend. Er habe sich geschworen, gegen die größte Geißel der Menschheit zu kämpfen. Doch so Erfolg versprechend seine Forschungen auch waren, am Ende habe der Krebs immer wieder die Oberhand gewonnen, ein unberechenbares Ungeheuer, dessen ganzes Wirken nur darin bestehe, Leben zu vernichten. Ich erschrak über seine harten Worte, sein versteinertes Gesicht. Der Tod lasse sich nicht besiegen, er komme, wann er wolle, raffe die Menschen dahin, wie es ihm beliebe.
»Wir meinen nur, wir könnten ihm ein Schnippchen schlagen, ihm wenigstens ein wenig Zeit abringen, doch am Ende folgt alles doch nur dem ursprünglichen, unabänderlichen Plan des Todes.« Mit düsterer Miene starrte mein Freund in sein Rotweinglas, dessen Inhalt jetzt schwarz erschien, dann leerte er es in einem Zug und blickte mich mit traurigen Augen an.
»So nah war ich dran!« Er deutete mit Daumen und Zeigefinger einen minimalen Abstand an. »Meine Frau hatte mir bis zuletzt vertraut und gekämpft. Es brach mir das Herz, als ich merkte, dass die Therapie nicht anschlug. Wenigstens musste sie nicht leiden, dafür hatte ich gesorgt.«
Im Kamin kippte ein Holzscheit um, Funken stiegen auf. Schweigend betrachteten wir das glimmende, verkohlte Stück Holz. Dann drehte er sich zu mir und sah mich mit ernstem Blick an.
»Ich sagte, ich helfe dir. Das tue ich, lieber Peter. Und diesmal schlage ich den Tod mit seinen eigenen Mitteln.«
3
Die Fahrt zum Hafen sollte nur kurz dauern. Der Morgen graute bereits. Paul gönnte mir auch jetzt keinen Blick auf die Küste. Er drängte mich einzusteigen; binnen Sekunden ließ der Wagen das Anwesen hinter sich, um in die Häuserschluchten Genuas einzutauchen. Hier kannte mein Freund offenbar jeden Winkel. Obwohl noch nicht viel Verkehr war, bevorzugte er die kleinen Gassen, vielleicht wollte er mir auch nur die verborgenen, die ursprünglichen Ansichten der Stadt zeigen, mich so einstimmen auf den wundervollen Tag und mein schönes Ziel. Sein Alfa kam gut mit den schlechten Straßen zurecht, der Motor schnurrte wie ein Kätzchen, mir fielen sogar immer wieder die Augen zu, so wohl fühlte ich mich in seinem rollenden Wohnzimmer. Als ich einmal aufschreckte, lächelte Paul nur, zeigte auf eine Bar, die noch verrammelt war, und erzählte mir von ihrem Besitzer namens Enzo, der ihm anfangs geholfen habe, sich im Alltag der Stadt zurechtzufinden. Sie hatten sich in einer Hafenbar kennengelernt, als er gerade die letzten Formalitäten zum Kauf seiner neuen Jacht regelte. Enzo hatte am Nebentisch gesessen und das Geschehen verfolgt. Gerade als Paul den Vertrag unterschreiben wollte, hechtete der Italiener wie ein kleiner Springteufel auf seinen Tisch zu und riss ihm die Papiere aus der Hand. Staunend saßen Händler und Käufer da und verfolgen, wie er den Vertrag überflog, hier und da missbilligend den Kopf schüttelte. Dann habe er das Papier auf den Tisch geknallt, zum edlen Füllfederhalter des Händlers gegriffen und unter dem lauten Protest seines Besitzers in dem Schriftstück herumgekritzelt.
Paul lachte leise und umfuhr elegant einen Müllhaufen. Stolz habe Enzo ausgesehen, als er den Füller ihm, dem Käufer, überreichte und auf den Vertrag deutete. Jetzt könne er unterschreiben.
»Ich dachte erst, der Deal sei geplatzt«, lachte Paul. »Der Händler war ungehalten, nahm den Vertrag und verließ umgehend die Bar. Doch schon am nächsten Tag war er wieder da, knallte den Text mit allen Änderungen auf den Tresen. Enzo prüfte, ich unterschrieb, erhielt Papiere und Schlüssel – nach nicht mal zwei Minuten war der Spuk vorbei.« Dieser Enzo muss ein echter Tausendsassa sein, dachte ich und bedauerte fast, ihn nicht mehr kennenlernen zu können.
»Der Verkäufer wollte mich um ein ganz schönes Sümmchen übers Ohr hauen«, fuhr mein Freund fort. »Enzo hat das geahnt und mich vor einem großen finanziellen Schaden bewahrt. Er kannte die Jacht und ihren Zustand, war wohl selber interessiert gewesen. Man musste auch noch einiges dran machen, aber das war nicht so wild. Seitdem stehe ich in seiner Schuld. Und trotzdem lädt er mich fast immer ein.«
Sein Lachen war ansteckend. Jetzt war ich hellwach. Im nächsten Moment erreichten wir auch schon den Hafen.
Paul hatte einen festen Parkplatz, von dem es nicht allzu weit bis zu seiner Motorjacht war. Diese war nicht sonderlich groß, aber sie wirkte modern und edel. Ich hatte keine Ahnung von Booten, von der Seefahrt allgemein, sah auch in Hamburg lieber den Schiffen vom sicheren Hafen aus zu. Nur selten wagte ich mich auf eines und auch nur dann, wenn das Wasser spiegelglatt war. Entsprechend dumm stellte ich mich an, als ich auf die Jacht steigen wollte, wäre fast zwischen Steg und Reling geraten. Paul half mir.
»Mind the gap!«, rief er lächelnd, »Wir wollen doch wenigstens noch die Villa sehen. Fang auf!«
Er warf mir die zweite Befestigungsleine zu, sie fiel mir natürlich zu Boden. Mit einem Sprung war auch er im Boot, wickelte die Leinen um die Klampen – so nannte er die Befestigungshaken – und einen Moment später ging auch schon der Motor an. Mein Freund drehte am lederbesetzten Steuer, drückte einen chromglänzenden Hebel und die Jacht setzte sich in Bewegung. Nicht lange und wir waren auf dem offenen Meer, das leichte Schaukeln bekam mir überhaupt nicht. Der schwere Rotwein schwappte wohl immer noch in meinem Magen. Das gebe sich, sagte mein Freund, heute Morgen sei die See ruhig wie eine schlafende Schönheit.
»Apropos schön, schau mal nach Steuerbord!« Paul zeigte nach rechts und meine leichte Übelkeit verschwand augenblicklich. Das Meer vor der Landzunge glitzerte bereits golden und nur ein Augenzwinkern später brachen die ersten Sonnenstrahlen hervor, tauchten die Küste und uns beide in warmes Licht. Wir brauchten uns nicht anzusehen, um zu wissen, dass wir beide das Gleiche fühlten. An diesem Morgen, auf dem Meer vor Genua, waren wir die zwei glücklichsten Menschen der Welt.
4
Während der Fahrt mit seiner kleinen, aber feinen Jacht hatten wir nicht viel gesprochen. Auch bei meinem Freund schien der Wein noch nachzuwirken, vielleicht fehlte uns auch nur ein wenig Schlaf. Andererseits waren wir überwältigt von dem grandiosen Sonnenaufgang, davon, wie die ersten Strahlen warmen Lichts erst das Meer und langsam auch das Hinterland der ligurischen Küste mit seiner baumreichen Vegetation, seinen Pinien und allerlei bunten Blühpflanzen mit Glanz überzogen. Dort, wo sich Bäume lichteten, wo auch Sträucher und Gräser keinen Halt fanden, traten grobe Felsen hervor, die die Sonne mit honiggelbem Schmelz bestrich.
In dieser entrückenden Morgenstimmung näherten wir uns der Villa, jenem Haus, das für die nächste Zeit mein Zuhause sein würde. Der Gedanke jagte mir einen wohligen Schauer über den Rücken, ich fühlte mich glücklich wie lange nicht mehr, am liebsten hätte ich meinen Freund umarmt und geküsst. Er stand mit einem Gewinnerlächeln am Steuer, wieder ganz der edle Conte, dem die Welt zu Füßen liegt – ich sowieso.
Er schaute mich nicht an, aber ich wusste, dass ihm meine Gefühle nicht verborgen blieben. Täuschte ich mich oder hatten nicht auch seine Augen feucht gefunkelt, bevor er seine Sonnenbrille aufsetzte? Vielleicht war er doch nicht so abgestumpft von seinem Wohlstand, vielleicht sah er die Welt gerade auch wieder ein wenig mit meinen Augen – mit den Augen des Kindes von damals, als wir zusammen unsere kleine Welt eroberten.
Paul hatte das Boot gestoppt. Mit sanft tuckerndem Motor trieben wir in den seichten Wellen und bestaunten das Bild vor uns. Ich nahm das Fernglas, das mir mein Käpt‘n hinhielt. Die Villa stand auf einem etwa dreißig Meter hohen Felsen, sie war in einem für diese Gegend typischen Stil gebaut, hatte einen hellen Anstrich, schmale Fenster und Türen, alle mit geriffelten Läden aus cremeweiß lackiertem Holz, sowie zwei Balkone mit klassischen schmiedeeisernen und edel patinierten Brüstungen. Das Haus war alt, wirkte aber frisch renoviert. Zwischen dem von einer massiven Balustrade eingefassten Felsvorsprung und dem Gebäude befand sich eine kleine, sanft abfallende Wiese mit saftiggrünem Gras und allerlei bunten Blumen. Doch das, was mich aber am meisten anzog, waren die großen alten Pinien in direkter Nähe zur Villa.
Ich liebte Pinien über alles. Mit ihrem würzigen Duft, den knarzenden Geräuschen ihrer Äste im Wind, seinem Fauchen in den Nadeln, waren sie für mich der Inbegriff des Südens. In der norddeutschen Heidelandschaft kamen gerade noch die Kiefern an sie heran, aber nur im Sommer bei südländischer Hitze.
Eine Pinie stand an der linken Seite des Hauses, so nah, dass der kleine Balkon im zweiten Stock vor der Nachmittagssonne geschützt sein würde. Unter jahrzehntelangem Einfluss auflandigen Windes krümmte sich der Stamm samt Geäst dem Haus entgegen, berührte dessen Außenwand aber nicht. Rechts stand eine noch größere Pinie in etwas weiterem Abstand zur Villa. Bei genauerem Hinsehen erkannte ich zwei Liegen und ein Tischchen unter ihrem gewaltigen Schirm. Einen besseren Ruheplatz im Freien konnte man sich nicht wünschen. Im Licht der aufgehenden Sonne warf dieser Baum einen Schatten auf die Fassade, die im frühen Sonnenlicht wie Bernstein glänzte, das Muster des feinen Nadelgeästs wirkte wie der Einschluss einer fossilen Pflanze. Als Kind hatte ich diese honiggelb glänzenden Steine immer bewundert – im Laden, denn leider hatte ich nie einen am Strand gefunden. Keine Frage, diese Villa war ein wahres Schmuckstück. Liebe auf den ersten Blick.
Paul hatte die ganze Zeit geschwiegen, er sah genau, wie mich der Anblick gefangen nahm. Langsam setzte er das Boot wieder in Gang, steuerte auf einen Holzsteg zu, den ich erst jetzt bemerkte. Er befand sich schräg unterhalb des Felsens und führte auf einen winzig kleinen Strand aus Kieselsteinen zu. Als wir näherkamen, erblickte ich seitlich am Felsen auch eine schmale Treppe mit einem Geländer aus verrosteten Eisenstützen und einem dicken Strick als Handlauf. Der Aufgang zur Villa.
Paul lenkte die Jacht routiniert auf den Steg zu, ließ sie sanft anlegen, nicht ohne vorher die Fender auszuhängen. Weil er mich nicht dumm aussehen lassen wollte, führte alle Handgriffe selbst aus. Er dosierte den Schub so, dass das Boot sanft gegen den Steg drückte, während er hinaussprang und die zuvor ausgeworfenen Leinen an den Holzpfosten befestigte. Als schließlich alles sicher vertäut war, machte er den Motor aus.
»Na, dann wollen wir mal«, sagte er und machte eine einladende Bewegung Richtung Steg.
Ich griff nach meiner Reisetasche und stieg aus. Paul blieb dicht hinter mir, bereit mich aufzufangen. Doch diesmal brauchte ich seine Hilfe nicht.
5
Die Treppe musste jemand schon vor langer Zeit, Stück für Stück in den Felsen gehauen haben. Sie war schmal und nur grob gearbeitet. Aber die Stelle war glänzend gewählt, denn hier war das Gestein schon von Natur aus in Kanten und Absätzen geformt.
»Das sind einige Stufen, 153, um genau zu sein.« Paul sah hinauf und dann mich an.
»Komm, ich trage deine Tasche.« Er hielt mir die Hand hin.
»Das ist lieb gemeint.« Ich lächelte ihn freundlich an. »Aber unterschätze meine Fitness nicht, bis vor kurzem war ich dreimal die Woche im Studio.«
Paul hob lachend die Arme und begann, die Treppe hochzusteigen, dann hielt er inne.
»Soll ich nicht lieber hinter dir bleiben?«
»Ummich aufzufangen? Jetzt hau schon ab!«