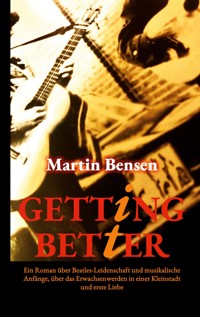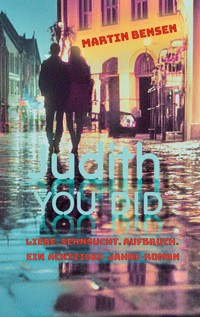
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach dem Ende von Band und Beziehung stürzt sich Tom Mitte der Achtziger voll ins Münsteraner Studentenleben. Es genießt die Freiheit, verliert aber über die vielen Fetennächte fast die Bodenhaftung. In einer Philosophie-Vorlesung entdeckt Tom seine Traumfrau - und schafft es, den Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Die gleichaltrige, aber reifere Judith zieht ihn aus seiner postpubertären Männer-WG auf eine höhere intellektuelle Ebene und in ein großbürgerliches Wohlstandsleben, das er nicht kennt. Für Tom beginnt eine Zeit der Kontraste: Bier und Eintopf hier - Schampus und Hummer dort, erst ein Billigtrip nach Kreta, dann ein Jetset-Skiurlaub in St. Moritz. Ist das die Dialektik der Achtziger Jahre? Was macht sie mit Judith und Tom?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 436
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Buch:
Nach dem Ende von Band und Beziehung stürzt sich Tom Mitte der Achtziger voll ins Münsteraner Studentenleben. Es genießt die Freiheit, verliert aber über die vielen Fetennächte fast die Bodenhaftung.
In einer Philosophie-Vorlesung entdeckt Tom seine Traumfrau – und schafft es, den Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Die gleichaltrige, aber reifere Judith zieht ihn aus seiner postpubertären Männer-WG auf eine höhere intellektuelle Ebene und in ein großbürgerliches Wohlstandsleben, das er nicht kennt. Für Tom beginnt eine Zeit der Kontraste: Bier und Eintopf hier – Schampus und Hummer dort, erst ein Billigtrip nach Kreta, dann ein Jetset-Skiurlaub in St. Moritz.
Ist das die Dialektik der Achtziger Jahre? Was macht sie mit Judith und Tom?
Autor:
Martin Bensen, 1962 in Ahaus/Westfalen geboren, ist Journalist. Seit 1989 lebt und arbeitet er in Stuttgart.
Hinweis:
Der vorliegende Roman ist fiktional. Er wurde von tatsächlichen Ereignissen, Menschen und Erlebnissen inspiriert, doch alle Figuren, Handlungen und Dialoge sind frei erfunden. Die Geschichte spielt in den 1980ern – und genauso ist sie auch geschrieben: mit der Sprache, den Denkmustern und dem Zeitgeist dieser Ära. Nicht alles entspricht heutigen Maßstäben oder Begriffen von politischer Korrektheit.
»Die Leute um mich rumwaren aufgekratzt und quatschten ohne Unterlaß, aber es passierte nichts Aufregendes, das Problem dieser Epoche schien darin zu liegen, wie man sich kleidete oder die Haare schneiden ließ, drinnen nach etwas zu fragen, was man nicht im Schaufenster fand, hatte keinen Sinn, o du meine arme Generation, die du noch nichts zur Welt gebracht hast, du kennst weder den Eifer noch die Revolte und verzehrst dich innerlich, ohne einen Ausweg zu finden.«
Philippe Djian: Betty Blue – 37,2° am Morgen. Roman.
»On baisait toutes les nuits.«
Aus dem französischen Trailer zum gleichnamigen Film.
Inhaltsverzeichnis
Erster Teil
Hühnerbein
Kant
Judith
Scheißer
Rüttler
Spiegelungen
Schwachstruller
Reisen
Montpellier
Zweiter Teil
Aufbruch
Parallelwelt
Taunus
Veränderungen
Freundeskreise
Schamgrenzen
Feiertage
Katastrophen
Kreta
Dritter Teil
Kälte
Krise
Gandia
Stuttgart
Glatteis
Prüfungen
Scham
Startrampe
Entgrenzung
Erster Teil
Hühnerbein
Nichts. Bis auf ein paar Krümel von irgendwas und den eingetrockneten Saftfleck wirkt der leere Kühlschrank fast sauber, oberflächlich gesehen. Besser mal Händewaschen. Mist, Spüli ist auch alle. Wenigstens die Ablage mit den zwei Kochplatten ist leer. Der Hängeschrank darüber leider auch. Kein einziger Teller, keine Tasse, nicht ein Besteckteil im Korb. Was ist denn hier los? Tom bückt sich zum Unterschrank, öffnet die Tür.
Dietmar, du Sau! Nicht nur, dass sich hier das ganze WG-Geschirr samt Töpfen und Besteck stapelt, natürlich benutzt und von Speiseresten verkrustet, auch ein widerlicher Gestank entweicht dem desolaten Haufen, wie ihn selbst das Klo bisher nicht abgesondert hat. Schnell schließt Tom die Schranktür, kämpft gegen den Würgereiz an, was ihm bei seinem Kater ziemlich schwerfällt. Sein Mund füllt sich mit Speichel, er beugt sich über das Waschbecken, doch es kommt nur Spucke und ein geräuschvoller Schwall Luft aus seinem Magen. Und Wut. Da hat es sich einer mal ganz einfach gemacht – aus den Augen aus dem Sinn.
Dietmar war mit Putzen dran, aber seit sie in der WG keine Liste mehr führen, was sie genau genommen auch nur fünf Wochen nach ihrem Einzug gemacht haben, sind sie komplett durcheinander gekommen. Mal ist der eine ausgerechnet in seiner Putzdienst-Woche weg, mal hat der andere mit dem Nächsten getauscht, muss aber dann doch für eine Klausur büffeln und so weiter. Aber diese Woche war Dietmar dran!
Er ist übers Wochenende nach Hause gefahren. Wie eigentlich halb Münster, Uni-Münster. DiMiDo-Studenten, alles Schwachstruller, um mit Freddie zu sprechen, dem ebenso ungekürten wie unhinterfragten Boss der Fünf-Männer-WG. Eigentlich heißt er Ferdinand, aber niemand sollte ihn so nennen, sonst kriegt er es mit seiner testosteron-und sportgestählten Schlagkraft zu tun. Was seine Faust anrichtet, hat Tom einige Male auf Feten gesehen, wenn ein anderer Testo-Hirsch ihn herauszufordern wagte. Tom bewundert Freddie dafür, auch wenn er selbst ein friedliebender Mensch ist – er hat noch nach dem Wehrdienst verweigert, es wenigstens versucht; seit Oktober 1982 ist er Student der Germanistik und Philosophie auf Lehramt, inzwischen schon im Hauptstudium, das fünfte Semester neigt sich bereits dem Ende zu, jedenfalls in Germanistik – in Philosophie ist er erst im dritten Semester, weil er bei der Einschreibung dummerweise Chemie als zweites Fach gewählt hatte; angeblich ging die Kombination mit Sozialwissenschaften nicht, wie man ihm beschied. Mit so etwas Vergeistigtem wie Philosophie braucht er Freddie nicht zu kommen, schon gar nicht beim abendlichen WG-Bier, aus dem nicht selten ein Saufabend wird, angefeuert durch Freunde, die ebenfalls nicht selten unangemeldet kommen, meistens mit weiteren Bierkisten oder wenigstens einem Sixpack im Schlepptau.
Freddie trägt seinen Spitznamen zu Recht, er ist eine ziemlich gute Version des Queen-Sängers, mit seiner schwarzen, nach hinten gekämmten Kurzhaarfrisur, seinem ebenso schwarzen Schnäuzer, der »Schenkelbürste«, wie er sie selber nennt. Obwohl Tom solche männlichen Zoten eigentlich hasst, kriegt er die damit verbundene Vorstellung nur schwer aus dem Kopf. Was auch immer es ist, er kennt mindestens drei Frauen, die erklärtermaßen verrückt nach Freddie sind, auch wenn sie wissen, dass er seiner Susi total treu ist, was er zumindest seinen Mitbewohnern oft und gerne und mit extra rollendem Münsterland-R versichert. Freddie kommt wie Tom vom Land, aus einem Ortsteil seines Heimatstädtchens Doesbeck, keine fünfzig Kilometer von Münster entfernt. Und weil die Heimat und seine Susi so nah sind, fährt er jedes Wochenende, oft schon am Donnerstag, nach Hause, um meistens erst dienstags wieder in der WG aufzuschlagen. DiMiDo-Student halt, Schwachstruller – zumindest in dieser Beziehung. Volker und Torsten auch.
Nur Dietmar bleibt schon mal übers Wochenende da, geht aber auch dann kaum raus. Er ist ein Stubenhocker und Faulenzer. Alle wissen, dass er nicht richtig studiert – auf Lehramt wie Freddie, Volker und Tom, aber irgendwann hat er es schleifen lassen, aus welchem Grund auch immer. Meistens liegt er auf dem Bett in seinem Zimmer, dem größten in der Fünfer-Wohnung – pures Glück beim Auslosen vor dem Einzug. Auch Tom kann sich nicht beklagen, sein Zimmer ist zwar recht klein, aber es hat als einziges einen Balkon, auf dem die fünf Männer gerade mal Platz haben.
Dietmar trinkt tütenweise O-Saft, raucht Unmengen an Selbstgedrehten, und wenn man sein Zimmer, ohne anzuklopfen betritt, was Freddie mit Vorliebe tut, liegt er meist auf dem Bett und starrt die Decke an oder er sitzt auf der Kante seines Schreibtisches und starrt aus dem Fenster. Genau zweimal hat Tom versucht, ihm irgendwie näher zu kommen, ihm zumindest zu signalisieren, dass er bereitstehe, falls er reden wolle. Dietmar hat nur mit den Schultern gezuckt, »Ne, wieso?« und »Alles gut« gesagt und Tom in einer Art Rollenumkehr nahegelegt, er solle doch lieber bei sich selbst nach Defiziten suchen.
Seit einiger Zeit fehlt Dietmar bei ihren Abendbierrunden, überhaupt ist etwas in Schieflage geraten. Die ursprüngliche Toleranz und Gelassenheit sind weg, die Ausgelassenheit mancher Abende, die Spontan-Feten in der Küche, der fröhliche Lärm, der auch das Klopfen der Streber-Nachbarn übertönte, der WG dafür Polizeibesuche einbrachte und schließlich eine Vorladung bei ihrem Vermieter, dem Studentenwerk Münster, wo sie eines ziemlich frühen Morgens vollzählig, aber verkatert vortanzten.
Den Blick der Chefin, einer nicht unattraktiven Frau in den Vierzigern, wird Tom nie vergessen: erst streng und abweisend, zwischen der Akte mit der Aufschrift W13, der Wohnungsnummer, und den vor ihrem Tisch stehenden Delinquenten hin und her wechselnd, während sie sie belehrte und einige der dokumentierten Missetaten aufzählte, dann, beim Zuklappen der Akte deutlich freundlicher, begleitet von einem unverhohlenen Grinsen und dem Wunsch, die fünf jungen Männer bitteschön nicht mehr wiedersehen zu wollen. Sie ist auf unserer Seite, dachte Tomund verliebte sich augenblicklich in sie. Freddie offenbar auch, er hatte wieder dieses anmachende Funkeln in den Augen und wollte gerade etwas sagen, als ihn die anderen mit vereinten Kräften aus dem Büro schoben, froh, entgegen ihrer Befürchtung doch nicht aus der Wohnung geflogen zu sein.
Überhaupt Freddie, schon verwunderlich, dass keine Aktennotiz speziell zu ihm drin war, jedenfalls nicht, dass sie es wüssten, wo er ihnen doch schon beim Einzug angekündigt hatte, dass seine Freundin laut sei, was sie an einem Wochenende, an dem beide in der WG übernachteten, weil Send war, selbst durch zwei geschlossene Türen eindrucksvoll und zweifelsfrei belegten. Besonders die Bewohnerin unter ihnen konnte dem Phänomen nicht entkommen, da das rhythmische Sexspiel unglücklicherweise von einem wackligen Bettsofa derart verstärkt wurde, dass es ihr zu bunt wurde. So stand sie kreidebleich und fassungslos vor der Wohnungstür, um Tom fast unter Tränen mitzuteilen, dass sie mitten in ihrer Diplomarbeit stecke. Trotzdem tat sie ihm nicht leid, denn es lag nahe, dass sie zu denen gehörte, die die WG beim Studentenwerk verpetzten. Die anonym angezettelte Unterschriftenaktion haben die fünf Männer mit Spott und Humor pariert. Das auf rotem Papier mit dickem Filzstift verfasste Plakat gegen den »Terror von W13« bekam, kaum dass es im Eingangsbereich hing, einen Ehrenplatz an ihrer Küchen-Pinnwand.
Angeekelt pfeffert Tom Dietmars Tüte mit der verklumpten Milch in den schwarzen Müllsack. Diese WG-Trägheit nach nicht mal einem halben Jahr muss ein Ende haben. Sie können nicht Jahre so hausen, drei wird er noch bis zu seiner Prüfung brauchen. Und sie sind nun wirklich keine Hänger, Müslis wie Bärchen und Mausezahn – er findet es lachhaft, wie die typischen Münsteraner Studenten sich in den Kontaktanzeigen des Stadtblättchens Na dann titulieren. So lachhaft, wie sie aussehen: die Frauen in India-Kleidern, wahlweise Latzhosen, oft mit gefärbter Kurzhaarfrisur, die Männer mit Vollbärten und halblangen Haaren. So sind die W13er nicht. Auch Dietmar nicht. Eher ein Muttersöhnchen, das sich sein Essen frei Haus liefern lässt. Regelmäßig kommen seine Eltern aus Beckum angefahren, um ihm den Kühlschrank mit allerhand Fressalien vom Discounter zu füllen, darunter so fragwürdige Delikatessen wie einge schweißte Hähnchenschlegel, die trotz ihres ziemlich befremdlichen Aussehens schon ein Mundraub der WG-Geier wurden. Genauer gesagt war es Volker, der nach einer Zechtour »Bock auf was Würziges« hatte und Dietmars letztes Hühnerbein unter albernem Gegacker direkt aus der Packung verschlang.
Volker ist ein Schwerenöter, sensibel, aber auch ein bisschen unberechenbar, wenn er besoffen ist. Nicht gefährlich, aber doch sonderbar. Es heißt, er streife nachts durch die Flure des Wohnheims, gebe dabei seltsame Geräusche von sich. Das sei Quatsch, sagt er, wenn auch mit seinem typischen schalkhaften Grinsen auf den Lippen, die immer aussehen, als klebe noch Tomatensoße seiner Fertigspaghetti daran.
Tommuss lachen. Im Grunde sind sie eine Super-Truppe, jeder Einzelne von ihnen ein Super-Typ, selbst Dietmar und auch Torsten, den man leider immer etwas »anwärmen« muss, um ihn aus den Kältekammern seines drögen Wirtschaftsstudiums zu holen. Torsten hat im allerletzten Anlauf seine Matheprüfung bestanden und so die WG gerettet. Bei der Klausur war er sogar leicht bedröhnt, weil er abends ein, zwei »Entspannungsbierchen« zu viel getrunken hatte. Wenn das mit Mathe nicht geklappt hätte, wäre ihre Fünfer-WG »am Arsch gewesen«, wie Volker sagte, als sie auf dem obersten Balkon ihres ehemaligen Wohnheims, wo jeder nur eine Zehn-Quadratmeter-Zelle mit Waschbecken hatte, ausharrten, um Torsten schon von Ferne zu sehen, und in erlösenden Jubel ausbrachen, als er endlich angeradelt kam und seinen rechten Arm in Siegerpose nach oben reckte. Wenig später zogen sie aus dem alten Wohnheim aus, direkt nach nebenan in den Neubau, ein Pilotprojekt des Studentenwerks, das sich ausdrücklich an WGs richtet. Tom freut sich immer noch, es hierher geschafft zu haben – Belohnung für monatelangen Baulärm direkt unter seinem Zimmerfenster. Seitdem er hier wohnt, weiß er, was Leben ist. Nie zuvor hat er so viel Spaß gehabt wie in dieser WG.
Und doch spürt er, dass sie ihre besten Zeiten gesehen hat. Die Jungs fehlen ihm plötzlich sehr. Heute Abend wird er der Einzige von ihnen sein, der nach nebenan auf die Fete geht. Sonst war wenigstens noch Dietmar dabei, wenngleich er meist nicht lange blieb.
Tom spürt, wie sich sein Herzschlag beschleunigt. Diese Frau aus der Vorlesung, die es ihm angetan hat, die plötzlich auf der Bildfläche erschienen ist, für die er schwärmt, von Ferne, wie ein ergriffener, aber noch stummer Minnesänger – keine Ahnung, warum, aber er hat so ein Gefühl, sie könnte heute Abend auch dort sein. Er hofft es, denn die Party im benachbarten Wohnheim ist bekannt und beliebt unter den Münsteraner Studenten.
Draußen dämmert bereits der Abend. Die Felder verschwimmen im Schneeregen, ihr diesiges Grau vermischt sich mit dem des Himmels, nicht lange und es wird stockdunkel sein. Seine Augen verlagern die Schärfe, erkennen den Schmutzfilm an der Fensterscheibe, darin sein Spiegelbild, das ihm älter vorkommt als das eines 23-Jährigen, der immerhin das »Orwell-Jahr« 1984 überlebt und glücklicherweise nichts von dem erlebt hat, was George Orwell in seinem gleichnamigen Roman aus seiner Anschauung von Totalitarismus vierzig Jahre zuvor für vorstellbar gehalten hatte.
Eine Weile hat er Orwell verehrt, auch seine Animal Farm, die er im Englisch-Leistungskurs gelesen hat. Der Autor starb zu früh, um seine 1984-Vision auch in der DDR wiederfinden zu können, in der genau dieses Buch folgerichtig verboten ist. Aus Revolution wird Diktatur, die erkämpfte Freiheit kommt unter die Räder und mit ihr auch die Ideale. Etwa bei den 68ern, denen Tom unterstellt, ihre Revolution und auch die Arbeiterklasse verraten zu haben, als sie in Scharen ins Establishment wechselten und heute gut bezahlte, angepasste Richter, Ärzte und Lehrer sind. Mit dieser Ansicht ist Tom allerdings ziemlich allein unter seinen links-alternativen Kommilitonen. Mit einigen hat er sich nach Seminaren schon heftig gestritten, meistens im Kakaobunker, der etwas schmuddeligen Kantine im Keller des Fürstenberghauses, seiner Alma Mater für Literaturwissenschaft, unweit der Linguisten, Philosophen und Theologen. Tom findet es beschämend, dass K-Gruppen, Emanzen und Jutetaschen-Ökos noch genauso agitieren wie die Achtundsechziger.
Neulich ist eine Gruppe Studentinnen mit lila Tüchern in ein Hegel-Seminar gestürmt, hat den Dozenten des Pultes verwiesen, um »über das Frauenbild Hegels« zu diskutieren. Die meisten Teilnehmer haben sich schnell verdünnisiert, auch Tom ist der Ton zu aggressiv gewesen. Immer wieder platzen Vorlesungen wegen hohler »Sit-ins«, Sitzstreiks und Sponti-Diskussionen, bei denen marxistischer Kauderwelsch verbreitet wird, den er nicht versteht, was er auch von den Vortragenden selbst vermutet. Einmal war sogar der Eingang des Fürstenberghauses versperrt. Streikende hatten einen riesigen Hintern aus Pappmaché vor die Haupttür gestellt; jeder der hindurch wollte, musste durch das Arschloch kriechen, was natürlich niemand machte. Ganz Schlaue nahmen den Seiteneingang für Dozenten, mussten dann allerdings erkennen, dass die meisten Profs gar nicht da waren, sondern ihre Veranstaltungen kurzerhand abgesagt hatten.
Das Hungergefühl ist einem stechenden Bauchschmerz gewichen. Tom geht durch den stillen, dunklen Flur ins Badezimmer, hält seinen Mund unter den Wasserhahn, trinkt in kleinen Schlucken und spürt den kühlen Schwall im Magen. Leider steigt ihm auch Volkers grässliches Männerparfüm in die Nase. Tom fragt sich, was ihn geritten hat, dieses billige Zeug vom Discounter zu kaufen und bei jeder Gelegenheit in der Wohnung zu verteilen. Vielleicht riecht Tom auch nur den schalen Rest davon, das Waschbecken klebt von Seifenresten und Volker ist momentan nicht nach Streichen, er muss büffeln.
Jetzt ist alles ruhig. Das ganze Haus scheint verlassen. Es gruselt Tom, er mag es nicht, bei Dunkelheit alleine zu sein. Den nasskalten Samstag hat er komplett verschlafen. Kein Wunder, denn wenn er um 23 Uhr das Postgebäude verlässt, ist noch genug Zeit für das Nachtleben. In letzter Zeit treibt er sich gerne auf Wohnheim-Feten herum, bevorzugt am Wochenende, wenn nur noch der harte Kern von Studenten da ist – und eindeutig die schöneren Frauen. Meistens belässt er es bei einem Flirt. Ein wenig knabbert er noch an seiner letzten verflossenen Beziehung. Diesmal hat er sie beendet – und sich so mies gefühlt wie damals, als ihn seine erste Liebe wegen eines anderen verlassen hatte. Weil das alles mit seinem Heimatort verbunden ist, fährt er kaum noch nach Hause, obwohl sein »Zuhause« ja nur einen Katzensprung entfernt liegt. Räumlich gesehen. Mittlerweile liegen Welten zwischen seinem Leben in Münster und dem vergangenen in Doesbeck. Alles hat seine Zeit. Gut so!
Er erinnert sich nicht mehr genau, wie er in sein Bett gekommen ist. Er weiß nur noch, dass er nach dem Ende der Fete ins Bahnhofsviertel gezogen ist, zusammen mit einem gar nicht mal so guten Bekannten und zwei völlig fremden Frauen. Bruchstückhaft stehen ihm Bilder vor Augen. Wie ihm eine der beiden Frauen den Kopf gehalten hat, als er gekotzt hat, irgendwo draußen an einem Bretterzaun. Mehr weiß er nicht. Mehr will er nicht wissen. Immerhin ist er im eigenen Bett aufgewacht, noch dazu allein.
Er hat noch Zeit bis zur Droko-Party. Bloß nicht zu früh kommen. Zu früh auf eine Fete kommen ist nie gut. Die, die schon da sind, wenn die interessanten Gäste kommen, sind verbrannt, kleine Verlierer, die sich den ganzen Abend abstrampeln können und doch keinen Stich machen. Das benachbarte Drosten-Kolleg, ein Gebäudekomplex aus rotem Backstein, macht mit Abstand die besten Wohnheim-Feten in Münster, zweimal im Jahr gegen Semesterende, und dann gleich in zwei Teilen: am Samstag- und am Montagabend. Kenner wissen, dass der Samstag der bessere Tag mit den besseren Leuten, der besseren Musik ist. Der Montag ist nur ein müder Abklatsch und trotzdem ist die Aula immer viel voller. Natürlich wird er übermorgen mitgehen, wenn seine W13-Jungs hinwollen. Aber jetzt ist er doch ganz froh, dass sie nicht dabei sind.
Tom nimmt sich vor, nur wenig zu trinken, ganz entspannt und souverän, er will nicht noch einmal die Kontrolle verlieren, will mit allen Sinnen er selbst sein. Wenn nur die geringste Chance besteht, dass sie heute Abend kommt, will er vorbereitet sein.
Kant
Der Saal ist schon ziemlich voll, leider mit weitaus mehr Männern als Frauen. Einige der Typen sehen mit ihrer biederen Kleidung aus, als kämen sie vom Land, jedenfalls nicht wie Studenten. Das ist neu. Nicht gut.
Nicht dass das heute noch Ärger gibt hier. Ob denen jemand erklärt hat, dass das kein Schützenfest ist?
Er arbeitet sich zur Getränkebar vor. Wenn er schon nichts zu essen bekommt, dann muss es das flüssige Brot tun, immerhin gibt es Pils vom Fass. Anders als in den Progressiv-Discos läuft auf der Droko-Fete aktuelle Popmusik. Nur auf Wunsch spielt der Typ am Plattenpult auch ältere Sachen. Weil er aber die Frauen bevorzugt bedient – Tom kennt das bärtige Bärchen schon –, ist mit Rock nicht zu rechnen, und Punk und New Wave sind ganz bestimmt nicht sein Ding, schade!
Ein Disco-Kracher dringt aus den Boxen: Big In Japan von den Münsteranern Alphaville. Heimspiel. Prompt schwappt eine Welle Tanzwütiger in die Mitte des Saals. Traditionell schwoft hier jeder, wo er will, mal ist fast der ganze Saal in Bewegung, mal sind es ein paar Häufchen inmitten des Publikums, nur am äußersten Rand stehen die Gaffer, Männer, die sich nicht trauen, die ihre Schüchternheit hinter coolen Blicken und einer wohl Humphrey Bogart nachempfundenen Art des Rauchens kaschieren. Im Nebensaal gibt es Tische und Bänke, aber da sitzen nur die, die »reden« wollen, Frauen, die sonst in alternativen Cafés sitzen und ständig Milchkaffee-Schalen mit beiden, halb von Strickbündchen gewärmten Händen umschließen, während sie reden und ganz oft »Duuu ... ich« sagen, theatralisch intensiv zuhören und verständnisvoll nicken, »na klar«, »find ich gut«, »total toll« ... Was die auf so einer Fete wollen, ist Tom ein Rätsel.
Jetzt will es Bärchen aber wissen. In den Auslauf von Alphaville platzt die prägnante Synthesizer-Fanfare des nächsten Hits und lässt die Menge augenblicklich jubeln. Wie kleine Springteufelchen hüpfen jetzt vor allem Männer in den Ring und grölen, noch ehe David Lee Roth von Van Halen überhaupt Jump singen kann. Tom beschließt zu nehmen, was kommt. Was soll er sich über die Musik aufregen? Deswegen ist er ja nicht hier.
Tomhat sie noch nirgends entdeckt. Instinktiv schreckt er davor zurück, den Saal zu durchkämmen, sich durch die eng stehende, tanzende Menge zu drücken. Es wird sich ergeben. Er ruft sich ihr Bild ins Gedächtnis, denkt an die Vorlesung, doch genau damit hat es ihn wieder: sein schlechtes Gewissen. Er hat ein Semester komplett vergeudet, nichts zustandebekommen, war nur auf Feten unterwegs, ständig verkatert, hat da schon seine Freundin vernachlässigt, sein Leben irgendwie überhaupt. Und über allem die Sinnfrage, als ob es nicht eine Nummer kleiner ginge. Wenn er gedacht hatte, dass die Philosophie ihm Antworten gibt, hat er sich getäuscht. Die großen Gelehrten sind handfest, Platon, Aristoteles, Descartes, Kant, Hegel. Besonders Kant! Was für ein strenges, unerbittliches System, »Die Kritik der reinen Vernunft«, die ganz und gar unbestechliche Ethik, frei von jeder Subjektivität.
Zusammen mit seinem Studienfreund Heinz, der ihn immer an eine jüngere Ausgabe von Franz Alt erinnert, den Autor des auch von Tom verschlungenen Bestsellers »Frieden ist möglich« und wegen seiner Kohl-Kritik mit einem Moderationsverbot belegten Fernsehjournalisten von Report Baden-Baden – mit Heinz besucht er eine Kant-Vorlesung, hinterher gehen sie meistens ein Bier trinken und versuchen sich ganz bierernst an Begriffsklärungen, Heinz so messerscharf, dass Tom ihn bewundert und sich einmal mehr fragt, was er selbst in diesem Fach zu suchen hat. Bis sie auftauchte.
Tatsächlich hat er sie nicht gesucht, er hat sie entdeckt und das auch nur, weil er bei genauem Hinsehen fand, dass sie von der Seite seiner ehemaligen Freundin ähnlich sieht. Dann wieder verlor sich dieser Eindruck, als wäre sie ein Chamäleon oder er nicht ganz bei Sinnen. Wie auch immer, diese Frau faszinierte ihn zusehends. Sie saß im steilen Auditorium schräg unter ihm, in der allerersten Reihe. Er konnte den Blick kaum noch von ihr lassen, studierte ihr Verhalten, ihre Konzentration, ihre Art des Nachdenkens, mit übereinandergeschlagenen Beinen und dem aufgestützten, nach innen gedrehten Unterarm, den Stift an den Lippen und dann wieder auf dem Block in ihrem Schoß, wie sich meldete, kaum merklich mit dem nur leicht abgewinkelten Arm, schließlich etwas fragte, so leise, dass er nichts verstand, der Professor sehr wohl, manchmal tritt er ganz nah auf sie zu, eine Wertschätzung, die bisher nur ihr zuteil wurde, sicher ist auch er total vernarrt in sie. So wie Tom. Nur dass sie ihn nicht beachtet, auch nicht beim Verlassen des Hörsaals, immer verpasst er sie, weiß der Geier, warum. Hätte sie ihn während der Vorlesung sehen wollen, hätte sie ihren Kopf um 120 Grad nach rechts drehen müssen, was er natürlich nicht verlangen konnte.
Und so bewunderte er sie aus der Ferne, ihre gepflegte, modische Erscheinung, das schwarz glänzende, schulterlange Haar, das sie mit einem hellen Stirnreif hinten hielt. Um der Vorlesung des Professors zu folgen, musste sie Tom ihr Profil zeigen, die gerade, schmale Nase, die Sommersprossen, die er aber nur erkennen konnte, weil er dort, wo er saß, seine Brille aufsetzen musste, die er sich eigens für die hinteren Plätze zugelegt hat. Er hasst es, vorne zu sitzen, womöglich »drangenommen zu werden« und vor dem ganzen Hörsaal, der zwar nicht bei dieser, aber bei anderen Vorlesungen zum Bersten gefüllt sein kann, etwas sagen zu müssen. Sich in einer Vorlesung vor Hunderten Studenten zu melden, ist für ihn ein Ding der Unmöglichkeit, aber auch in vollen Seminaren mit dreißig oder mehr Leuten, ist er gehemmt, dann graut ihm immer vor den Referaten, die leider Pflicht sind für einen Schein. Die Frau in der ersten Reihe hat mit solchen Psychosen sicher nicht zu kämpfen, sie ist selbstbewusst, noch dazu bildschön – einfach bewundernswert!
Er konnte den Blick nicht von ihr abwenden, was natürlich dazu führte, dass er den Gedanken des Professors nicht mehr folgen konnte. Nein, die Strahlkraft dieser Frau war zu stark, einmal trug sie einen pinkfarbenen Pullover mit schwarzem Leopardenmuster, dazu einen passenden Haarreif und eine schwarze Hose. Ihre halbhohen Lederschuhe wirkten elegant, überhaupt sieht sie nicht aus wie die meisten anderen Studentinnen, sie ist eine richtige Dame. Nur ihre Augen hatte er bis dahin nie richtig sehen können. Er tippte auf braune Augen, sie passten zu ihrer fast südländischen Erscheinung, ihren hohen Wangenknochen, die sie ein wenig aristokratisch wirken ließen. Und dann kam der Moment.
Ausgerechnet sein Sitznachbar Heinz war es, der ihm die ersehnte Gelegenheit eröffnete: Völlig überraschend hatte er sich gemeldet, und als er seine Frage stellte, war Tom so perplex, dass er fast die einmalige Chance verpasste. Tatsächlich hatte sich auch die junge Dame aus der ersten Reihe zu Heinz umgedreht. Braune Augen, wie ich vermutet habe, aber sie leuchten, glühen fast. Raubtieraugen.
Wie gelähmt starrte er in dieses schöne Gesicht, die vollen Lippen, die leicht in Falten gelegte Stirn. Eine Denkerstirn, dachte er und war wie gefangen von der Wirkung ihres Blicks, versteinert wie von dem der sagenhaften Medusa. Heinz war längst verstummt, der Professor antwortete bereits, und alle hingen wieder an seinen Lippen, als Tom immer noch in ihre Richtung starrte, und sie sich plötzlich ein weiteres Mal umdrehte, nicht zu Heinz, sondern zu ihm. Ihre Blicke trafen sich, fast hoffte er auf ein Lächeln, doch sie drehte sich langsam wieder um, diesmal für den Rest der Vorlesung. Beim nächsten Mal fehlte sie, ihr Platz blieb leer, als sei er nur für sie bestimmt, auch in ihrer Abwesenheit. Das war am vergangenen Dienstag.
Die letzten Takte von Eurythmics‘ Sweet Dreams verklingen – wie passend –, jetzt wird es seichter: Die prägnante Melodie von Careless Whisper holt ihn in die Gegenwart zurück. Er mag diese Schnulze von George Michael, findet den glasklaren Sound, die Melodie und das Arrangement perfekt, selbst das Saxofon, auf das er sonst gut verzichten kann. Anders als viele seiner Freunde, besonders die männlichen, ist er froh, dass die muffigen Siebziger vorbei sind, weder hängt er den filzigabgerockten Hippiezeiten nach, noch der ersten rauen Punkwelle, die Achtziger mit Funk und Soul erweitern seinen musikalischen Horizont, gleichwohl macht es ihn traurig, dass die Punk-, Wave- und Rockansätze, die er gerne mit einer neuen Band umgesetzt hätte, zunehmend weichgespült werden. Aus The Jam wird Style Council, U2 werden komplizierter, abgeklärter, die Ramones, die Simple Minds, The Cure– alle erscheinen softer oder treten in den Hintergrund wie The Sex Pistols, The Clash, The Police; was in den Charts überleben will, wird geschliffen, lackiert und tanzbar gemacht, aber die Sounds sind auch edler, klingen auf CD sauberer, vielleicht zu sauber. Clean. Und Smooth. Sade mit ihrem gleichermaßen unterkühlten und erregenden Smooth Operator, dem unvermeidlichen Saxofon, das sich wie eine schnurrende Katze anschmiegt; die Erotik der Achtziger erscheint anders: nicht mehr so hässlich, schmierig und direkt, sondern distanziert, unnahbar, cool. Jetset-Neon-Sex statt Jeansstoff-Hippie-Fick.
Seit Herbst 1982, seitdem er studiert, macht er keine Musik mehr, vielleicht genau wegen dieser Entwicklung weg von der ungeschminkten, bewusst auch schrägen Gitarrenmusik, hin zu technisch anspruchsvolleren Aufnahmen und Gigs, die ihn faszinieren, aber auch einschüchtern. Im Grunde weiß er auch nicht mehr, was er will. Vielleicht schreiben, das geht gut alleine. Ihm fehlen Gleichgesinnte, mit denen er sich eine Band vorstellen könnte. So einer wie Botte, sein ihn prägender Freund und Mitmusiker bis Anfang der Achtziger, er ist hier noch irgendwo in Münster, bestimmt büffelt er für sein Wirtschaftsstudium statt wie Tom auf Feten rumzuhängen, er hat ihn so lange schon nicht mehr gesehen. Zuletzt hat er seinen Musikgeschmack nicht mehr geteilt. Die Band war am Ende, als im Herbst 1982 auch die sozialliberale Koalition in Bonn zerbrach. Jetzt lebt Tom schon fast zwei Jahre unter der Regentschaft Helmut Kohls, und er findet, das spürt man.
Der Christdemokrat Kohl, so sehr auch als »Birne« verlacht, steht zusammen mit dem wirtschaftsliberalen Hans-Dietrich Genscher für eine andere Zeit, für eine kältere, mehr auf Leistung getrimmte Gesellschaft. Vielleicht kommt es ihm auch nur so vor, weil er jetzt erwachsen ist, schon längst arbeiten und »Geld verdienen« könnte, statt zu studieren und der Gesellschaft, vielmehr seinen Eltern, auf der Tasche zu liegen, anders als die jungen, schon in Lohn und Brot stehenden Leute aus seiner Doesbecker Nachbarschaft, was deren Eltern seinen Eltern bei jeder Gelegenheit aufs Butterbrot schmieren, was seinen Vater, den überzeugten »Sozi« aber erst recht opponieren lässt wie seine SPD im Bundestag, obwohl Mutter und Vater nicht ohne Sorge sind, was die Zukunft ihrer drei Söhne angeht, und ihn, der es im letzten Semester hat schleifen lassen, ganz besonders, auch wenn sie davon nichts wissen, auch nicht wissen sollen, und er sein Versagen allein mit seinem Gewissen ausmachen muss.
Immerhin hat er sich den Job bei der Post besorgt, und das Wintersemester läuft auch wieder besser, muss es auch, weil er jetzt im Hauptstudium ist, was er eben auch ernst nehmen will. Die Erstsemester sind schon anders, zielstrebiger, echte Aktivposten der Wendezeit, sie kleiden sich auch anders, nicht mehr so nachlässig, wirken selbstbewusster, gleichzeitig unpolitischer. Aber vielleicht ist das nur sein Gefühl, auch er redet seltener über Politik als früher, die alten Themen, allen voran der Kalte Krieg, sind schal geworden, man flüchtet sich mehr ins Private, einzig die Ökos scheinen jetzt stärker zu werden, in der Umweltbewegung haben die Alternativen eine neue Heimat gefunden, man sieht sie jetzt bei den Grünen, ebenso wie die Achtundsechziger, allen voran Joschka Fischer, der mit den Grünen den Bundestag aufmischt und einen echten Gegenpol zu Kohl, aber auch den anderen etablierten Parteien bildet.
Bärchen am Plattenspieler ist für einen Moment abgelenkt, es geht nicht weiter. Jetzt hört man das laute Durcheinander von Stimmen, verschwitzte Menschen verlassen die Mitte, drängeln sich um die Getränkebar. In den Boxen knackt es, drüben reflektiert eine CD-Hülle den Lichtschein der Funzel über dem Musikpult. Hat Bärchen etwa Ladehemmung? Offenbar klappt das Zusammenspiel von Plattenspieler und CD-Player nicht so. Zeitenwende in der Zeitschleife – Tom muss grinsen. Doch im nächsten Moment erstarrt er.
Ist das neben Bärchen nicht ...? Er müsste sich schon sehr täuschen, wenn das nicht die Frau aus der Kant-Vorlesung ist. So ein Zufall! Er hat sie hier noch nie gesehen, jedenfalls nicht bewusst. Jetzt oder nie! Doch gerade als er rübermarschieren will, legt sie ihre Hand auf Bärchens Oberarm und lächelt ihn an. Jetzt lässt sie los und verschwindet in der Menge. Im selben Moment erklingt das Saxofon von Smoot Operator, noch so ein Zufall, aber eigentlich naheliegend nach George Michael. Es scheint so, als ob sie sich das Stück gewünscht hat und damit das Gleiche gedacht hat wie Tom. Naheliegend oder nicht, er nimmt es als Zeichen, aber eher so nebenbei, zu nervös ist er jetzt.
Tommischt sich unters Volk, sieht sie erst nicht, entdeckt sie schließlich im hintersten Eck der Aula. Sie tanzt für sich, hat die Augen geschlossen, ihre Bewegungen sind geschmeidig, sparsam, passend zum Stück. The Smooth Operator. Coast to coast, LA to Chicago, western male ... Kein Western Male bei ihr, um sie herum nur Frauen. Das ist gut. Jemand berührt ihn an der rechten Schulter, Tom dreht sich um, sieht niemanden, dreht sich nach links, erkennt Angela. Mist! Ausgerechnet jetzt, und dann noch mit dem ältesten aller dummen Scherze.
Angela ist ein kleiner Flirt aus dem letzten Sommer. In ihrem Girlie-Outfit ist sie nicht nur ihm sofort aufgefallen, eine Mischung aus Madonna und Cindy Lauper, ... just wanna have fun ... ziemlich süß, aber irgendwie auch sehr künstlich. Ausgerechnet ein Epilepsie-Anfall des Philosophie-Professors machte sie miteinander bekannt. Mitten im Vortrag erstarrte und verkrampfte der ältere Mann an seinem Stehpult, was zunächst für Lacher sorgte, denn der Prof war wegen seines humorvollen Vortragsstils beliebt, doch diesmal machte er keine Scherze. Seine Assistentin erhob sich aus der ersten Reihe und bat um Ruhe. Nicht lange, und der Professor richtete sich auf und trat für einige Durchatmer ans Fenster, um bald danach seine Vorlesung fortzusetzen, als wäre nichts geschehen.
Angela stand später unschlüssig im Flur und schien auf irgendjemanden zu warten. Er lächelte ihr zu, sie lächelte zurück und sprach ihn gleich an. Ob sie nicht zusammen in den Kakaobunker gehen wollten, sie müsste jetzt unbedingt mit jemandem reden. Wider Erwarten hatten sie Spaß, sie war lustig und wirklich sehr süß. Einige Male trafen sie sich noch, doch mehr wurde nicht daraus – zu viel Chaos bei Tom. Auf der Droko-Fete im letzten Sommer hat sie ihm gestanden, dass sie ziemlich verknallt gewesen sei, aber dass sie seine Situation verstanden hätte – er konnte sich gar nicht erinnern, ihr allzu viel von seinem Beziehungsstress erzählt zu haben.
Sie sieht jetzt anders aus, ihr Haar ist nicht mehr blond und lang, sondern kurz und schwarz, alles an ihr ist schwarz, sogar ihre Tränensäcke, sie sieht ausgemergelt aus. Sie starrt ihn mit großen Augen an, freut sich offensichtlich, ihn wiederzusehen, setzt ihn damit unter Stress. Er will nicht mit ihr reden, will zu der schönen Frau aus der Vorlesung, gleich ist das Lied zu Ende und sie wird die Tanzzone verlassen, vielleicht sogar das Fest.
»Hey, schön dich zu sehen!« Er muss gegen die Musik anschreien. »Sorry, ich wollte mir gerade ein Bier holen.«
Eine spontane Eingebung. Dumm nur, dass nicht nur ihr Glas, sondern auch seines noch halb voll ist. Er trinkt es auf Ex.
Angela blickt ihn beleidigt an. »Hab schon verstanden, Arschloch!« Abrupt wendet sie sich ab und wird von der Menge verschluckt.
Tut mir leid, denkt er, aber jetzt geht es um Leben und Tod.
Das Lied läuft aus, Bärchen macht Schocktherapie und schickt Depeche Mode ins Rennen, Master And Servant, sofort schießen ihm die Bilder aus dem rasant geschnittenen Video in den Kopf. Er versucht keine Folge der Musiksendung Formel Eins zu verpassen.
Er wischt die Bilder beiseite, konzentriert sich auf die Tanzecke, sieht sie dort nicht mehr, bahnt sich einen Weg durch die wogende Menge, aber wohin?
Dann steht sie vor ihm.
Judith
Wir sind auf einer Insel mitten im wogenden Meer. Um uns tost ein Sturm, doch hier bei uns ist vollkommene Stille. Wir müssen uns nur immer ansehen, uns ineinander vertiefen. Solange wir ganz bei uns sind, kann uns nichts und niemand etwas anhaben.
Täuscht er sich oder sind tatsächlich alle auf Abstand gegangen? Ist die Musik leiser geworden?
Tu was! Sag was! Sie will schon an dir vorbei! Nein, geh nicht!
Sie zögert. Ihr Blick! Nicht abweisend, erstaunt.
»Kennen wir uns?«, fragt sie.
Yeah! Er kann es kaum fassen, ist so aufgeregt, dass er sofort damit rausplatzt: »Ja, von der Kant-Vorlesung.«
Plumper gehts echt nicht. Wir haben uns da vielleicht gesehen, aber deswegen kennen wir uns nicht.
Schon rechnet er mit einer Abfuhr, einem wütenden Impuls, die sich aufdrängende Frage, ob er ihr nachstellt, doch sie kräuselt nur die Stirn. Wo sind ihre süßen Sommersprossen? Sie hat sich geschminkt, dezent nur, aber ihre Augen wirken dunkler, fast schwarz, ihre roten Lippen dafür umso greller, selbst in dem funzeligen Licht. Sie trägt eine weiße Bluse, die sie recht weit aufgeknöpft hat. Natürlich muss er jetzt genau da hinsehen, schnell sucht er wieder ihre Augen, nur so geht es weiter, auch auf die Gefahr hin, dass er in ihnen versinkt.
»Wie findest du die Vorlesung?«
Erwischt! Warum hat er sich nicht besser vorbereitet?
»Ich weiß nicht, ich ...« (habe eigentlich nur dich gesehen.)
»Komm, lass uns nach nebenan gehen, da redet es sich leichter.«
Zeit durchzuatmen. Eine Galgenfrist. Sie geht voraus. Ihr Stirnreif fehlt. Groß ist sie, größer als gedacht. Soll er ihnen was zu trinken holen? Er hat immer noch das leere Bierglas in der Hand. Ob hinten ein Platz frei ist? Er ist total durcheinander.
Sie zwängen sich zwischen zwei Frauenpaare auf die Holzbank. Er muss seinen rechten Arm auf die Lehne legen, damit sie nicht zu eng sitzen, was trotzdem unmittelbar vertraut wirkt, ihn mindestens wie einen Macker wirken lässt. Er muss an den Autoscooter auf der Doesbecker Kirmes denken, bei den Bauernjungs gehört es zum männlichen Imponiergehabe, mit nur einer Hand zu lenken, während ein Arm lässig auf der Rückenlehne liegt, im günstigsten Fall über der Schulter des Mädchens, natürlich nur zum Beschützen der Holden, nicht als Anmache.
Sie lächelt.
»Möchtest du was trinken?«, fragt er. Anders als vorhin meint er es ernst, macht sich aber gleich Sorgen, dass sie ihm wieder abhandenkommen könnte, quasi als Strafe für sein mieses Verhalten gegenüber Angela.
»Ein Frascati wäre schön.«
Frascati? Nie gehört. Was solls, ich frage einfach. Frascati, Frascati ... merk dir das!
»Wenn die den nicht haben, geht auch Soave.«
Soave, Soave ... Den Namen kennt er aus der Pizzeria, müsste ein Wein sein. Jenseits vom Bier kennt er sich mit angesagten Getränken nicht gut aus. Sangria, Sekt, Rotwein, Weißwein, aber Marken? Martini, Cinzano, Southern Comfort, Blue Curaçao, mit O-Saft eine Grüne Wiese.
Als er an der Bar endlich an der Reihe ist, hat er natürlich vergessen, was sie gesagt hat. Nicht mal ihren Namen kennt er ja.
Sollte man sich nicht erst mal vorstellen? Ob sie Wert darauf legt? Muss der Mann bei ihr den Anfang machen?
»Pils und?« Die kleine Frau hinter der Bar sieht ihn genervt an.
»Weißwein. Ich hab ehrlich gesagt den Namen vergessen. Was habt ihr denn da?«
»Na, Weißwein halt. Rotwein auch.«
»Ne, ich brauch Weißwein. Zeigst mir mal die Flasche?«
Die Kleine stöhnt laut auf, pustet sich eine Locke aus der Stirn. Sie öffnet den Kühlschrank hinter sich, holt eine grüne Flasche heraus und knallt sie etwas unsanft auf die Theke.
»Wäre die genehm?«
Ihren Flunsch übersieht er, mustert das Etikett, liest Soave und findet, dass die Flasche billig aussieht.
»Aha. Den anderen da, Name ist mir entfallen, den habt ihr nicht?«
»Ey, Junge, den da trinken hier alle, die kein Bier mögen. Wennde was anderes willst, musste in den Schoppenstecher gehen. Da kost dat aber dreimal so viel.«
»Okay, okay, ich nehm den. Zwei Gläser davon.«
Er jongliert die randvollen Gläser ganz passabel durch die Menge. Die Fete kippt schon etwas, die Musik wechselt zu den Evergreen-Lieblingen von Bärchen. Gerade läuft On Broadway in der Fassung von George Benson, für Tom eines der ödesten, leider aber dauernd gespielten Stücke, an Langeweile nur noch übertroffen von dem Huh-huh-Heuler Sympathy For The Devil der Stones; doch die alles in den Schatten stellende Pest ist Marmor, Stein und Eisen bricht, ein Stimmungslied von Drafi Deutscher, das er nicht mal volltrunken aushält und das trotzdem der heimliche Höhepunkt jeder Party kurz vor Schluss ist.
Als er den Nebenraum erreicht, sitzt sie nicht mehr da. Die Bank hat sich schon weitgehend geleert.
Geschieht dir recht, du Idiot!
»Hier!« Sie hat sich nur umgesetzt. Auf ein Zweier-Sofa, das einzige weiche Möbelstück im Raum, noch dazu in einem toten Winkel direkt hinter der offenen Tür mit einem Tisch als zusätzlichem Trenner davor. Sie klopft mit der flachen Hand auf den Platz zu ihrer Linken.
»Na, wie hab ich das gemacht?« Ihr Lachen ist reizend, unverhohlener Stolz blitzt aus ihren Augen. Raubtieraugen.
Erstmals sieht er ihre Zähne, ahnt, dass es sich bei der makellosen Reihe um teure Kronen handelt, schämt sich für sein Gebiss, bei dem es bisher nur zu Kunststofffüllungen und jeder Menge Amalgam-Plomben in den Backenzähnen gereicht hat, und ist deshalb dankbar für das Schummerlicht. Er setzt sich. Sie prosten sich zu. Sie nippt nur an dem Weinglas. Ihre Zähne kratzen sanft über ihre Unterlippe, die feucht schimmert. Immerhin verzieht sie nicht das Gesicht. Für diesen Fall hätte er sich womöglich entschuldigt und mit den Worten der Thekenfrau gesagt, dass das Droko nun mal nicht der Schoppenstecher sei, den Namen hat er sich vorsorglich gemerkt.
Sie stellt das Glas ab, gibt ihm die Hand – wie förmlich! »Judith!«
Er greift zu, spürt kühle, glatte Haut.
»Thomas! Lieber Tom.«
»Du hast eine schöne warme Hand, lieber Tom. Nein, bitte, nicht loslassen, das ist angenehm.«
Sie sieht ihn ernst an, von ihrer braunen Iris ist kaum noch etwas zu sehen, so riesig sind ihre Pupillen. Ihre Lippen öffnen sich leicht. Was für ein schöner Mund!
»Ich fürchte nur, dass meine Hand deine gleich verbrennt, wenn du mich noch länger so ansiehst.«
Sie grinst schelmisch, zieht ihre Hand aus seiner und gibt ihr einen Klaps.
»So so«, sagt sie gespielt streng. »Und du kennst mich aus der Kant-Vorlesung? Wo sitzt du denn immer? So wahnsinnig viele sind da ja gar nicht, als dass man sich nicht automatisch über den Weg liefe, nicht wahr?« Ihre Stimme hat einen lauernden Unterton bekommen.
Er beschließt, die Wahrheit zu sagen. Ihr offenkundiges Interesse und ihre direkte, anzügliche Art machen ihm Mut.
Alles oder nichts.
»Um ehrlich zu sein, habe ich irgendwann nicht mehr viel vom Stoff mitbekommen. Ab da, wo ich dich entdeckt habe. Ich gebe zu, dass ich dich beobachtet habe. Ich konnte mich einfach nicht von dir lösen. Soll jetzt echt keine Anmache sein, das musst du mir glauben. Ich bin nicht so ... Es ist nur, weil ...«
Sie legt den Zeigefinger über ihre Lippen, sieht ihn mit großen Augen an. Er rutscht unruhig hin und her, seine Lider flackern nervös. Sie legt ihre Hand auf seinen Unterarm.
Wenn mich das beruhigen soll, liegst du falsch ...
Schon lässt sie wieder los, greift nach ihrem Glas und nimmt einen großen Schluck. Wieder dieser leichte Biss auf die Unterlippe, das feuchte Schimmern darauf. Was für eine schöne, verführerische Frau!
»Warum hast du mich denn nicht angesprochen.? Wir hätten noch was trinken gehen können – und über Kant reden.«
»Oder über was anderes«, nuschelt er ins Glas, trinkt hastig und hofft, dass sie es nicht gehört hat.
»So?« Ihr Mund nähert sich seinem. »Über was denn?«
Ihm wird heiß und kalt zugleich, seine Erregung ist fast schmerzhaft. Judiths Lippen beben leicht, noch einmal beißt sie sich sanft auf die Unterlippe, dann stößt sie vor und küsst ihn. Ihre Wucht reißt ihn um, sie geraten in Schieflage, sie liegt jetzt halb auf ihm, küsst ihn auf eine fordernde, raumgreifende, sehr erregende Art, er schmeckt den Wein auf ihrer Zunge, den Geschmack nach Silvesterbowle, nach weintrunkenen Mandarinen, da hört sie unvermittelt auf und legt ihren Kopf auf seine Brust. Sie zittern beide, er hält sie im Arm, kann nicht glauben, was geschieht, so schnell, so schön. Sie krault sein Haar, gleitet mit der anderen Hand an seinem Oberkörper entlang nach unten. Sie wird doch nicht? Doch nicht hier?
»Keine Angst, ich bin ein braves Mädchen«, flüstert sie, richtet sich wieder auf und trinkt das Glas in einem Zug leer.
Aufrecht sitzend, schmiegen sie sich aneinander, küssen sich immer wieder, versinken ineinander – und schrecken auf.
Ein lauter Knall direkt vor ihnen. Ein Typ mit halblangen, blonden Haaren steht da, klatscht jetzt wieder mit der flachen Hand auf den Tisch und hebt sie, als wolle er Tom schlagen. Instinktiv springt er auf, bereit sich zu verteidigen. Das Herz schlägt ihm bis zum Hals, mehr vor Wut als vor Angst. Der Blonde ist kleiner, aber sportlicher als er.
»He, hallo«, ruft eine Frau mit schriller Stimme, »wenn ihr euch schlagen wollt, dann draußen, kapiert?!«
Sie stehen sich gegenüber, belauern sich. Noch unschlüssig. Abwartend. Dann zieht Judith Tom auf das Sofa zurück und blafft den anderen an.
»Uli, hau ab! Wie oft hab ich dir gesagt, dass es vorbei ist? Kapier das endlich und lass mich um Himmels willen in Ruhe!«
»Du!« Der Blonde zeigt wütend auf Judith. »Du, du bist doch ... Das Letzte bist du! Den Einen abserviert und gleich nen Neuen am Wickel! Und du ...«, jetzt funkelt er Tom an. »Du tust mir jetzt schon leid!«
Nachdem er verschwunden ist, sagen sie lange nichts, vermeiden es, sich anzusehen, halten sich nur im Arm wie zwei Schiffbrüchige in einem Rettungsboot, noch ohne Ziel, nur froh, dem Untergang entkommen zu sein. Im Saal läuft Good Night von den Beatles. Haben sie was verpasst? Lief schon der Gassenhauer? Wenn das Einschlaflied der Beatles kommt, ist definitiv Schluss, das weiß Tom. Mit dem Fest jedenfalls. Was Judith betrifft, ist er komplett durcheinander. Was läuft da mit dem Blonden? Vielleicht wird sie es ihm erklären. Vielleicht ist er, Tom, für sie nur ein Zufallsopfer, eine dankbare Ablenkung, eine zweifelhafte Projektion für einen irgendwie ersehnten Neuanfang.
Wenn ich richtig interpretiere, was gerade geschehen ist, steckt sie in einer ähnlichen Lage wie ich. Aber woher soll ich wissen, was sie wirklich durchmacht? Ich kenne sie ja überhaupt nicht.
Judith nimmt seine Hand und steht auf. Sie verlassen das Gebäude als Paar. Draußen bleibt sie unvermittelt stehen.
»Lass mich nicht los«, flüstert sie und krallt ihre Finger in seine Hand.
Atemwölkchen umspielen ihre Lippen, ihr Gesicht hat einen flehenden Ausdruck. Er lässt sie nicht los, aber sie gibt ihm Rätsel auf. Was, wenn hinter der schönen, selbstbewussten Fassade ein zerrissener Mensch steckt, womöglich ein psychisch kranker? Wie eine Flirt-Bekanntschaft von ihm, die ihn erst geküsst und dann unvermittelt geohrfeigt hatte.
Nein, er lässt sie nicht los. Dafür sie ihn. Sie öffnet ihre Handtasche, holt eine PackungMarlboro heraus und Streichhölzer. Nach drei Versuchen, aber noch ehe er ihr sein Feuerzeug anbieten kann, brennt ihre Zigarette. Sie steckt sie ihm in den Mund, die zweite zündet er ihr an. Sie inhaliert tief, nimmt wieder seine Hand, hält sie fest. So stehen sie und rauchen, lassen ihre blauen Wolken zu den weißen am Nachthimmel aufsteigen.
Oh nein, jetzt bloß keine peinliche Pause aufkommen lassen. Sag was! Was Witziges. Bring sie zum Lachen! Tom kramt in seinem Kopf nach Film-Zitaten, doch er findet keines, das passt. Er muss improvisieren.
»Also, Spatzl, was machen wir zwei Hübschen noch mit dem angebrochenen Abend.« Ganz passabel. Monaco Franze wäre zufrieden mit mir, denkt Tom, der die Münchener Serie über den »ewigen Stenz« sehr mag.
Judith grinst, geht aber nicht auf sein Spiel ein.
»Ick wür ma sajen, dit vertajen wir, wa.«
»Kommst du aus Berlin?«, fragt er sofort.
»In Berlin geboren, aber mein Vater hat hier in Münster bei einer Privatbank angefangen, die Familie musste natürlich mit. Meine Mutter ist Lehrerin und kann überall arbeiten. Ich bin hier aufgewachsen, habe in Hiltrup mein Abi gemacht und bin fürs Studium nicht allzu weit gekommen, wie du siehst. Aber ich fühle mich einfach wohlhier, die Profs sind gut und für ihre Forschung international bekannt. Meine Eltern wohnen längst in Bad Homburg, mitten in der Pampa, aber nahe genug an Frankfurt, dass mein Papa die Finanzwelt retten kann.«
»Oh, dann ist er wohl ein hohes Tier?«
»Das ist er wohl.« Judith wirft den glühenden Stummel zu Boden und tritt ihn mit Nachdruck aus. Tom schnippt seinen in die nächste Pfütze.
»Die Nacht ist noch jung, aber ich werd nicht mehr alt«, sagt Judith mit müder Stimme, hakt sich bei ihm unter, zieht ihn aus dem nachtschlafenden Hof des Droko zur Straße.
»Wohnst du weit von hier?«, will er wissen.
»Ziemlich. Mit dem Taxi bist du von hier aus locker 20 Mark los. Lass uns mal gucken, ob wir eins finden.«
»Sonst könntest du auch bei mir ... Ich mein, ... Bloß übernachten, mein ich. Das wäre nur ein Katzensprung.«
»Das ist lieb. Aber ich hab gleich morgen früh eine Verabredung.«
Sie gehen schweigend nebeneinander her. Was will sie ihm sagen? Dass sie begehrt ist und an jedem Finger jemanden hat?
»Tja«, sagt sie bedauernd. »So blöd muss man sein, sich für den Sonntagmorgen nach einer Party zu verabreden. Aber ich hab nicht mehr viel Zeit. Meine Hausarbeit muss in spätestens einer Woche beim Prof sein. Ich schreibe sie mit Hedwig zusammen, einer Kommilitonin. Wir arbeiten beide als studentische Hilfskräfte bei Degen, da müssen wir mehr abliefern als andere.«
Er bleibt stehen. »Doch nicht etwa bei dem Degen?«
»Ich weiß nicht, welchen du noch kennst, aber Degen ist der Beste. Seine Literaturforschung ist in aller Munde, sogar in der DDR.«
»Kein Wunder, wenn ich mich nicht irre, ist er Marxist.«
»Ach ja? Und was heißt das? Was vertrittst du denn für einen wissenschaftlichen Ansatz?«
Judith sieht ihn argwöhnisch an. Ihre Augen blitzen im kalten Licht der Laterne. Er weiß nicht, was er sagen soll, kennt die verschiedenen Forschungsansätze eigentlich nur oberflächlich und hat sich nie gefragt, welchem er in seinen Hausarbeiten folgt. Ein Mischmasch, wahrscheinlich. Aber das kann er ihr natürlich nicht sagen.
»Ist ja auch egal«, sagt sie mit leichtem Bedauern in der Stimme. »Ich erklär dir gerne, wofür Degen steht und warum es zu seinem Ansatz keine Alternative gibt. Aber nicht jetzt. Ich bin wirklich müde.«
»Dann komm«, sagt er und geht weiter. Er ist verstimmt, geht deswegen schneller. »Wenn wir Glück haben, steht noch ein Taxi am Stand in der Wilhelmstraße. Das ist aber noch‘n Stück.«
Judith hält mit, ihre Schuhe knallen auf das Pflaster wie kurze, harte Hammerschläge.
Sie gibt den Takt an. Er bemüht sich um einen Gleichschritt, obwohl sie gar nicht Arm in Arm laufen, noch nicht einmal Hand in Hand, er will nicht, dass die Sache jetzt aus dem Takt gerät.
Unvermittelt knickt Judith um, er kann sie gerade noch auffangen.
»Du bist mein Prinz«, sagt sie und küsst ihn auf die Wange. »Na komm, sei wieder gut mit mir. Wenn wir jetzt auseinandergehen, dann wenigstens wie zwei nette Menschen. Naja, gehen wäre zu viel gesagt.« Sie besieht sich ihren rechten Schuh, der Absatz ist abgebrochen.
»Gerne würde ich Euch auf mein Pferd heben, Gnädigste – allein, ich vermag keines mein eigen zu nennen.« Er hat beschlossen, die ganze Situation mit Humor zu nehmen, blasiert reden kann er. Und Judith zieht mit.
»So versuche Er sein Bestes auf des Schusters Rappen, meine Wenigkeit wird jegliche Strapaze auf sich nehmen und Ihro Gnaden so wenig zur Last fallen wie es sich unter diesen Unbilden für eine Dame geziemt.«
Sie deutet einen Knicks an, da sieht er Rettung nahen.
»Halt, Kutscher! So halte Er doch an!« Tom hat ein Taxi entdeckt, noch dazu mit beleuchtetem Schild auf dem Dach. »TAXI!«, schreit er und winkt wie ein Geistesgestörter.
Der Fahrer geht in die Eisen, hält mitten auf der vierspurigen Umgehungsstraße. Tom rennt zu dem Wagen. Judith humpelt hinter ihm her. Er öffnet die Tür. Vanille – Taxi-Geruch.
»Und? Wo solls denn jetzt noch hingehen?« Ein bulliger Mann mit Lederweste und Schiebermütze glotzt ihn aus kleinen Schweinsäuglein an.
»Zur ... ähm ... Jedenfalls lohnt sich das für Sie.«
»Erzähl keinen Stuss, Junge, hast wohl einen gehabt, wa? Oder biste auf Drogen?«
Der Fahrer lehnt sich vor, will schon die Tür schließen, als Judith keuchend neben Tom auftaucht.
»In den Dahlweg. Muss ich. Fahren Sie. Da. Noch hin?«
Der Fahrer überlegt einen Moment.
»Na, dann steigense mal ein, eigentlich wollt ich schon Feierabend machen, aber die Tour nehm ich noch mit.«
Judith freut sich, reißt die hintere Tür auf und sitzt schon, als ihr einfällt, dass er auch noch da ist.
»Komm her«, sagt sie.
Er erwartet, dass sie nach links rückt, um ihm Platz zu machen, freut sich schon, doch sie bleibt sitzen, reckt sich nur etwas vor und gibt ihm einen langen Kuss.
»Wat is nu? Können wir?«, grunzt der Taxifahrer.
Judith drückt Tom sanft weg und schließt die Tür. Sofort fährt der Wagen los und ist schnell hinter der Kurve verschwunden.
Da steh ich nun, ich armer Tor und bin so klug als wie zuvor. Nicht mal ihre Nummer hat er, immerhin weiß er, dass sie wohl im Dahlweg wohnt. Oder zumindest in der Nähe, wenn sie dort vielleicht nur aussteigen möchte. Die Suche nach ihr dürfte außerhalb der Uni schwierig werden, wenn nicht unmöglich, er kennt zwar nicht ihren Nachnamen, aber immerhin ihren Prof. Sie weiß von Tom noch weniger, bemerkt er jetzt, außer, dass er in Droko-Nähe wohnt, in dieselbe Vorlesung geht und Thomas heißt. Aber dass er in einer WG wohnt, hat er ihr nicht erzählt – nichts hat er von sich erzählt. Nur dumm verstummt ist er, als es um Fachliches ging. Es scheint ihr wichtig zu sein, und er weiß nicht, ob er das gut findet. Er ist so etwas nicht gewohnt, jedenfalls nicht von seinen bisherigen Beziehungen, da hat er es immer leicht gehabt, hat den Intellektuellen gegeben, jetzt muss er auf der Hut sein.
Am besten, ich schlage sie mir aus dem Kopf, denkt er beim Zähneputzen. Letzte Chance am Dienstag. Bei der Abschlussvorlesung über Kant. Ob sie kommen wird? Ob sie ihn dann noch kennen will? Schwermut senkt sich wie ein dunkler Schleier über sein Bett. Er lässt den Vorhang offen. Ganz hinten sieht er schon einen feinen Streifen der Morgendämmerung, dann fallen ihm endlich die Augen zu.
Scheißer
Viel zu früh wacht er auf. Von Ferne dringt Glockengeläut an sein Ohr, es erinnert ihn an seine Kindheit in Doesbeck, an den nach Buchsbaumzweigen duftenden Palmsonntag, an die Vorfreude auf den Sonntagsbraten – wie lange hat er nichts mehr gegessen? Sein Magen krampft sich zusammen, nicht vor Hunger, über die grimmige Phase ist er schon hinaus, sondern weil er an gestern Abend denkt, die Nacht mit Judith. Wie das klingt ...