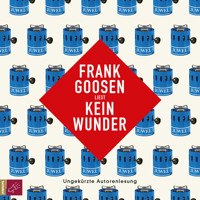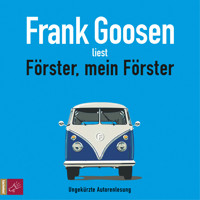Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tacheles!
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Felix genießt sein Leben als stiller Teilhaber einer Bar – bis er eines Tages an einer Straßenecke einem Mann gegenübersteht, von dem er instinktiv weiß, dass es sein tot geglaubter, unbekannter Vater ist.
Mit großer Lakonie erweist sich Frank Goosen in „Pink Moon“ als brillanter Erzähler männlicher Abgründe.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:5 Std. 5 min
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
FRANK GOOSEN
Pink Moon
Roman
WILHELM HEYNE VERLAG MÜNCHEN
Das Buch
»Auf dem Bild sehen Sie so aus, als würden Sie gleich eine der Flaschen nehmen und an die Wand werfen«, hatte Evelyn gesagt, als sie Abzüge ihrer Fotos präsentierte, die sie am Tag zuvor im PINK MOON gemacht hatte: Felix alleine, Felix zusammen mit Walter, seinem Schulfreund und Geschäftsführer, die Bar, die grobkörnigen Fotos von Nick Drake, Tim Buckley und Gram Parsons im Hintergrund, das PINK MOON in der Totalen. Im Übrigen fand Felix nicht, dass er aggressiv wirkte. Oder unglücklich. Probleme hatten doch nur die anderen. Wie sein ebenso geheimnisvoller wie zutraulicher Nachbar Renz. Oder sein Tennispartner Wöhler. Und vor allem seine Mutter, die Zeit ihres Lebens ihrer großen Liebe nachgetrauert hatte, seinem Vater, dem Helden und großartigen Tänzer, der kurz nach seiner Geburt für immer verschwand. Die ihre große Sehnsucht mit unglücklichen Affären stillte. Und die ihm ein Restaurant geschenkt hatte, das ihn nicht brauchte. So genießt Felix ein Leben als stiller Teilhaber – bis er eines Tages an einer Straßenecke einem Mann gegenübersteht, von dem er weiß, dass es sein vor Jahren verstorbener, unbekannter Vater ist … Lakonisch und mit großer Souveränität erzählt Frank Goosen die Geschichte von Menschen, die auf der Suche nach den kleinen und großen Geheimnissen ihrer Vergangenheit sind. Und die finden, was sie nie verloren glaubten.
Der Autor
Frank Goosen, geboren 1966, hat sich Ruhm und Ehre als eine Hälfte des Kabarett-Duos Tresenlesen erworben. Sein Durchbruch war Liegen lernen, der lange auf der Spiegel-Bestsellerliste war und erfolgreich verfilmt wurde. Pokorny lacht war sein zweiter Roman. 2003 erhielt Frank Goosen den Literaturpreis Ruhrgebiet. Im Heyne Verlag erschien auch seine Erzählsammlung Mein Ich und sein Leben sowie die von ihm herausgegebene Fußball-Anthologie Fritz Walter, Kaiser Franz und Wir.
Lieferbare Titel
Fritz Walter, Kaiser Franz und wir – Unsere Weltmeisterschaften – Mein Ich und sein Leben – Pokorny lacht – Liegen lernen
Inhaltsverzeichnis
Für Ludwig
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Vollständige Taschenbuchausgabe 04/2007 Copyright © 2005 by Eichborn AG, Frankfurt Copyright © 2007 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München. Umschlagfotografie: © Moni Port Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design unter Übernahme des Originalumschlags nach einer Idee von Moni Port Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
eISBN: 978-3-641-21536-1V001
www.heyne.de
www.randomhouse.de
Pink Moon(2:00) Nick Drake, piano
I saw it written and I saw it sayPink Moon is on its wayAnd none of you stand so tallPink moon gonna get you allIt’s a pink moonIt’s a pink, pink, pink, pink, pink moon.
Nick Drake, Pink Moon
1Ich sah meinen Vater erstmals neunzehn Jahre nach seinem Tod. Ich erkannte ihn gleich wieder, auch wenn er mehr als dreißig Jahre älter war als auf dem einzigen Foto, das meine Mutter von ihm aufbewahrt hatte: ein gutaussehender, glatt rasierter Mittzwanziger mit Fassonschnitt in einer Prager Seitenstraße, während hinter ihm der Frühling durch die Straßen floh.
Auch jetzt noch sah er gut aus mit seinem kurzen, grauen Haar, der hellen Hose, dem dunklen Jackett und dem gestreiften Hemd, an dem die obersten drei Knöpfe offen standen. Seine Brust war glatt und unbehaart, die Haut hatte den attraktiven Teint natürlicher Bräune, und seine Augen waren von jenem klaren Blau, das meine Mutter um den Verstand gebracht hatte. Sie hat mir nicht viel über ihn erzählt, aber wenn sie es doch tat, endete sie so: »Seine blauen Augen haben mich um den Verstand gebracht. Er war ein Held und toller Tänzer!« Keiner von den Vätern, die sie zwischendurch an mir ausprobierte, erfüllte diese Kriterien.
Mein Vater stand an einer Straßenecke und stritt sich mit einer Frau. Ich drückte mich in einen Hauseingang und sah zu den beiden hinüber. Die Frau rauchte und kaute an den Fingernägeln. Mein Vater redete auf sie ein und machte beruhigende Handbewegungen: so, als wolle er etwas zu Boden drücken. Die Frau schüttelte den Kopf.
Bestimmt eine Viertelstunde betrachtete ich die beiden und fragte mich, wie lange sie da schon standen. Als die Frau sich mit dem Handballen durch die Augen fuhr, wusste ich, dass sie weinte. Mein Vater berührte sie an der Schulter, aber sie schüttelte ihn ab. Er machte einen Schritt zur Seite und wollte an ihr vorbeigehen, sie stellte sich ihm in den Weg. Das ging ein paar Mal hin und her. Dann sagte mein Vater etwas und ließ sie stehen.
Er kam auf mich zu. Ohne nachzudenken, drückte ich auf die zweite Klingel von oben. Der Summer ertönte, und ich trat in den Hausflur. Durch die Rauglasscheibe sah ich einen Schatten vorbeigehen. Ich zählte bis zehn und folgte ihm.
Mein Vater ging Richtung Innenstadt. Ich wechselte ein paar Mal die Straßenseite, ließ mich zurückfallen und holte wieder auf, wenn er um eine Ecke bog. In der Fußgängerzone war es etwas schwieriger, ihm zu folgen. Samstagmittag, die Stadt war voll. Ich zog meine Jacke aus und hielt sie in der Hand. Es war Anfang September, noch immer mehr als zwanzig Grad und blauer Himmel. Bevor in ein oder zwei Wochen unwiderruflich der Herbst kam, wollten die Leute noch ein paar Mal ihre kurzen Röcke, die knappen T-Shirts und die offenen Schuhe und Sandalen ausführen. Sie saßen vor den Eisdielen und den Szene-Cafés, löffelten bunte Becher und betrachteten glücklich kühle Getränke in beschlagenen Gläsern, an denen Wassertropfen herabperlten. Kinder pusteten durch ihre Strohhalme Luft in Apfelschorlen, und ihre Eltern hatten die Welt im Griff, weil sie Sonnenbrillen trugen und niemand ihnen in die Augen sehen konnte.
Mein Vater blieb vor einem chinesischen Restaurant stehen und warf einen Blick auf die Speisekarte, die in einem roten, von einem kleinen Pagodendach gekrönten Schaukasten hing. Er sah durch eines der Fenster und ging weiter.
Als wir zum Bahnhof kamen, fürchtete ich, er würde einen Zug nehmen, aber er ging durch die Halle hindurch, nahm den Südausgang und wandte sich nach rechts. An der Ausfallstraße, die zur Universität hinausführte, lag das Kelo, eine auf drei versetzten Ebenen angeordnete Mischung aus Café, Restaurant und Bar mit Backsteinwänden und Tischen aus Tropenholz, benannt nach einer Nummer von Miles Davis. Ich mochte keinen Jazz. Mein Vater ging hinein, und ich wartete ein paar Minuten, bevor ich ihm folgte.
Caroline saß auf der Empore, zu der links vom Tresen eine kleine Treppe hinaufführte. Mein Vater hatte auf der rechten Seite am Fenster Platz genommen. Ich nickte Caroline zu und setzte mich auf einen Barhocker. Im Spiegel hinter dem Tresen konnte ich trotz der davor aufgereihten Spirituosen meinen Vater beobachten. Ein junger Mann ganz in Schwarz, mit knöchellanger weißer Schürze und dunklen Haaren voller Gel, sah mich fragend an, und ich bestellte einen Kaffee. Es dauerte nur ein paar Minuten, bis Caroline von der Empore kam und sich neben mich setzte. Ihr Haar und ihre cremefarbene Bluse rochen nach kaltem Rauch, ihre Augen waren gerötet und ihr Gesicht ein wenig aufgeschwemmt. Es schien eine lange Nacht gewesen zu sein. Als ich sie darauf ansprach, schüttelte sie den Kopf. Ich fragte sie, ob das eine neue Bluse sei, was sie noch mehr verärgerte.
»Das ist keine nette Frage«, sagte sie. Ihrer Stimme war die letzte Nacht noch anzuhören. »Es ist die gleiche Bluse wie gestern. Ich hatte noch keine Gelegenheit, die Sachen zu wechseln. Sie ist zerknittert und riecht nach mir anstatt wie üblich nach teurem Parfüm und Reinigung. Deine Bemerkung war also nicht besonders charmant.«
Ungefähr so war seinerzeit der Irrtum unserer Annäherung verlaufen. Äußere Reize, gemeinsame berufliche Interessen und funktionierender Small Talk hatten eine Dynamik in Gang gesetzt, die ein gemeinsames Essen und einen Kuss vor ihrer Haustür nach sich gezogen hatte. Doch schon beim zweiten Treffen waren viele Scherze ins Leere gegangen, und wir hatten beide nur gelacht, um nicht unhöflich zu sein.
Mein Vater studierte die Speisekarte. Ein anderer junger Mann, der genauso aussah wie der hinter dem Tresen, baute sich breitbeinig neben ihm auf und ließ einen Bleistift zwischen Zeige- und Ringfinger der rechten Hand in schneller Folge auf und ab wippen, so dass er immer wieder gegen einen Block in seiner Linken stieß. Mein Vater ließ sich Zeit, bestellte dann, ohne den Kellner anzusehen, und gab ihm die Karte zurück.
Caroline zupfte sich die Bluse zurecht. Der Mann hinter dem Tresen stellte ihr einen Milchkaffee hin, in dem ein langstieliger Löffel und ein Strohhalm steckten. Ich umfasste meine Kaffeetasse am oberen Rand, weil meine Finger nicht durch den Henkel passten. Caroline lachte, aber ich wusste nicht worüber. Sie legte mir eine Hand auf den Unterarm, und ich lächelte sie an.
Nur drei oder vier Tische waren besetzt. An einem saß eine Familie mit drei Kindern. Der Vater hatte etwas mit Fleisch und gerösteten Kartoffelecken vor sich stehen, die Mutter einen Salat und die Kinder Nudeln oder Pommes frites. Der Vater schob sich große Stücke Fleisch in den Mund, die Mutter richtete den Kindern die Servietten, hob Essen auf, das auf den Boden gefallen war, und wischte mit einem mitgebrachten Waschlappen Speisereste aus Mundwinkeln.
Mein Vater stand auf, ging zu dem Kleiderständer bei den Toiletten, nahm sich eine Tageszeitung, die dort in einem Holzhalter hing, und ging zurück zu seinem Tisch. Er holte ein schwarzes Etui aus der Innentasche seines Jacketts, setzte eine Lesebrille auf und nahm sich die Zeitung vor.
Caroline erzählte, wie sie die letzte Nacht verbracht hatte. Ich lächelte und bestellte noch einen Kaffee, obwohl die erste Tasse noch nicht ganz leer war.
Vier Männer in Anzügen kamen herein und gingen zu den beiden geknöpften Chesterfield-Sofas auf der rechten Empore, ließen sich nieder, legten ihre Arme auf die Lehnen und holten fast gleichzeitig die Spitzen ihrer Krawatten zwischen Bauch und Gürtelschnalle hervor. Einer winkte dem Kellner zu, der schon meinen Vater bediente. Der junge Mann nahm die Bestellungen entgegen, kam an den Tresen und schob dem Dunkelhaarigen dahinter einen Zettel zu. Der fing an, Bier zu zapfen.
Der Laden füllte sich langsam. Lauter Menschen mit Einkaufstüten kamen herein, suchten sich Plätze, redeten und lachten. Aus einem Hinterzimmer kamen zwei weitere Kellner, die genauso aussahen wie die anderen.
Mein Vater bekam sein Essen. Fisch. Er sagte etwas zu dem Kellner und bekam gleich darauf ein Glas Weißwein. Beim Essen führte er die Gabel zum Mund, ohne ihr entgegenzukommen.
Caroline legte mir wieder die Hand auf den Arm und erzählte etwas von einem Brauerei-Jubiläum. Ich erinnerte mich an eine Einladung, die kürzlich in meinem Briefkasten gelegen hatte, und sagte, ich würde es mir überlegen. Caroline ging in die Küche, kam kurz darauf mit einer kleinen Vorspeisenplatte zurück und bot mir an mitzuessen. Ich sagte, ich hätte noch nicht einmal gefrühstückt. Sie hob kurz die Schultern und aß allein.
Die vier Männer in Anzügen tranken Bier und lachten lauter als alle anderen. Die übrigen Gespräche bildeten einen durchgehenden Geräuschteppich.
Mein Vater war mit dem Essen fertig, schob den Teller von sich weg, griff wieder nach der Zeitung und setzte die Brille, die während des Essens über seiner Stirn gehockt hatte, wieder auf die Nase. Er stieß leicht auf. Der Kellner räumte den Teller ab und sagte etwas. Mein Vater nickte und tätschelte sich den Bauch.
Draußen war es hell und sonnig. Das Kelo hatte keinen Freisitz. Der wäre auch nicht sonderlich attraktiv gewesen, so dicht an der Straße. Die Leute, die vorbeigingen, schauten hinein und trugen ihre Einkaufstaschen weiter.
Caroline tupfte mit einem Stück Brot das restliche Öl auf, das von all den eingelegten Sachen übrig geblieben war, schob es sich in den Mund wischte sich die Hände an ihrem Rock ab. Sie brachte den leeren Teller in die Küche zurück. Ich wünschte mir, sie würde da bleiben, aber ich hatte Pech. Sie stützte ihren Ellenbogen auf den Tresen, legte ihren Kopf in die Handfläche und sah mich an, sagte aber nichts. Ich bemühte mich wieder um ein Lächeln, und sie knuffte mich mit der Faust in die Seite. Wir hätten gut befreundet sein können, wenn wir uns nicht eingebildet hätten, da könnte mehr sein. Jetzt gelang es uns nicht, ungezwungen miteinander umzugehen, wobei ich den Eindruck hatte, dass es ihr schwerer fiel als mir. Ich mochte sie, und ein bisschen bewunderte ich sie auch. Sie hatte diesen Laden hier aus dem Nichts nach oben gebracht, mit vollem Risiko, bis über beide Ohren verschuldet. Sie hatte keinen Geschäftsführer, der sie entlastete. Anfangs hatte sie nicht das Geld gehabt, um einen zu bezahlen, und inzwischen hatte sie sich daran gewöhnt, alles selbst zu erledigen. Wahrscheinlich hatte es deshalb zwischen uns nicht funktioniert: Als Geschäftsmann musste ich ihr oberflächlich vorkommen.
Der Kellner brachte meinem Vater einen Espresso und hielt ihm eine geöffnete Kiste hin. Mein Vater nahm eine Zigarre heraus, drehte sie in der Hand, zog sie sich unter der Nase durch, nickte und ließ sich Feuer geben. Wahrscheinlich war er kein regelmäßiger Raucher, sonst hätte er ein eigenes Feuerzeug gehabt. Er sah aus, als hätte er etwas zu feiern. Vielleicht hatte es mit der Frau zu tun, mit der er sich vorhin gestritten hatte.
Der Vater der Familie mit den drei Kindern hielt eine Hand in die Höhe. Der Kellner kam gleich zu ihm und legte die Rechnung auf den Tisch. Der Vater holte sein Portemonnaie aus der Gesäßtasche seiner hellen Baumwolljeans, während er versuchte, bei geschlossenem Mund mit der Zunge Essensreste aus den Zahnzwischenräumen zu entfernen. Die Mutter zog den Kindern gegen deren deutlichen Widerstand Jacken an, obwohl es draußen dafür viel zu warm war. Schließlich verließen sie das Lokal dicht hintereinander hergehend.
Caroline fragte mich, ob ich müde sei. Ich nickte, mit den Gedanken woanders.
Auch mein Vater verlangte nun nach der Rechnung. Ich fragte Caroline, was sie für den Kaffee bekomme, sie aber sagte nur, Ich bitte dich. Ich bedankte mich und rutschte von meinem Barhocker. Kurz sah es so aus, als wolle sie mich auf die Wange küssen, aber da hatte ich mich wohl getäuscht.
Ich war als Erster draußen und wartete auf der anderen Straßenseite. Er ging den gleichen Weg zurück und machte beim Gehen kleine gymnastische Übungen, drehte die Schultern nach hinten, warf den Kopf hin und her und streckte sich.
Ich malte mir aus, was passieren würde, wenn ich ihn ansprach, und fragte mich, wann der Zeitpunkt günstig wäre. Im Kelo hatte ich mich bemüht, meine Erwartungen zu dämpfen, ihn nicht mit den Augen meiner Mutter als verliebte Fünfundzwanzigjährige zu sehen. Was ihn anging, war sie nie älter geworden, auch wenn sie ab der Zeit mit Bludau nie wieder über Otto Simanek, den Helden und großartigen Tänzer, geredet hatte, bis sie mir dann erzählte, er sei gestorben. Früher, als Kind, wenn ich unter dem Küchentisch hockte, an dem meine Mutter mit meinen diversen Ersatzvätern redete und lachte und trank, stellte ich mir meinen richtigen Vater vor: wie er eines Tages in der Tür stehen und die anderen Kerle aus der Wohnung werfen und meiner Mutter beibringen würde, wie eine ordentliche Familie auszusehen hatte, so wie es bei anderen Kindern auch war. Da stand der Vater jeden Abend in der Tür und machte klar, dass er der Vater war, er allein und niemand anders, denn ihr sollt keinen anderen Vater haben neben mir.
Ich rechnete nicht damit, ihn während meiner Beschattung zu verlieren. Als er das Parkhaus betrat, war ich zu sehr damit beschäftigt, was ich ihm sagen wollte, wenn wir uns gegenüberstanden. Ich beobachtete ihn von weitem, wie er am Kassenautomaten bezahlte, und dachte mir nichts dabei. Als er einen Fahrstuhl betrat und die Türen sich schlossen, hastete ich zur Treppe und lief, immer zwei Stufen gleichzeitig, nach oben, aber wo würde der Aufzug anhalten? Das Parkhaus hatte fünf oder sechs Stockwerke. Ich dachte, wenn sein Auto im ersten oder zweiten stand, hätte er nicht den Fahrstuhl genommen. Also rannte ich bis zum dritten, stürmte durch die graue, von Filzstift-Graffiti übersäte Brandschutztür und blickte keuchend zur Leuchtanzeige über dem Fahrstuhl. Das Ding war schon im vierten Stock. Ich zögerte einen Moment, und schon leuchtete die Fünf auf. Ich dachte nach. Dann rannte ich wieder nach unten. Die Ausfahrt lag in einer kleinen Seitenstraße. Ich sah mich nach einem Taxi um, fand aber keins.
Er fuhr einen dunklen Opel. Ich erkannte ihn, als er die Scheibe herunterließ, um die Karte in den Automaten zu schieben. Er blinkte links und fuhr langsam Richtung Hauptstraße. Ich folgte dem Wagen bis zur Ecke und sah mich wieder nach einem Taxi um, hatte aber kein Glück. Ich blickte dem Wagen meines Vaters nach, wie er erst nach rechts und an der nächsten großen Kreuzung nach links abbog und verschwand.
Ich stützte meine Hände auf die Knie und atmete tief durch. Ich hatte meinen Vater zum zweiten Mal verloren.
Ich betrat das nächste McDonald’s, schloss mich dort auf der Toilette ein und legte meine Stirn gegen die Kacheln, bis ich mich beruhigt hatte. Dann ordnete ich meine Kleidung und verließ die Kabine wieder, hängte meine Jacke an die Tür, wusch mir am Waschbecken Gesicht und Hände und fuhr mir mit den Fingern durchs Haar. Ich erkannte seine Gesichtszüge in meinen. Die kräftige, leicht gebogene, etwas zu breite Nase, die dunklen Augen, den niedrigen Ansatz der Haare (seine schon edel ergraut, meine noch dunkel wie nasse Baumrinde), und vor allem die geschwungenen Linien, die von der Nase um den Mundwinkel herumliefen und dann im Kinnbereich verschwanden.
Ich kaufte noch ein paar Sachen ein und ging zu meinem Wagen. Ich machte einen kleinen Umweg und fuhr durch die Straße, in der ich meinen Vater und die Frau gesehen hatte. Ich stieg sogar aus und suchte nach Spuren. Hätte er geraucht und eine Kippe weggeworfen, hätte ich sie aufsammeln und mitnehmen können. An dem Filterstück wäre sein Speichel gewesen, und ich hätte damit seine DNA sichern können.
Als ich in meine Straße einbog, sah ich Renz, meinen wahnsinnigen Nachbarn, vor der Haustür stehen. Er hielt ein Tau, in das in unregelmäßigen Abständen Knoten geknüpft waren, in seiner rechten Faust.
Ich wunderte mich bei Renz über nichts mehr. Vor ein paar Wochen, als ich aus dem Moon gekommen war, zufrieden, aber mit schmerzenden Füßen und vor Müdigkeit brennenden Augen, hatte er zitternd, mit angezogenen Knien und kaltschweißiger Stirn auf dem Treppenabsatz zwischen dem ersten und zweiten Stock gesessen. Seine Augen waren aufgerissen, und von seiner hängenden Unterlippe hangelte sich ein Speichelfaden auf seine verwaschene, ausgebeulte Jeans. Ich sprach ihn an, fasste ihn an der Schulter, aber er reagierte nicht. Eine halbe Stunde versuchte ich erfolglos, zu ihm durchzudringen, dann wählte ich den Notruf. Kurz bevor die Polizei und der Notarzt erschienen, löste Renz sich aus seiner Starre, stand auf, sah mich kurz an und stieg die Treppe nach oben zu seiner Wohnung. Ich rief ihm nach, ob alles in Ordnung sei, hörte aber nur noch das Zuschlagen der Tür. Zehn Minuten später erklärte ich den Polizeibeamten und den Sanitätern, wie ich Renz auf der Treppe vorgefunden hatte, und sie gingen nach oben, um mit ihm zu reden, meinten aber hinterher, da sei nichts zu machen, der Mann habe klar und deutlich gesagt, dass es ihm gut gehe und ich die Situation missverstanden hätte.
Ein paar Tage später kam er in den Keller, als ich gerade Wäsche in meine Maschine stopfte, und überreichte mir ein Päckchen, das er für mich angenommen hatte. Seine Stimme war leise, fast ein Flüstern. Er verneigte sich wie ein Japaner und verschwand. Auf dem Päckchen stand nur mein Name, keine Adresse und kein Absender. Als ich es öffnete, fand ich darin ein paar verwelkte Blätter.
Dann bemerkte ich ihn eines Tages, wie er im Regen vor dem Haus stand und zu meinem Fenster hochsah. Er hob die Hand wie zum Gruß und ging davon. Von da an fühlte ich mich beobachtet, machte mir aber keine Sorgen. Ich mochte ihn. Er war so deplatziert, überall. Ich konnte mir keinen Ort vorstellen, an den er wirklich gepasst hätte, an dem man hätte sagen können: Das ist Renz-Land, hier gehört er hin.
Heute hing ihm das Hemd aus dem Hosenbund und er trug Sandalen ohne Socken. Seine Zehennägel hatten schon länger keine Schere gespürt. Sein schwarzes Haar hatte er zu einem Pferdeschwanz gebunden.
»Ich halte ein Tau in der Hand!«, verkündete er.
»Jeder braucht ein Hobby«, sagte ich.
»Darf ich einen Augenblick mit zu Ihnen hinaufkommen?«, fragte er.
Ich zuckte mit den Schultern. Er machte mir Platz, ich schloss die Tür auf, hob sie an, um sie über den Buckel am Boden zu schieben, und ging die Treppe hoch. Renz ließ das Tau fallen und folgte mir.
In meiner Wohnung ging er direkt ins Wohnzimmer, als kenne er sich hier aus, und ließ sich auf das Sofa fallen. Ich setzte mich in den Sessel. Ein paar Sekunden war es still zwischen uns, dann sagte Renz, ich sei ein netter Mensch. Ich sagte, das wisse ich. Er lachte, als hätte ich einen wirklich guten Witz gemacht. Dann meinte er, er habe sich noch gar nicht bedankt. Ich fragte ihn, wofür. Er dachte nach und meinte, wegen der Nacht, als er auf der Treppe gesessen habe. Ich sagte, das sei schon in Ordnung, wir hätten alle manchmal solche Tage.
»Nächte«, verbesserte er mich.
»Nächte«, sagte ich. »Entschuldigung.«
»Schon gut. Die Nächte sind schlimmer als die Tage.«
Ich hatte den Eindruck, er wollte, dass ich nachhakte, dass ich fragte, was an den Nächten schlimmer sei. Ich tat ihm den Gefallen, und er sah mich an, als könne er nicht begreifen, wie man so etwas fragen kann.
»Na, weil die Nächte dunkel sind. Dunkel, verstehen Sie? Tun Sie doch nicht so, als wüssten Sie das nicht. Tagsüber ist es hell, und nachts ist es dunkel, Herrgott, das weiß doch jedes Kind.« Er grinste, als müsse ich schon wissen, wie er das gemeint habe. Das Grinsen verebbte langsam, und Renz sah auf seine Füße. Er krallte die Zehen nach innen und fuhr sie wieder aus. Das machte er ungefähr zehnmal. Dann sagte er, es sei allerdings nicht nötig gewesen, gleich die Polizei zu rufen. Ich versicherte ihm, beim nächsten Mal würde ich mich anders verhalten.
»Eine Frau hat nach Ihnen gefragt«, sagte er. »Sie war jung. Etwa in Ihrem Alter. Gut aussehend. Sehr … energisch.«
Ich hatte keine Ahnung, wer das sein sollte.
»Dunkelhaarig«, fügte er hinzu. »Hat geraucht. Mir fällt so was auf. Also nicht nur wegen der Zigarette. Sie roch ein wenig danach. Sprach mit leichtem Akzent. Osteuropäisch, würde ich sagen. Hat mir ihren Namen nicht genannt. Stand vor Ihrer Tür, als ich die Treppe herunterkam. Meinte, sie sei eine alte Bekannte von Ihnen. Aus Berlin. Ich habe ihr gesagt, dass Sie nicht zu Hause sind.«
»Wann war das?«
»Heute Morgen. Als Sie in der Stadt waren.«
»Woher wissen Sie, dass ich in der Stadt war?«
»Ich habe gesehen, wie Sie mit Ihren Einkäufen wieder nach Hause gekommen sind. Ich bin nicht blöd.«
Jetzt war es wieder still. Renz sah auf seine Füße. Wieder krümmte er ein paarmal die Zehen nach innen.
»Ich habe vergessen, einkaufen zu gehen. Bin einfach nicht dazu gekommen. Jetzt habe ich nichts zu essen im Haus.«
»Was brauchen Sie?«, fragte ich und stand auf.
»Ich bin kein Schnorrer.«
»Jeder kann mal was vergessen. Dann geht man zum Nachbarn und borgt sich was.«
»Waren Sie als Kind schon so groß?«
»Ich bin nicht besonders groß. Ich weiß nicht, was Sie meinen.«
»Größer als ich sind Sie auf jeden Fall.«
»Einszweiundachtzig.«
»Einsachtundsiebzig.«
»Das ist kein großer Unterschied.«
»Ich könnte etwas Brot gebrauchen. Und, wenn es Ihnen nichts ausmacht, Käse. Käse ist gut.«
Ich ging in die Küche, holte das Brot aus dem Steingut-Topf, schnitt es in der Mitte durch und reichte es Renz, der mir aus dem Wohnzimmer nachgekommen war.
»So kann ich es nicht essen«, sagte er, »ich brauche es in Scheiben.«
»Haben Sie kein Messer?«
»Bitte.«
Ich schnitt ihm das Brot in Scheiben und gab ihm ein Stück Käse.
Nachdem Renz weg war, ging ich ins Bad und warf mir kaltes Wasser ins Gesicht. Dunkelhaarig, energisch, mit einem leichten, osteuropäischen Akzent, Berlin. Das konnte nur Maxima sein.
Es war noch früh am Abend, trotzdem waren schon fast alle Tische besetzt. Der weitläufige Raum lag im Halbdunkel. An den Wänden sorgten verkleidete Röhren für angenehm indirekte Beleuchtung. Von der Tür aus sah ich dem Personal beim Bedienen zu, bis Walter kam, mich am Ellenbogen berührte und mich fragte, was ich hier mache.
»Das Übliche«, sagte ich, »ich sehe mir an, wie alles so läuft.«
»Wir wären nicht überrascht gewesen, dich hier ein paar Tage nicht zu sehen.«
Walter hatte sehr dichte Augenbrauen. Schräg stehend. Das war mir schon häufiger aufgefallen. Jetzt aber waren sie zusammengefahren wie zwei sinkende Schiffe.
Ich sagte, es sei schon in Ordnung.
»Hast du nicht einen ganzen Haufen Angelegenheiten zu regeln?«
»Ist alles schon erledigt«, sagte ich.
Ich nickte ein paar Leuten zu. Walter meinte, es werde heute noch hoch hergehen, er erwarte eine Gesellschaft mit zwölf Personen und hoffe, dass der große Tisch im hinteren Bereich rechtzeitig frei werde.
»Ist doch schön, wenn es läuft«, sagte ich.
Ich ging hinter den Tresen und machte mich an der Kaffeemaschine zu schaffen, um nicht völlig nutzlos in der Gegend herumzustehen. Elena kam und legte mir eine Hand auf die Schulter. »Willst du nicht ein paar Tage Pause machen?«
»Nicht nötig«, sagte ich und versuchte, ein freundliches Gesicht zu machen. »Es geht mir gut.«
»Wenn ich irgendetwas für dich tun kann …«
»Danke.«
Ich ging ins Büro, schaltete den Computer ein, beantwortete ein paar Mails, plauderte mit Karol, dem Koch, während der irgendwas in einer Pfanne in Brand setzte, dass die Flammen bis zum Dunstabzug hoch schossen, ließ mir dann etwas zu essen zubereiten, ging ins Kühlhaus, holte frischen Fisch und stach ein neues Fass Bier an, als es nötig war. Ich hatte das alles schon hunderte Male gemacht, und jedes Mal hätte es auch jemand anderes machen können.
Es war kurz nach elf, ich stand an einem der Tische und plauderte mit Gästen, die mir vage bekannt vorkamen, als Walter an mir vorbeiging und leise sagte, ich hätte Besuch.
Sie sah gut aus. Sie saß am Ende des Tresens, ein Glas Champagner vor sich, eine extra lange Zigarette zwischen Zeige- und Mittelfinger ihrer rechten Hand. Sie trug schwarze Jeans und ein rotes Tanktop unter einem weißen Jackett. An den Füßen offene Schuhe. Ihre Zehennägel waren lackiert. Sie hatte die Beine übereinander geschlagen. Als ich näher kam, musste ich mich korrigieren. Sie sah nicht wirklich gut aus, sondern wirkte müde und nervös. Ihre Kleidung war abgetragen.
Als sie mich sah, drückte sie ihre Zigarette im Aschenbecher aus und musterte mich von oben bis unten. Ihre Finger zitterten, als sie sich eine neue Zigarette ansteckte. Ich setzte mich auf den Hocker neben sie.
»Läuft gut, der Laden!«, sagte sie.
»Ich kann mich nicht beklagen.«
Sie nickte. »Du hast dich noch nie beklagt. Das ist dein Problem.«
»Was kann ich für dich tun?«
Sie sah sich um. »Sehr geschmackvoll. Viel Holz. War alles nicht billig.«
Ich gab Elena ein Zeichen, mir einen Espresso zu machen.
»Ich hätte dich angerufen«, sagte Maxima, ohne mich anzusehen, »aber du stehst nicht im Telefonbuch, und dein Adjutant« – sie machte eine Kopfbewegung in Richtung von Walter, der uns quer durch den Raum beobachtete – »wollte sie mir nicht geben.«
Lächelnd stellte Elena den Espresso vor mich hin. Ich sah ihr nach. Seit ein paar Tagen trug sie ihr Haar zu kurzen, wie Stachel vom Kopf abstehenden Zöpfchen geflochten, die eine Hälfte blond, die andere blau. Walter meinte, Kellnerinnen dürften ein wenig exotisch aussehen, solange sie gepflegt wirkten.
»Ich bin bei dir zu Hause gewesen und habe diesen Irren vor deiner Tür getroffen.«
»Renz«, sagte ich.
»Der ist wahnsinnig, ich hoffe, das weißt du. Er hat sich an deiner Tür zu schaffen gemacht, als ich die Treppe raufkam.«
»Wie meinst du das?«
»Er hat davor gekniet und etwas an dem Schloss gemacht.«
»Er ist harmlos.«
»Das werden sie dir in den Grabstein meißeln, wenn er dir nachts die Kehle durchgeschnitten hat.«
»Warum wolltest du zu mir?«
Maxima bemühte sich um ein höhnisches Auflachen, kriegte aber nur eine Karikatur hin. »Ich freue mich auch, dich zu sehen.«
»Das letzte Mal, als ich dich gesehen habe«, sagte ich, »ist es mir nicht gut ergangen.«
Wieder drückte sie die halb gerauchte Zigarette im Aschenbecher aus und zündete sich gleich eine neue an. Ihre Hände zitterten nicht mehr so stark. »Was kann ich dafür, dass du dich auf offener Straße fast abstechen lässt, nachdem du stundenlang durch mein Fenster gespannt hast.«
»Er hat mich nur am Arm verletzt.«
Sie atmete Rauch aus. »Ist ja auch egal.«
»Warum sagst du mir nicht …«
Sie unterbrach mich, indem sie ihre Hand auf meine legte. Das speichelfeuchte Endstück der Zigarette berührte meinen Handrücken. »Ich muss mit dir reden«, sagte sie.
»Nur zu.«
»Nicht hier. In Ruhe. Allein.«
»Ich fände es besser, du kämest gleich zur Sache.«
»›Fände‹ und ›kämest‹! Hast du irgendwo einen Sack Konjunktive gefunden?«
Ich trank meinen Espresso und schob die Tasse von mir weg, zum Zeichen, dass dieses Gespräch für mich beendet war.
»Du hast den Zucker vergessen«, sagte Maxima.
»Wie?«
»Du hast den Espresso ohne Zucker getrunken.«
»Ja und?«
»Also gut«, stöhnte sie, »wenn du darauf bestehst … Obwohl ich lieber später, wenn der Laden zu ist, mit dir gesprochen hätte. Oder morgen. Wie du willst.«
»Später habe ich noch etwas vor«, sagte ich, und ohne es geplant zu haben, blickte ich dabei Elena an, die gerade eine Flasche Ginger Ale aus der Kühlung nahm und meinen Blick auffing.
»Sag nicht, du machst dich an deine Kellnerinnen ran!«
»Komm zur Sache oder lass mich in Ruhe!«
»Ich kann auch woanders meinen Champagner trinken!«
Ich sah sie an. »Wenn du es könntest, wärst du nicht hier.«
Sie hielt meinem Blick nicht lange stand. Als hätte sie gerade erst gemerkt, dass sie sich das enge Top, das sie trug, längst nicht mehr leisten konnte, zog sie die Revers ihres verbeulten weißen Jacketts am Hals zusammen.
»Ich brauche deine Hilfe«, sagte sie leise.
»Die Zeiten ändern sich.«
Elena brachte den Espresso und warf einen kurzen, ernsten Blick auf die etwas aufgedunsene Frau neben mir.
»Es ist nicht viel. Für dich jedenfalls«, sagte sie.
»Woher willst du wissen, was für mich viel ist?«
»Ich muss mich hier nur umsehen.«
»Wie viel?«
»Ich muss neu anfangen. Ich habe da einen an der Angel. Ganz junger Bursche. Echter Rohdiamant. Total ausgeflippt, kann aber singen. Nicht wie dieser andere. Bei Superstar und Star Search ist er durchgefallen, aber ich hab ihn live gesehen und ich weiß, der Junge ist die Granate. Ich muss ihn mir sichern, bevor es ein anderer tut. Aber da muss ich in Vorleistung gehen. So ist das heute. Früher war das anders, da waren sie froh, wenn sie eine Dumme hatten, die sich für sie das Ohr abtelefonierte. Ich zahl es dir zurück, in ein paar Monaten, mit Zinsen, klare Sache!«
»Wie viel?«
Sie holte einen vorbereiteten Zettel aus der Innenseite ihres Jacketts und reichte ihn mir. Die Summe war unverschämt. »Komm am Montag wieder her. Früher Abend.«
»Oh Mann, danke, Felix. Ich wusste, auf dich kann man sich verlassen.«
Sie widerte mich an. Das beruhigte mich.
Sie trank den Champagner, den sie bisher nicht angerührt und der sämtliche Kohlensäure verloren hatte, in einem Zug aus. Dann legte sie wieder ihre Hand auf meine und sagte, sie könne gern warten, bis ich frei hätte, damit wir noch etwas zusammen unternähmen. Ich schüttelte den Kopf.
»Komm am Montag um sechs wieder her.«
Ohne mich zu verabschieden, ging ich Richtung Herrenklo, um mir die Hände zu waschen.
Am Sonntag stand ich früh auf, nachdem ich fast die ganze Nacht wach gelegen hatte, frühstückte und las die Zeitung vom Samstag. Vor dem Amtsgericht war es nach einem Scheidungsverfahren zu einer Messerstecherei gekommen, bei der drei Männer verletzt worden waren. Einem anderen Mann hatte man Kinderpornos auf das Mobiltelefon geschickt, nachdem er im SMS-Chat eines Fernsehsenders mit jemandem in Kontakt getreten war. An einer Eisenbahnbrücke hatte man sich gestern zwischen 11 und 13 Uhr mit roten Rosen fotografieren lassen können. Drei Männer zwischen achtzehn und zwanzig hatten den Einbruch in einen Drogeriemarkt gestanden. An der Universität hatte ein Aktionstag für studierende Mütter und Väter stattgefunden. An einem Krankenhaus war ein Zentrum zur besseren Betreuung von Multiple-Sklerose-Kranken eröffnet worden. Ein Schriftsteller, dessen Roman ein genaues Psychogramm unserer Gesellschaft entwarf, würde in der nächsten Woche bei einer Veranstaltung im Theater auf einen Philosophieprofessor treffen.
Danach setzte ich mich mit einer Tasse Kaffee ans Fenster, sah nach draußen und dachte an meinen Vater. Als ich damit fertig war, machte ich mich auf den Weg.
Vor dem Haus traf ich die junge Frau, die sich mit ihrem Mann oder Lebensgefährten eine Wohnung im zweiten Stock teilte. Man konnte sehen, dass sie geweint hatte. Sie grüßte stumm und hastete an mir vorbei. Ich konnte mich weder an ihren noch an den Namen des Mannes erinnern. Beide waren klein und hatten Übergewicht. Während die Frau sich Mühe gab, ihre Figur durch dunkle, weite Kleidung zu kaschieren, sah der Mann in den letzten Wochen zunehmend schlecht aus. Er ließ sich die Haare wachsen, wechselte seine Hemden viel zu selten und rasierte sich nicht mehr.
Ich ging in den Stadtpark und sah den alten Männern beim Schachspielen zu. Es war noch früh, aber sie waren schon mittendrin. Dem lauen, sonnigen Septembersonntag angemessen, waren sie alle leicht bekleidet, trugen Hemden mit kurzen Ärmeln, aber lange Hosen, und die meisten von ihnen helle Schuhe aus Kunstleder mit geflochtener Oberseite. Die beiden, die gerade gegeneinander spielten, trugen karierte Hemden, der eine in der Grundfarbe Rot, der andere in Blau. Der Rote hatte die schwarzen Figuren, der Blaue die Weißen. Zwischen den Zügen dachten sie lange nach, das Kinn auf der Brust, schweigend. An den Rändern standen die anderen, allesamt über fünfzig. Überraschend viele trugen Kopfbedeckungen, alte Schieber-, Prinz-Heinrich- und sogar Baskenmützen. Zwei hatten Basecaps, der eine mit einem eingekreisten G an der Vorderseite, das für die Green Bay Packers stand, wobei ich mir ziemlich sicher war, dass keiner der Anwesenden jemals von diesem Football-Team gehört hatte. Der andere hatte die traditionelle Mütze der New York Yankees auf seinem kahlen Schädel. »Alte Männer tragen Hüte«, hatte meine Mutter mir mal gesagt, als ich drei oder vier Jahre alt war, »damit ihnen der liebe Gott nicht in den Kopf gucken kann.« Dieser Satz hatte für mich damals viele Fragen aufgeworfen, die mir bis heute noch niemand beantworten konnte: Was sucht der liebe Gott in den Köpfen der alten Männer? Wieso wollen sie nicht, dass er da reinguckt? Verstecken sie etwas, das er nicht sehen darf? Und wie ist das mit den jungen Männern? Will der liebe Gott denen nicht in die Köpfe schauen? Wenn ja, warum nicht? Wenn er ihnen doch hineinschaut, wieso tragen die jungen Männer dann keine Hüte? Haben sie nichts zu verbergen? Oder wissen sie gar nicht, dass der liebe Gott ihnen in die Köpfe gucken will? Warum gaben die Alten den Jungen nicht einen Tipp? Und was ist mit den Frauen, egal ob jung oder alt? Ich fragte meine Mutter, ob die alten Frauen auch Hüte trugen, damit ihnen der liebe Gott nicht in den Kopf schaute, aber meine Mutter sagte, da müsse er nicht reingucken, weil er genau wisse, was drin sei.
»Woher?«, wollte ich wissen.
»Weil die Frauen sich ihr ganzes Leben lang beklagen. Deshalb weiß er Bescheid.«
»Wieso beklagen sich die Frauen ihr ganzes Leben?«
Meine Mutter machte eine lange Pause, und ich dachte schon, sie wolle gar nicht mehr antworten. Schließlich aber sagte sie: »Ich schätze mal, so sind sie einfach, die Weiber.«
Der Rote ließ sich für seinen nächsten Zug immer noch ein wenig mehr Zeit als der Blaue, der sich zwischendurch ständig Zigaretten ansteckte. Der Green-Bay-Packers-Fan rauchte eine billige Zigarre, deren Geruch sich über unsere Köpfe legte. Der Blaue bewegte eine Figur von hier nach da, und danach dauerte die Pause besonders lang. Plötzlich legte der Rote eine seiner Figuren flach auf den Boden, ging zu dem Blauen und gab ihm die Hand, die der Blaue mit beiden behaarten Pranken umschloss, als wollte er sich dafür entschuldigen, dass er gewonnen hatte. Die beiden traten zur Seite und diskutierten gedämpft die zurückliegende Partie, während zwei andere die Figuren wieder in ihre Ausgangspositionen brachten. Ich kam mir vor wie beim Treffen einer Geheimloge.
Als Nächstes spielten die New York Yankees gegen ein weißes Hemd, das sich über einem kompakten Altersbauch spannte. Dieses Match ging schneller vonstatten und war nach nur wenig mehr als zwanzig Minuten beendet, was ein plötzliches, anscheinend grundloses Gelächter der Umstehenden zur Folge hatte.
Es erschien ein kleines Männchen mit schütterem Haar, ging in die Knie und fegte mit einem Handfeger Zigaretten- und Zigarrenstummel auf ein Kehrblech, trug das zu einem der am Weg stehenden Papierkörbe und entsorgte den Müll. Das machte das Männchen jeden Sonntag, für diesen Job war es fest eingeteilt, und es machte diesen Job gut.
Ich stand auf und ging in diese kleine, leicht heruntergekommene Eisdiele in der Nähe des Parkausgangs. Ich war der einzige Gast. Ein gelangweilter Italiener Mitte vierzig lehnte sich, nachdem er mir einen Kaffee gebracht hatte, gegen die Eistheke und nagte sehr konzentriert an seinen Fingernägeln. Zwischendurch betrachtete er sie und schob sie wieder zwischen die Zähne. An einem Tisch in der Ecke war eine etwa gleich alte Frau in einem weißen Kittel, mit geschwollenen Füßen in ausgelatschten Sandalen über die Lokalzeitung gebeugt, und kommentierte, was sie las, mit Kopfschütteln.
Der Kaffee war sehr bitter. Bevor ich einen zweiten bestellen konnte, stieß ein junger Mann in einer rot-gelben Sportjacke, die Hände in den Taschen einer Jeans vergraben, deren Gesäßtaschen etwa in Kniehöhe hingen, die Tür mit seinem Hinterteil auf und kam herein. Die Jacke hing ihm so weit hinten, dass sie fast von den Schultern rutschte. Er ging hinter den Tresen und machte sich einen Espresso. Die Maschine machte Lärm. Der Junge stürzte den Espresso in einem Zug hinunter, tippte auf eine Taste der Registrierkasse, nahm etwas Geld aus der Schublade und verschwand wieder.
Ich sah auf die Uhr, zahlte und machte mich auf den Weg ins Kino, wo ich während der Werbung einschlief und erst wieder wach wurde, als eine Frau die Reihen nach leeren Flaschen absuchte und die Reste des Popcorns zusammenfegte.
Kurz nach halb sechs stand ich bei Ernesto vor der Tür. Ich wartete ein paar Sekunden, bis ich wieder bei Atem war, und klingelte. Annemarie öffnete, legte mir eine Hand an den Oberarm, beugte sich vor, hob fast ein wenig ab und küsste mich auf die Wange. Sie roch nach Parfüm und Wein.
»Du musst entschuldigen«, sagte sie, »als ich die Flasche geöffnet hatte, konnte ich nicht widerstehen.«
Sie trank nicht oft, und schon das erste Glas zeigte bei ihr Wirkung.
»Ich habe ihr gesagt, sie soll es lassen, der Abend ist lang, aber sie hört ja nicht auf mich.« Ernesto stand in der Küchentür, mit einem Stück Käse in der Hand. Wir umarmten uns, und er hob mich ein Stückchen vom Boden hoch, wie er es immer machte, seitdem wir Kinder gewesen waren.
Annemarie hakte sich bei mir ein. »Wie machst du das?«, fragte sie mich. »Das sind vier Stockwerke, aber du bist überhaupt nicht außer Atem!«
Sie führte mich in die Küche, wo der Tisch gedeckt war. Sie hielten sich fast ausschließlich in der Küche auf. Das Wohnzimmer war zum Rauchen und zum Lesen da. Fern sahen sie so gut wie nie, obwohl sie einen kleinen Farbfernseher besaßen, den sie von Annemaries Vater geerbt hatten. Das Wohnzimmer, eine Abstellkammer am Ende der Diele sowie ein ganzer Kellerraum waren vollgestopft mit den Büchern, die mal Jürgen, Ernestos Vater, gehört hatten. Viel politisches Zeug, vergilbte Taschenbücher, Marx und Engels, amerikanischer Imperialismus, deutscher Faschismus, internationaler Alles-Ismus und Krimis, zentnerweise Krimis, Chandler, Hammett, Highsmith, aber auch Sjöwall und Wahlöö, was ich als Kind eigenartig fand: schwedische Krimis, Menschen mit zwei ö im Namen. Wenn ich an den Regalen entlangging, musste ich an meine Mutter als junge Frau denken, obwohl sie damals älter war als die wirklich jungen Frauen. Ich musste an einsame Abende unter dem Küchentisch denken, umringt von Füßen, eingehüllt in Gelächter über Witze, die ich nicht verstand.
Auf dem Tisch standen Wein, Käse und Brot. Ich setzte mich, während Ernesto sich bückte, um eine lose Kachel wieder am Boden zu befestigen. Er sagte, der Boden sei in die Jahre gekommen, immer mehr Kacheln seien locker. Eigentlich müsste er alles neu verlegen. Annemarie meinte, er solle nicht übertreiben.
»Wo ist der Kleber?«, fragte Ernesto.
»In der Kammer.«
Ernesto öffnete die schmale Tür neben dem Herd, ging in die Hocke und wühlte in einer Kiste herum. In dem Regal darüber standen Lebensmittel. Mit einer Tube in der Hand ging Ernesto zu der losen Kachel, nahm sie auf und trug eine milchige Paste an der Unterseite auf.
»Muss das jetzt sein?«, fragte Annemarie.
»Ich vergesse es sonst.«
»Dieses Zeug stinkt«, sagte Annemarie in meiner Richtung.
Ich hob die Hand und schüttelte den Kopf. Mir machte das nichts aus.
»Es ist nur eine einzige Kachel«, sagte Ernesto. »Da ist es nicht so viel Kleber.«
Annemarie nahm meine Hand. »Das hättest du auch morgen machen können.« Ihre Hände waren sehr schön, mit langen Fingern, deren Nägel perfekte kleine Monde hatten.
»Dieses Ding«, sagte Ernesto, trat die Kachel mit dem Fuß fest und blieb noch ein paar Sekunden darauf stehen, »stand so ein bisschen hoch. Da kann man drüber stolpern. Oder man haut sie ständig wieder raus. Das ist doch nervig.«
»Können wir jetzt essen?«
»Hast du dir wieder die alten Männer angesehen?«, wollte Ernesto wissen, als er sich an den Tisch setzte und mir Wein einschenkte.
Ich erzählte ihm, wie es gewesen war. Er hatte mich schon ein paar Mal begleitet, aber meistens ging ich allein hin, und das war mir auch lieber so.
»Schön, dass du gekommen bist«, sagte Annemarie, und sie meinte es so. Sie berührte meine Hand. Sie fasste gern Menschen an, jedenfalls, wenn sie sie mochte. Seit über zehn Jahren war sie mit Ernesto zusammen.
»Es ist gut«, fuhr sie fort, »dass du rausgehst und nicht zu Hause sitzt und dich bedauerst.«
»Du brauchst ihn nicht zu therapieren«, unterbrach Ernesto. »Er ist keiner deiner Patienten.«
Annemarie lachte. Ihre Augen glänzten alkoholisch unter ihren kleinen, roten Locken, die sie immer bis auf die Nasenwurzel wachsen ließ, weil sie meinte, ihre Stirn wölbe sich zu weit vor. Ich konnte das nicht beurteilen, ich hatte ihre Stirn noch nie gesehen. Annemarie war klein, aber wenn sie im Raum war, bemerkte man sie. Sie trug ein ärmelloses schwarzes Oberteil mit einem hohen Bördchen, das ihren schmalen, langen Hals umschloss. Als Kind hatten ihr ihre Sommersprossen und die roten Haare Probleme gemacht, und noch heute tendierten Menschen, die sie nicht kannten, dazu, sie nicht ernst zu nehmen, weil sie so mädchenhaft wirkte.
Wir tranken Wein. Ich hielt mich mit dem Essen zurück. Ernesto erzählte von den Kindern, mit denen er arbeitete. Er glaubte noch immer daran, da etwas bewegen zu können. Ich beneidete ihn um seinen Optimismus, auch um seine Energie und seinen Willen, sich nicht entmutigen zu lassen. Ich fragte mich, ob Annemarie Renz helfen könnte, obwohl mir nicht einmal klar war, was er für Probleme hatte. Vielleicht war er nur ein wenig merkwürdig, stand vor der Tür und hielt ein Tau umklammert, einfach, weil es ihm Spaß machte, und solange er niemandem wehtat, war es seine Angelegenheit. Ich war neugierig. Am liebsten wäre ich in seine Wohnung geschlichen, um mich dort umzusehen und mehr über ihn zu erfahren. Er erinnerte mich an jemanden, den ich früher gekannt hatte. Er erinnerte mich an mehrere Jungs und Männer, auch Mädchen und Frauen, die ein wenig anders waren, anders als andere, anders als ich. Das hatte mich immer interessiert.
Annemarie stützte ihren Kopf in eine Hand und fasste mich wieder an. »Gut siehst du aus«, sagte sie. Ihre Zunge war schon etwas schwerer geworden, ihr Gesicht war gerötet und sie kicherte. Sie hatte eine gewisse Wirkung auf Männer. Manche verstanden ihre Zutraulichkeiten als Annäherung, was grundfalsch war. Anderen ging sie auf die Nerven, weil man immer den Eindruck hatte, als sehe sie etwas in einem, von dem man selbst nichts wusste.
»Du hast wieder etwas Farbe bekommen«, sagte sie.
»Das macht der Wein«, antwortete ich.
»Erzähl uns ein paar Geschichten aus deinem Laden. Was geht da vor sich?«
Ich musste zugeben, dass ich es selbst nicht so genau wusste, aber das war nichts Neues.
»Diese Neue«, sagte Ernesto, »die mit den komischen Haaren …«
»Mein Mann ist ein bisschen verliebt.«
»Sie ist interessant«, fuhr Ernesto fort. »Wie macht sie sich?«
»Sie ist nicht mehr neu«, sagte ich. »Sie hat alles sehr gut im Griff, und sie versteht sich mit Walter, was ja das Wichtigste ist. Ich weiß nur nicht, wie lange sie bleiben will, schließlich studiert sie noch.«
»Und du?«, fragte Annemarie. »Was willst du jetzt machen?«
»Nichts Besonderes.«
»Lass ihn doch in Ruhe«, meinte Ernesto.
Es machte mir nichts aus, dass Annemarie wissen wollte, wie es mir ging. Ich überlegte, wie viel ich den beiden sagen wollte. Dann ging der Moment vorbei. Ernesto erzählte einen Witz, über den ich sehr lachen musste, aber vielleicht lag das an dem Wein, denn kurz darauf hatte ich ihn schon wieder vergessen.
Um neun war ich im Moon. Walter schüttelte den Kopf und fragte, warum ich mich nicht ein wenig schonte. Ich sagte, ich wolle nicht allein sein, und da nickte er.
»Hast du getrunken?«
»Nur ein bisschen Wein.«
Ich half hinter dem Tresen. Gegen halb zehn wurde ich an einen der großen, runden Tische im hinteren Teil gerufen, unter den extrem vergrößerten, grobkörnigen Schwarzweißfotografien von Nick Drake, Tim Buckley und Gram Parsons. Acht Leute konnten an diesen Tischen Platz finden. In diesem Fall waren alle Stühle besetzt, und man hatte noch die beiden Kinderstühle dazwischengequetscht. Es war gleich zu sehen, um wen es hier ging: einen beleibten, halslosen Mann von Mitte sechzig. Sein Gesicht war gerötet und sein kahler Schädel glänzte. Um ihn herum saß seine Familie. Töchter oder Söhne mit ihren Männern oder Frauen, dazu zwei Enkel.
»Kommen Sie her!«, rief der Mann mir zu. »Nehmen Sie sich einen Stuhl!«
Alle rückten ein wenig zusammen, um mir Platz zu machen. Der Glatzkopf griff mir unter die Sitzfläche und zog mich noch näher zu sich heran. Er griff nach der Flasche Champagner in dem mit Eiswürfeln gefüllten Kühler in der Mitte des von leer gegessenen Tellern gerahmten Tisches. Ich winkte einem der Kellner, damit er abräumte. Der Glatzkopf goss Champagner in ein unbenutztes Glas, stellte es vor mich hin und stieß mit seinem eigenen so heftig dagegen, dass es fast umgekippt wäre. Ein hochgewachsener Junge mit blonder Tolle, der, glaube ich, Rolf hieß, und die schmale, dunkle Carola nahmen sich der Teller an. Der Glatzkopf sagte, hier werde sein Geburtstag gefeiert, und dass es die Idee seines Sohnes gewesen sei, hierher zu kommen. Mit seinem Glas zeigte er auf einen untersetzten Mann, mit teigigen Gesichtszügen, der mir zunickte, dann aber gleich wieder wegsah. Neben ihm saß eine Frau in einem hellen Kleid, mit einer weißen Perlenkette um den Hals. Sie hatte Ränder unter den Augen und eine große Nase, lächelte mir zu und fasste an ihre Kette. Zuerst, meinte der Glatzkopf, sei er von der Idee nicht begeistert gewesen, schon wegen des Namens, er sei kein Freund des Englischen. Außerdem habe er das Lokal, das früher hier gewesen sei, noch in schlechter Erinnerung, aber sein Sohn habe nicht lockergelassen, und jetzt müsse er sagen, er sei kolossal dankbar. Kolossal gutes Essen, kolossal guter Wein und kolossal schöne Bedienungen. Er sagte nicht schön, sondern etwas anderes. Und fragte, ob ich ihm »die Kleine« nicht zum Mitnehmen fertig machen könnte. Er meinte Carola. Ich versuchte ein Lachen und trank von dem Champagner.
»War nicht billig«, sagte der Glatzkopf und machte eine Armbewegung, die das ganze Lokal einschloss. Das war immer das Einzige, was allen einfiel: Läuft gut, war nicht billig.
Ich lachte wieder, wiegte den Kopf hin und her und fragte, ob ich die Herrschaften zu einem Digestif einladen dürfe, was mir eine Gelegenheit bot, hier wegzukommen. Der Glatzkopf schlug mir auf die Schulter, und ich stand auf, um mich darum zu kümmern.
Am Montagvormittag rief Elena an und sagte, es gebe ein Problem. Ich machte mich gleich auf den Weg. Im Hausflur traf ich Renz. Er trug ein rotes, kurzärmeliges T-Shirt, auf dem in abblätternden Buchstaben 1st Brigade zu lesen war. Er hob die Hand, ich nickte ihm zu und nahm meine Wagenschlüssel aus der Jackentasche, um Eile anzudeuten.
Renz sagte: »Ich habe Sie gehört.«
Ich war schon ein paar Stufen tiefer als er, blieb stehen und sah zu ihm hoch. »Was meinen Sie damit?«
»Träumen Sie schlecht?«
»Ich schlafe ja nicht mal.«
»Nicht heute Nacht«, sagte Renz. »Ganz allgemein.« Er fuhr sich mit der Hand über die Wange. »Ich höre Sie, wenn ich vor Ihrer Tür stehe. Sie träumen schlecht.«
»Vielleicht träume ich, dass jemand vor meiner Tür steht und mich belauscht.«
Renz lächelte. »Belauschen ist ein schönes, altmodisches Wort.«
Vor dem Pink Moon stand der Lieferwagen der Brauerei.
Auf dem Beifahrersitz saß ein junger Mann und rauchte, den rechten Fuß gegen das Armaturenbrett gestemmt. Drinnen war Elena mit einem zweiten Bierlieferanten in etwas vertieft, das von weitem wie ein Streit aussah. Als sie mich sah, entspannten sich ihre Züge, sie sagte etwas zu dem Mann in der grünen Arbeitskleidung mit dem Logo der Brauerei auf der Brusttasche, der Mann drehte sich um und kam auf mich zu. Er war etwa so groß wie ich, aber viel kräftiger. Um seinen geröteten Schädel zog sich ein dunkler Haarkranz, der hinten ein wenig zu lang war. Das Auffälligste in seinem Gesicht war eine grotesk geschwollene Nase. Er streckte mir ein Klemmbrett entgegen und holte hinter dem rechten Ohr einen billigen Kugelschreiber aus schwarzem Plastik hervor. Die wöchentliche Bierlieferung. Meine Befürchtung, der Mann rieche nach Schweiß und Alkohol, bestätigte sich nicht. Seine Arbeitskleidung verströmte einen undeutlichen Waschmittelduft. Ich nahm den Lieferschein. Der Mann grinste. Er hatte einen guten Oberkiefer. Er machte eine Kopfbewegung in Richtung Elena, verbreiterte sein Grinsen und bewegte die geballte Faust seiner freien Hand vor seinem Oberkörper waagerecht rhythmisch hin und her. Ich unterschrieb. Der Mann tippte sich an die Stirn und ging nach draußen zu dem Lieferwagen.
»Ekelhafter Typ«, sagte Elena.
»Was war los?«
»Die haben das Bier gebracht. Wie ich den Keller aufkriege, wusste ich ja, aber als er sagte, ich soll unterschreiben, wusste ich nicht, ob das in Ordnung ist. Da hat er sich gleich aufgeregt.«
»Wo ist Walter?«
»Ich habe ihn heute noch nicht gesehen.«
Zwei ältere Damen kamen herein, setzten sich ans Fenster und winkten Elena herbei. Ich ging nach hinten ins Büro und rief bei Walter an, aber es meldete sich nur der Anrufbeantworter. Ich ging wieder nach vorn. Elena stand an der Kaffeemaschine und fragte mich, ob wir schon Kuchen hätten. Es war kurz nach halb zwölf.
»Ich weiß nicht, wie Walter das handhabt.«
»Ist er krank?«
Ich hatte keine Ahnung. »Er kommt später«, sagte ich.
Karol, der Koch, kam pünktlich. Als die ersten Gäste für das Mittagessen erschienen, war Walter noch immer nicht aufgetaucht. Elena und die zweite Kellnerin (eine Neue, deren Namen ich nicht kannte) bedienten an den Tischen, während ich versuchte, den Tresen zu versorgen. Ich war ziemlich aus der Übung, und es war einiges los.
Als sich alles wieder beruhigt hatte, sah ich Walter vor dem Fenster stehen. Er war unrasiert und machte den Eindruck, als habe er in seinem Anzug übernachtet. Da er nicht hereinkam, ging ich raus zu ihm und fragte, ob alles in Ordnung sei. Als er mich sah, drückte er die Schultern zurück und straffte mit einer schnellen Bewegung sein Jackett. »Ich bin etwas spät dran«, sagte er und schob sich an mir vorbei. Ohne Elena und die neue Kellnerin zu begrüßen, ging er nach hinten ins Büro. Ich folgte ihm und nahm mir vor, ihm keine Vorwürfe zu machen. Es war noch nie vorgekommen, dass Walter zu spät kam. Ich wollte nicht kleinlich erscheinen.
Als ich ins Büro kam, hatte er sich schon bis auf die Unterwäsche ausgezogen. Er nahm ein frisches Hemd aus einem der Aktenschränke. Ich wusste, dass er Kleidung zum Wechseln hier aufbewahrte, falls ihm oder jemand anderem beim Bedienen ein Missgeschick passierte. Er ging ins kleine Bad, das ich vor einigen Jahren auf seine Anregung hin hatte einbauen lassen, und stellte die Dusche an. Ich fragte ihn, ob ich ihm helfen könne, und er sagte, er könne sich allein einseifen.
Später saß ich mit Elena an einem der Tische, und wir tranken Kaffee. Die andere Kellnerin stand hinter dem Tresen und rauchte. Ich fragte mich, ob der Anblick einer gelangweilt an einer Zigarette ziehenden jungen Frau ein gutes Aushängeschild war, aber da der Laden gerade leer war, sagte ich nichts.
Geduscht und rasiert, in frischen Sachen und freundlich lächelnd setzte sich Walter zu uns und ließ sich berichten, wie das Mittagsgeschäft gelaufen war. Er machte eine scherzhafte Bemerkung darüber, dass es mir doch sicher gut getan habe, mal wieder richtig zu arbeiten, sagte aber nichts zu den Gründen für seine Verspätung. Elena warf mir einen Blick zu, den ich nicht deuten konnte. Dann kamen Gäste.
Ich fragte Walter nach der neuen Kellnerin, und er sagte mir ihren Namen, den ich gleich darauf wieder vergaß. Sie sei nur auf Probe, und er glaube nicht, dass er sie übernehmen werde. Sie sei langsam und begriffsstutzig und könne ihren breiten Dialekt offenbar nicht ablegen. Ich sagte, der sei mir nicht aufgefallen, und auch sonst habe sie sich im Mittagsgeschäft ganz gut gehalten.
»Wenn sie dir so gut gefällt, dann behalten wir sie natürlich«, sagte Walter. »Soll ich sie nach dem Dienst zu dir nach Hause schicken? Nackt, mit einem Schleifchen um den Kopf?«
Ich sah ihn an und vermutete, dass es keinen Sinn hatte, sich heute mit ihm zu streiten. »Ich muss los«, sagte ich und winkte Elena und der Neuen zu.
Ich war zu früh im Clubhaus, obwohl ich noch bei der Bank gewesen war, um das Geld für Maxima zu besorgen. Ich wartete im Café auf Wöhler, trank etwas Mineralwasser ohne Kohlensäure, nickte ein paar Leuten zu, die ich vom Sehen kannte, und blickte durch die Glasscheibe in die Halle hinunter, wo auf allen vier Plätzen gespielt wurde. Hinter dem Tresen stand ein junger Mann, den ich hier noch nie gesehen hatte, der mich aber beim Hereinkommen begrüßt hatte wie einen alten Bekannten. Zwischen seinen Schneidezähnen hatte dabei etwas aufgeblitzt, das aussah wie ein kleiner Diamant.
Wöhler war der Einzige von meinen Gästen, mit denen ich mich je angefreundet hatte. Fünf Jahre war das jetzt her. Damals blieb ich noch selbst bis zum Schluss im Moon, machte die Abrechnung und schloss die Türen ab. Wöhler, den ich bis dahin nur in Begleitung seiner Frau gesehen hatte, hockte allein in der Ecke mit einer ganzen Flasche Malzwhiskey neben sich. Ich setzte mich zu ihm und hörte mir an, was er zu sagen hatte. Eheprobleme, nichts Außergewöhnliches. Ich ließ ihn auf meinem Sofa übernachten. Die Sache mit seiner Frau, Julia, renkte sich wieder ein, und sie kamen noch häufiger ins Moon als vorher ohnehin schon. Wir fingen an, uns auch privat zu treffen, die beiden boten mir das Du an und stellten mir Frauen vor, von denen sie glaubten, dass sie mir gefielen. Wöhler hatte einiges von dem, was ich nicht hatte. Er konnte laut werden und sich beschweren. Im Moon hatte er keinen Grund dazu, aber ich war schon mit ihm und Julia in anderen Restaurants und Cafés gewesen, wo er sich über den Service oder das Essen beklagt hatte. Er hatte Recht gehabt, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, so aufzutrumpfen. Julia sagte mir einmal, dass sie diese Seite an ihm besonders interessiere, dieses Herrische, sich Vorreckende. Gleichzeitig sei es ein Problem zwischen ihnen, weil er dieses Verhalten auch ihr gegenüber zeigte. Es war nicht so, dass ich so sein wollte wie er, aber bisweilen war es nicht uninteressant, ihm zuzusehen.