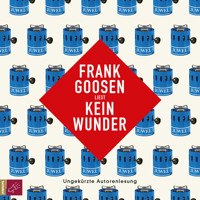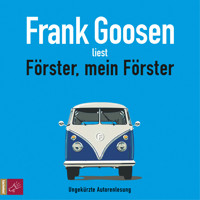4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mixtapes statt Kohle: Die Achtziger im Ruhrgebiet. Als die Achtziger ausbrechen, ist Frank Goosen dreizehn, als sie enden, vierundzwanzig. Dazwischen: Schulterpolster, Synthiepop – und jede Menge Veränderung im Ruhrgebiet. Kultur statt Kohle lautet die Devise: Während Zechen und Hochöfen stillgelegt werden, erobert Schimanski die Fernsehbildschirme und Starlight Express die Rollschuhbahnen. Beste Voraussetzungen also, um erwachsen zu werden! In seinen neuen Stories und Glossen nimmt Frank Goosen uns mit in diese legendäre Zeit des kulturellen Wandels. Denn während man sich im Ruhrgebiet zu neuen musikalischen und modischen Höhen aufschwingt, fängt auch für ihn das Leben erst richtig an: Mit fulminantem Witz und viel Selbstironie berichtet er von merkwürdigen Ritualen beim Trio-Konzert und von der Jagd nach dem perfekten Mixtape für Claudia, Kerstin und Frauke. Er erklärt, wieso die Achtziger für ihn vor allem nach Videotheken rochen und wie Billy Crystal ihm einmal eine Beziehung ruinierte. Eine so persönliche wie vergnügliche Zeitreise – für die, die dabei waren, und für alle anderen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Frank Goosen
Sweet Dreams
Rücksturz in die Achtziger
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Frank Goosen
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Frank Goosen
Frank Goosen hat neben seinen erfolgreichen Büchern, darunter »Raketenmänner«, »Sommerfest« und »Liegen lernen«, zahlreiche Kurzgeschichten und Kolumnen in überregionalen Publikationen und diversen Anthologien veröffentlicht. Zuletzt erschien der Roman »Spiel ab!« bei Kiepenheuer & Witsch (2022). Darüber hinaus verarbeitet er seine Texte teilweise zu Soloprogrammen, mit denen er deutschlandweit unterwegs ist. Einige seiner Bücher wurden dramatisiert oder verfilmt. Frank Goosen lebt mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen in Bochum.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
In seinen neuen Stories und Erzählungen nimmt uns Frank Goosen mit in eine legendäre Zeit des kulturellen Wandels. Denn während immer mehr Zechen und Hochöfen stillgelegt werden und man sich selbst im Ruhrgebiet zu neuen musikalischen und modischen Höhen aufschwingt, fängt auch für ihn das Leben erst richtig an. Mit seinem unvergleichlichen Humor und viel Selbstironie berichtet er von seiner Jugend im Lieblingsjahrzehnt der Deutschen, von merkwürdigen Ritualen beim Trio-Konzert und von der Jagd nach dem perfekten Mixtape für Claudia, Kerstin und Frauke. Er erklärt, wieso die Achtziger für ihn vor allem nach Videotheken rochen und wie Billy Crystal ihm einmal eine Beziehung ruinierte. Eine so persönliche wie vergnügliche Zeitreise – für die, die dabei waren, und für alle anderen.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2021, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: nach © non123 / shutterstock.com
ISBN978-3-462-30316-2
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Teil 1: Der Papst auf Prosper-Haniel
Meine Achtziger
Teil 2: Don’t you want me
Vielleicht bin ich verwundert
Für eine Solovioline eine echt säuische Stelle
Shake Hands
Eine Brücke über unruhiges Wasser (alt. Take)
Unheimlich schön
Was kann schöner sein?
Mixtape
Teil 3: Das Jahr, in dem wir neunzehn wurden
Januar: Inversionswetterlage
Februar: Moonboots
März: Umme Ecke
April: Axel
Mai: Vollmond
Juni: Vierundfünfzig Steine
Juli: Die Ulli
August: Gamechanger
September: Geld für nix
Oktober: Jemand zu Hause?
November: Klinikum
Dezember: Der erste gute Vorsatz
Teil 4: Zimmer mit Aussicht
Wohnen mit Egon
Der Geruch der Achtziger
Wohnen da eigentlich Vögel drin?
Stück noch geradeaus!
Mein Mauerfall
Teil 5: Jump, Shout, Relax
Schloss aus Sand
Warten auf Springsteen
Kommst du mit?
Dank
Veröffentlichungsnachweise
Meine Achtziger
Als die Achtziger ausbrachen, war ich dreizehn, und als sie zu Ende gingen wie eine Krankheit, von der man sich erholt, war ich vierundzwanzig. In den Achtzigern passierte für mich vieles zum ersten Mal: Ich bekam meinen ersten Zungenkuss, war das erste Mal betrunken, blieb im zehnten Schuljahr sitzen (wegen Mathe, Latein, Französisch und Claudia), verlor meine Unschuld, machte Abitur und Führerschein, baute meinen ersten Unfall und versuchte mich an meinem ersten Roman.
Für das Ruhrgebiet waren die Achtzigerjahre eine Zeit des fortgesetzten Umbruchs. Das Alte war noch nicht ganz weg, das Neue noch nicht da. Was das Neue sein sollte, weiß man bis heute nicht so richtig. Noch im April 1980 unterzeichneten Vertreter der Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke und des Gesamtverbandes des deutschen Steinkohlebergbaus den zweiten Kohle-Strom-Vertrag. Bis 1995 sollte die Verstromung heimischer Kohle nicht nur sichergestellt, sondern ausgebaut werden. Die Mehrkosten der Wirtschaft, die auf die günstigere Importkohle verzichtete, sollten durch den sogenannten »Kohlepfennig« aufgefangen werden. Zum ersten Mal seit 1974 verzeichnete der Ruhrbergbau wieder mehr Neueinstellungen als Abgänge.
Ich selbst hatte andere Dinge im Kopf. In Bochum, wo ich 1966 auf die Welt geworfen worden war, hatte die letzte Zeche 1973 geschlossen. Ich hatte keine Verwandten auf irgendeinem Pütt, mein Großvater väterlicherseits und mein Onkel waren zwar noch eingefahren, aber der Großvater war schon 1967 gestorben, und mein Onkel verdiente sein Geld längst bei Krupp. Mein Vater hatte sich als Elektriker selbstständig gemacht und ein paar Jahre lang daran geglaubt, dass alles besser werden würde, weshalb es bei uns zu Hause keine Eichen-Schrankwand im Stile des Gelsenkirchener Barock gab, auch keine Blümchentapeten oder Linoleum auf dem Küchenboden, sondern eine schwarz-weiße Wohnzimmertapete mit fast psychedelischem Muster, dazu eine weiße Ledergarnitur und ein hochmodernes Schrankensemble mit Vitrine, schwarzen Türen und stahlfarbenen, senkrechten Streben. Der Fernseher war ein Top-Teil von Nordmende, und statt einer mehrarmigen Hängelampe beleuchteten drei große orange Scheinwerfer, die an der Wand mit der auffälligen Tapete angebracht waren, diese Szenerie des Zukunftsoptimismus und der Aufstiegshoffnung. Im Korridor (woanders auch gern auf der Diele) stand eine wuchtige, mehrteilige Stereoanlage auf weißen Regalbrettern, an der Wand hing ein Kasten (wieder in Orange) mit Knöpfen und Lämpchen, von wo mein Vater die in der Küche sowie dem Wohn- und Schlafzimmer verteilten Kleinlautsprecher ansteuern konnte.
Mein Jugendzimmer war ein Traum in den Modefarben der Siebziger. Es gab Braun und Beige und, natürlich, Orange, dazu einen Sessel mit Cordbezug und einen gelben Kleiderschrank mit weißen Griffen. Darauf hatte ich einen Aufkleber gepappt: Caramac bringt auf Zack! Unter der Decke sorgten zwei verkleidete Leuchtstoffröhren für eine nicht gerade teintschmeichelnde Vollausleuchtung.
Ende April 1980 hatte ich Konfirmation. Auf einigen unscharfen Fotos sieht man mich in einem dunkelblauen Samtanzug und einem hellblauen Hemd mit Fliege vor der Tür unseres Hauses an der Alleestraße stehen, immer alles schön mittig, nur keine ungewöhnlichen Perspektiven! Da ich noch zwei Ommas und einen Uroppa hatte, dachte ich einen Tag später: Ich werde in meinem Leben niemals arbeiten müssen! Ich war unfassbar reich und legte mir endlich eine halbwegs ordentliche Musikanlage zu, da es bisher nur für einen Mister Hit gereicht hatte. Hi-Fi-Gourmets legten sich seinerzeit Türme aus Einzelkomponenten zu, ich war eher der praktische Typ und entschied mich für ein Gerät, bei dem ich nicht ahnen konnte, dass allein die Nennung des Produktnamens mir vierzig Jahre später bei Lesungen bisweilen Szenenapplaus einbringen sollte: die legendäre Schneider Kompaktanlage.
An meinem vierzehnten Geburtstag Ende Mai 1980 gewann der VfL Bochum 5:2 gegen Werder Bremen und belegte den zehnten Platz, und zwar in der richtigen Liga. Man nennt es nicht umsonst die gute alte Zeit.
Auch deshalb: Im September 1980 übertrug das ZDF live aus dem Bochumer Schauspielhaus die Uraufführung des neuen Thomas-Bernhard-Stückes Der Weltverbesserer mit Bernhard Minetti und Edith Heerdegen.
Lassen Sie das bitte kurz sacken: die Uraufführung des neuen Stückes eines passionierten Misanthropen im ZDF! Live! Zur besten Sendezeit! Den Anfang des Stückes kann ich immer noch aufsagen: »Das Ei weich, die Sauce süß. Süß die Sauce!«
Der Spiegel nannte das Bochumer Theater ein »Pilgerziel« für Theaterfreunde. Kultur statt Kohle. Außerdem war es damals so: Machten wir uns an Mädchen ran, luden wir sie oft nicht ins Kino ein, sondern ins Theater. Peymanns legendäre Inszenierung von Kleists Die Hermannsschlacht habe ich bestimmt fünfmal gesehen, mit gefühlt sechs verschiedenen Frauen.
Knapp drei Wochen nach dem Weltverbesserer feierte in der Lichtburg in Herne der Film Theo gegen den Rest der Welt Premiere, ein Dreivierteljahr später folgte Jede Menge Kohle von Adolf Winkelmann. Etwa zur gleichen Zeit regten sich viele über den neuen Tatort Duisburg-Ruhrort auf, weil Schimanski nicht im Trenchcoat wie Kommissar Haferkamp daherkam, sondern im Parka. Götz Georges erstes Wort im Film ist legendär geworden: »Scheiße«. Okay, dachten wir uns, so wird hier auf der Straße sowieso geredet, warum dann nicht auch im Fernsehen?
Im Mai 1981 eröffnete das Kulturzentrum Zeche Carl in Essen, im November folgte Die Zeche in Bochum, und am Theater an der Ruhr in Mülheim übernahm Roberto Ciulli. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, hat Hermann Hesse gesagt, und zu Beginn der Achtziger war eine Menge Anfang im Ruhrgebiet. Das war die eine Seite.
Aber es gab auch eine andere. Im Januar 1982 protestierten 2000 Werksangehörige des Thyssen-Betriebs Schalker Verein in Gelsenkirchen gegen die Stilllegung des letzten Hochofens der Stadt. 2500 Beschäftigte von Krupp demonstrierten vor der Villa Hügel in Essen gegen die Schließung der Walzwerksanlagen in Duisburg-Rheinhausen. Die Proteste blieben erfolglos, Tausende verloren ihre Arbeit.
Gleichzeitig war ich zum ersten Mal so richtig verliebt. Ich lernte das Küssen im Bochumer Stadtpark. Am Ort des damaligen Geschehens steht heute ein Stromkasten. Kein Witz. Ich bin sicher, da wird nicht nur Energie weitergeleitet. Sondern neu gewonnen. Wissenschaftler stehen vor einem Rätsel. Ich habe damals schon vermutet, dass meine große Liebe irgendwann alle Probleme dieser Welt lösen wird.
Ich ging zur Tanzschule, aber nicht zum Tanztreff Bobby Linden wie meine Eltern, sondern in einen privaten Tanzzirkel, der in der Villa Harmonie abgehalten wurde. Unsere Tanzlehrerin spielte eine kleine Rolle in dem Film Die Heartbreakers über eine Beat-Band im Ruhrgebiet der Sechziger, der 1983 in die Kinos kam und wegen dem wir uns alle (also wir Jungs) in Maria Ketikidou verknallten, nachdem uns zuvor Sophie Marceau in La Boum schlaflose Nächte bereitet hatte.
Aber Sophie Marceau – das war die große, weite Welt. Vor der Haustür sah es anders aus. Was heute als Klischee verschrien ist, war damals Wirklichkeit: Alte Frauen in Haushaltskitteln saßen in ihren winzigen Gärten, daneben Männer in kurzen Hosen und mit freien Oberkörpern. Die jüngeren Frauen trugen gewagte Bikinis, die Männer gerne Schnäuzer, und die Haare bitte aufwendig frisiert, bei den Herren vorne kurz und hinten lang, bei den Damen aufgetürmt oder asymmetrisch oder Kurzhaar mit Stirnband. Physical ist eine schlimme Nummer, das Video ganz fürchterlich, aber Olivia Newton-John mit ihren kurzen Locken und dem weißen Ding um ihre Stirn macht mich immer noch ganz nervös.
Meine schon mit Anfang dreißig ergraute Mutter trug ebenfalls Kurzhaar, aber unaufwendig, mein Vater Fassong (muss ich so schreiben, die französische Version bekomme ich einfach nicht hin). Modisch ließen sie sich gerne mal zu Entgleisungen hinreißen, die meinem pubertierenden Ich peinlich waren. So trug mein Vater etwa eine Zeit lang einen weißen, mit Nieten besetzten Ledergürtel oder braune Stiefeletten. Herrje, denke ich heute, als ich fünfzehn war, waren die zwei sechsunddreißig, und von heute aus gesehen, mit Mitte fünfzig, kommt mir sechsunddreißig vor wie sechzehn, also Nachsicht bitte.
Zu den kleinen Freuden meiner Eltern gehörte ihr Schrebergarten, aber für den war nicht immer Zeit, also kletterten sie manchmal nachmittags aus dem Fenster und stellten Liegestühle auf den Vorbau vor dem Küchenfenster, in dem das Wohnzimmer der Vermieter untergebracht war. Rotstichige Fotos zeigen meinen Vater, wie er sich den Bauch mit der Magenoperationsnarbe tätschelt. Direkt vor der Tür dröhnte die vierspurige Alleestraße, in der anderen Richtung war man nach hundert Metern auffem Eierberch oder auffe Gurke, dem angeblich weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannten Rotlichtbezirk.
Ich war einer der wenigen, die zu Fuß zur Schule gingen, jeden Morgen einmal quer durch die Innenstadt. Die meisten meiner Mitschülerinnen und Mitschüler wohnten in den Vororten, die Eltern waren Ärzte, Rechtsanwälte, Steuerberater, Banker und Apotheker oder betrieben irgendeinen Laden. Viele hatten Gärten gleich hinter dem Haus, die brauchten keinen Schrebergarten und mussten nicht aus dem Fenster klettern, wenn sie sich im Liegestuhl erholen wollten.
Im Orwell-Jahr entkam ich der Aufsicht meiner Eltern wenigstens ein bisschen, indem ich eine zugige, im Winter nicht wirklich zu heizende Mansarde im gleichen Haus bezog. Im Januar hatte ich Eisblumen am Fenster. Außerdem ein gelbes Schaumstoffsofa von IKEA, auf dem irgendwann mein Erstes Mal stattfand – wie es sich gehört eine meinerseits etwas hektische, unsichere, peinliche Veranstaltung.
Auf den nach Leistungskursen geordneten Fotos meines Abiturjahrgangs sieht man den ganzen modischen Querschnitt der Achtziger: Christiane mit den blonden Locken und der roten, kurzen, noch zusätzlich hochgekrempelten Hose; Olaf mit dem Sakko und den weißen Tennisschuhen; Oliver mit der Popper-Welle und den weißen Socken; Dirk mit dem über die Schulter geworfenen Pulli; ich selbst in der obligatorischen Jeansjacke, das Haupthaar bereits so schütter, dass eine komplizierte Frisur schon damals nicht infrage kam.
Ich war achtzehn, als die UdSSR endlich wieder einen Chef bekam, der aussah, als würde er nicht in den nächsten Minuten tot umfallen. Jetzt sollte sich alles ändern, alles mal wieder besser werden. Ein Jahr später flog in Tschernobyl in der Ukraine ein Atomkraftwerk in die Luft, und sogar meine Omma legte sich Jodtabletten zu. Wieder ein Jahr darauf schloss mit Minister Stein die letzte Zeche in Dortmund, da half es auch nicht, dass der Papst Prosper-Haniel in Bottrop besuchte. In Hattingen wurden die noch verbliebenen Hochöfen der Henrichshütte stillgelegt, der letzte Abstich erfolgte kurz vor Weihnachten 1987. Fuhr man früher über die Kosterbrücke, brannte der Himmel. Das war jetzt vorbei.
Für mich selbst dagegen fing so vieles erst mal an, ging es nur bergauf. Ich fuhr jetzt einen Ford Taunus mit vier Türen, runden Lampen und mottenfarbenen Liegesitzen, und zwar nach Holland und nach München, wo ich mit einem Kumpel am Straßenrand im Auto übernachtete. Ich hatte eine Menge darüber gehört, was auf dem Rücksitz eines solchen Wagens alles mit Mädchen laufen sollte, aber was mich anging, blieben das Geschichten wie die von der Spinne in der Yucca-Palme. Es gibt ein Foto von mir, da sitze ich auf der Motorhaube des Taunus vor einem Ferienhaus in Holland, natürlich wieder in Jeansjacke, das war kein Auto für Sakkos. Den Gaszug musste ich irgendwann mit einem Schnürsenkel fixieren – SO ein Auto war das.
Zusammen mit einem guten Freund ging es auf die damals obligatorische Interrail-Tour quer durch Europa. In Paris verzichteten zwei Kanadierinnen auf näheren Kontakt zu uns, als sie hörten, dass wir erst achtzehn waren. In Madrid aßen wir früh am Sonntagmorgen ein Boccadillo con Jamon, wobei der Jamon zur Hälfte aus Fett bestand, wahrscheinlich aus den Beständen für besonders naive Gäste. In Lissabon traten uns Polizisten in die Seite, weil man vor dem Bahnhof nicht schlafen sollte, und in Albufeira trafen wir zwei Schwedinnen, die wir schon in Paris und Nizza gesehen hatten.
Ich studierte Geschichte an der Strukturwandel-Uni in Bochum. Damals waren die Gebäude noch nicht bunt angemalt, bei Regenwetter bildeten sich weiße Ränder an den Balkonen aus Sichtbeton und auf dem Forum wackelten die Bodenplatten. Das Mensa-Essen wurde morgens zur Ansicht in eine Vitrine gestellt und sah mittags aus, als könnte es nur noch als Dichtungsmasse benutzt werden. Bevor man essen oder in den Caféten der Gebäude etwas trinken konnte, musste man zuerst Dutzende von Flugblättern beiseitewischen. Das heutige Institut für soziale Bewegungen hieß damals Institut zur Erforschung der Europäischen Arbeiterbewegung.
In Duisburg-Rheinhausen wurden noch mal alte Schlachten geschlagen. Im Februar 1988 bildeten achtzigtausend Menschen eine siebzig Kilometer lange Menschenkette quer durch das Ruhrgebiet, das endgültige Ende für das Stahlwerk konnte aber nur verzögert werden. Vier Monate später hatte das Musical Starlight Express in Bochum Premiere. Das Alte und das Neue gaben sich die Klinke in die Hand. Dann fiel die Mauer, und die Achtziger waren vorbei.
In der konfektionierten Erinnerung der Kinofilme und Fernsehserien sind die Achtziger ein quietschbuntes, neonfarbenes Jahrzehnt voller naivem Hedonismus, aber es war auch ein Jahrzehnt, in dem vieles zu Ende ging. Das Ruhrgebiet trug Kämpfe aus, deren Heftigkeit noch nicht durch Selbstironie abgemildert wurden. Der versöhnliche Blick zurück, die Stilisierung und Ironisierung standen erst meiner Generation, für welche die Achtziger vor allem Aufbruch waren, zur Verfügung.
Als die Achtziger am 9. November ’89 endeten, hatte ich noch immer das gelbe Schaumstoffsofa, wohnte in der Nähe des Bochumer Stadions und hatte in meinem Wohnzimmer eine Gasheizung, von deren Ausdünstungen ich regelmäßig Kopfschmerzen bekam. Nicht selten rührten die aber auch von den Getränken her, die ich zu mir nahm. Einmal meinte mich der Vermieter daran erinnern zu müssen, dass ich in seinem Haus eine Wohnung und keine Kneipe gemietet hätte. Schon seit Ende September stand Lambada an der Spitze der deutschen Charts.
Ich gehörte in den Achtzigern keinem der Tribes an, war kein Popper, nie Punk, kein New Romantic, Grufti oder Kutten-Hool, wobei ich mit meiner Vorliebe für Jeansjacken Letzteren vielleicht am nächsten stand. Ich war Beatles-Fan und 1982 innerhalb von sechs Wochen erst beim Konzert von Trio in der Bochumer Zeche und dann bei Simon and Garfunkel im Dortmunder Westfalenstadion. Auf den Familienfeiern war ich umgeben von Männern mit von der Arbeit zu Würsten geschwollenen Fingern und Frauen, denen das Fußfett aus den Schuhen quoll. Alle hatten sie diese Kriegsgesichter und wussten noch, was echter Hunger war, von dem wir Jungen keine Ahnung hatten, wir kannten doch nur Appetit, und das war uns auch ganz recht. An den Männern war alles Arbeit, an den Frauen alles Duldung, selbst wenn sie lachten, wirkte das ernst, außer bei meiner Omma, aber das ist was für ein anderes Buch.
Das war die Welt der Gerdas und Günthers, der Waltrauds und der Heinze, der Irmgards und der Alfreds, wir waren die Franks und Michaels und Christophs und Thomasse, und wir brannten für die Susannes und Sabines, Ankes und Andreas, Birgits und Barbaras, und wenn es nach mir geht, heißen die Achtziger Katja und Claudia, Freundschaft und Verlangen.
Vielleicht bin ich verwundert
Die zweite große Pause hatte schon angefangen, aber ich war zum Tafeldienst eingeteilt, und wenn niemand dabei war, versuchte ich das möglichst gewissenhaft zu erledigen, also den Schwamm sauber von oben nach unten zu ziehen und ihn nach jeder Bahn auszuwaschen, damit es keine Streifen gab. Vor Zeugen ging ich sehr viel lässiger vor, um nicht den Eindruck zu erwecken, ich sei ein verklemmter Ordnungsfanatiker und Saubermann. Wenn die anderen zur nächsten Stunde kämen, hätten sie längst vergessen, dass ich es gewesen war, der die Tafel in diesen makellosen Zustand versetzt hatte, und an diesem Tag war es sowieso egal, denn als Nächstes hatten wir in der fünften Stunde Musik im Musikraum und in der sechsten Erdkunde im Erdkunderaum und dann Schluss.
Als ich mit dem Wischen fertig war, sahen meine Finger faltig aus wie nach dem Baden, fühlten sich aber kälter an, und ein unsichtbarer Rest von Kreidestaub bedeckte meine Fingerkuppen. Ich wischte mir die Hände an der Jeans ab, warf noch einen Blick auf die perfekt gereinigte Tafel und war zufrieden mit mir.
Im Treppenhaus traf ich auf Nicole, die ich schon länger ziemlich gut fand. Ich ging aber davon aus, dass da für mich nichts zu holen war. Sie sagte Hallo und zeigte mir dieses Lächeln, das meiner Ansicht nach unter das Kriegswaffenkontrollgesetz hätte fallen sollen. Der Speichel in meinem Mundraum verwandelte sich in Staub.
»Sag mal, hast du die Solo-Platte von Paul?«, fragte sie.
Sie sprach es Deutsch aus, und da ich hormonell verwirrt war, stand ich erst mal auf dem Schlauch. Welchen Paul, der Platten machte, konnte sie meinen? Paul Kuhn? Aber warum solo? In welcher Band war Paul Kuhn gewesen? Hatte der nicht seine eigene? Zwei Sextaner rannten an uns vorbei die Treppe hinunter. Dass ich verwirrt war, stand mir natürlich ins Gesicht geschrieben, deshalb präzisierte Nicole: »Paul McCartney. Der von den Beatles.«
Wieder sprach sie den Vornamen deutsch aus. Wahrscheinlich konnte ich froh sein, dass sie wenigstens den Namen der Band richtig verwendete.
»Solo-Platte von Paul«, sagte ich. »Da kommen ja einige infrage, McCartney aus dem Jahr 1970, da ist Maybe I’m amazed drauf, tolle Nummer, das heißt: Vielleicht bin ich verwundert, und das geht einem ja oft so im Leben, oder Ram von 1971, die meiner Ansicht nach unterschätzt wird, vor allem The Backseat of my Car, oder meinst du vielleicht Wings Wild Life, was ja streng genommen keine Solo-Platte ist, weil er da schon eine neue Band hatte, die Wings nämlich, unter anderem mit Denny Laine, der übrigens hauptsächlich für Mull of Kintyre zuständig war, was aber alle ganz selbstverständlich Paul zuschreiben, wie man überhaupt fragen kann, ob die Wings eine richtige Gruppe sind, denn letztlich geht es immer um Paul, und …«
Nicole hob die Hand, und ich verstummte augenblicklich.
»Wieso redest du so viel?«
»Ich rede zu viel?«, bekam ich heraus und hörte mich an wie einer der schwarzen Vögel, die hinterm Haus meiner Uromma auf der Teppichstange saßen. »Ich versuche einfach, das von dir Gewünschte einzugrenzen, weil da ja so viel …«
»Vielleicht bin ich verwundert«, sagte sie lächelnd, »aber habe ich mich so unklar ausgedrückt?«
Nie zuvor war mir so deutlich geworden, wie sehr man an den Händen schwitzen konnte. Der Schweiß verband sich mit der noch spürbaren Feuchtigkeit des Tafelschwamms, den ich vorhin geschwungen hatte, durchsetzt mit Resten von Kreidestaub.
»Das würde ich so nicht sagen«, sagte ich, »aber es ist ja tatsächlich eine offene Frage, ob man die Platten der Wings zu den Solo-Platten zählt, ich tue das auf jeden Fall, weil solo heißt für mich bei Paul alles, was er nach den Beatles gemacht hat, denn seien wir mal ehrlich, wenn man mal bei den Beatles war, dann sind doch alle anderen Gruppen, in die man sich begibt, immer nur eine Begleitband für einen Exbeatle, und …«
Wieder hob Nicole die Hand, wieder riss mein Redeschwall abrupt ab. Sie sagte: »Ich meine die, wo er so guckt wie ein kleiner Junge, den man mit der Hand im Pudding erwischt hat.«
»McCartney II, ja, die habe ich.«
Natürlich hatte ich die. Ich war seit letztem Jahr Beatles-Fan, und Mitte Mai war McCartney II erschienen, Ende Mai hatte ich sie mir zum Geburtstag schenken lassen.
»Kannst du mir die mal ausleihen?«
»Äh, ausleihen?«
»Ja, okay, ich verstehe, du gibst die nicht so gerne raus. Dann komm doch in den nächsten Tagen mal bei mir vorbei, dann nehme ich sie mir schnell auf.«
Normalerweise war ich in solchen Situationen nicht in der Lage, so richtig schnell zu schalten, aber diesmal schoss mir sofort durch den Kopf, dass eine Verabredung erst in ein paar Tagen absolut unmöglich war, weil ich bis dahin an nichts anderes hätte denken können, und übermorgen schrieben wir Mathe, da musste ich irgendwie versuchen, eine Vier zu kriegen.
»Äh, also, in den nächsten Tagen bin ich ziemlich dicht, was Termine angeht, aber heute Nachmittag könnte ich dich noch dazwischenschieben.«
Nicole sah mich ein paar Sekunden lang an, wobei ihre schönen Schneidezähne ein wenig auf ihrer Unterlippe herumkauten.
»Wenn du mich um halb vier dazwischenschieben könntest, wäre das toll«, sagte sie. »Dauert auch nicht lange.«
»Ja, nee, ist okay, halb vier ist super.«
»Prima«, sagte sie und lief die Treppe hinunter in die Pause, was ich auch hatte tun wollen, aber jetzt hätte das natürlich blöd ausgesehen. Also ging ich erst mal zur Toilette beim Musiksaal und wusch meine Hände, die sich ganz pappig anfühlten, wahrscheinlich von dem Kreidestaub.
Am Nachmittag war ich natürlich viel zu früh bei Nicole und musste fünfmal um den Block gehen, um nicht gleich den (völlig zutreffenden) Eindruck totaler emotionaler Bedürftigkeit zu vermitteln.
Ihr Bruder Andreas, der schon fast achtzehn war, öffnete mir die Tür und sagte: »Du bist der Beatles-Typ, oder?«
Das fängt gut an, dachte ich, denn verdammt, ja, ich war der Beatles-Typ. Ich war nicht nur Fan, ich war praktisch der sechste Beatle. Der sechste, weil der fünfte ja der Produzent George Martin war. Um diesen Titel hatten sich immer wieder alle möglichen Leute gekloppt, aber für mich kam nur dieser seriöse ältere Herr infrage, der so großen Einfluss auf den Sound der Fab Four gehabt hatte. Vor allem bei den frühen Aufnahmen merkte man einen himmelweiten Unterschied zum Beispiel zu den frühen Nummern der Stones, fand ich.
Und da ich der sechste Beatle war, sagte ich nicht »ja, stimmt« oder etwas in der Art, sondern verstieg mich zu einem angeberischen »sure, my friend«. Andreas sah mich an, als hätte ich ihm gerade mitgeteilt, ich hätte Krebs im Endstadium.
Nicole kam aus ihrem Zimmer und schoss wieder dieses Lächeln ab. Ich schämte mich noch für das saudumme »sure, my friend« und konnte die ganze Situation gar nicht verarbeiten.
»Hi«, sagte Nicole.
»Hi Hi Hi – with the Music on«, zitierte ich den Song, den Paul mit den Wings 1972 als Doppel-A-Seiten-Single zusammen mit dem Song C-Moon herausgebracht hatte, und fragte mich: Wie kann man nur so blöd sein?
Nicole runzelte die Stirn und ging vor in ihr Zimmer. Für ein Mädchen-Zimmer war es ziemlich sachlich. Ein Bett ohne Kopf- und Fußteil, darüber allerdings ein zartblaues Netz; als Schreibtisch eine große Platte auf zwei Malerböcken; zwei Regale vollgestopft mit Büchern; ein blauer Ohrensessel mit einer aus vielen unterschiedlichen Quadraten zusammengesetzten Häkeldecke als Überwurf; neben dem Sessel eine Chiquita-Bananenkiste, auf der eine einfache Spanplatte lag; ein Stereoturm mit Plattenspieler, Verstärker und Tapedeck jeweils von unterschiedlichen Herstellern, woran man angeblich erkannte, dass jemand richtig Ahnung von Musik und Technik hatte, denn Kenner kauften Einzelkomponenten, Ahnungslose Kompaktanlagen. Meine war von Schneider.
»Willst du einen Tee?«, fragte Nicole.
Diesmal schaffte ich es einfach nur »ja, gerne« zu sagen, anstatt so was zu singen wie »the Duchess of Kincaldy always smiling and arriving late for Tea«. Vielleicht bestand doch noch Hoffnung für mich.
Nicole verschwand irgendwo in der Wohnung, wahrscheinlich ging sie in die Küche, um den Tee zu kochen. Ihr Bruder lehnte sich in den Türrahmen und beobachtete mich.
»Und du findest wirklich alles toll, was die Beatles gemacht haben?«
Viel zu schnell antwortete ich: »Du nicht?«
Andreas grinste und fing an, die Alben der Beatles einer kritischen Würdigung zu unterziehen. Please please me, ja, das habe etwas Rohes, aber vom Sound her sei es doch noch sehr Fünfzigerjahre-mäßig, und dann ständig diese Mundharmonika, die könne einem ziemlich auf die Nerven gehen. P.S. I love you sei doch was für Mädchen.
»Und With the Beatles ist doch vor allem ein Aufguss der ersten Platte. All my Loving, das ist stark, auch ihre Version von Money, aber bei Hold me tight singt McCartney doch total schief!«
Was für ein Schwachsinn, dachte ich, sagte aber nichts.
»A hard Day’s Night ist allerdings der Hammer, das muss ich zugeben«, machte Andreas wieder Boden bei mir gut. »Von vorne bis hinten perfekt.«
»Ja, genau!«, bestätigte ich, um auch mal was zu sagen. »Und es ist die erste Platte, auf der nur eigene Songs von ihnen sind. Auf Beatles for Sale und Help sind ja dann auch wieder Coverversionen. Ich frage mich, wieso sie das gemacht haben. Sie hatten doch genug Songs zusammen. Einige haben sie sogar an andere Leute weitergegeben. One and one is two zum Beispiel, das The Strangers with Mike Shannon aufgenommen haben. Oder From a Window oder Nobody I know oder Like Dreamers do!«
»Ach komm, das ist doch nicht dein Ernst, Junge!«
Wieso nannte der mich jetzt Junge? Wo blieb Nicole?
»Die Beatles wussten einfach, dass eine gute Coverversion besser ist als eine schlechte Eigenkomposition. One and one is two ist doch ein Kinderlied! Aber mit dem eigenen Schrott Geld verdienen, ohne dass es aussieht wie der eigene Schrott, das ist natürlich auch wieder die hohe Schule.«
Was redete der? Wie konnte er die Substantive Beatles und Schrott in einem Satz verwenden? Die Beatles produzierten nur Schrott, wenn sie ein Auto kaputt fuhren, und selbst daraus würden sie noch große Kunst machen!
»Und hast du mal Magical Mystery Tour gesehen?«
Nein, hatte ich natürlich nicht, denn das war ein Film, der 1967 im englischen Fernsehen gelaufen war und wohl auch einmal im deutschen, aber da war ich noch zu jung gewesen. Ich kannte niemanden, der den Film gesehen hatte. Also sagte ich: »Klar habe ich den gesehen!«
Damit hatte Andreas nicht gerechnet.
»Es ist nicht Fellini, aber schön surreal«, setzte ich nach.
Zum Glück verzichtete Andreas darauf, hier nachzubohren. Wahrscheinlich hatte er genauso wenig Ahnung wie ich, traute sich aber nicht, mich zu überbluffen.
»Ach, was soll’s«, sagte Andreas. »Du bist noch so jung!«
Er ließ mich einfach stehen, und dann kam endlich Nicole mit einer braunen Teekanne und zwei henkellosen Tassen zurück.
»Ist Wildkirsch okay?«
»Wildkirsch ist super«, sagte ich.
Sie trug Kanne und Tassen zu der Bananenkiste mit der Spanplatte, stellte alles ab und setzte sich im Schneidersitz daneben. Ich tat es ihr gleich.
»Jetzt erst mal ein Teechen«, sagte sie.
Verniedlichungsformen habe ich damals schon gehasst. Süppchen, Käffchen, Päuschen, Teechen – alles Quatsch. Ich wollte Suppe, Kaffee, eine richtige Pause und einen ordentlichen Tee.
Ich sagte: »Fein, so ein Teechen.«
Noch feiner wäre es mit Zucker oder Kandis gewesen, aber ich wollte jetzt keine Probleme machen.
»Zeig mal die Platte.«
Ich holte McCartney II aus der gelbroten Elpi-Tüte, die ich während der Diskussion mit Andreas krampfhaft umklammert gehalten hatte, sodass sie auf meine Finger abgefärbt hatte. Dummerweise an meiner rechten Hand. Ich würde also ausschließlich meine linke Hand benutzen können, wenn ich, nur so als Beispiel, Nicole das Haar aus der Stirn strich, um sie zu küssen.
Nicole nahm die Platte, musste lachen, als sie Pauls wirklich etwas merkwürdigen Gesichtsausdruck auf dem Cover sah, stand auf und ging um den provisorischen kleinen Tisch herum zu ihrem Stereoturm. Es gefiel mir sehr, wie vorsichtig sie erst die Innenhülle aus dem Klappcover und dann die Platte aus der Innenhülle nahm. Vier Fingerkuppen stützten die Platte genau auf dem grünen Odeon-Label, der Daumen lag seitlich am Vinyl an. Mit der freien Hand klappte sie den Deckel des Plattenspielers oben auf dem Stereoturm hoch und legte die LP vorsichtig auf. Dann ging sie zu ihrem Schreibtisch, kam mit einer TDK SA90 zurück und ging vor dem Turm in die Hocke.
Ihre Karottenjeans spannte sich über ihrem Po.
Ich unterdrückte einen Hustenreiz.
Nicole nahm die Kassette aus der Hülle, drehte mit dem Finger bis zum Anfang des Bandes, legte das Tape ein, drückte erst Pause und dann gleichzeitig Play und Record.
Das meiste davon hätte sie auch im Stehen machen können, dachte ich.
Sie richtete sich wieder auf, startete den offenbar halbautomatischen Plattenspieler, legte die Nadel vorsichtig auf die Rille und löste die Pausentaste. Zu den ersten Takten von Coming up wiegte sie den Kopf, aber als Paul zu singen begann, runzelte sie die Stirn.
»Das klingt so undeutlich«, sagte sie. »Stimmt was nicht mit der Platte?«