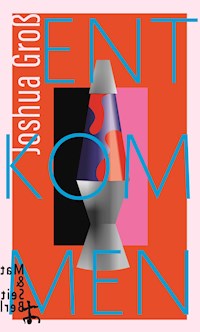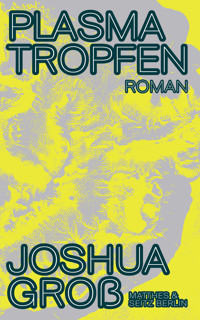
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Helen ist Malerin. Und sie hat übernatürliche Kräfte. Zwei Tage vor der Eröffnung ihrer Ausstellung werden alle ihre Bilder gestohlen. Anstatt sich um die Aufklärung des Falls zu kümmern, fliegt sie zurück in ihre griechische Heimatstadt Egio. Während sich Helen wieder ihrer künstlerischen Arbeit widmet, untersucht ihr Partner Lenell die tektonische Grenze, auf der Egio liegt. Das Privatleben des Paares ist bewegt, sie können sich ihren eigenen Verletzungen und den Versehrungen der Welt immer weniger entziehen. Und die Frage, die sich einmal gestellt hat, bleibt: Ist es möglich, angesichts der Bruchstellen, die uns umgeben, nur nach persönlicher Erfüllung zu streben? Und wofür soll man die eigenen Kräfte einsetzen – zumal wenn sie, wie in Helens Fall, sogar telekinetisch sind? Plasmatropfen erzählt von inneren und äußeren Verwerfungszonen, von Plattentektonik und Sehnsucht, Permafrost und Kunst. Joshua Groß protokolliert nicht, was war, sondern imaginiert, was passieren könnte, in einer Welt, die sich immer mehr dem Surrealen und Märchenhaften annähert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Plasmatropfen
Joshua Groß
Plasmatropfen
Roman
Matthes & Seitz Berlin
Inhaltsverzeichnis
TEIL 1 Normalnull
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TEIL 2 Anti-Trauer
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
TEIL 3 Nichtleben
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
TEIL 1 Normalnull
1
Helen stand nachts an der Tankstelle, neben dem Taxi. Außerhalb von Lelystad, im Norden der Niederlande. Es stürmte, aber Helen brauchte Snacks. Sie kam von ihren Aufbauarbeiten im Raumfahrtmuseum und war unterwegs in die Stadt, zu ihrem Apartment. Die Straßenlampen an den Überspannleitungen bebten, deshalb wankte das Licht andauernd. Staub wurde aufgewirbelt, spiralförmig. Die Wolkenschicht pulsierte cremig. Unweit schimmerten die Logos eines Fast-Food-Restaurants. Helens glatte, schwarze Haare reichten knapp über ihre Ohren; an den Ohrläppchen hingen jeweils goldene Ringe. Auf unmerkliche Weise hatte sie eine lange Nase und große, zu den Seiten geschwungene Augen; ausgreifende Brauen. Ihre Lippen waren schmal. Sie hatte eine schwarze Bluse und eine weiße Stoffhose an.
Kurz hielt sie inne und betrachtete das Einkaufszentrum gegenüber, das besetzte Palazzo. Das Gelände war gesäumt von einer zweifach gesicherten Befestigungszone, verbarrikadiert hinter blinkenden, holografischen Sperrmarkierungen und Backsteinmauern. Angeblich waren überall Sprengsätze angebracht, um Räumkommandos fernzuhalten. Es gab nur eine Zufahrtsmöglichkeit: ein schweres Eisentor, schwarz lackiert; eine matte, abschreckende Fläche, vor der drei Menschen in blauen Overalls und Skimasken standen, schwer bewaffnet, das Sicherheitsteam des Palazzos.
Helen lief zum Shop der Tankstelle. Die Schiebetüren öffneten sich automatisch. Die Verkaufsräume waren rosafarben erleuchtet. Sie ging ratlos durch die Gänge, nahm sich eine Flasche Cola und einen Packen Kakao aus dem Kühlregal. Die grauen Fliesen waren gerade gewischt worden. An manchen Stellen waren sie feucht, und Helen hinterließ absichtlich die Abdrücke ihrer Turnschuhe darin. Auf einer Ablage blinkte die vollautomatische Kaffeemaschine grell auf, weil Wasser nachgefüllt werden musste.
Helen stellte die Cola und den Kakao auf den Tresen und verlangte vier Rubbellose. Kaugummikauend kam die junge Frau mit ihren blau gefärbten Haaren Helens Wünschen nach. Helen zog eine EC-Karte aus der Tasche und bezahlte. Sie bedankte sich. Die junge Frau nickte ihr zu und fragte, ob sie noch mehr brauche. »Ich verstehe nicht«, sagte Helen, »mehr von was?« »Einfach mehr von allem«, sagte die junge Frau. Helen überlegte. Schließlich sagte sie: »Ich nehme zwei Käsebrötchen und noch mal vier Rubbellose.« Wieder zahlte sie mit ihrer EC-Karte. »Noch mehr?«, fragte die junge Frau. Helen schaute unschlüssig rum. Sie war besorgt, ob der Taxifahrer warten würde. Sie zuckte mit den Schultern und wendete sich ab. Als sie wieder rauskam, stockte sie. Der Wind war stärker geworden. An einem der Stahlträger, die das Wellblechdach der Tankstelle stützten, war ein Spender für Einweghandschuhe angebracht; aus dem Gehäuse wand sich ein Band aneinander haftender, fast durchsichtiger Schutzhüllen, das im Sturm heftig hin und her geworfen wurde. Sobald es für einen Moment ruhiger war, trank Helen verwirrt Cola. Dann sah sie zu, wie das Plastikband von Neuem zu tanzen schien. Der Spender gab unentwegt weitere Schutzhüllen aus. Offenbar war der Bewegungssensor vom Wind ausgetrickst worden. Helen starrte auf das sich schlängelnde, rauschende Plastikband, das von selbst immer länger wurde. Unmenschlich schön, dachte sie. Während sie zum Taxi lief, näherte sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein weißer Lieferwagen mit abgedunkelten Scheiben. Auf Höhe der Tankstelle verlangsamte der Lieferwagen sein Tempo und rollte eine Weile dahin, fast geräuschlos, bevor er plötzlich quietschend beschleunigte und an der nächsten Kreuzung abbog. Helen hatte nicht erkennen können, wer sich darin befand. Sie streckte ihre Wirbelsäule und blickte in die Richtung, in die der Lieferwagen verschwunden war. Eine Sturmböe blähte ihr Shirt weg vom Körper. Fast wäre ihr die Papiertasche mit den Käsebrötchen aus der Hand geweht worden. Sie stieg ins Taxi und legte ihre Einkäufe ab.
»Bitte noch nicht losfahren«, sagte Helen.
Sie kramte ihre Augentropfen hervor und ließ etwas Flüssigkeit auf ihre Pupillen laufen.
»Okay«, sagte sie. »Ich bin bereit.«
Nachdem Helens Pupillen erfrischt waren, betrachtete sie aufmerksam die Alleen, durch die sie chauffiert wurde. Orange Straßenlampen. Schwankende Sommerbäume. Bürogebäude, deren Fensterfronten aufblendeten. Kreisverkehre. Helen war müde. Dass sie gerade unter Normalnull war, fand sie schlimm, wirklich schlimm. Schon bald wurde sie vor dem Apartmentkomplex abgesetzt und bezahlte den Fahrer. Sie stemmte sich gegen den Sturm und lief, einer Panikattacke nahe, zur Tür. Sperrte auf. Schritt den Flur entlang. Noch immer piepte der Feuermelder in der leeren Erdgeschosswohnung. Seit ihrer Ankunft in Lelystad piepte der Feuermelder permanent. Helen ließ den Aufzug kommen. Der Marmorimitatboden schimmerte. Helens Puls passte sich dem Feuermelder an. Wahrscheinlich war nur die Batterie schwach. Sie war seit fünf Tagen in Lelystad. Die Anfrage, ihre Tuschemalereien im Raumfahrtmuseum auszustellen, war für sie die Möglichkeit, außerhalb der üblichen Kontexte (Museen, Galerien, Kunstvereine etc.) aufzutreten. Mittlerweile war sie renommiert und berühmt genug. Deshalb hatte sie zugesagt – obwohl Lelystad unter Normalnull lag und Helen sich unbehaglich fühlte, wenn sie unter Normalnull war. Immer schon hatte sie sich unter Normalnull unbehaglich gefühlt. Existenziell falsch. Ihre Kräfte kamen durcheinander. Aber sie wollte die Ausstellung unbedingt machen. In drei Tagen würde die Eröffnung stattfinden. Anschließend würde Helen zurück nach Griechenland fliegen, wo sie hauptsächlich lebte. Mit Lenell, dem Seismologen. Dort würde sie wieder in ihrem Atelier arbeiten, das von Agaven und Palmen umgeben war. Im Aufzug ließ ihr Unbehagen nach. Das Apartment war im vierten Stock. Nichts piepte. Sie ließ Wasser in die Badewanne laufen. Helen steckte den Papphalm in den kleinen Folienkreis der Kakaopackung und trank, während sie sich entkleidete. Sie musste den Kragen ihres Shirts weit dehnen, um ihn über die klobige Kakaopackung zu bekommen. Aber sie hatte Kakaobedarf und Entkleidungsbedarf gleichzeitig. Mit der freien Hand stellte sie den Plastikmülleimer neben die Badewanne, legte sich zwei Rubbellose aufs Fensterbrett und begab sich ins warme, dampfende Wasser. Als sie rausschaute, sah sie am Himmel den Sturm. Ja, es stimmte, der Sturm war sichtbar, ein paar Momente lang. Zwei Möwen wurden jäh verweht, fast als würden sie gebeamt werden, ruckartig waren sie im Himmel um fünfzig Meter verschoben worden, und ihr weiß schimmerndes Gefieder hatte währenddessen streifenhaft nachgewirkt.
2
Die Rubbellose hatten Space-Thematik. Es waren quadratische Kartons. Auf der linken Hälfte war in malerischer Überhöhung ein Deep-Sky-Objekt abgebildet, ein Knoten aus Galaxien und interstellaren Gasen, sehr verheißungsvoll inszeniert, lila und silber, in schwarzer Schrift stand Nachtelijke Hemel darauf. Rechts befanden sich zwölf silbern überzogene Punkte (sechs untereinander angeordnete Reihen mit jeweils zwei Feldern), wiederum umgeben von Farben, in denen Helen die Tiefe des Alls spüren sollte. Außerdem waren ein paar QR-Codes aufgedruckt, das Symbol der niederländischen Lotterie, eine Seriennummer sowie kleingedruckt die Erklärung für das Gewinnspiel. Um zu gewinnen, brauchte man nebeneinanderstehend eine Kombination aus einer Zahl und einem Symbol. Der Hauptgewinn lag bei 77000 Euro. Dafür war das Freirubbeln eines Mondes sowie der Zahl 77 vonnöten. Helen verdiente genug Geld mit dem Verkauf ihrer Bilder. Lenell verdiente genug Geld mit seiner Forschungsstelle an der Universität. 77000 Euro kam Helen nicht endlos viel vor. Vielleicht setzte bei ihr auch eine innere Inflation ein. Inflation des Erfolgs. Die Lose hatte Helen aus Verdruss gekauft, weil sie vom Gefühl, nach unten gesogen zu werden, heimgesucht wurde. In den Boden einbrechen, in Schlünde stürzen, pausenlos. Sie konnte sich nicht erinnern, jemals Rubbellose gekauft zu haben. Egal, dachte sie. Es wird schon Spaß machen. Sie blieb lange in der Wanne; wenn sie fröstelte, ließ sie heißes Wasser nachlaufen. Sie hatte sich einen Badezusatz gekauft, der nach Kiefernnadeln roch, und sie hatte den Eindruck, die Kiefern in ihren Muskeln zu spüren. Manchmal schaffte sie es beim Baden nicht, ruhig zu werden, sondern wurde im Gegenteil stetig nervöser durch das Nichtstun in der Wanne. Aber heute war sie so müde, dass die Nervosität nicht ausbrechen konnte oder sie nicht überfiel, oder sie konnte nicht in die Nervosität fallen. Sie war endlich wieder über Normalnull. Ihre Wohnung war ein Panikraum. Manchmal meinte Helen, wenn sie aus dem Fenster über Lelystad schaute, sie könne schimmernd eine Fläche wahrnehmen, vielleicht rosa oder weißlich, eine Fläche, die Normalnull markierte. Und wie eine Meerestopografie lagen darunter die meisten Areale der Stadt, eigentlich versunken, überschwemmt, überkommen. Helen befiel eine Trauer dabei, oder teilweise auch Angst. Sie betrachtete dann die Lichter, minimal gefärbt von der schimmernden Fläche, und fragte sich, ob das die Zukunft sei. »Welche Zukunft?«, sagte sie leise. Einfach die Zukunft als solche, antwortete sie sich. Aber jetzt, inmitten des Badezusatzes, dachte Helen nicht an die Zukunft, sie dachte nicht an die Meereshöhe, sie empfand nicht mal ihren Körper als versunken, obwohl das nahelag. Sie dachte nicht an ihre Ausstellung, die fast fertig war. Sie dachte nicht an Lenell. Wenn sie die Augen öffnete, konnte sie durch die allmählich beschlagene Fensterscheibe den Mond sehen. Sie sah den Mond leicht verschwommen, ohne an ihn zu denken. Erst später richtete sie sich auf, lehnte sich mit dem Rücken an die schräge, gewölbte Wannenwand, griff nach einem Tuch und trocknete sich die Hände sorgfältig ab, die eingewellte Haut mit ihren unwillkürlichen Vertiefungen wehrte sich mehr als sonst. Helen wählte eine Nagelfeile aus ihrem Necessaire: Der angeraute, flache Stahl lief spitz zu, im vordersten Teil war ein glattes Dreieck. Lange hatte sich Helen kaum für Nagelfeilen begeistern können. Sie hatte nur Scheren genutzt, um an ihren Nägeln und ihrer Haut rumzuwerkeln, wenn sie nervös war. Das hatte sich ungefähr nach ihrem siebenundzwanzigsten Geburtstag geändert – sowohl die Nervosität als auch die Finesse, mit der sie Maniküre betrieb. Mittlerweile besaß sie verschiedene Feilen. Sie begann also, die runden, silbern übersiegelten Felder auf dem ersten Rubbellos freizukratzen. Sie entdeckte Zahlen und Planetensymbole, aber nie nebeneinander, beispielsweise vier Euro und nichts, oder nichts und Saturn, das brachte keinen Gewinn, nicht mal ein Freilos, fuck. Helen hielt das Rubbellos so, dass die gummiartige, silberne Abdeckpaste neben der Badewanne in den Plastikmülleimer fiel. Schließlich warf sie das Los hinterher. Sie nahm aber direkt das zweite vom Fensterbrett und kratzte weiter. Sie war ein bisschen angefixt. Schwierig. Wieder nur Nieten, Nieten, Nieten, Nieten, Nieten, bis sie in der letzten Spalte zwei Monde nebeneinander sah. Das irritierte Helen, weil ja eigentlich immer eine Kombination aus Zahl und Symbol erscheinen sollte. Zwei Monde nebeneinander, das musste ein Fehler sein. Helen betrachtete ihr Rubbellos, drehte es um, las die Erläuterungen auf der Rückseite, aber der Fall von zwei sich nebeneinander befindenden Symbolen war nicht beschrieben. Helen glitt wieder ins Wasser, es schwappte über ihrem Kopf, nur ihre Hände hielten weiterhin hochgestreckt das Rubbellos.
3
Am nächsten Morgen frühstückte Helen ein paar abgepackte Pains au chocolat, sie trank Orangensaft aus der Flasche und Kaffee, den sie sich mit ihrem mitgebrachten Kännchen gekocht hatte. Das Rubbellos mit den zwei Monden hielt sie beim Zähneputzen in der Hand, grübelnd, aber sie wollte nicht bei der Bezahlhotline der niederländischen Lotterie anrufen. Stattdessen klemmte sie es mit einem Kühlschrankmagneten, der das Logo der Apartmentvermietung zeigte, an den metallenen Spiegelrahmen im Flur, gleich neben die Tür. Helen schminkte sich die Augen, eigentlich tuschte sie nur die Wimpern. Dann nahm sie den Aufzug runter in die Gefahrenzone. Kurz hielt sie dabei die Luft an, sammelte sich, und atmete ein. Jedes Mal war sie überrascht, dass weiterhin Sauerstoff vorhanden war. Ihre Brustmuskulatur verspannte sich. In der vermutlich leeren Erdgeschosswohnung piepte der Feuermelder noch immer. Helen fuhr mit dem Linienbus raus zum Raumfahrtmuseum, das sich auf dem Flughafengelände befand. Viele Touristïnnen mit Koffern waren im Bus. Das Wetter war gut, sehr mild. Der Wind hatte nachgelassen, aber nicht ganz. Als das besetzte Palazzo auftauchte, schaute Helen neugierig, was sie erkennen konnte. Wie immer. Die Sicherheitsleute, die reglos herumstanden; die Befestigungszone; die holografischen Markierungen, Barrikaden, Backsteinmauern, Stacheldrahtzäune, beschriftete Tücher, die von den Dächern hingen, etc. Helen schaute in den Himmel und sah wieder die schimmernde Fläche und begriff wieder, wie weit sie selbst unter Normalnull war. Gruselig.
Im Ausstellungsraum fühlte sie sich ein bisschen abgeschirmter; es gab kein Tageslicht, dafür waren die Wände samtblau, und Helen probierte noch ein paar Feinheiten aus, wie sie mit den tuschebemalten Fahnen und Papierarbeiten umgehen könnte. Sie war ziemlich perfektionistisch. Manchmal kamen Technikerïnnen vom Museum und fragten, ob sie Hilfe brauchte, aber Helen verneinte. Gegen Mittag besprach sie sich mit ihrer Pariser Galeristin Bianca per Videoanruf. Auch Lenell schickte sie Bilder. Sowohl Lenell als auch ihre Galeristin waren beeindruckt. Am späten Nachmittag hatte sie das Gefühl, fertig zu sein. Sie räumte die übrig gebliebenen Materialien weg und saugte den sogenannten Sonderausstellungsraum, der unbehelligt blieb von Astronautenanzügen und Mondgestein und Berechnungen und Forschungsberichten und Antriebsraketen. Sie saugte heimlich; nicht, weil es ihr nicht erlaubt war, aber die Direktorin würde sie schelten, wenn sie davon erführe. Die Direktorin war darum bemüht, dass ihr Team zuvorkommend sei. Helen beeilte sich. Noch zwei Tage bis zur Eröffnung.
Helen nahm den Bus in die Stadt. Im Apartmentkomplex piepte der Feuermelder in der Erdgeschosswohnung. Im Aufzug lockerte sich Helens Muskulatur. Am Spiegel hing das Rubbellos. Helen kochte sich Kaffee. Sie beantwortete Mails auf dem Balkon, überhalb der schimmernden Fläche. Sie trug dunkelblaue Leinenhosen und BH. Sie war barfuß. Sie hockte im Schneidersitz an der Hauswand, auf einem Sofakissen, im Sonnenlicht. Neben ihr stand die Kaffeetasse. Menschen, die nach ihren Bildern fragten, verwies sie an die Galerie; Freundïnnen berichtete sie knapp, aber zugewandt, wie es ihr erging; Spam und Werbung löschte sie. Sie bestellte sich indisches Essen. Nachdem sie das Essen bekommen hatte, hörte sie Musik und saß, bis die Sonne verschwand.
4
Vielleicht sollte sie eine Atemmaske einpacken (wegen Körperhorror) und ein paar tourismusmäßige Aktivitäten starten, überlegte Helen am Tag vor der Eröffnung. Sie hatte frei. Die Pressekonferenz würde komischerweise unmittelbar vor der Eröffnung stattfinden. Helen wunderte sich darüber, aber es störte sie nicht. Die geplanten Interviews mit internationalen Kunstmagazinen würde sie später von Griechenland aus geben. Lenell war derweil wieder hoffnungslos verschwunden in seinen seismologischen Analysen, und vermutlich verschwand er in den seismologischen Analysen, weil er hoffnungslos in sich selbst verschwunden war. Helen hoffte, dass er nicht schon wieder Tavor nehmen würde. Aber mit einer hoffnungslosen Traurigkeit verbat sie sich, ausschweifend darüber nachzudenken. Sie fragte Lenell, ob er ihr ein Foto vom Meer schicken würde – so hatte er wenigstens einen externen Auftrag, der übers Überleben hinausführte. Ein paar solcher Anfragen konnte sie stellen, aber nicht ständig. Lenell musste sich selbst kümmern. Zur Therapie gehen (was er meistens auch tat). Sie konnte nicht alles auffangen. Das war keine zumutbare Perspektive für ihr Miteinander. Aber deshalb wäre auch ein vorwurfsvolles Gewissen sich selbst gegenüber oder bloßes Mitleid Lenell gegenüber destruktiv. Helen machte hundert Jumping Jacks und schattenboxte sich danach zehn Minuten lang konzentriert durchs Wohnzimmer, bevor sie duschte und sich in die Stadt aufmachte. Natürlich piepte der Feuermelder in der Erdgeschosswohnung. Mit strammem Blick navigierte Helen zu einer Apotheke und kaufte dort eine kleine Sauerstoffkartusche sowie eine Atemmaske. Sie empfand sich selbst als lächerlich, aber dann spürte sie Erleichterung, eine sich wundersam fortsetzende Erleichterung in den Zellen; sie empfand diese Erleichterung mit der gleichen Skepsis, mit der sie als Kind die Domino-Days im Fernsehen verfolgt hatte – weil in jeder Sekunde ein Stopp hatte passieren können, ein Versiegen, ein Hindernis im System erwachsen, das die Ausbreitung der Erleichterung verhinderte. Und die gleiche Skepsis wallte in Helen bezüglich ihres Körpers. Aber dass sie ihr Notfall-Kit im Rucksack hatte, ermöglichte Helen jetzt touristische Aktivitäten. Wobei sie schnell touristenhaft enttäuscht war. Lelystad war ziemlich langweilig, zumindest aus touristischer Perspektive. Wahrscheinlich musste sie einfach ans Meer, aber das konnte sie zu Hause auch, wo es nichts Touristisches hatte, sondern etwas von Work-Life-Balance, oder etwas von Ausgleich des Lebens. Was dabei ausgeglichen wurde? Das Nichtleben natürlich. Helen überlegte, im Meer bis zum Horizont zu schwimmen, oder zumindest an diesem dämlichen Damm entlangzuschwimmen, bis er enden würde. Aber sie tat es nicht, weil sie touristisch unterwegs war. Sie stand in einer Einkaufsstraße und schaute sich im Internet an, was Lelystad zu bieten hatte. Die Houtribschleusen. Das ging als Sehenswürdigkeit durch. Sie machte sich auf. Endlich ein Anlaufpunkt, endlich nicht mehr dieses endlose touristische Schlendern, das nur die eigene Ratlosigkeit euphemisieren sollte. Das wurde Helen schnell zu viel. Sie hörte Musik und wurde wieder normal ungeduldig, wenn andere Menschen zu gemächlich liefen oder nicht wussten, wo sie hinwollten. Wieder bemerkte Helen einen langsam fahrenden weißen Lieferwagen, als sie an einer Ampel wartete. Aber sie entschied, dass das nichts zu bedeuten hatte. Stattdessen wollte sie in einem Café zwischenstoppen. Jetzt, wo sie eine Entscheidung getroffen hatte, fühlte sie sich nicht mehr so gehetzt. Sie wusste, dass sie nicht den halben Tag würde sinnlos herumschlendern müssen. Zu den Houtribschleusen dauerte es zu Fuß eine Stunde. Helen setzte sich unter eine orange Markise, in die hinterste Ecke, direkt an der Scheibe des Cafés, unscheinbar, neben sich Blumenkübel. Sie streckte ihre Beine aus, überall der warme Wind, an ihren Knöcheln, den Fersen, am Saum ihrer Hosenbeine. Sie bestellte sich Salat und Espresso. Das sommerliche Treiben in der Innenstadt war ulkig: Fußgängerïnnen und E-Scooter-Fahrerïnnen und Essenslieferantïnnen und Geschäftsleute. Ein kleines Mädchen trug eine Plüschmeerjungfrau herum. Außerhalb von Helens Sichtfeld spielte jemand Gitarre. Jugendliche hatten sich Energydrinks geholt. Glasfassaden glänzten und Backsteinmauern glänzten. Helen erhielt das gewünschte Foto von Lenell – aufgenommen von der Terrasse ihres gemeinsamen Bungalows. Das Meer war wie eine gekippte Fläche zwischen Pinien sichtbar, ohne Oberflächenstruktur, eingefasst von Landmassen und Hausdächern. Über Hügeln entschwand jäh der Himmel. Helen hatte Heimweh. Sie zoomte in die Pinien, schaute perplex in die Nadelansammlungen und begriff, dass dieser Grünton in Lelystad nicht vorkam. Sie fertigte einen Screenshot von den Nadeln an und bedankte sich bei Lenell mit Herz-Emojis.
5
Ein paar Stunden hatte Helen im Café verbracht – zeichnend und lesend und Sprachnachrichten aufnehmend –, ehe sie sich aufraffte, um die Houtribschleusen zu sehen. Lenell war mit dem Motorboot im Golf von Korinth unterwegs gewesen. Von Egio aus (die Stadt, in der sie lebten) hatte er Inseln angefahren, um dort seine Seismografen zu prüfen, Inventurfahrten, die er nur machte, wenn er halbwegs wohlauf war. Helen liebte es, ihn bei diesen Arbeiten zu begleiten: von Insel zu Insel mit seinem hellblauen Motorboot; auf Hügel klettern, die mit Pinien bewachsen waren, wilden Salbei riechen, Felsformationen überwinden, von Ziegen betrachtet werden – und vor allem zu spüren, wie präzise und raffiniert Lenell vorging. Im Klettern und Justieren bewegte er sich anders als im Mentalen, seine professionelle Tätigkeit zweckentfremdete ihn aus seiner Starrheit heraus. Helen bewunderte, wie behände er sich verhielt, metadatennährend. Manchmal schliefen sie miteinander, zwischen Olivenbäumen, in Einebnungen, die nicht einsehbar waren, maximal gestört von Stechmücken, die sie kichernd oder erbost verscheuchen mussten. Teilweise hatte Lenell Erektionsprobleme, weil Piniennadeln in seinen Hintern stachen. Auch rote Ameisen lenkten ihn ab. Helen versuchte, ihm zu helfen, nahm seinen Penis in den Mund, spürte dabei seine geleeige, fleischliche Erschrockenheit. Es konnte gelingen, Lenell wieder empfänglich zu machen für superempathisches Reinimmersieren, oder er rutschte ab in Selbsthass, was den Sex beendete und stattdessen zu Eigenvorhaltungen führte, zu Trennungsangeboten etc. Aber egal, wie sich ihre körperlichen Anbändelungen vollzogen, die Tage auf den Inseln waren immer erhebend für Helen. Forschungstätigkeit verschwamm mit Noblesse, wenn sie sich beispielsweise ein Seidentuch um den Kopf knotete, bei 60 km/h im Gischtstaub. Oder sie bewegte sich ewig gebückt durch strohige, ausgebrannte Wiesen und fing Heuschrecken, die sie sofort wieder freiließ.
Während Helen ein Violinkonzert hörte, lief sie zum Damm. Sie hatte keine Ahnung, was von diesen künstlichen Gewässern Süßwasser und was Salzwasser war. Es wird schon Erklärungen geben, dachte sie unbekümmert. Erklärungen gab es überall, Erläuterungen, Anmerkungen, Infos, Hintergründe, fanatische Geschichtsberauschtheit. Sie würde nicht umhinkommen, dachte sie, nicht umhinkommen, herauszufinden, was es mit diesem abgetrotzten Land auf sich hatte, mit diesem trockengelegten Meeresboden, mit diesen makellosen Seenlandschaften. Sie sah die sieben Pforten der Schleusen im Abend aufragen, angestrahlt. Im Vordergrund stand der Fernsehturm. Die wabenhafte Nutzplattform hing im senkblauen Himmel, der nach 19 Uhr ein bisschen intensiver wurde, was Helen gefiel. Das erinnerte sie an zu Hause. Sie legte ihren Kopf in den Nacken und empfand etwas wie invertierte Höhenangst. Sie spürte die Schwerkraft in ihrer unteren Körperhälfte aussetzen, Rückenmark floss erhitzt durch ihre Wirbelsäule aufwärts. Unsinn, sagte sich Helen und schloss bienenhaft die Augen. Ihr war schwindlig. Sie entdeckte einen Getränkeautomaten und holte sich Cola. Die aufgeschütteten Deiche sahen gepflegt aus: Meergrünes Gras wuchs auf den Anlegern, Docks und Wellenbrechern. Alles wirkte sehr geometrisch. Helen war zufrieden. Sie stand am Ufer, wo der Damm begann, und blickte nach Norden. Das war die Einlösung ihrer touristischen Ambitionen. Die Cola war kalt. Von links kam das Licht der rötlichen Sonne fast waagrecht. Den warmen Wind blendete Helen beinahe komplett aus, weil sie so musikversunken war, dass sie alle physischen Einflüsse, die annähernd Körpertemperatur hatten, vergaß. Ihr Hirn implodierte fast. Möwen flogen rum. Helen machte ein paar Fotos, auf denen der Wind auch nicht zu bemerken war: Die Wellen mutierten nicht verräterisch genug. Eigentlich kam es nie vor, dass das Aufsuchen touristischer Ziele bei Helen zu Erleichterung führte. Nur die Musik bewahrte sie vor Dysphorie. Sie lief los, den Damm entlang. Sie blickte runter in die Schleusenbecken, wo abgedeckt von schimmernden Flächen das Pumpen und Abfließen und Röhren und Strudeln des Wassers vor sich ging. Anschließend begab sie sich auf einen vorgelagerten, parallel zur Küste verlaufenden, inselhaften Streifen mit Sandstrand, von dem aus man die erleuchtete Promenade von Lelystad sehen konnte. Auf den Parkplätzen waren Camper abgestellt. Menschen standen beieinander, Liebespaare, Familien, Gesellschaften. Sie waren betrunken, high, nüchtern, sie spielten Boule, sie ließen Drachen steigen, sie picknickten. Gelblich wuchs das Schilf.
Am Ende des Streifens entdeckte Helen eine weitere Gestalt. Die Sonne würde gleich vom Planeten verdeckt sein. Kurz kippte die Atmosphäre ins Schwachrötliche. Die Gestalt, offenbar eine ältere Frau, war dabei, Teleskope aufzustellen. Die Schatten der Frau wie der Teleskope wirkten schwindsüchtig und unendlich. Helen stand in diesen fisseligen Schatten. Sie begab sich in Richtung der Frau und versuchte, nicht auf die Schattenbeine der Teleskope zu treten. Dann verloren sich die Schatten in sich selbst, das heißt, um die fragilen Schatten legte sich ein massiver, alles überlagernder Schatten, bevor die Straßenlaternen neue Schatten gebaren, allerdings wesentlich kontrollierter, fast gezüchtet wirkten diese neuen Schatten, ätherisch wuchsen und verschwanden sie in orangen Radien. Dafür intensivierten sich die Reflexionen auf der Wasseroberfläche. Die Lichter von Lelystad verteilten sich auf den Wellenkämmen und schwankten. Vielleicht intensivierte sich auch der Wind, womöglich lag dieses Gefühl aber auch daran, dass Helen in diesem Moment die Kopfhörer aus ihren Ohren nahm. Die Geräusche der Luft überkamen sie tosend. Vogelgekreisch, das Surren der Drachen, geworfene Angelschnüre, flatternde Klamotten am Körper. Neben den Teleskopen war eine Schautafel platziert: Werbung für die ESA, die europäische Weltraumorganisation. Das Logo der ESA war genauso auf den Teleskopen zu finden. Und auch die ältere Frau, die elegant wirkte mit ihren Plateausandalen und den grauen Haaren, trug zu ihrem langen, lila Rock eine schwarze Cordweste, an der ebenfalls ein Button der ESA steckte. Sie hatte zwei Teleskope aufgebaut und war gerade dabei, das größere auszurichten und scharf zu stellen. Helen bemerkte, dass die Teleskope nicht in die gleichen Richtungen positioniert waren.
»Bist du jeden Tag hier?«, fragte sie.
Die Frau wendete ihren Kopf. Es dauerte kurz, bis sich ihre Augen umgewöhnt hatten. Dann lächelte sie.
»Wenn es nicht bewölkt ist«, sagte sie. »Und du?«
»Nicht jeden Tag«, sagte Helen.
»Touristin?«
»Nein, ich eröffne morgen eine Ausstellung, im Raumfahrtmuseum.«
»Ah, wie passend.«
»Finde ich auch.«
»Willst du mal schauen?«
»Klar.«
Leicht nach vorn gebeugt, während sie das linke Auge geschlossen hielt, blickte Helen durch das Fernrohr des Teleskops. Es war auf den Mond gerichtet, der klobig und schepps leuchtete, ausfransend zur Seite. Helen sah die Krater und Gebirge, konturiert wie ausbrechender Schimmel. Sie blinzelte und ihre Wimpern schrubbten über das Glas des Fernrohrs. Danach brauchte sie eine Weile, um sich wieder fokussieren zu können. Unbekümmert produzierte sich der Mond weiterhin selbst. Anschließend schritt Helen zum anderen Teleskop. Sie wollte wissen, was für ein Planet oder was für eine Sternenformation hier zu beobachten war. Sie senkte ihren Kopf und blickte in das Fernrohr. Wieder sah sie den Mond. Sie richtete sich auf und schüttelte ihr Haar. Wieder senkte sie ihren Kopf und blickte in das Fernrohr. Wieder sah sie den Mond. Grübelnd betrachtete sie die Frau, die die Teleskope aufgestellt hatte. Aber die Frau schien es nicht zu bemerken. Es war offensichtlich, dass die Teleskope in verschiedene Richtungen zeigten. Helen dachte an ihr Rubbellos.
»Ich hatte kürzlich ein Rubbellos mit zwei Monden«, sagte sie.
»Lotterien habe ich immer gemieden«, sagte die Frau. »Ich glaube, ich wäre zu anfällig für Spielsucht.«
»Mein Rubbellos war wahrscheinlich fehlerhaft, es zeigte zwei Monde.«
»Ich habe keine Vorstellung, was das bedeutet.«
Helen zuckte mit den Schultern. Diesmal blickte sie direkt hintereinander durch beide Fernrohre, aber jedes Mal sah sie Monde. Sie starrte in den Himmel, konnte aber nur einen Mond erkennen. Ihr Kreislauf spukte.
»Ich habe Muffins dabei«, sagte die Frau. »Willst du?«
Helen nickte. Die Frau lief zu ihrem Auto, ein weißer Kombi, und kam mit einer Papiertüte zurück. Sie hielt Helen die Tüte hin.
»Es gibt Blaubeere und weiße Schokolade. Such dir einfach aus, was du magst.«
Helen entschied sich für Blaubeere. Sie setzte sich neben die Schautafel und aß, indem sie nach und nach kleine Brocken aus dem Muffin herauszupfte. Der Wind brachte weiterhin die Luft zum Eruptieren. Ein paar Möwen, die scheinbar an Helens Muffin interessiert waren, landeten unweit der Teleskope. Sie dachte an die Gestirne. Eigentlich wiederholte sie unablässig das Wort in ihrem Kopf: Gestirne, Gestirne, Gestirne.
»Du wirkst verwirrt«, sagte die Frau.
»Ich komme gerade mit den Monden nicht zurecht.«
»Trübsal bringt dich nicht weiter.«
»Trübsal?«
»Ja«, sagte die Frau. »Ich heiße übrigens Lynn.«
»Ich heiße Helen«, sagte Helen.
»Ich weiß, ich habe die Plakate für deine Ausstellung gesehen. Sie hängen überall.«
»Wie lange arbeitest du schon für die ESA?«
»Ach, erst ein paar Jahre, es ist aber eher eine ehrenamtliche Beschäftigung. Eigentlich muss ich nicht mehr arbeiten.«
»Und hast du schon immer mit dem Weltraum zu tun?«
»Nein«, lachte Lynn. »Ursprünglich komme ich aus dem Chanson.«
»Was soll das heißen?«
»Zuerst lebte ich für den Chanson, dann kam eine lange, komische Phase, und jetzt versuche ich, wie viele andere Menschen, das Interesse für die Gestirne zu wecken.«
»Wer weckt denn noch das Interesse?«
»Viele Menschen, meistens alte Menschen, überall in Europa. Hast du noch nie eine Schautafel der ESA gesehen?«
»Nein.«
»Meistens sind wir an touristischen Orten: Hafenanlagen, Promenaden, Aussichtspunkten. In warmen Sommernächten.«
»Ist mir noch nie aufgefallen.«
»Du bist auch noch jung.«
»Es geht.«
»Doch, doch.«
»Ich bin vielleicht jünger.«
»Es ist wichtig, dass wir uns mit den Gestirnen befassen. Schließlich werden wir sie bald besuchen.«
»Ich kann’s mir nicht vorstellen.«
»Genau deshalb mache ich meine Arbeit.«
»Meine Sehnsucht nach einer Reise ins All ist dadurch nicht angewachsen, nur meine Verwirrung.«
»Die Zukunft ist nicht für alle gleichermaßen logisch.«
»Was sollte das heißen: Du kommst aus dem Chanson?«
»Also mein Name ist Lynn Kern, ich war in den späten 1960ern und in den 1970ern eine bekannte Chansonsängerin. Ich war in den Hitparaden, im Fernsehen, auf Tourneen …«
»Und jetzt stellst du Teleskope auf. Warum kommt eigentlich niemand her?«
»Das ist unterschiedlich. An manchen Tagen sind hier unwahrscheinlich viele Menschen, an anderen Tagen bin ich unsichtbar. Wie heute.«
»Ich bin doch hier.«
»Stimmt. Aber wirst du der ESA auch eine Spende überlassen?«
»Selbstverständlich.«
Lynn kramte in einer Tasche, die versteckt in der Schautafel verborgen gewesen war, und überreichte Helen eine kleine, metallene Spendenbox, auf der ein Aufkleber der ESA pappte. Mit geschickten Fingern faltete Helen einen Zwanzigeuroschein leporellohaft und steckte ihn in den Schlitz der Spendenbox.
»Hoffentlich verkaufst du ordentlich Bilder«, sagte Lynn.
»Ausreichend«, antwortete Helen.
»Du bist der einzige Mensch, der mich sehen kann, obwohl ich unsichtbar bin.«
»Quatsch.«
Eine junge, schwarze Katze kam herbei. Kurz war ihr Fell aufgeraut vom Wind. Sie miaute. Helen bot ihr einen Krümel des Muffins an. Die Katze schnupperte daran und fraß den Krümel. Sie schmiegte sich an Helens Knie. Vorsichtig begann Helen, sie zu streicheln.
»Nicht mal die Katze nimmt mich wahr«, sagte Lynn pikiert.
Helen ging nicht darauf ein, sondern hob die Katze auf ihren Schoß und kraulte sie am Hals. Die Katze schnurrte. Die Möwen entfernten sich kreischend. Sie tappten rückwärts auf ihren kralligen, schwimmhäutigen Füßen, was im Pulk ein bisschen psychopathisch anmutete. Helen machte ein Foto von der Katze und schickte es Lenell. Sie schrieb, dass sie mit einer etwas missmutigen Chansonsängerin und einer Katze am Ufer sitze und dass sie zwei Monde sehen könne. Lenell antwortete, dass ihm das noch nie passiert sei. Er schickte ein verwackeltes Bild des Mondes über Egio. Ich freue mich schon auf dich, schrieb Helen. Wie der kleine Katzenkörper so unproblematisch in ihren Händen verweilte, überkam Helen eine von innen heraus triefende Schläfrigkeit. Ihre Bewegungen wurden langsamer, stoppten aber nicht. Sie fühlte sich wie ein Mahlwerk, in dem Schlafgranulat fein gemahlen wurde. Und erst später würde das Pulver in ihr wirksam werden. Zwischenzeitlich würde sie einfach ein Behältnis bleiben, dachte sie. Was für ein Behältnis? Ein Auffangbehältnis, ein Zwischenlager. Ein hortender Körper, Organe, in denen sich Schlaf selbst züchtet.
Helen hatte kein Gefühl, wie viel Zeit vergangen war, als Lynn fragte: »Hast du schon abendgegessen?«
»Nein«, antwortete sie.
»Wenn du mir einpacken hilfst, lade ich dich ein zu den besten Artischocken überhaupt.«
»Deine Schicht ist schon vorbei?«
»Meine Schicht ist so lange, wie ich es aushalte. Und wenn ich unsichtbar bin, halte ich es nicht lange aus.«
»Wie gesagt: Ich sehe dich.«
»Ja, du.«
»Was ist das Problem mit mir?«
»Es gibt kein Problem. Hilf mir einfach.«
Lynn holte zwei Plastikboxen aus dem Kofferraum ihres Kombis. Sie klappte die Schautafel zusammen und verfrachtete sie auf die Rückbank. Helen gab die Katze frei und erhob sich. Die Katze fand keinen Gefallen daran, sich aus dem warmen, mahlwerkhaften Hort herausbewegen zu müssen. Helen verstreute noch ein paar Muffinkrümel. Dann machte sie sich vorsichtig daran, die Teleskope abzubauen, nachlässig instruiert von Lynn. Vorübergehend nahm sich Helen selbst als ehrenamtliche Mitarbeiterin der ESA wahr. Sie fragte sich, ob es plausibel wäre, Teleskope am Hafen von Egio aufzustellen. Lenell würde sich darüber freuen. Er würde durch das Fernrohr blicken und augenblicklich spintisieren.
6
Das Restaurant war nicht sehr geräumig. Es gab nur sechs Tische, die mit weiß-rot karierten Decken bezogen waren. Die Stühle aus dunklem Holz hatten runde Beine und in die Lehnen eingearbeitete Schnitzereien. Auch die Theke der Bar war aus dunklem Holz. An den Wänden hingen teilweise Malereien, die Gartenzwerge zeigten, teilweise Poster mit Vermeer-Gemälden. Über den Tischen hingen mehrere bunte Lichterketten. Besonders bizarr waren die Heizpilze, die zwischen den Tischen standen; von ihnen ging keine Hitze aus. Lynn quatschte kurz mit dem Besitzer, der am Aufräumen und Putzen war. Dabei setzte sie sich an einen Tisch am Fenster. Helen tat es ihr gleich. Lynn bestellte Artischocken für beide, mit Buttercremesoße und Parmesansoße und Mayonnaise. Helen war heißhungrig. Sie hatte schon lange keine Artischocken mehr gegessen. Trinken wollte Lynn Weißwein, Helen wollte Grapefruitschorle. Lynn entschuldigte sich, um die Toiletten aufzusuchen. Im Internet las Helen, dass sich Lynn Kern 1975 aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, nach ihrer Heirat mit dem sogenannten Müllmagnaten Ruud van Kolwech. Er hatte ein Unternehmen geführt, das Müll aus Deutschland und Frankreich von holländischen Häfen aus in nichteuropäische Länder exportierte, mutmaßlich mithilfe gefälschter Zertifikate von illegalen Recyclinganlagen und auch durch das Falschauszeichnen von Plastikabfällen. Er hatte diverse Import- und Exportfirmen gegründet und war vielfacher Millionär geworden. Weiter las Helen, dass Lynn Kern die Geschäfte nach seinem Tod im Jahr 2008 übernommen, das Business aber 2016 abgewickelt hatte. Vermutlich waren diese Jahrzehnte die komische Phase gewesen, von der Lynn gesprochen hatte. Geblieben war ihr das Geld sowie zwei Containerschiffe, die im Hafen von Rotterdam ankerten; nach Recherchen wurden die Schiffe weiterhin gewartet und sogar eine kleine Crew lebte jeweils auf Deck. Helen öffnete Instagram und scrollte durch Bilder und Videos, besann sich aber bald und schloss die App wieder. Sie legte ihr Smartphone weg und nahm ihr Getränk in Empfang. Sie trank. Sie wartete. Die Artischocken wurden gebracht. Eine Weile dampften sie vor sich hin. Helen überlegte gerade, ob sie einfach mit dem Essen beginnen sollte, da kam Lynn zurück.
»Warum hast du nicht angefangen?«, fragte sie.
»Ich war gerade dabei, mich dazu durchzuringen.«
Am meisten schwärmte Helen für die Buttercremesoße. Sie tauchte die warmen Hüllblätter in die Soße und zog den fleischigen, unteren Teil mit ihren Zähnen ab. Lynn lächelte.
»Es ist so geil«, sagte Helen. »Ich wusste nicht, dass ich derart auf Entzug war.«
Lynn tupfte Baguette in die Mayonnaise und erzählte, dass sie hier fast täglich aß, vor oder nach ihren ESA-Schichten.
»Wie war es, Chansonstar zu sein?«, fragte Helen.
»Ich weiß nicht«, antwortete Lynn, »ich war jung, ich war hübsch, ich konnte singen, ich wurde benutzt und manipuliert, ich hatte Sex, ich nahm Drogen, ich wurde depressiv, ich war reich. Es nutzt sich ab. Anfangs spürte ich, dass ich unabhängiger wurde, aber mit den Jahren wendete sich das Gefühl und ich begriff, wie limitiert die Erwartungshaltung war. Ich sollte für Klatsch sorgen, ich sollte singen, ich sollte Geld generieren. Sobald ich das verstanden hatte, verging mir die Lust. Ich wurde mit Privatjets nach Hawaii und Las Vegas und Lanzarote geflogen. Aber ich existierte nur, um zu gefallen.«
»Also?«
»Also sattelte ich um. Ich heiratete einen charmanten Geschäftsmann und half ihm mit seinem Business.«
»Was für ein Business?«
»Wir exportierten Müll für Entsorgungsunternehmen. Ich würde es nicht wieder machen. Ich schäme mich sogar dafür. Aber ich kann dir sagen, es war das abenteuerlichste Leben, das du dir vorstellen kannst. Ich will damit nicht angeben. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, mehr Adrenalin auszuschütten, als ich es während meiner Jahre im Müllhandel getan habe. Ich musste es einfach tun. Es war illegal und gefährlich. Das Gegenteil meiner Karriere als Chansonsängerin. Eine völlig neue Erfahrung. Das ist die einzige Erklärung, die ich finden kann. Unglaublich, wie viel kriminelle Energie ich in mir hatte.«
»Was soll das konkret heißen?«
»Das kann ich dir leider nicht sagen, ein paar meiner Businessmoves sind noch nicht verjährt.«
»Und warum hast du aufgehört?«
»Die Auflagen wurden verschärft. Umweltschutzorganisationen agierten frenetischer. Behörden ließen sich nicht mehr so leicht umgehen. Bürokratie wurde extrem nervig. Mein Mann war verstorben. Ich hatte keine Lust, im Gefängnis zu landen. Das ist die Kurzfassung. Willst du nicht von deinen Bildern erzählen?«
»Nein, eigentlich nicht.«
»Warum?«
»Es bringt nichts, über Bilder zu sprechen, die du nicht gesehen hast. Letztlich gleitet fast jedes Gespräch in Erklärungen ab. Und ich hasse es, meine Bilder zu erklären. Was ich dir sagen kann, auch wenn es vage und anmaßend klingt: Ich versuche, kosmische Zustände auszudrücken, die noch nicht ausgedrückt worden sind. Du musst die Ausstellung besuchen, wenn es dich interessiert.«
»Okay, okay«, meinte Lynn. »Ich merke schon, wir sind ganz ausgezeichnete Gesprächspartnerinnen. Aber das ist nicht schlimm. Ich weiß, was wir tun.«
7
Nur ein paar Straßen weiter befand sich eine kleine Karaokebar. Auf dem Fußweg dorthin sah Helen wieder die schimmernde Fläche, die Normalnull markierte. Und als die Fläche herabzusinken schien, weil sie über eine winzige Brücke gingen, hüpfte Helen mehrmals hintereinander, um ein paar Atemzüge über der Meeresoberfläche machen zu können. Die Laternen schimmerten, es war nach Mitternacht. Lynn, die schon leicht angetrunken war, zeigte sich von Helens Sprüngen irritiert, fragte aber nicht, was es damit auf sich hatte. Allerdings sagte sie kurz darauf, dass Helen eigentlich alle bedeutenden Anlaufpunkte in Lelystad gesehen hätte beziehungsweise gleich sehen würde. Jetzt spürte Helen, dass ihr unlauteres Tourismusherz zufrieden war. Es gab wohl doch einen Anteil in ihr, dem es wichtig war, Städten gegenüber nicht abfällig zu sein, der sie nicht nur als Hüllen nutzen wollte, durch die sie wandelte, um arbeiten zu können. Vielleicht war das aber auch nur ein überzogener Gedanke in der Nacht.
»Hattest du bei den Teleskopen eigentlich schon oft Besuch von der schwarzen Katze?«, fragte Helen.