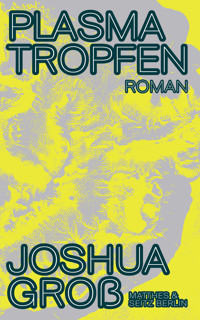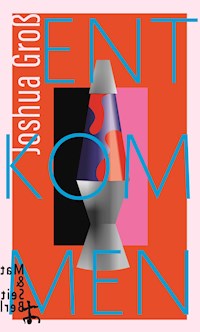Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf der Bergiselschanze in der Tiroler Wintersportmetropole Innsbruck lernen der Erzähler Joshua und seine Partnerin Lisa im Frühsommer den sechzehnjährigen Michael Stiening kennen, ein österreichisches Skisprungtalent, das sich auf die neue Saison und seinen Angriff auf die Weltspitze vorbereitet. In den Trainingsmethoden seiner älteren Schwester Johanna finden Gravitation, Eingebundensein und Selbstkonfrontation zusammen. Als Joshua und Lisa in die Ferienwohnung im Haus der Geschwister einziehen, entsteht eine Gemeinschaft auf Zeit, zu der unerwartet noch Joshuas exzentrische, aber fürsorgliche Oma Suzet und für einige Wochen auch noch die kleine Tilde dazustoßen. Und so beginnt in diesem heißen Sommer an diesem beinahe unwirklichen Ort nahe den Sümpfen, wo Aloe Vera in den Alpen wächst, für alle eine Reise der Selbstwerdung. Prana Extrem ist ein Versuch, die sich überstürzend verändernde Welt vielschichtig abzubilden; es ist das Wagnis, durch Liebe, Aufmerksamkeit und Humor Raum für ein anderes Miteinander entstehen zu lassen; ein Buch, das vom Gelingen tiefer Verbundenheit erzählt, und ein Ort, der für die Dauer der Lektüre als magisch erhabener Gegenraum zu unserer Wirklichkeit entsteht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Joshua Groß
Prana Extrem
Roman
Inhalt
Prana Extrem
Beim Grenzüberschritt hörte ich nur deinen Herzschlag und wie der Wind an meinen Ohrenknochen entlangkämmte als Antimaterie.
– Anne Carson
Lisa hat, fast ein Jahr bevor wir uns kennenlernten, auf Instagram gepostet:
Es gibt
keinen Ort
für mich.
Ende des Gedichts.
Als ich diesen Eintrag zum ersten Mal gelesen habe, fühlte ich mich ihr seltsam verbunden in meiner damaligen Getriebenheit. Wir waren uns noch nicht begegnet. Ich fühlte den Vibe ihrer Gedanken; sie wirkten in mir, ohne dass ich mich zu lange damit aufhielt, herauszufinden, was der Grund dafür sein könnte. Es war vielleicht so, dass ich eine innere Nähe wahrnahm, zu einem Menschen, mit dem ich bislang nur ein paar kurze Mails hin- und hergeschrieben hatte. Mittlerweile empfinde ich immerzu Zuneigung für ihren Mut, sich schonungslos in der Welt zu behaupten.
In Chester Watsons Lost Inside habe ich später eine Entsprechung entdeckt; Musik, die angemessen war, in ihrem Verhängnis, in ihrer Verspultheit, für mein eigenes, scheinbar unabänderliches Gefühl des Verlorenseins. In den untergründigen, rasselnden Sonarsounds fühlte ich mich ausgesetzt, und oft wurde mir dabei ganz makaber ums Herz. Ich spürte deutlich meine Abgenutztheit und vielleicht auch die letzten asteroidenhaften Bruchstücke eines Stolzes, der in mir zwischenzeitlich noch zurückgeblieben war: Ich hatte gelernt, in einer jahrelangen, unendlichen Anstrengung, dass ich fast überall funktionieren konnte; auch in Zusammenhängen, die mir nicht guttaten. Auch in dieser erstarrten Umgebung, auf diesem Planeten, den wir jetzt wieder von Neuem aufbauen müssen. Ich hatte gelernt, dass ich diese andauernden inneren Mangelzustände ertragen konnte, indem ich selbst teilweise erstarrte.
Was das für ein Stolz war? Ein chaotischer und selbstabsorbierender Stolz, der mich lange zusammengehalten hatte und der seine neonfarbene Energie hauptsächlich aus Abscheu und Skepsis bezog. In meinem Kopf lasse ich diese Energie verglühen, indem ich die Hook eines imaginären Trapsongs andauernd wiederhole:
Ich mach’s für die culture / wie Robert Walser
Ich mach’s für die culture / wie Robert Walser
Ich mach’s für die culture / wie Robert Walser
Ich mach’s für die culture / wie Robert Walser
Ich will versuchen, mich selbst (und auch alles andere, sofern es meine eingeschränkten Wahrnehmungsfähigkeiten zulassen) neu zu erfahren, um die Verklumpungen, die permanent in mir wirken, auf der tiefstmöglichen Ebene mit außerirdischen Lichtwellen zu fluten, bis meine Charakterpanzer brechen.
Oberer Stadtplatz, Hall in Tirol, wo Lisa Stadtschreiberin war: Ich ballere mir Snickers-Eis rein, während ich am Brunnen sitze, direkt auf dem uralten Kopfsteinpflaster, weil die Stühle, die zur Eisdiele und zum Café Weiler gehören, keine Abendsonne mehr abkriegen, auch wegen des aufragenden Kirchturms. Ich schreibe in mein Notizbuch und um mich laufen Familien rum; die Kinder trinken Milchshakes aus Plastikcups und die Erwachsenen rauchen Zigaretten. Sie bereiten sich auf den Erstkommunionsgottesdienst vor, der am nächsten Tag stattfinden wird. Ich warte auf Lisa, die kurz zum Kulturlabor gegangen ist, um irgendwas zu klären; im Anschluss werden wir überteuerte, aber fancy geformte Pommes essen, an einem schäbigen Imbiss auf der Innsbrucker Straße. In den Kalkalpen, die sich überall hier anhäufen, hängt glitzernder Dunst, der zart über die Schneegrenze hinwegschwebt, vielleicht auf achthundert Meter über Normalnull. Deshalb ist der Wind, der durch die Gassen kommt, kühl und klar. Ich glaube, die Tatsache, dass ich in mein Notizbuch schreibe, ist quasi irrelevant im Vergleich zu dem, was ich hier zwischendurch erahne. Allerdings beruhigt mich ein Gedanke von Anna Lowenhaupt Tsing: … die Kiefern mögen das beiläufig vom Menschen produzierte Durcheinander. Das ermöglicht meinen Notizen eine Perspektive. Ich habe andauernd das Gefühl, dass ich Durcheinander produziere. Aber vielleicht ist das hilfreich, zumindest speziesübergreifend. Vielleicht hilft den Kiefern, was ich schreibe. Vielleicht hilft es mir dabei, mich selbst in einem Zustand der Kontamination und der Sehnsucht zu begreifen, ohne dass ich darauf mit Abschottung reagieren muss. Es gibt keine Existenz ohne Kontamination. Vielleicht konnte ich meinen Stolz so lange aufrechterhalten, bis ich kapiert habe, dass ich nicht unantastbar bin. Ich will gar nicht mehr unantastbar sein, sondern brüchig, aufbrechend; ich will keinen Stolz mehr, um mich abzuschotten, sondern Schutzzauber, die mich in meiner Offenheit bewahren.
Während wir auf den Zunterkopf rauflaufen, im Karwendelgebirge, stapfen wir durch den letzten Schnee, wobei sich staubige Geröllfelder auf allen Seiten an den Berghängen, die uns umgeben, abgelagert haben; als Überbleibsel von Lawinen wahrscheinlich. Teilweise sieht es außerirdisch aus, und es ermöglicht uns, die molekularen Flüsse, aus denen unser gemeinsames Leben aufgebaut ist, zu reinigen, indem wir das, was uns immer wieder heimsucht, langsam schmelzen lassen und unsere eigentlichen Perversionen freilegen. Manchmal sehen wir sukkulentenhafte Pflanzen am Rand des Weges; fleischige, tentakuläre Blätter, die gelb gesprenkelt um sich greifen. Ich gehe vor ihnen in die Hocke und betrachte sie eindringlich, bewundernd; ihre gezähnten, pulsierenden Blätter und die mattgrüne, dünne, faserige Haut. Außenrum befinden sich die weiten, aufleuchtenden Flächen aus Gestein und Schutt. Als wir uns umschauen, bemerken wir, dass diese Pflanzen überall auf den Südhängen wachsen. Gämsen beobachten uns währenddessen gelangweilt von weiter oben. Sie wiederkäuen Gräser, die den Winter farblos überstanden haben.
Kann es sein, dass das Aloe sind?, sagt Lisa; wahrscheinlich weil sie ahnt, dass es Aloe sind, während sie gleichzeitig weiß, wie abseitig diese Ahnung wirkt, wegen Mai und Klimazone und Verbreitungsgebiet.
Ich glaube, es sind Aloe, antworte ich ihr fast fragend.
Lisa fotografiert die Pflanzen mehrere Male mit ihrem iPhone, bevor ich ein paar äußere Blätter abbreche. Dann steigen wir vorsichtig den Hang hinauf. Viel weiter oben verharren die schneebedeckten, massiven Gipfel der Dreitausender. Wie verloren mögen sie sich fühlen? Die Oberflächen meiner schwarzen Boots und Lisas schwarzer Stiefel sind bald mit feinen Kalkschichten überzogen; wir halten uns an den Händen, um weniger weit abzurutschen im Kies. Wir klettern, bis wir einige frei stehende Felsen erreichen, deren Formen seit Millionen Jahren korallenhaft gewachsen sind; sie haben schon den ganzen Tag die Sonnenwärme aufgenommen und glühen jetzt gewissermaßen, als wir uns dagegenlehnen. Wir atmen tief und heftig und verschwitzt. Ich öffne den lila Rucksack; wir trinken Eistee, hintereinander, und bestaunen den Höhenunterschied, den wir mit unserem kurzen Aufstieg geschafft haben. Wir sind bis über die Baumgrenze gekommen. Wir sind so trill gemeinsam in Tirol. Unter uns ist es bröckelnd und gleißend, und weiter entfernt sehen wir einen Bergbach, der durch kalkige Canyons ins Tal fließt; gesäumt von finsteren Tannen, die abgründig wirken in der Dichte und Entschiedenheit ihres Aufkommens und durch die Schatten, die sie unter sich versammeln. Während sich der Planet, mit all seinen Gebirgen obendrauf, der Sonne entgegendreht, schneiden wir die Aloeblätter mit einer von Lisas Haarspangen der Länge nach auf: Schleimige, klebrige Flüssigkeit quillt hervor, erst stellenweise, da, wo die Schnitte tiefer sind, bald aber gleichmäßig und geleeig. Wir haben nur Shirts an. Wir dippen mit den Spitzen unserer Finger im Pflanzensaft der Aloe. Wir verteilen die Flüssigkeit gegenseitig auf unseren Armen und in unseren Gesichtern; sie dringt kalt in die Poren und erwärmt sich dann langsam auf der Haut. Wir schauen uns an, mit gleichmäßigen, eintrocknenden Streifen auf den Wangen. Wir nehmen alles in uns auf, hauptsächlich Liebe, aber auch das Wissen, dass Gefährdetsein eine Grundbedingung menschlichen Lebens ist.
Nachdem wir unsere erste gemeinsame Nacht verbracht hatten, musste Lisa vormittags in die Universität, um Bücher für ihre Professorin zu scannen. Ich lief in der Zeit durch die Braunschweiger Innenstadt, beziehungsweise ich hockte, mit meinem Laptop auf dem Schoß, eine Weile fast besinnungslos in den Schloss-Arkaden; noch unfähig, ansatzweise zu kapieren, was uns beiden passiert war. In einer Buchhandlung kaufte ich die DVD Im Schatten des Mondes; eine Doku über die Apollo-Missionen der NASA. Als wir den Film später anschauten, mit mehreren Unterbrechungen, feierten wir den Astronauten Alan Bean, der nach seiner Rückkehr vom Mond direkt aus der Quarantäne in die Galleria-Mall in Houston gefahren war, um dort stundenlang zu sitzen, Eis zu essen und eine Normalität zu bestaunen, die er im All nicht mehr gekannt hatte. Auf dem Mond habe das Universum so gewaltig und leer gewirkt, erzählte er. Im Spaß haben wir hinterher unsere Begegnung mit der ersten Mondlandung verglichen. Aber darum geht es hier nicht. Die Bedeutung von zwei so verschiedenen Ereignissen zu vergleichen, würde zu Erklärungen führen, und ich will nichts erklären; ich finde es nur bemerkenswert, inwieweit sich menschliche Reaktionen auf die unwahrscheinlichsten Extremsituationen ähneln. Lisa kennenzulernen war eine Umwerfung für mich, die bis in die subatomare Ebene meiner Existenz hineinwirkt. Ich hatte scheinbar einen ähnlichen Impuls wie Alan Bean. Ich wollte mich rückversichern, dass die Welt nach wie vor existierte; dass unsere Begegnung tatsächlich in der Welt stattgefunden hatte, nicht in meinen Hirngespinsten. Jetzt erst verstehe ich Julio Cortázars Gedanke, wenn er schreibt, Wunder seien nicht absurd; was ihnen vorausgehe und was auf sie folge allerdings schon.
Neben Lisas Bett lag Das wilde Denken von Claude Lévi-Strauss. Während sie für uns Kaffee kochte, nach dem ersten Aufwachen miteinander, las ich: Alles Geheiligte hat seinen Ort, sagt einEingeborenendenker. Man könnte sogar sagen, dass erst dadurch etwas geheiligt ist, dass es einen Ort hat, da man, wenn man das Heilige unterdrückte, und sei es nur in Gedanken, die Ordnung des Universums zerstören würde; es trägt also dazu bei, diese Ordnung aufrechtzuerhalten, indem es den Ort einnimmt, der ihm zukommt. Ein paar Stunden später las ich Maggie Nelsons Erörterungen zu der Frage: Was, wenn der Ort, an dem ich bin, das ist, was ich brauche? Ich habe mich ausgiebigst damit auseinandergesetzt, ob die früheren Konstellationen, in die ich mich immer wieder von vorn begeben hatte, Rückschlüsse ermöglichen würden bezüglich meiner Tendenz, mich in Begegnungen selbst zu vergessen. Vielleicht war ich deshalb so vorsichtig, was die Auswahl meiner wenigen Freundinnen und Freunde anging. Also nicht, weil ich Vorbehalte anderen gegenüber hatte, sondern massive Vorbehalte gegenüber mir selbst; dass ich mich selbst nur erhalten konnte (womit ich quasi meinen bereits beschriebenen Stolz meine), indem ich wenige, intensive Freundschaften führte, innerhalb derer ich mich sicher wähnte. Trotzdem war ich zwischendurch mehrere Beziehungen eingegangen, die mir zusetzten und mich in die ärgsten Verzweiflungen trieben. Meistens habe ich das Gefühl, dass ich lange brauche, um irgendwas zu verstehen, manchmal fast ewig. Allerdings konnte ich langsam begreifen, dass ich mich selbst nicht hatte ausfüllen wollen, sondern oft nur verfickt zuvorkommend einübte, mich selbst aufzugeben. Das wollte ich wieder verlernen und mich trotzdem hingeben.
Und es war auch nicht Eifersucht, die mich kurzzeitig festhielt, nachdem wir über frühere Liebschaften gesprochen hatten; ich hatte mich nur laichend in mir selbst verschlossen, für ein paar Minuten. Vielleicht gab ich mich Vergangenheitsspekulationen hin, oder ich musste akzeptieren, dass Lisa früher schon Sehnsüchte hatte, also ähnliche oder sogar die gleichen wie jetzt auch, und dass sie bei anderen (auf andere Weise) gehofft hatte, wahrgenommen zu werden, als die, die sie war. Es war also nur meine idiotische Kurzverweigerung dahingehend, dass überhaupt schon Sehnsüchte existierten, als wir uns noch nicht kannten. Aber dann begriff ich wieder, wie sehr wir beide schon gelebt hatten davor; eine Tatsache, für die ich unendlich dankbar war.
Es gibt einen Ort für uns. Wir erschaffen ihn gemeinsam, durch unsere Offenheit und durch unseren Hustle, durch unseren Humor und durch die wahnwitzigen und wunderbaren Wiederholungen. Wir kontaminieren uns gegenseitig, immerzu; es ist eine Verunreinigung, die elektrisierend ist, weil sie aus unseren Gedanken, unseren Körperflüssigkeiten und unserem Lachen besteht. Wir befinden uns in einem subatomaren Zueinanderfinden; ein Zueinanderfinden, in dem wir beide luxurieren als zwei.
Im Rahmen ihres Stadtschreiber-Stipendiums wohnten Lisa und ich für einige Tage im AC Hotel in Innsbruck. Unser Zimmer war in der fünfzehnten Etage, und zwar weil wir es unbedingt so gewollt hatten, wir hatten so weit oben wohnen wollen wie möglich. Direkt morgens gingen wir vom Frühstücksbuffet aus in die Sauna, um dort zu lesen. Es war ungelogen der beruhigendste Ort im ganzen Hotel. Danach schrieb Lisa an ihrem Roman, während ich mir auf Youtube alte Skisprungwettbewerbe anschaute, die in Innsbruck stattgefunden hatten. Von unserem Zimmer aus konnte ich, während ich im Schneidersitz auf dem Bett saß, direkt die Bergiselschanze betrachten; der Turm steht futuristisch am Stadtrand rum, bewachend und skeptisch. Irgendwann fand ich einen kurzen ORF-Beitrag aus dem Jahr 2002, der die Sprengung der alten Schanze zeigt; man sieht, wie die Anlage innerhalb von Sekunden komplett in sich zusammenkracht, eigentlich zur offensichtlichen Verblüffung ihrer selbst: Ihr ontologisches Befinden vaporisiert sich gewissermaßen aus dem Universum heraus; ein Sachverhalt, der sich seltsamerweise sogar in der aufquellenden Staubwolke artikuliert.
Ich hatte mir damals, also um 2002, in fast fieberhafter Erregung Winter für Winter die Vierschanzentournee von Anfang bis Ende reingeballert; meistens bei meinen Großeltern, im Anschluss an irgendwelche nachweihnachtlichen Essen, die entweder aus Gans oder Rouladen oder Sauerbraten bestanden, gereicht mit gebratenen Nudeln und Serviettenklößen und Rotkraut und Pilzsoße und anderen, gesiebten Soßen; ich will mich jetzt nicht in die Erinnerungen an diese Gelage reinsteigern, sonst würde mich eine dermaßene Familienabscheu befallen und ich müsste die widerwärtige Ekelhaftigkeit meines Onkels darlegen, und auch die traurige Engstirnigkeit meiner Großeltern, es würde vermutlich zu einem erbitterten Rant führen, den ich mir aufsparen möchte für spätere Anlässe. Na ja. Jedenfalls verließ ich den Esstisch bei der erstbesten Gelegenheit, deren Eintreffen ich schon aufmerksam erwartet hatte, und verkroch mich in das Fernsehzimmer meiner Oma, das im ersten Stock war, wo ich RTL einschaltete und mich von den ungebrochenen Immersionen der Übertragung umhüllen ließ, überzeugt von der Bedeutsamkeit der Vierschanzentournee, und (wie ich jetzt denke) auch weil es eine perfekte Fluchtmöglichkeit war, die mich rausbeamte aus dem Reihenhaus, in dem ich mich gerade befand und in dem die im Alltag überlagerte Erstickungsgefahr unter der pseudogutbürgerlichenemotionalverwahrlosten Tristesse andauernd spürbar war; mittlerweile ist dieses Reihenhaus, das allerselbe, ein bemerkenswertes Bauwerk, das es gerade noch so, also unter Aufbringung all seiner Vorzüge, schafft, die Existenzen zweier Menschen zu ermöglichen, die gegenseitig in sich andauernd die eigene Abgefucktheit gespiegelt sehen, den ganzen Tag lang, und die unfähig sind, seit Jahrzehnten eben, auch nur kurz darüber nachzudenken, ob es Veränderungen geben könnte, die es ermöglichen würden, sich nicht nur auf erschreckende Weise aneinander abzunutzen, sondern so mit dem eigenen Leben und Sterben umzugehen, dass es innerhalb der individuellen Beschränktheiten als wertvoll empfunden wird. Ich weiß nicht, ob die Zuneigungen, die meine Großeltern mir zweifellos entgegengebracht haben, aufwiegen können, dass ich mich innerlich immerzu wehren muss gegen die Sozialisation in einer Umgebung, in der es nur um Erfolg und Gesehenwerden ging und in der gleichzeitig die vielen Facetten und Auswirkungen der Depression allgegenwärtig waren, in der eine Verwahrlosung des Denkens stattgefunden hatte, in der auf einer existenziellen Ebene überhaupt kein Zuspruch möglich gewesen ist, weil alles von Selbsthass und Ignoranz befallen war. Ich muss jetzt nicht weiter darüber nachdenken, Trauer ist ein seltsamer Antrieb; aber später einmal wird es nötig werden, schätze ich, später, wenn alle tot sind beispielsweise.
Immer, wenn ich Youtube überdrüssig wurde, hauptsächlich aufgrund der schlechten Bildqualität der alten Fernsehmitschnitte, spazierte ich allein durch die Stadt, eigentlich orientierungslos, oder zumindest ohne Vorhaben. Oft machte ich einen Stopp im Café Kater, wo ich wahrscheinlich Science-Fiction-Romane las. Das waren damals die einzigen Bücher, die mich interessierten.
An einem Tag, der sonnig und heiß war, entschloss ich mich, auf die Bergiselschanze raufzulaufen; ich wunderte mich, warum ich erst jetzt auf die Idee gekommen war. Ich ging an einem Einkaufszentrum vorbei, an einem Kino, an einem Friedhof auch, und dann endlich durch Wohngebiete, die an den Hang gebaut waren; schließlich erreichte ich das Gelände der Bergiselschanze und stieg die vielen fitzeligen Treppen des Absprungturmes rauf. Oben im Turm ist ein Restaurant untergebracht, das ich ausprobieren wollte; als ich reinkam, war ich sofort massiv unter Druck von neuschickem, billigmondänem Design und infiltriert von Klimaanlagenluft, die mir augenblicklich Gänsehaut verpasste, den kompletten Rücken runter. Ich setzte mich an einen kleinen Tisch, direkt an der Fensterfront, von dem aus ganz Innsbruck zu überschauen war, und auch die funkelnden Bergmassive, die es umgaben; auf den Dächern waberte die Sonnenhitze, der Fluss zitterte mehr oder weniger – es war kompliziert, alles zu begreifen, die Reflexionen auf den Autodächern, die leuchtenden Baumkronen, die Windstille, eigentlich sogar die Gravitation, also wie all diese Gesteinsformationen aufeinander rumlasteten, dazu die ultraviolette Strahlung, die unsichtbar einsickerte, beispielsweise durch das unsichtbare Loch irgendwo in der unsichtbaren Atmosphäre. Währenddessen, gewissermaßen um Besinnung zu erlangen, fragte ich mich, ob die allmorgendlichen Meteoritenschauer auf dem Merkur gerade stattfinden würden, weil ich nicht wusste, was ein Morgen auf dem Merkur überhaupt bedeutete; ich dachte an die Aufnahmen der NASA, ich fragte mich, wie man ausgehend von solchen statischen Fotografien das andauernde Vergehen, das Meteoriten eigentlich bedeuten, verstehen sollte. Es war schon wieder viel zu unmöglich, alles aufmerksam in mich aufzunehmen, viel zu viel auf einmal, sodass mein Bewusstsein kapitulierte; ich glaube, ich starrte die Stadt minutenlang an, einfach so, wobei ich mir gewahr darüber war, dass ich hinterher zwar ein Wirrwarr an Emotionen für diesen Moment haben würde, aber eben kein statisches Panoramaabbild in meinem Bewusstsein. Also erfinde ich den Ausblick von der Bergiselschanze neu, oder ich erfinde ihn nach, sodass er möglicherweise im Einklang mit den Emotionen steht, die meine waren, als ich selbst in dem Restaurant saß. Natürlich wurde ich schon bald von einer Servicekraft aus meiner Verwunderung herausgerissen. Ich bestellte, ohne in die Speisekarte geschaut zu haben, einen vegetarischen Salat, einen gespritzten Birnensaft und einen Espresso Macchiato. Birnensaft gab es nicht, also wechselte ich zu Traubensaft. Gespritzt aber, wiederholte ich. Gespritzt, bestätigte mir die Servicekraft; ein junger Mann mit geglätteten, schwarz gefärbten Haaren, dessen weißer Hemdkragen vielleicht ein bisschen zu steif gebügelt war. Entweder war er belustigt von unserer Konversation oder beschämt, er errötete jedenfalls leicht in seinem verflaumten, bleichen Gesicht und grinste mich an. Um mich insgesamt zu beruhigen, las ich daraufhin weiter in meinem Science-Fiction-Roman. Zwischendrin betrachtete ich die Anlaufspur, die mit glitzernden Eisenplatten ausgelegt war und ziemlich steil nach unten führte; der Schanzentisch glitzerte auch. Ich wusste, dass darunter alles von dunkelgrünen Matten bedeckt war; weiter unten im Tal, um den Auslauf herum, waren die Tribünen angeordnet, leer und lauernd irgendwie. Es war immer noch Vormittag, ich war quasi allein in dem Restaurant, mal abgesehen von dem jungen Mann und anderen Servicekräften, die Besteck sortierten oder Servietten falteten oder angeödet miteinander sprachen oder einfach nur dastanden, müde, maßlos, überfordert, jäh verwirrt von der Eigenartigkeit ihrer Nebenjobs. Ich war gut gelaunt. Ich wusste, dass ich am Nachmittag mit Lisa schwimmen gehen würde, dass wir gemeinsam über die Doku, die wir am Abend zuvor gesehen hatten, nachdenken würden, dass wir Eis essen und auf flauschigen Hotelhandtüchern im dickflüssigen Schatten einer Kiefer liegen würden. Und es war so, dass mein Hungergefühl eingebettet war in eine hitzebedingte, flaue Gemächlichkeit, also kaute ich nur sehr versonnen auf meinem Salat rum, salzte minimal nach, pfefferte ein bisschen und musste fast einen Anflug von High unterdrücken, als ich mir mittendrin meinen Espresso Macchiato reinschüttete. Ich fragte den jungen Mann, ob er sich nicht mehrmals im Sommer erkälten würde, in dieser trockenen Klimaanlagenluft hier drin. Wahrscheinlich schon, sagte er, ist aber mein erster Sommer hier oben. Dann nahm er meine Espressotasse mit und verschwand in der Küche; er bemühte sich um eine gewisse Striktheit in seinem Gang, aber es wirkte überstürzt. Menschsein ist meistens doch sehr verräterisch. Die kleinen Brotecken im Salat waren supercrispy, das war belebend irgendwie, also jeder einzelne Biss manifestierte mich ein Stück weit mit. Kannst du einfach kauen, dachte ich mir gegenüber, kannst du einfach nur weiterkauen bitte. Natürlich wurden die Brotecken irgendwann schwammig, durch meinen Speichel hauptsächlich, auch durch das Malmen meiner Backenzähne. Aber trotzdem, es half trotzdem. Ich bestellte mehr von den Brotecken, und der junge Mann grinste schon wieder. Was für eine Komplizenschaft sollte das werden zwischen uns? Gar keine, wie sich herausstellte, weil das Restaurant plötzlich eingenommen wurde von Nachwuchsskispringerinnen und Nachwuchsskispringern, die in ihren silbernen Anzügen und ihren Skischuhen reingelaufen kamen und sich überall hinsetzten; auch zu mir setzte sich ein junger, hochgewachsener Skispringer. Er legte seinen schwarzen Helm auf dem Tisch ab, direkt neben meinem Salatteller. Die Servicekräfte waren auf einmal damit beschäftigt, Vitaminwasser und Powerriegel zu verteilen.
Wer seid ihr?, fragte ich den Skispringer.
Österreichische Jugendnationalmannschaft, antwortete er.
Okay, sagte ich.
Was liest du da?, fragte er und schob sein Kinn in Richtung meines Buches vor.
Gertrude Rhoxus.
Kenne ich nicht.
Schade, aber macht eigentlich auch nichts.
Um was geht es da?
Science-Fiction, antwortete ich.
Ich lese Mangas, sagte er, also die richtigen, die man umgekehrt liest, von hinten.
Cool, sagte ich.
Und Bildbände schaue ich mir manchmal an, sagte er, und Internet natürlich.
Bist du ein guter Springer?
Ich bin 1,82 Meter groß und wiege 56 Kilo und bin fucking muskulös und athletisch, sagte er grinsend.
Was soll das heißen?
Schon, dass ich gut bin, sagte er, auch weil ich diszipliniert bin. Hier schau her, du kannst meinen Powerriegel haben, ich schmeiße ihn nachher eh weg.
Ich hasse solche Riegel, sagte ich, außer die Fruchtschnitten von Dr. Munzinger.
Er lachte, ein klein bisschen unsicher vielleicht; wahrscheinlich wusste er nicht, wovon ich redete.
Was heißt das denn, dass du gut bist?, fragte ich.
Ich wurde jetzt im Januar bei der Juniorenweltmeisterschaft Vierter, sagte er schulterzuckend.
Wie alt bist du?, fragte ich.
Sechzehn.
Arg, sagte ich, und jetzt trainiert ihr alle heute hier?
Nee, wir machen ein Teamfoto jetzt gleich, für Sponsoren.
Nachdem ich meinen Salat gegessen hatte, sagte ich dem jungen Skispringer, dass ich mich auf die Panoramaplattform begeben würde, um dort Marihuana zu rauchen. Er könne mich begleiten, wenn er wolle, sofern es nicht gegen Anti-Doping-Gesetze verstoßen würde. Er schaute mich spöttisch an, oder missbilligend, oder auf so eine dumme, heranwachsende Weise renitent.
Meine große Schwester raucht ständig Dope, und sie ist meine Trainerin, sagte er.
Ich glaube, er war ziemlich stolz darauf.
Okay, sagte ich.
Also stellten wir uns gemeinsam draußen in die Sonne, stützten uns aufs Geländer und schauten schweigend die Schanze an; die Höhenangst fickte mir kurz das Gehirn weg.
Ist das nicht geistesgestört, da runterzuspringen?, fragte ich.
Irgendwie schon, antwortete er, aber es ist halt auch immer dasselbe, also wirklich fast dasselbe. Die vielen Tausend Sprünge, die man macht, sind fast nur ein einziger Sprung, aber jedes Mal wird es unmerklich intensiver.
Arg, sagte ich wieder und inhalierte die Alpenluft.
Du wiederholst nur noch dasselbe, aber das Beben wird dabei immer heftiger in dir, sagte er.
In mir drin entwickelte sich eine Antwort; ich musste nämlich an eine depperte Weisheit von Lil Wayne denken, die so geht:
My picture should be in the dictionary
next to the definition of »definition«
Because repetition is the father of learning.
Mich haben diese Zeilen immer genervt, ich glaube, weil Lil Wayne seine Genialität hier so billig rausballert wie selten; und dass mir genau das einfiel, in diesem Moment, als mir Michael von seiner Leidenschaft erzählte, führte dazu, dass ich mich selbst als altväterlich und idiotisch empfand. Ich sagte ihm davon auch gar nichts. Später, ich war dezent high, lud er mich ein, ihn am kommenden Tag zu besuchen und bei seinem Training auf einer kleinen Mattenschanze unweit von Innsbruck zuzuschauen, genauer gesagt in Kurbruck.
Das veränderte alles, was den Verlauf dieses Sommers betraf.
Vorhersagen können quälend sein; aber auch unterhaltsam, vor allem, wenn sie nicht eintreffen und das, was angeblich hätte passieren sollen, geisterhaft nachwirkt, also schon lange vorbei ist, aber trotzdem immer wieder Wege findet, um die eigene Wahrnehmung heimzusuchen. Ich weiß noch, wie Anfang 2007 der Beef zwischen 50 Cent und Cam’ron begann und sich immer weiter zuspitzte, bis hin zu dem verhängnisvollen 17. Mai, an dem sich Camr’on in Florida befand und eine Videoansage aufnahm; er steht – bekleidet mit weißen Socken, blauen Boxershorts und einem weißen Unterhemd – vor einem Pool, hinter einem Haus, in der Hand sein Blackberry. Er verkündet, er würde sich noch ein paar Wochen im Urlaub befinden (get my fuckin’ pool in the back), dass er aber bald zurück in New York sein werde, und da seine Bewährung abgelaufen sei, könnten sich alle darauf gefasst machen, dass ein langer, heißer Sommer bevorstehe. Ich war damals, nachdem ich das Video gesehen hatte, so verwirrt, belustigt und gespannt auf das, was in den kommenden Monaten passieren würde. Die floridamäßige Ästhetik und das lächerliche oder überinszenierte Auftreten vor dem Pool waren ein Bruch mit dem bis dato geschaffenen Image einer kalten, brutalen New Yorker Kompromisslosigkeit, die sich in einem Gehabe von äußerster Gewaltbereitschaft äußerte und eigentlich immerzu die Möglichkeit beschwor, dass der Beef jederzeit über das Austauschen bedrohlicher Ansagen hinausgehen könnte. In Wahrheit zog sich Cam’ron nach seiner Videoansage für mehrere Jahre aus dem Rapbusiness zurück. Ich war aber monatelang immer wieder auf der Suche nach Neuigkeiten gewesen, die mir hätten erklären können, was Cam’ron mit seiner Ankündigung gemeint hatte. Dabei war, wie sich im Nachhinein herausstellte, der 17. Mai der unbestreitbare Höhepunkt dieses Sommers gewesen. Aber noch heute, und das finde ich so quälend und unterhaltsam gleichzeitig, taucht diese Videobotschaft manchmal auf in meinen Empfindungen, in komplett falschen Zusammenhängen, als wäre dieser lange, heiße Sommer 2007 noch immer nicht abgeschlossen, oder als würde er sich so lange unterirdisch fortsetzen, bis Cam’ron endlich ausführen wird, was er damals geplant hatte. Ein Video, das genau neunundfünfzig Sekunden dauert, entstanden in der entlegensten Diaspora deutscher Aufmerksamkeitsökonomie, als ich siebzehn Jahre alt war, wirkt in mir immer noch nach, völlig unabhängig davon, welche erwachsenen Emotionalentscheidungen ich sonst so treffe. Ich mag das. Ich glaube, dass sich alles auswirkt, und zwar unkategorisch, und dass Wirkkraft unabhängig ist von der Blasiertheit derer, die sich den Auswüchsen der Gegenwart verweigern; alles kann existenzielle Grenzerfahrungen auslösen, die Zukunft ist überall, nur nicht in der Unantastbarkeit. Es gibt Energie, entfesselte Energie, und es gibt Wachheit.
Eine der Vorhersagen, die für mich immer am übersinnlichsten und am meisten verängstigend war, ist die Szene in Twin Peaks, in der Annie und Agent Cooper im Roadhouse tanzen, und Annie erzählt, dass sie am Schönheitswettbewerb der Stadt teilnehmen werde; sobald sie ihm das eröffnet hat, empfängt Cooper eine außerzeitliche, extranatürliche Eingebung, worin der Riese, der ihm im Verlauf der Geschichte immer wieder hilft, im Spotlight auf der Bühne des Roadhouses erscheint; durch Kopfschütteln und leicht verlangsamte, abwehrende Handbewegungen teilt er Cooper unmissverständlich mit, dass Annie auf keinen Fall beim Schönheitswettbewerb mitmachen dürfe; in seiner Körperhaltung liegen eine solche Dringlichkeit und Drastik und ein Wissen um die bevorstehende Katastrophe, dass seine Vorhersage keine Möglichkeit verkündet, sondern schon die Schrecken einer tatsächlichen Zukunft beinhaltet. Mir hat diese Szene, als ich Twin Peaks zum ersten Mal gesehen habe, ein komplett intrinsisches Unwohlsein verpasst, eben weil die Zeichen überdeutlich waren, und auch, weil Cooper die Botschaft des Riesen zwar wahrnahm, ihr in der Folge aber zu wenig Bedeutung schenkte. Das ist untypisch für ihn. Es kann allerdings sein, dass sich die Beschränktheit unserer Wahrnehmungsfähigkeiten gerade dann offenbart, wenn wir es nicht schaffen, eine Überlagerung von zwei Raumzeiten zu begreifen, was heißt, dass wir Vorhersagen maximal als Warnungen betrachten können, die im besten Fall zu erhöhter Aufmerksamkeit führen, und nicht als Visionen, die unser Handeln direkt beeinflussen sollten.
Lange war da eher die Vorstellung in mir, Sehnsüchte würden mich, weil ich sie für Präinkorporierungen hielt, blenden oder abhalten vom Vorankommen, bis ich kapierte, dass Sehnsüchte keine vorgefertigten, einseitigen Bedeutungen haben. Nie hatte ich wissen wollen, wohin sie mich führen könnten. Ich hatte mir selbst oft vorausgesagt, geprägt von Erfahrungen, die wahrscheinlich aus meinen Ängsten heraus entstanden sind, wie unwahrscheinlich es sein würde, dass ich mich lösen könnte von diesen inneren, mich erschreckenden Mangelzuständen. Statt aufzubrechen wollte ich mich immer nur abarbeiten an mir selbst; wodurch sich Ingrimm entwickelte und oft auch Verzweiflung. Jetzt werde ich wacher und spontaner die Desillusionierung meiner eigenen Idiotie betreiben und die verfickten Fatalismen aus mir rausexorzieren.
Kurz nachdem ich Michael Stiening, das Skisprung-Kid, kennengelernt hatte, fuhr ich mit dem Bus nach Kurbruck. An jenem Morgen empfand ich das Inntal bedrückend, weil auf beiden Seiten gigantische Gebirgsmassive lauerten, majestätisch und dräuend – während die Wolken dazwischen den Himmel zerfleischten, und obwohl sie so tief hingen, meinte ich seltsamerweise, sie würden mich verschonen wollen, wegen des Platzes zwischen ihnen und mir. Der Bus fuhr über mehrere Dörfer; ich las noch immer den Roman von Gertrude Rhoxus, konnte mich aber nicht konzentrieren, wegen des Gewackels und der Abstoppungen. Ich verrutschte andauernd in den Zeilen, weil ich müde war. Dazu kam, dass die Sonne, trotz allem, manchmal für wenige Sekunden erkennbar wurde, weil Strahlenbüschel ins Tal fielen, wie Spaghetti, die gerade in einen Topf geschüttet werden. Ich schaute also aus dem Fenster, sah die dunklen Berghänge im Schatten und grauen Schnee an den Rändern der Wiesen. Dazwischen floss trist der Inn, trüb und schwerfällig. Dann fuhren wir durch einen Schwarzkiefernwald, von dem ich gelesen hatte: Er umgab Kurbruck ringförmig, überall da, wo keine Berghänge waren – die Ortschaft war also zum Tal hin abgeschirmt. Obwohl es sofort noch finsterer wurde (im Bus war die Beleuchtung nicht angeschaltet worden), hatte ich kurz den Eindruck, dass die hohen Baumkronen ein Schutz sein könnten gegen die Wolken darüber, und dass es insgesamt gut sei, sich unter Kiefern aufzuhalten, egal wo man sich gerade befindet im Universum. Als ich das dachte, drang für wenige Sekunden sogar Sonnenlicht durch die Nadeln, vielfach gebrochen, unendlich weich eigentlich, fast wie Schaum. Ein Krankenwagen kam entgegen, aber ohne Sirenenlärm.
In Kurbruck hielt der Bus nur an der Hauptstraße, wo ich ausstieg und mich umsah; Mohnblumen blühten überall, in der unmittelbaren Umgebung waren ein Fliesenhändler und ein Geschäft für Tiernahrung. An einer Abzweigung waren Wegweiser angebracht: ein Campingplatz war ausgeschildert, und auch die Skisprungschanze. Ich ging los, zwischen Wohnhäusern führte die schmale Straße leicht bergan. Bei einem Bäcker kaufte ich Streuselkuchen. Wo der Ort aufhörte, lag ein Parkplatz; eine Wanderkarte zeigte das ganze Gebiet des Tiroler Mittellandes. Ich blieb kurz stehen. Ich hatte mir die Gegend um Kurbruck schon online angeschaut und ein paar Artikel dazu gelesen, vor allem hatte ich mich mit den Thermalquellen beschäftigt. Aber als ich mich jetzt umdrehte, war ich geschockt von der stillen, andauernden Dominanz der Berge überall, sie waren einfach nur unverrückbar und verinnerlichten sich selbst permanent. Ich vergaß das zwischenzeitlich immer wieder; ich vergaß es, obwohl die Berge immerzu in mich reinprägten, und ich fühlte mich beengt von ihnen, gemäßigt, ruhiger, bedrückter. Ich lief an einem Bach entlang durch den Wald. Es war ein warmer Frühsommertag mit Kälte im Schatten.
Die Schanze war umgeben von Kiefern. Ich stand auf einer feuchten, warmen, fast sumpfigen Wiese im weiten Auslauf; besser gesagt in erdigem Schlamm, wo platt getretene Gräser wuchsen. Ich schaute nach oben. Die Wolken drückten sich weiterhin gegen die Berge, alles verschmolz langsam ineinander. Ich konnte die Anlaufspur fast nicht erkennen zwischen den Bäumen, erst vom Schanzentisch abwärts war der Hang breiter gerodet worden und alles war mit dunkelgrünen Kunststoffmatten ausgelegt, die von quietschgelben Weitenmarkierungen unterteilt wurden. Bei 101,5 Metern war der Schanzenrekord eingezeichnet. Auf dem Hügel waren Wasserhähne installiert, von denen aus Schläuche zu Sprinkleranlagen führten. An drei Stellen wurden die Matten bewässert; asynchron und allmählich bewegten sich die Fontänen bogenförmig hin und her. Ein bisschen weiter weg lagen ein Walkie-Talkie und Gewichte halb versunken im Gras, außerdem rosafarbene Gymnastikbänder. Auf einem Stativ war eine Kamera befestigt, zur Schanze hin ausgerichtet. Am Saum des gerodeten Korridors entlang führte ein Skilift nach oben.
Eine Libelle flog an mir vorbei, rötlich schimmernd; ihre Flügelspannweite war ungefähr so breit wie mein Kopf. Ich schaute ihr nach. Sie verharrte eine Weile in der Luft und fokussierte mich, wahrscheinlich mit dreißigtausend Augen mindestens. War ich für sie etwas anderes als eine Anomalie? Vielleicht war sie nur neugierig und betrachtete mich nachsichtig, vielleicht spürte sie, dass ich selbst nicht genau wusste, wo ich war. Ihr roter Körper hob sich vom tiefgrünen Dunst ab, der von den Berghängen ausging. Ich hob mich überhaupt nicht ab, oder nur minimal, weil ich eingebunden war in das Durcheinander oder in das Miteinander um mich herum; ich spürte, wie alles in mir trippen wollte in den Nebelschwaden. Ich drehte mich im Kreis, meine Schultern zuckten, mein Sweatshirt war klamm, aber wenn der Stoff spannte, empfand ich eine Erhebung in mir, als wären die verschwitzten Sinneshaare unter meinen Achseln eigens aufnahmefähig, während meine Schuhe festgesaugt wurden von der weichen Erde, es schlurpte rhythmisch bei meinen Schritten, ich war auch losgelöst, aber hauptsächlich hatte ich Kicherkicks, im Angesicht der Libelle, die auf der Stelle schwebte und herzergreifend schillerte. Mittendrin zog ich mein Sweatshirt aus.
Heftig, oder?, schrie eine helle Stimme hinter mir.
Ich drehte mich um. In einem zweisitzigen Golfcart fuhr eine Frau heran, in etwa so alt wie ich selbst. Ich betrachtete sie, während sie näher kam. Sie war dunkelhaarig und athletisch, ihr Gesicht war gebräunt von der Alpensonne, sie trug ein weißes Tanktop, eine schwarze, kurze Trainingshose und Sneakers. Sie hielt direkt neben mir an.
Die Libelle?, fragte ich.
Genau, antwortete sie und stieg aus, mit einem Camcorder in der Hand. Sie roch nach Parfum (blütenmäßig, klebrig, hell) und ansatzweise nach Marihuana.
Ich habe noch nie so eine große Libelle gesehen, sagte ich.
Wart’s mal ab, hier gibt’s noch größere, sagte sie, die haben sich hier scheinbar wegen der Thermalquellen entwickelt; das Grundwasser ist ziemlich warm, das ganze Jahr über. Die Sprinkler locken sie an. Ein paar Biologinnen von der Uni Innsbruck haben mal was dazu publiziert; angeblich leben hier die größten Libellen, die es momentan auf der Erde gibt. Nur manchmal ist es für Michael gefährlich, wenn er springt. Ein Zusammenprall in der Luft wäre echt abgefuckt. Wir müssen immer darauf achten, die Sprinkler rechtzeitig abzudrehen. Andererseits ist dieses Miteinander auch schön. Du bist Joshua, stimmt’s? Michael hat mir von dir erzählt.
Ja, sagte ich lächelnd, stimmt.
Ich bin Johanna, meinte sie, die Trainerin von Michi, und auch seine Schwester. Komm mit, wir fahren ein Stück, damit ich den nächsten Sprung filmen kann.
Ich setzte mich in das Golfcart. Wir fuhren näher an die Schanze heran, was ziemlich mühsam war bei dem nassen Boden, manchmal drehten die Reifen fast durch, aber wir blieben nicht stecken. Dann gingen wir zu Fuß weiter. Ich vermeinte, dass Johanna leicht humpeln würde, aber wenn ich darauf achtete, konnte ich es nicht sehen. Während wir den Hang hochliefen, zur Trainertribüne (ein frei stehendes, zwischen Bäumen verstecktes Baugerüst in der Nähe des Schanzentischs), schaltete Johanna die Sprinkler aus.
Hier in Kurbruck hat sich punktuell ein Sumpfklima entwickelt, sagte Johanna, eigentlich schlechte Trainingsbedingungen, aber es ist von zu Hause aus extrem nah und hier stört uns niemand.
Hier ist es einfach nur mystisch, sagte ich.
In der Insektenwelt sind die Infrastrukturen schon komplett weggebrochen, sagte Johanna, zumindest hier.
Mit Johanna war es so: Sie war in der Gegend um Innsbruck herum quasi heilig, weil sie so ein tragisches Schicksal durchlebt hatte. Sie war im Ski-Internat gewesen und als genialische Nachwuchsathletin gerade dabei, zur Weltspitze aufzuschließen, als sie mit neunzehn Jahren, kurz vor ihrem internationalen Durchbruch, bei einem heftigen Sturz einen doppelten Kreuzbandriss erlitt, was ihre Karriere beendet hatte. Der ÖSV hatte ihr anschließend ein Studium finanziert (Philosophie, VWL, teilweise Kulturgeografie), während sie an den Wochenenden Trainerinnenlehrgänge besuchte. Im Alter von sechsundzwanzig Jahren begann sie, ihren jüngeren Bruder Michael Stiening zu coachen, der bald gigantische Fortschritte machte und reihenweise Juniorenwettkämpfe gewann. Weil der Vater der beiden, Norbert Stiening, eine leitende Position beim Österreichischen Skiverband innehatte, durften sie zu zweit weitertrainieren, unbehelligt von den Querelen, denen man unterliegt, wenn man sich in aufreibenden Vereinsstrukturen aufhält.
Die wollen, dass ich die Juniorinnen komplett coache, sagte Johanna, aber ich habe keine Lust darauf, zumindest gerade. Ich will am liebsten eh nur kiffen. Michi wird bestimmt in den nächsten Jahren den Weltcup gewinnen. Ich muss nur drauf achten, dass er nicht abdriftet. Das ist gut, wenn man drüber nachdenkt, dass es meine Arbeit ist. Und wenn so Geld in die Familie reinkommt, dann habe ich eh auch was davon.
Ich nickte.
Ich schwöre dir, Skispringer sind solche Psychopathen, flattrig und unstet. Und außerdem kapieren sie nicht, wie wichtig Gelassenheit wäre, weil sie immerzu panisch sind.
Sie wollte wissen, warum ich in Innsbruck war. Ich erzählte ihr, dass meine Freundin ein Stipendium hatte und ich sie begleitete, und dass wir das Geld gerade nutzten, um in einem Hotel zu leben. Dabei kletterte ich, Stufe für Stufe, mit wackligen Knien die Leiter hoch auf die Trainertribüne, bis wir uns auf Höhe der Baumkronen befanden. Mein Magen fühlte sich pelzig an, weil das Gerüst leicht schwankte. Ich versuchte, meine Innereien zu beruhigen, telekinetisch. Der Boden war eine Metallplatte, die gelöchert war, sodass ich runter in den Wald schauen konnte. Johannas Smartphone vibrierte. Michael war gleich fertig mit seinen Sprungvorbereitungen, also mit den Aufwärmübungen und dem Stretching, wie sie mir erklärte. Langsam lockerten sich die Wolken auf und es wurde heller im Tal; ich schaute angestrengt, ob Libellen unterwegs waren, aber scheinbar hatten sie sich zurückgezogen. Vielleicht spürten die Libellen, dass die Sprünge auch eine Gefahr für sie darstellten. Kurz darauf konnten wir sehen, wie Michael sich oben auf den Balken setzte, bekleidet mit einem alufoliensilbernen Anzug. Er ließ seine Schultern kreisen und rückte sich die Skibrille zurecht. Er atmete tief ein.
Äußerlich passiert im besten Fall fast gar nichts, sagte Johanna, er muss in sich drin bereit sein, verstehst du?
Ich nickte. Johanna bat mich, den Camcorder zu halten und den Sprung zu filmen. Sie prüfte eine Weile die Windverhältnisse, während es mir so vorkam, als sei es komplett windstill. Ich versuchte währenddessen, meine Hand ruhigzuhalten. Durch den Bildschirm sah ich Michael herangezoomt. Er lächelte kurz, als er zu uns rüberschaute, war aber sofort wieder fokussiert. Dann winkte Johanna ausfallend in die Luft und Michael stieß sich ab. Ein geisteskrankes Sirren erschütterte den Wald, als Michael die gleißende Anlaufspur hinabfuhr, tief in der Hocke. Ich folgte ihm mit dem Camcorder. Am Schanzentisch schnellte er aus sich heraus und ging vornüber in eine relativ breite V-Formation. Mit meinem ungeübten Blick nahm ich nur wahr, dass Michael auf einem Luftpolster dahinglitt, ohne seine Haltung korrigieren zu müssen; unter ihm das tiefe, künstliche Grün der feuchten Matten, um ihn herum die Kiefern. Kurz war alles Geschwindigkeit. Obwohl der Flug nur wenige Sekunden dauerte und ich dermaßen beschäftigt damit war, mit der Kamera nichts zu verpassen, spürte ich eine Anmut, eine Eleganz, eine Erhabenheit in Michaels Sprung, der mit einer perfekten Landung endete, meines Erachtens bei ungefähr hundert Metern. Mit ausgestreckten Armen, voller Selbstüberzeugung und komplett im Gleichgewicht, rutschte Michael den Auslauf entlang, bis zu dem Punkt, wo die Matten aufhörten, er schlidderte weiter über die sumpfige Wiese und kam schließlich zum Halten.
Wow, sagte Johanna, das war stark.
Sie pfiff grell und zufrieden, indem sie sich ihre beiden Zeigefinger in den Mund steckte; es klang harsch, aber auch anerkennend. Michael winkte kurz hoch zu uns und schnallte sich die Skier ab. Dann griff er nach dem Walkie-Talkie im Gras und analysierte mit Johanna seinen Sprung. Ich verstand wenig davon. Johanna meinte, er solle beim Absprung nicht so viel forcieren. Plötzlich schien die Sonne komplett ins Tal rein und alles wärmte sich sofort auf. Michael lief zum Skilift und fuhr hoch, zurück zur Schanze.
Er schafft es so leicht, in Balance zu bleiben, sagte Johanna, wenn er sich im Wettkampf nicht aus der Fassung bringen lässt, wird er im Weltcup direkt absahnen. Aber das darf man ihm natürlich nicht sagen. Außerdem weiß er es ja eh.
Ich setzte mich im Schneidersitz hin und beobachtete, wie überall Dampf aufstieg, zart und umfassend und leuchtend. Johanna kramte in ihrem Rucksack rum und hielt mir dann eine Cola hin. Ich trank ein paar Schlucke.
Noch ein Sprung, sagte Johanna, dann kommt eine Einheit mit Krafttraining im Ort, bevor wir nachmittags wieder herkommen.
Ich werde später irgendwann wieder nach Innsbruck fahren, sagte ich.
Ich kann dich mitnehmen, sagte Johanna, ich muss jetzt dann eh zur Hautärztin nach Innsbruck.
Nachdem Michael einen weiteren Sprung ausgeführt hatte, genauso makellos wie zuvor, trafen wir uns im Auslauf. Michael schälte sich aus seinem Anzug, wir halfen ihm und hielten seine Ärmel fest, sodass er seinen verschwitzten, bleichen, schlaksigen Oberkörper rauswinden konnte. Dabei grinste er mich an, verstohlen und stolz. Anschließend fuhren wir mit dem Golfcart zum Parkplatz und stellten es in einer kleinen Scheune ab.
Warst du schon mal bei den Quellen?, fragte Michael.
Nein, sagte ich.
Die zeige ich dir beim nächsten Mal, sagte er, das ist perfekt zum Regenerieren.
Wenn du wieder kommst, dann bring doch deine Freundin mit, sagte Johanna.
Mache ich, sagte ich.
Dann könnt ihr auch bei uns übernachten, wir haben eine freie Ferienwohnung bei uns im Haus.
Michael packte seine Ski und die Ausrüstung in den Kofferraum eines schwarzen SUVs, der neben der Scheune stand. Es war ein Land Cruiser mit abgedunkelten Scheiben, der im Sonnenlicht funkelte und mächtig war, breit und uneinnehmbar. Sie hatten Essen mitgebracht; Nudelsalat und Gemüseshakes. Ich hatte noch den Streuselkuchen. Wir saßen in der Sonne und aßen gemeinsam. Kurz schwebte eine Libelle zwischen uns rum, verschwand aber bald wieder. Die Wolken lösten sich nach und nach komplett auf. Anschließend fuhren wir los. Johanna brachte Michael zum Sportplatz von Kurbruck, wo er seine Trainingseinheit mit einem Fitnesscoach absolvieren würde. Ich versprach ihm, bald wieder zu kommen. Sobald wir zu zweit im SUV waren, verknüpfte Johanna ihr Smartphone mit der Anlage und ließ Skibrille von Juicy Gay laufen. Während wir die Landstraße entlangrasten, vibten wir und rappten mit. Dabei fiel mir ein, dass ich bald wieder meine Muttermale prüfen lassen musste. Ich erzählte Johanna davon. Ich sagte, komplett übertrieben, dass ich es mehr als alles lieben würde, zu meiner Hautärztin zu gehen, weil es sich anfühlen würde, als wäre man im Vorspann eines Science-Fiction-Films. Johanna schaute schief rüber zu mir.
Wirklich, antwortete ich, es ist wirklich so.
Ach komm, sagte sie.