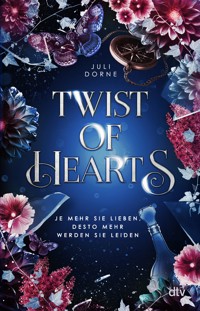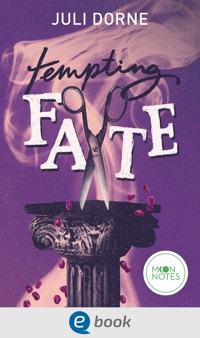Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: The AOS
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: The Hearts Duet
- Sprache: Deutsch
Magie ist tückisch. Wünsche sind gefährlich. Liebe ist voller Geheimnisse. Für die Erfüllung ihres innigsten Wunschs verspricht Evie einem unbekannten Jungen im magischen Spiegelkabinett ihrer Großmutter ihr Herz – und zahlt dafür einen hohen Preis: Seither bringen ihre Hände jedem, den sie berührt, den Tod. Erst als sie Jahre später dem charmanten Arthur begegnet, scheint sich ihr Wunsch nach jemandem, der sie liebt, endlich zu erfüllen. Doch Evies Fluch macht es den beiden unmöglich zusammen zu sein. Und als sie der Versuchung, sich nahezukommen, nicht länger widerstehen können, zahlt Arthur einen zu hohen Preis für seine Liebe zu Evie. Der Einzige, der Evie und Arthur helfen kann, ist der unergründliche Rémi. Doch er hütet zahlreiche Geheimnisse – und sie alle könnten Evie das Herz brechen ... - Eine magische Romantasy – märchenhaft, romantisch und mit einem faszinierenden Setting - Perfekt für Fans der Tropes Slow Burn, Forbidden Love und He Falls First
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Magie ist tückisch. Wünsche sind gefährlich. Liebe ist voller Geheimnisse.
Mitten im kanadischen Kiefernwald wohnt die Familie Magâme, die mit ihrer Magie dem Tod dient, und deren jüngstes Mitglied Einsamkeit im Herzen trägt. Als die damals siebenjährige Evie im Spiegelkabinett ihrer Großmutter einen mysteriösen Jungen trifft, wünscht sie sich einen Freund. Doch Magie bleibt nie ohne Konsequenzen und Evies Berührung bedeuten nun für jeden den Tod.
Als Evie elf Jahre später Arthur begegnet, ignoriert sie alle Warnungen. Jeden Tag trifft sie sich heimlich mit ihm, jeden Tag wachsen ihre Gefühle für ihn – und doch verschweigt Evie Arthur ihren Fluch. Bis das Unglück über sie hereinbricht. Doch Evie ist bereit, alles zu tun, um Arthur zu retten. Der Einzige, der Evie und Arthur helfen kann, ist der unergründliche Rémi. Doch er hütet zahlreiche Geheimnisse – und sie alle könnten Evie das Herz brechen.
Eine magische Romantasy – märchenhaft, romantisch und mit faszinierenden Settings
Juli Dorne
Play of Hearts
Band 1
Roman
Für alle einsamen Herzen da draußen – ihr verdient es, geliebt zu werden.
Für meine Oma. Danke, dass du das Gegenteil von Evies grand-mère bist.
11 Jahre zuvorDer Wunsch im Spiegel
Tausend Mädchen tanzen um mich herum. Ihre eisblauen Röcke schwingen im gleichen Rhythmus wie mein eigener. Die schneeweißen Haare, in denen eingeflochtene Kristalle im vergilbten Licht der Wandleuchten funkeln, wirbeln um ihre Köpfe wie Sternschnuppen. Eine Sternennacht im dunkelsten Raum des weißen Schlosses, der zu einem glitzernden Ballsaal wird.
Ich lache und fühle mich wie eine Prinzessin.
Warum meine grand-mère mir verboten hat, den Salon der tausend Spiegel zu betreten, verstehe ich nicht. Er ist wunderbar. Hier habe ich tausend Freundinnen, die mit mir tanzen. Aber vielleicht will meine grand-mère auch nicht zugeben, wie gern sie selbst tanzt. Oder dass sie sich auch einsam fühlt. Egal. Darüber will ich nicht weiter nachdenken, ich will mich immer weiterdrehen. Die traurigen Augen der Mädchen in den Spiegeln ignoriere ich. Sollen sie doch traurig sein – ich bin es nicht mehr.
Ich drehe mich, bis meine Knöchel sich ineinander verheddern und ich kichernd auf den Boden falle.
Die Mädchen stürzen mit mir, aber keine von ihnen nimmt mich in den Arm. Dabei tun meine Knie so weh, dass meine Augen brennen.
Mit meinen Händen stütze ich mich auf dem harten Holzboden ab und rappele mich wieder auf. Ich muss weitertanzen, sonst fangen die Mädchen an zu weinen.
Ich wirble herum, bis mir schwindelig wird, und schließe die Augen. Als ich anhalte, sausen die Mädchen weiter um mich herum. Ich starre auf meine Socken, um einen fixen Punkt zu finden. Im Sportunterricht wurde uns erzählt, dass die Welt dann stehen bleibt. Aber ich will weder, dass die Welt stillsteht, noch will ich an den Sportunterricht denken. Oder an die Schule. Oder an die anderen Kinder, die fiese Dinge flüstern und mich sonst ignorieren. Oder an meine Maman, die mich an diesen Ort geschickt hat und noch gemeiner ist als all die Kinder zusammen.
Ich möchte einfach nur tanzen und vergessen.
Ein nasser Tropfen landet auf meinem rechten Fuß, auf den ich immer noch starre, und verfärbt den weißen Stoff meiner Socke dunkel. So einfach ist das mit dem Tanzen, mit dem Vergessen leider nicht.
Auch wenn meine grand-mère, die schlauer ist als alle meine Lehrer zusammen, immer sagt, dass ich nicht weinen darf, kann ich es doch manchmal nicht lassen. Leise tropfen weitere Tränen auf meine Socken. Ich will nicht zu den anderen Mädchen in den Spiegeln schauen. Sie können mich auch nur ansehen und mit mir weinen, aber Nähe spenden sie mir nicht. Wozu sind sie dann überhaupt da? Ich schniefe laut und wische mit meinem Ärmel über meine Nase.
»Du hast so ein einsames Herz.«
Ruckartig hebe ich den Kopf und strauchle zurück, als zwischen meinen Spiegelbildern ein weiteres Gesicht erscheint. Ein Junge. Mit dunklen Haaren, die ihm auf die Schultern fallen, einem dreckigen Hemd, lockerer Hose und nackten verschmutzten Füßen. Ich wirble herum, drehe meinen Kopf und suche ihn im Raum, aber er ist nicht hinter dem dunklen Pult, nicht hinter der Büste mit dem gruseligen Kopf einer alten Frau, nicht in den Schatten, die die Wandleuchten zwischen die Spiegel werfen. Nirgendwo. Nur in einem alten, fast komplett angelaufenen Spiegel. Neben den anderen mit Goldrahmen, Verzierungen und hübschen Ornamenten wirkt er unscheinbar und ganz fehl am Platz. Und trotzdem habe ich ihn übersehen.
»Wer bist du?« Langsam trete ich an den Spiegel heran, während der Junge mich neugierig mustert und die Arme hinter seinem Rücken verschränkt. Ich wische über meine Wangen, auf denen die Tränen anfangen zu kleben und zu jucken.
»Hast du denn keine Angst?«
Ich schüttle den Kopf. »Bist du ein Geist?«
»Nein, ich bin ein Mensch. Wie du.« Ein leichtes Lächeln entsteht auf seinem Gesicht. Aber es ist einer dieser Ausdrücke, mit denen die Erwachsenen versuchen, ihre Gefühle zu verbergen. Ich habe das schon so oft gesehen auf den Beerdigungen, die meine Familie organisiert. Es sind immer die Mütter und Väter, die Onkel und Tanten, die mit diesem gezwungenen Lächeln am Grab stehen, während die Kinder weinen dürfen. Ich finde es unfair, dass diese Kinder es dürfen und ich nicht. Sie werden danach auch von ihren Eltern in den Arm genommen, während meine Maman mir noch nicht einmal die Hand reichen kann.
Meine Hände finden bei dem Gedanken an sie zueinander – halten sich selbst – und meine Finger verknoten sich, während ich mich an unser letztes Gespräch erinnere. Wie ich ihr unter Tränen erzählt habe, was die gemeinen Kinder in der Schule mir angetan haben, wie sie wortlos eine weitere Flasche ihres stinkenden Traubensafts aufgemacht und mich dann auf mein Zimmer geschickt hat, damit ich meine Tasche packe.
Statt zu trösten oder zu lächeln, öffnet Maman immer Flaschen.
»Ich bin kein Mensch«, flüstere ich jetzt und sehe dem Spiegeljungen ins Gesicht. »Ich bin ein Monster.«
»Du trägst Magie in dir«, sagt der Junge und ich nicke, obwohl es keine Frage ist. »Das macht dich nicht zu einem Monster. Das macht dich besonders.«
»Aber alle haben Angst vor mir.« Und warum sonst sollte meine Maman nicht wollen, dass ich weiter bei ihr wohne? Warum hat sie mich dann zu meiner grand-mère in dieses kalte Schloss geschickt? Und warum betrachten mich die anderen Kinder in der Schule, als würden sie mich eher anzünden, als mit mir zu spielen?
Der Junge mustert mich. Nun ist er es, der nickt, obwohl ich keine Frage gestellt habe. Aber er versteht mich, das will er mir damit sagen. Er lächelt mich weiter an und ich finde, dass er wirklich nett ist. Schade, dass er in einem Spiegel steckt.
»Wünschst du dir, dass dich jeder liebt?« Seine plötzliche Frage überrumpelt mich ein wenig und ich überlege kurz, schüttle dann aber den Kopf. »Meine grand-mère sagt, dass man mit Liebe im Herzen nur falsche Entscheidungen trifft«, erkläre ich. Und höre unmittelbar die strenge Stimme meiner grand-mère, die mir die Regeln vorbetet: Gnadenlos sein. Nicht zögern, nicht überlegen. Menschen, die uns lieben – Freunde –, sind nur Ballast, denn sie trüben unser Urteilsvermögen. Man muss auf sie verzichten, allein die Familie zählt. Ich versuche, ihre Stimme abzuschütteln, und blicke wieder zu dem Jungen im Spiegel.
»Aber …«, setze ich leiser an, als würde ich ihm ein Geheimnis anvertrauen. »Ich hätte so gerne einen Freund.« Meine grand-mère würden diese Worte wütend machen. Aber sie ist nicht hier und hört mich nicht.
»Einen Freund?« Irritiert blickt der Junge im Spiegel zu mir. »Willst du nicht mehr als einen Freund? Ich könnte dir eine ganze Schar von Freunden beschaffen.«
»Wie willst du das anstellen?« Ich stemme die Hände in die Hüfte und glaube ihm kein Wort. »Du bist in einem Spiegel.«
»Das stimmt.« Der Spiegeljunge wiegt seinen Kopf von links nach rechts. »Aber das bedeutet nicht, dass ich dir keinen Wunsch erfüllen kann.«
Sein kühles Lächeln lässt mich einen Schritt zurücktreten. Vielleicht sollte ich einfach gehen. Vielleicht gibt es ja wirklich einen Grund, weshalb ich diesen Raum nicht betreten darf und wieso meine grand-mère so wütend geworden ist, als sie mich vor ein paar Tagen in dem dunklen Flur entdeckt hat, der hierherführt. Das Gesicht des Jungen wird wieder freundlich und die Stimme sanft, als hätte er meine Gedanken gelesen. »Na gut, du wünschst dir also einen Freund?«
»Ja«, sage ich immer noch vorsichtig. Denn ich will wirklich einen Freund. So sehr, dass mein Herz aufgeregt zu schlagen beginnt und meine Hände ganz schwitzig werden. Ich habe mir schon so oft ausgemalt, wie es wäre, einen Freund zu haben. Vielleicht würde er mit mir in den Wald gehen und zwischen den Wildblumen spielen. Oder er würde mit mir kleine Schiffchen bauen und sie den Bach hoch- und runterjagen. Vielleicht würde er sogar meine Hand halten oder … oder er würde mich umarmen! Der Gedanke daran ist so aufregend, dass ich auf der Stelle auf und ab wippe.
Einen Freund zu haben … das ist wirklich alles, was ich will.
»Gut.« Etwas in den Augen des Jungen flackert auf, aber ich kann es nicht greifen, denn da lächelt er schon wieder. »Aber damit ich dir diesen Wunsch erfüllen kann, muss ich bezahlt werden.«
Mein freudiger Herzschlag stolpert und die bunten Vorstellungen in meinem Kopf werden dunkel. »Ich habe kein Geld, ich werde übermorgen erst sieben.« Ich zeige ihm die Zahl mit meinen Fingern und lasse meine Hände enttäuscht sinken.
»Dein Geld brauche ich nicht. Ich will einen Wunsch für einen Wunsch.«
»Was wünschst du dir denn? Auch einen Freund?«
»Nein.« Der Junge lächelt, aber etwas daran gefällt mir gar nicht. »Ich wünsche mir dein Herz.«
»Mein Herz?« Ich lege eine Hand auf meine Brust und trete erneut einige Schritte zurück. »Du kannst nicht einfach mein Herz nehmen. Das funktioniert gar nicht, Herzen sind mit dem Körper verbunden und –«
»Keine Sorge«, unterbricht mich der Junge im Spiegel. »Du wirst es verstehen, wenn die Zeit gekommen ist. Und du willst doch einen Freund, oder?«
»Ja.« Ich nicke. »Ja, das will ich wirklich.«
»Dann werden wir uns wiedersehen. Aber denk dran«, er hebt einen Finger, »Magie muss immer im Gleichgewicht bleiben. Es gibt keine Ausflüchte, nur Konsequenzen.«
»Ich weiß, wie Magie funktioniert«, antworte ich ihm in dem trotzigen Ton, der meine grand-mère zur Weißglut treibt.
»Natürlich.« Der Junge spitzt seinen Mund und neigt den Kopf. »Also?«
Ich überlege kurz, sehe mir den Jungen genau an. Ganz geheuer ist er mir nicht. Aber er ist auch in einem Spiegel. Und ich nicht. Wie will er mich also wiedersehen, wenn ich einfach jeden Spiegel meiden kann und vor allem diesen? Außerdem will ich einfach nicht mehr den ganzen Tag allein sein. Was soll schon passieren?
»Okay«, sage ich selbstbewusst und lege meine Hand an das Glas des Spiegels. Der Junge kommt mir entgegen. Ich zucke zurück. Für einen Moment glaube ich, seine Handfläche an meiner zu spüren. Wieder funkelt etwas in seinen Augen auf. Ich bekomme eine Gänsehaut.
»Ich warte auf dich und dein einsames Herz, Genevieve.«
»Ich bin Thomas.«
Verwundert hebe ich meinen Kopf, lasse meinen Bleistift sinken und sehe einem kleinen pummeligen Jungen entgegen, der vor meinem Tisch steht. Als ich nicht reagiere, zieht er geräuschvoll seine Nase hoch. Sein Blick haftet weiterhin an mir. Ich sehe mich in der überfüllten Schulcafeteria um, ob er wirklich mich meint, und blinzle ein paarmal, als er immer noch vor mir steht. Ein schüchternes Lächeln überzieht sein rundes Gesicht und ihm läuft Schnodder aus dem rechten Nasenloch, was er entweder nicht bemerkt oder ignoriert. »Brauchst du ein Taschentuch?«
Ich warte nicht auf seine Antwort, sondern krame schon in meinem Rucksack, der neben meinem Tisch steht. Die Taschentücher sind auf den Boden gerutscht, also muss ich ihn leicht anheben. Umständlich ziehe ich ihn hoch und löse einen der Träger von meinem Stuhlbein. Eine Vorsichtsmaßnahme, damit mein Rucksack nicht wieder geklaut wird.
»Nein«, kommt es von Thomas, gerade als ich die Packung Taschentücher erwischt habe. Zwischen den weißen Strähnen meiner Haare, in denen ich heute rosa Steine in Form eines Elefantenfalters eingeflochten habe, sehe ich ihn verwirrt an. Er grinst, zieht laut schabend den Stuhl zu meiner Rechten über den Fliesenboden und setzt sich zu mir.
»Wie heißt du?«, fragt er, während ich ihm weiter das Taschentuch entgegenhalte. »Sieht cool aus, was du da malst! Ist das ein Sarg? Die Blumen darauf sind hübsch.« Er redet einfach weiter, ohne auf eine Antwort von mir zu warten. Neugierig beugt sich Thomas, dem immer noch Schnodder aus der Nase läuft, über das Bild, das ich gerade zeichne. Ich rutsche ein Stück zurück.
»Ja, aber …«
»Echt krass! Das sieht richtig detailliert aus.«
»Danke?« Es klingt eher nach einer Frage, ich bin schließlich immer noch verwirrt. Aus vielen Gründen. Warum er das Taschentuch nicht will, zum Beispiel. Oder warum er tatsächlich mit mir redet. Aber Thomas scheint meine Verwirrung gar nicht zu bemerken, sondern grinst mich nur an.
»Du solltest dir wirklich die Nase putzen.« Ich halte ihm das weiße Papiertuch mittlerweile direkt vor sein Gesicht. Nicht, weil ich es eklig finde, aber es ist der perfekte Grund für die Kinder einen Tisch weiter neben uns, hierherzukommen und gemein zu sein. Ich verziehe das Gesicht, als sie sich gegenseitig mit den labbrigen Pommes bewerfen, die es an der Essensausgabe gab. Wenn ich Glück habe, fliegt mir heute keine davon in die Haare, sondern nur auf meinen Teller.
»Ach, das geht schon. Bin nicht krank oder so«, meint Thomas unbekümmert und wischt sich mit seinem Ärmel über die Nase. »Bist du eine Künstlerin?«
»Ich weiß nicht. Ich … ich glaube nicht.« Immer noch verwundert über sein Auftauchen und welche Gründe es dafür sonst haben sollte, wenn nicht wegen eines Taschentuchs, sehe ich ihn forschend an. Ist er eines dieser Kinder, die erst freundlich sind und dann rote Grütze in meine Schuhe füllen? Oder will er, dass ich seine Hausaufgaben mache? Ich bin wirklich gut im Rechnen.
»Wie kann man das nicht wissen?«, redet Thomas weiter, packt seine Brotbüchse aus und öffnet sie. Zum Vorschein kommen haufenweise Gemüse und ein Sandwich. »Du weißt doch auch, dass der Himmel blau ist oder dass Archaeopteryxe Federn hatten.«
»Hatten sie das?«
Thomas verdreht die Augen. »Aber klar doch! Kennst du dich mit Dinosauriern nicht aus?«
»Nicht wirklich«, murmle ich und schaue zwischen Thomas und dem Tisch neben uns hin und her, während Thomas sich unbekümmert eine Gurkenscheibe in den Mund steckt. Wieder blicke ich zu den Kindern am Nachbartisch. Schnell sehe ich weg, als der Schlimmste von ihnen uns entdeckt. Haben sie ihn zu mir geschickt? Vielleicht drückt er mir gleich die Möhre neben seinen Gurken ins Auge. Ich rücke noch ein Stück von ihm ab, bis ich nur noch halb auf dem harten Stuhl sitze.
Kurz bevor Thomas mir mehr von Dinosauriern erzählen oder sein Essen ins Gesicht drücken kann, fliegen ein Dutzend Pommes vor mir auf den Tisch. Eine Pommes trifft mich im Gesicht. Ich zucke zusammen, als hämisches Gelächter erklingt.
»Hey, Fetti, hast du eine neue Freundin?«, ruft einer der Jungs und ich ziehe den Kopf ein. Seine Freunde grölen hinter ihm. Ich mache mich immer kleiner, in der Hoffnung, sie übersehen mich. Was nicht passiert. Sie sehen mich immer. »Pass auf, dass er dich nicht frisst, Hexe!«
Mein Blick huscht von den Pommes zu Thomas, dessen Wangen sich rot färben. Aber statt zu ihnen zu sehen, schaut er mich ruhig an. Er macht nichts weiter. Er schüttet mir keinen Joghurt ins Gesicht, keine rote Grütze oder sonst irgendetwas. Stattdessen lächelt er. Kein trauriges Lächeln wie das von Erwachsenen. Es ist eine neue Art von Lächeln, die ich noch nicht gesehen habe.
»Ignorier sie einfach«, flüstert Thomas und sammelt Pommes aus seiner Brotbüchse, während es in meiner Brust zu poltern beginnt. Nicht wegen der gemeinen Kinder, die immer weiter rufen und Gesten in unsere Richtung machen, für die mich meine grand-mère für drei Stunden in den Keller schicken würde, um die Fliesen dort zu schrubben. Nein. Dieses Gefühl in meiner Brust ist mir so fremd wie das Lächeln auf Thomas’ Gesicht. »Die haben winzigere Hirne als ein Stegosaurus und das war nur so groß wie eine Walnuss. Wusstest du, dass der Stegosaurus –«
»Willst du mein Freund sein?«, platzt es aus mir heraus. Sofort presse ich meine Lippen aufeinander. Angst verdrängt das Gefühl, das ich mittlerweile direkt in meinem Herzen lokalisiert habe. Aber er muss es sein, da bin ich mir sicher. Mein Wunsch, der mir erfüllt werden soll. Thomas blinzelt mich an und lässt seine Gurke sinken. Doch statt davonzulaufen und sich den Fieslingen am Nachbartisch anzuschließen, streckt er mir seine Hand entgegen. Seinen kleinen Finger hält er dabei hocherhoben. Überrascht sehe ich ihm ins Gesicht.
»Aber nur, wenn ich dir mehr über Dinosaurier beibringen darf.« Ich nicke so schnell, dass mir Haare ins Gesicht fliegen und die Falter klimpern. Er deutet auf seinen Finger, den er immer noch abspreizt. »Du musst deinen kleinen Finger mit meinem verhaken, nur dann funktioniert es.«
Mein Herz rast und saust und fliegt in meiner Brust. Er meint es ernst. Er will wirklich mein Freund sein. Mein Freund. Der Junge im Spiegel hat sein Versprechen gehalten. »Willst du das wirklich?«, frage ich trotzdem nach. Ich muss es einfach hören. »Mein Freund sein?«
»Klar!« Thomas nickt, aber dann lässt er seine Hand sinken und sein Lächeln verblasst. »Es sei denn, du findest mich eklig. Wegen des Schnodders und allem.«
»Nein«, sage ich schnell, bevor Thomas verschwinden kann und mein Herz, das Purzelbäume schlägt, stolpert und wieder stehen bleibt. »Ich find Schnodder eigentlich ziemlich witzig.«
Ich sehe Thomas breit grinsend an und kann mein Glück kaum fassen. Er will wirklich mein Freund sein! Ich kann sogar das erste Mal, seit ich zur Schule gehe, die Rufe der Kinder, die es gar nicht gut finden, dass wir sie ignorieren, ausblenden. Ich bin schließlich nicht mehr allein.
Feierlich halte ich meine Hand hoch, auch Thomas lächelt wieder.
»Freunde?«, frage ich, als ich meinen kleinen Finger mit seinem verhake. Thomas zuckt kurz zusammen, als hätte ich ihm einen zarten Stromschlag verpasst. Ich kichere, doch eine Sekunde später bleibt mir der Laut im Hals stecken.
Thomas’ Hand erschlafft. Sein Mund steht offen, der Schock über sein gesamtes Gesicht geschrieben, aber dieser Ausdruck verschwindet so schnell wie das Leben aus seinen Augen.
Thomas fällt um und jemand beginnt zu schreien.
Vier Tage später ist seine Beerdigung. Der Himmel weint, die tiefgrünen Kiefernbäume, die den Friedhof umgeben, verbeugen sich, doch ich bleibe stumm und steif. Ich habe dazugelernt. Ich lächle das traurige Lächeln der Erwachsenen. Die Lippen zusammengepresst, Mundwinkel leicht nach unten. Und es hilft. Ich werde taub und sperre alles weg, was mich fühlen lässt. Nur meine Hände, die seit dem Vorfall in feinen spitzenbesetzten Handschuhen sicher verwahrt sind, umklammern den weißen Regenschirm etwas zu stark. Gegen diesen Fluch – diese Konsequenz – komme ich nicht an. Was habe ich nur getan?
Ich starre mit festem Blick zu Onkel Benoît und Tante Estelle, die den viel zu kleinen Sarg in das tiefe Erdloch sinken lassen, zu den trauerschwarz gekleideten Erwachsenen, die ihr schmerzhaftes Lächeln auf den Gesichtern tragen, und zu meiner grand-mère, die die Grabrede hält. Und in diesem Moment, als der Sarg in der Dunkelheit verschwindet, schwöre ich mir, nie wieder jemanden zu fragen, ob er mein Freund sein will. Ich werde nie wieder jemanden ohne meine Handschuhe berühren. Nie wieder nach einem Freund suchen. Ich werde einsam bleiben und die Erinnerung an den Spiegeljungen zusammen mit meinem dummen Wunsch neben Thomas begraben. Mein Herz muss hart werden und eiskalt. So etwas darf nie wieder geschehen. Es wird nie wieder geschehen.
Akt 1Das eiskalte Herz
1Eine Familientragödie
Morgen. Was darf es –« Die Verkäuferin verschluckt ihre Worte, als sie bemerkt, dass ich ihr gegenüberstehe. Ihr freundliches Lächeln, mit dem sie gerade noch den Mann vor mir bedient hat, erlischt und ihre Mundwinkel fallen herab. Ich weiß, was nun folgt. Der Frühlingswind, der den Geruch von Farbe und Azeton von ihrem Stand über den ganzen Markt hinwegweht, trägt die Erinnerungen an meinen letzten Besuch bei sich. Auch diesmal wird sie einen Schritt von der Auslage vor ihr zurücktreten, ihr Blick wird hart werden mit einer Spur Angst und ihre Hände … die wird sie verstecken.
»Was willst du schon wieder hier, Hexe?«, zischt sie, schafft Distanz zwischen uns und schiebt ihre angeschwollenen und schwieligen Hände unter ihre Blumenschürze. Wusste ich es doch.
Ich lächle sie freundlich an und lasse mir nicht anmerken, wie sich mein Magen zusammenzieht. »Guten Morgen. Ich würde gern diesen Pinsel und …« Ich recke meinen Kopf etwas, um mir die Farbpigmente genauer anzusehen. »Dieses Rosenmagenta kaufen. Drei Gramm, bitte.« Als ich mit meiner Hand darauf zeige, geht sie einen weiteren Schritt zurück. Mein Lächeln bleibt ungerührt auf meinem Gesicht haften. »Was kostet mich das?«
Ich sehe, wie sie zögert. Wie sie überlegt, ob sie mich einfach wegschicken oder mir sagen soll, dass diese Ware nicht zum Verkauf steht. Aber ihre müden Augen und ihre eingefallenen Wangen wollen verkaufen – das wollten sie schon vor drei Wochen, als ich das letzte Mal hier war. Die Geschäftsfrau in ihr weigert sich, mich wegzuschicken, egal was man sich über uns erzählt. Was sich die Menschen in diesem Teil der Stadt in leisen Worten zuraunen, wann immer sie mich und meine Familie sehen. Von den Brücken, den Laternen, den Holzschindeln an den Fassaden bis hin zum bröckligen Asphalt. Überall und in jeder Ritze, unter jedem Kieselstein hört man die Schreckensgeschichten über die Hexen vom Château Blanc. Nur, dass wir keine Hexen sind.
»Dreißig Dollar.« Ihre Stimme klingt wie scharf geschliffene Klingen, schnell und schmerzlos entwischen sie ihrem Mund, um keine Sekunde länger mit mir reden zu müssen. Ich blinzle und mein Lächeln wankt. Verwundert sehe ich auf die Preisschilder. »Das sind fünfzehn Dollar mehr als letztes Mal und –«
»Willst du nun was kaufen oder nicht?«, bellt sie mir förmlich entgegen. »Du hältst die Kundschaft auf.«
Ich drehe mich um, nur damit ich sichergehe, dass ich wirklich niemanden aufhalte. Aber natürlich ist niemand in meiner Nähe. Bis auf einen alten Mann, der seine Schritte beschleunigt, als er mich sieht, und eine Mutter mit ihren zwei Kindern, die eines davon dicht an sich heranzieht. Auch die anderen Stände mit ihren rot-weiß gestreiften Planen, die Essensstände und die quietschbunte Hüpfburg, die noch traurig und platt auf dem Boden liegt, sind menschenleer. Schließlich bin ich genau deshalb so früh hierhergekommen. Ich seufze und will gerade meine Tasche durchsuchen, weil ich nicht weiß, ob ich genug Bargeld dabeihabe, bis ich in meiner Bewegung innehalte.
Er ist hier. Ich fühle seine drückende Präsenz mit dem kühlen Windhauch, der durch die noch blattlosen Baumkronen streicht. Der dunkelste der Schatten hat diesen Markt betreten. Langsam hebe ich meine Lider und versuche, aus den Augenwinkeln herauszufinden, wo er sich befindet. Vielleicht lauert er in den lang gezogenen Schemen der Morgensonne, vielleicht aber auch unter den Abdeckplanen. Oder haftet er bereits an einem Menschen?
Gänsehaut pirscht über meinen Körper, je intensiver ich ihn fühle. Wind bauscht auf und trägt den Duft des Todes, kühl wie ein Wintermorgen und lieblich wie eine Lilie, zu mir.
»Wenn’s dir zu teuer ist, kannst du gehen.«
Ich richte meinen Blick wieder auf die Verkäuferin und rücke mein Lächeln zurecht. Sie wollte sicher erbost klingen und warnend, aber ich höre das leichte Zittern in ihrer Stimme, die ihre Angst vor mir zum Klirren bringt.
»Schon gut. Ich nehme es«, gebe ich in einem ruhigen Ton zurück und finde genug Geld in meinem Korb, um beides zu bezahlen. Enttäuschung vermischt sich mit einem gierigen Funkeln in ihren Augen und huscht über ihr Gesicht, als ich ihr die Scheine entgegenhalte. Auch wenn sie gehofft haben muss, dass ich bei ihren Preisen weiterziehe, kann sie dem Geld nicht widerstehen.
An einem anderen Tag hätte ihre Taktik vermutlich funktioniert und sie wäre mich losgeworden. Dafür habe ich zu Hause bereits zu viele Pinsel. Aber heute nicht. Es ist schließlich mein Geschenk an mich. »Bitte.« Ich halte ihr das Geld weiter entgegen, doch sie starrt nur meine behandschuhten Hände mit angsterfüllten Augen an, als wäre es ein Umstand, den sie mehr verdrängt als vergessen hat. Immerhin weiß jeder hier, was ich getan habe.
Stoisch lächle ich weiter, spüre aber, wie meine Wangenmuskulatur bereits zu schmerzen beginnt und sich mein Nacken verkrampft. Als sie sich nicht rührt, lege ich das Geld auf den Tisch und versuche, weiter ein freundliches, sanftes Gesicht zu wahren, obwohl alles in mir einfach nur weggehen und den Pinsel mitsamt der hübschen Farbe stehen lassen will. Aber zu gehen, wäre ein Eingeständnis, gegen das ich seit jenem Tag vor elf Jahren ankämpfe.
Die Verkäuferin nickt nur, dreht sich um und wiegt das Pigment ab, das ich haben wollte. Ich atme durch, entspanne meine Lippen für eine Sekunde und dehne meinen Nacken. So bemerke ich, dass die Mutter, die ihre Kinder zuvor schützend an sich gedrückt hat, gerade am Nachbarstand Möhren kauft. Ein herzhaftes Lachen ertönt, gefolgt von Händeschütteln und einem Geschenk für die kleine Tochter. Sie bemerken meinen Blick. Sofort verstummen die Gespräche und das Lachen verebbt. Ich richte meine Aufmerksamkeit wieder auf die Verkäuferin, mit nun noch steiferen Schultern und einem Nacken, der mich spätestens heute Abend umbringen wird, und wage es nicht mehr, mich umzusehen. Die Verkäuferin ist immer noch dabei, zu wiegen und das Pigment umzufüllen. Zeit, mein Lächeln wieder aufzusetzen. Auch wenn ich weiß: Ein Monster bleibt ein Monster, egal wie sehr man versucht, das Narrativ zu verändern. Darum schnappe ich mir auch selbst den Pinsel, damit sie ihn mir nicht reichen muss, und warte, bis sie mit dem Abwiegen fertig ist.
Was habe ich mir denn auch gedacht? Dass die Menschen eines zufälligen Morgens aufwachen und mich nicht mehr fürchten? Das, was ich getan habe, wird weder vergessen noch verziehen. Thomas war ein Mahnmal für all jene, die versucht haben, meiner Familie und vor allem mir zu nahe zu kommen. Jeder hat sich an diese Warnung gehalten. Auch ich. Darum habe ich schließlich meinen Wunsch an den Spiegeljungen mit Thomas begraben. Mein Fluch, die Konsequenz, die die Magie gefordert hat, ist mir dennoch geblieben. Ich habe seither nicht mehr gewagt, jemanden ohne meine Handschuhe zu berühren.
Die Verkäuferin hustet schwer im hinteren Bereich des Zeltes und zieht mich damit aus meinen Gedanken zurück in die Realität. Rasselnd dringt die Luft aus ihrer Lunge und ihr ganzer Körper verkrampft sich. Ich recke meinen Kopf, um herauszufinden, ob sie sich womöglich verschluckt hat und Hilfe braucht.
»Alles gut bei Ihnen?«, frage ich lauter, umklammere meinen Korb etwas stärker und stelle mich aufrechter hin.
Sie reagiert nicht auf meine Frage, sondern wischt sich lediglich mit einem Taschentuch über den Mund. Mein Herz sackt in meinen Magen. Ich erhasche einen kleinen Blutfleck auf dem weißen Stoff und plötzlich weiß ich, weshalb ich den Tod so deutlich gespürt habe. Er war direkt vor mir – er ist direkt vor mir und haftet bereits an der Verkäuferin. Nun fallen mir die Details auch auf, die ich in meinem Versuch, so wenig angsteinflößend wie möglich zu sein, übersehen habe. Zwischen den helleren Nuancen ihres Schattens entdecke ich ihn, pechschwarz und geduldig steht sein Schatten – das Einzige, was man je von ihm sieht. Auch er entdeckt mich. Ich fürchte mich nicht vor ihm, sondern nicke ihm zu wie einem alten Bekannten, den man nicht sprechen, aber auch nicht ignorieren will.
Ohne ein Wort zu sagen, legt mir die Verkäuferin, die von der stummen Begrüßung nichts mitbekommen hat, eine kleine Tüte mit dem Pigment auf den Verkaufstresen, nimmt das danebenliegende Geld mit einer Zange und gibt mir kein Rückgeld.
»Was glotzt du so? Willst du noch was?«
Ich kann nicht wegsehen. Mein Blick huscht zwischen ihr und dem Tod hin und her. Jetzt erkenne ich weitere Zeichen. Jeder gewöhnliche Mensch würde sie beim genaueren Hinsehen als einfache Alterserscheinung abtun. Die dunklen Ringe unter ihren braunen Augen, die eingefallenen Wangen und ihr schütteres, glanzloses Haar. Aber ich erkenne eine Todbedachte, sobald ich sie wirklich ansehe. Und mich nicht ablenken lasse.
»Auf Wiedersehen«, murmle ich leise. Meine Stimme bricht aus Mitgefühl für diese Frau und ich drehe mich um. Ich versuche, das gezischte »dreckige Hexe« zu überhören. Eigentlich sollte ich eher wütend sein und sie anfauchen, wie Tante Estelle es tut, aber alles, was ich empfinde, ist Kummer. Ich werde sie heute noch einmal wiedersehen, ob sie will oder nicht. Nachts an ihrem Sterbebett.
Aus meiner Rocktasche ziehe ich ein kleines Päckchen mit Blumensamen, als ich mich von ihrem Stand entferne. Während ich mit gesenktem Kopf davongehe, lasse ich die Samen aus meinen Händen gleiten und hoffe, dass der Wind sie dorthin trägt, wo der Verkaufsstand ab morgen nicht mehr zu finden sein wird.
Willow Falls erwacht allmählich aus seinem Sonntagsschlaf und immer mehr Menschen tummeln sich auf den schmalen, mit Kopfstein gepflasterten Straßen, um sich auf den Weg zum Markt zu machen. Ich zwinge mich inzwischen, nicht mehr zu lächeln, wenn sie mir begegnen und dann die Straßenseite wechseln. Meine Füße tragen mich vorbei an Bachläufen, schmalen Brücken und der Willow Falls University of Arts. Normalerweise bleibe ich stehen, lasse meinen Blick über die Studierenden gleiten, frage mich, wie es wäre, wenn ich ein anderes Leben hätte und dort studieren könnte. Aber heute stelle ich mir weder ein anderes Leben vor noch quäle ich mich mit »Was wäre, wenn«-Fragen. Ich weiß doch, dass es keine Alternative gibt. Ich habe eine Pflicht zu erfüllen, wie jeder andere in meiner Familie auch. Wir gehen mit dem Tod, nicht mit dem Leben.
Ich greife wieder in meine Rocktasche, vielleicht diesmal hauptsächlich aus Trotz, und verteile erneut Blumensamen, bis ich meine Tante Estelle und Onkel Benoît an einem schmalen Haus mit einer rostroten Holzverkleidung stehen sehe. Sie sind gerade dabei, einen Transportsarg aus dem Haus in das Auto zu schieben.
Als Benoît mich entdeckt, reißt er eine Hand hoch und winkt mich heran. Ich beschleunige meine Schritte, lasse die restlichen Samen aus der Hand gleiten und das Lächeln, das ich mir zuvor mühsam aufgezwungen habe, entsteht nun ganz leicht.
»Ma petite fleur!«, ruft er. »Wie geht es dir?« Er drückt mich an seine breite Brust und streicht mir über die Haare.
»Gut, danke.« Ich sehe zu Estelle. »Wie läuft es?«
Benoît öffnet die Kofferraumluke mit einem Grinsen, als hätten sie gerade einen Lottogewinn abgeholt und nicht einen leblosen Menschen, und schiebt den Sarg in den Kofferraum.
»Nun, die Toten sind tot oder nicht?« Ein spitzes Lächeln entsteht auf Estelles Gesicht, ehe sie den Wagen umrundet und einen genervten Blick zum Haus wirft. »Ein Glück.«
Ein Kichern erklingt von Benoît, als er den Kofferraum zuschlägt. »Stell dir nur vor, die Toten würden lebendig werden. Was wäre das für ein Spaß, wenn sie dann in unserem Keller erwachen?«
Estelles Lächeln wird breiter und ihre sonst so eisig grauen Augen blitzen auf. »Stell dir nur die Gesichter dieser dämlichen Städter vor.«
»Herrlich!«, erwidert Benoît.
Glücklicherweise bleiben aber die Toten wirklich tot. Die Bewohner von Willow Falls würden uns und unser Schloss direkt anzünden.
Benoîts Blick richtet sich auf mich und sein Lachen verrutscht leicht. »Was ist mit dir los, Genevieve? Weshalb siehst du aus, als würdest du selbst gleich in einen Sarg springen? Heute ist doch ein großartiger Tag für dich, oder?«
»Ja. Nein, alles gut«, gebe ich zurück und spüre, wie das Lächeln wieder schwerer wird, herabgezogen von den Erinnerungen an den Markt. »Fahrt ihr zurück zum Schloss? Könnt ihr mich mitnehmen?«
Estelle nickt, kneift aber die Augen zusammen. Ich seufze und weiß, was kommt. »Nun red schon, Genevieve. Wen hast du gefunden?«
»Die Frau vom Kunststand. Sie wird heute Nacht sterben.«
Estelle und Benoît wechseln einen schnellen Blick, während ich schlucke und versuche, dieses klebende Gefühl von Kummer loszuwerden. Es tut so weh, wenn ein Leben zu Ende geht.
»Du sollst kein Mitgefühl mit ihnen haben«, tadelt mich Estelle in einem strengen Ton. »Sie haben auch keins mit uns.«
Ich will etwas erwidern, doch da grätscht Onkel Benoît bereits dazwischen.
»Ah, meine kleine Blume, du und dein großes, großes Herz.« Onkel Benoît nimmt mein Gesicht in seine schwieligen Hände und drückt einen Kuss auf meinen Scheitel. Gekonnt wie immer schafft es Benoît, Estelles tobenden Orkan aus Gefühlen abzuschwächen. Estelle gibt lediglich ein unzufriedenes Geräusch von sich. »Beschütze dein Herz, Genevieve, sonst wirst du es irgendwann verlieren.« Benoît streicht ein letztes Mal über mein Haar, ehe er sich hinter das Steuer setzt.
Dazu sage ich nichts, allein ein flaues Gefühl bleibt in meiner Magengegend.
Bevor ich mich ebenfalls in den Wagen setzen kann, hält Estelle mich grob am Oberarm fest. Das sanfte Licht der Morgensonne, das zwischen den knorrigen Zweigen des Ahornbaumes hervorlugt, lässt ihr helles Haar leuchten und sie beinahe weich erscheinen. Ich glaube sogar, zwischen all den harten, unerbittlichen Gefühlen in ihrem Blick eine Spur Verständnis zu sehen.
»Es ist unsinnig, Mitgefühl mit ihnen zu haben, Genevieve. Jedes Leben ist vergänglich. Also lass dir diesen Quatsch nicht bei deiner grand-mère anmerken, sonst schickt sie dich in den Keller Fliesen schrubben.« Ein letzter Blick gleitet über mein Gesicht. »Und hör auf, darauf zu hoffen, dass dich jemand finden und lieben wird.«
»Aber du hast Onkel Benoît auch gefunden …«
»Und? Was hat es mir gebracht?« Estelle dämpft ihre Stimme, in ihren Augen flackern Schmerz und jene alles absorbierende Dunkelheit auf, die sie jedes Jahr nur am fünfzehnten Oktober an die Oberfläche lässt. »Ich habe jedes meiner Kinder begraben, also glaube nicht, dass du einfach das bekommst, was du willst. Wir wurden geboren, um unglücklich zu sein. Es ist unsere Tragödie, also arrangiere dich endlich damit.«
2Ein sonderbarer Besucher
Die Fahrt zum Château Blanc verläuft schweigend, während wir die Innenstadt hinter uns lassen. Genauso wie den sonnenklaren Himmel, der inzwischen grauen Schleierwolken und Nebeltupfern gewichen ist. Benoît holt jeden zehnten Herzschlag tief Luft und Estelle schaut aus dem Fenster. Als wir in den Wald abbiegen und uns das Dunkel der hohen Kiefernbäume verschluckt, lösen sich einige Strähnen aus Estelles streng zurückgesteckten Haaren. Auch Benoîts Schultern, die trotz seines Lächelns außerhalb des Schlosses immer angespannt sind, lockern sich. Er tastet nach Estelles feingliedrigen Händen und drückt sie leicht.
Ich bin mir sicher, er hat das Gespräch vor unserer Abfahrt gehört. Seine Augen, die eine Spur ernster wirken, verraten ihn. Aber vielleicht deute ich diese Situation, die ich schon zu oft beobachtet habe, auch einfach falsch.
Erst als wir das schmiedeeiserne Tor passieren und an der Rampe, die in die Kellerräume führt, halten, entspannt sich die Stimmung völlig. Onkel Benoît steigt als Erster aus, fährt sich mit seiner Hand durch die zerzausten blonden Locken und beginnt, eine fröhliche Melodie zu pfeifen, als wäre nichts gewesen. Eine Leichtigkeit sickert durch die Sitze des Wagens, nun, da wir wieder zu Hause sind. Auch ich merke, wie sich die Muskeln in meinen Beinen entspannen, wie die Luft nicht mehr in meiner Kehle stockt, sondern bis in meine Lungen wandert.
Ich will gerade aussteigen, als Estelle sich umdreht. Ihr kalter Blick bohrt sich in mein Gesicht und weist mich streng an innezuhalten. Heimlich hoffe ich, dass sie ihre Worte von vorhin zurücknimmt. Die Vorstellung, für immer unglücklich zu sein, ist zu trostlos, um sie hinzunehmen. Ich will einfach nicht daran glauben, dass unser Leben wirklich eine Tragödie ist. Nicht nur für mich, sondern auch für Estelle. Denn dann würde sie nach all dem Schmerz vielleicht doch ihr Glück finden.
Doch Estelle spitzt nur ihre Lippen und deutet hinter mich, wo Benoît gerade den Sarg auslädt. Nun summt er das Lied vom Tod. Wie bezeichnend.
»Es gab übrigens eine Änderung für deinen Auftrag«, sagt Estelle. »Die Familie für die Beerdigung in zwei Tagen wünscht sich weiße Chrysanthemen auf dem Sarg.« Das Letzte klingt aus ihrem Mund, als wäre es eine entsetzliche Bürde, die sie trägt. Dabei bin ich es, die schon Hunderte von Särgen mit den Trauerblumen verziert hat. Es ist meine Aufgabe in unserem Familienunternehmen, die Särge herzurichten. Für die Verstorbenen ist ein Sarg die letzte Ruhestätte und den Hinterbliebenen schenkt es oft ein letztes Lächeln, wenn der Sarg mehr ist als nur ein schmuckloses Holz, das ihre Liebsten für immer mit in die Erde nimmt. Und wenn ich dafür die Tausendste Chrysantheme zeichnen muss, ist es das wert.
»Natürlich«, antworte ich daher und zögere noch einen letzten, hoffnungsvollen Moment. Aber Estelle steigt aus.
»Ah, und Genevieve?« Estelle steckt den Kopf zurück in den Wagen und wirft mir einen langen Blick zu. Ich halte den Atem an. »Deine grand-mère will dich in der Maison Nuit sehen.«
Ich nicke, schmecke die bittere Enttäuschung auf meiner Zungenspitze, greife nach meinem Korb mit den Einkäufen und folge ihr aus dem Wagen. Ich schaue ihnen nach, wie sie den Sarg durch den Kellereingang schieben, um den Toten zu präparieren.
Mein Blick wandert mit dem Zuschlagen der Kellertür über das Grundstück. Die große Eiche, die sich über Estelles Giftblumengarten erhebt, zerstreut das Licht und lässt dunkle und helle Flecken darübertanzen, während nur zwei Meter weiter die Maison Nuit in ganzer Sonnenpracht steht.
Was meine grand-mère wohl vorhat? Vielleicht weist sie mich in ihre Gartenkunde ein. Die Maison Nuit ist eigentlich ein einfaches Gewächshaus, in dem Pflanzen ihren Schutz vor dem manchmal harschen kanadischen Wetter finden. Und doch habe ich das Gefühl, dass diesem Haus ein ganz eigener Zauber innewohnt. Was vermutlich an den unzähligen Motten liegt, die dort drin leben, sich von Raupen in Kokons und schließlich in Nachtfalter verwandeln. Manchmal kommt es mir vor, als wären sie das einzig wirklich Lebendige hier.
Mit einem leichten Quietschen öffne ich die Holztür mit Fenstereinsatz. Partikel tanzen durch die Luft, als lockten sie mich bereits in grand-mères Irrgarten aus menschengroßen Gewächsen. Ich schmecke die feuchte Luft, die sich durch die Ritzen der Glastür drückt, die in den Hauptraum des Gewächshauses führt. Darin ist die Luft so voller Feuchtigkeit, dass sich meine Haare nur noch mehr kräuseln.
Ich recke meinen Hals und halte Ausschau nach meiner grand-mère, doch durch die beschlagene Scheibe kann ich nur die Schemen der Pflanzen erkennen, also wende ich mich wieder ab und gehe auf die Kommode zu. In der zweiten Schublade neben einer Pflanzenschere liegen meine Sachen. Zeichenpapier, Stifte, Farben und Pinsel. Ich packe sie in den Korb, in dem sich mein neuer Pinsel und das Rosenmagenta neben einer Büchse mit Apfelkuchen und einer Decke befinden, und mache mich auf den Weg zum besten Ort in ganz Willow Falls. Ich habe fest vor, diesem Tag noch irgendetwas an Schönheit abzugewinnen.
Das hohe Gras, noch taubenetzt vom kühlen Frühlingsmorgen, kitzelt an meinen Knöcheln und durchnässt den Saum meines Rockes, als ich unser Grundstück verlasse und in den Wald eintauche.
Augenblicklich werden die Farben kräftiger, das helle, frische Grün der Wiese vor dem Schloss mit den weißen Tupfern der Frühblüher, die bereits aus dem Winterschlaf erwacht sind, weicht einem satten Grünton von großen moosbewachsenen Findlingen und dicken Wurzeln. Neben den Moosflechten drängen sich Farne aus dem Boden und Sträucher tragen bereits erste Blüten. Auch die Geräusche haben sich verändert. Vögel singen ihre Frühlingslieder und in einem Brombeerstrauch raschelt es verdächtig. Vermutlich suchen die Wildkaninchen nach Nahrung oder kommen gerade aus ihrem Bau. Für einen Moment schließe ich die Augen und lasse mich in die Welt fallen, die ich soeben betreten habe. Dieser Wald ist das Gegenteil von dem Leben im Château Blanc. Dort herrscht tosende Stille, hier bedächtiger Lärm.
Ich laufe den Trampelpfad entlang, den meine eigenen Füße über die Jahre gebildet haben, und hebe meinen Rock, damit er sich nicht in den Stacheln der auf dem Boden ausgebreiteten noch blattlosen Büsche verheddert. Nur wenige Gehminuten später bin ich schließlich da.
Die Oberfläche des Baches funkelt in der Morgensonne, als wäre er mit Diamanten besetzt. Dichtes Gras sprießt an seinem Ufer und wirkt durch den weichen Schatten der großen Weide mit ihren langen Armen wie weichgezeichnet. Zwischen den Halmen der Gräser und den Blüten der Krokusse blitzen die feinen Flügel der Falin auf, die schon eifrig bei der Arbeit sind. Einige der kleinen Kobolde entdecken mich und kommen aufgeregt zu mir geflogen, während ich die Decke aus meinem Korb auf dem Gras ausbreite und aus der Büchse den Apfelkuchen hole.
»Guten Morgen«, begrüße ich zwei ganz besonders neugierige Wesen, die ihre Köpfe, kaum so groß wie mein Daumennagel, längst in meinem Korb vergraben haben. Sie ziehen zwei Kerzen heraus, mitsamt einer Streichholzpackung, und halten sie mir entgegen. Ich lächle, weil sie wissen, dass ich zuerst die Kerzen anzünden und mir etwas wünschen muss, bevor sie ein Stück vom Kuchen bekommen.
»Vielen Dank.«
Weitere Falin kommen zu mir geflogen, als ich die Kerzen in den Kuchen gesteckt und angezündet habe. Das Schlagen ihrer Flügel vibriert durch die Morgenluft wie das eines Kolibris. Der ungeduldigste Kobold von ihnen deutet mit einem Finger, so dünn wie ein Haar, auf den Kuchen.
»Ich mach ja schon«, murmle ich und schaue den Falin streng an, während es mir schwerfällt, ein Lächeln zu unterdrücken. Doch sein Blick ruht nur hungrig auf dem Kuchen. »Es ist schließlich mein Geburtstag, da darf ich mir Zeit nehmen, oder?«
Er schüttelt den Kopf und ich muss lachen. Frechdachs.
»Na gut.« Ich hole tief Luft, schließe die Augen und puste die Kerzen aus, mit dem gleichen Wunsch wie seit elf Jahren. »Alles Gute zum Geburtstag, Genevieve«, flüstere ich und schlucke. Meinen achtzehnten Geburtstag habe ich mir irgendwie immer besonderer vorgestellt. Immerhin bekommen andere zu diesem besonderen Anlass Autos, Wohnungen, Familienfeiern und Aufmerksamkeit. Und ich … ich schüttle den Kopf. Ich sollte nicht undankbar sein. Ich habe schließlich alles, was ich brauche. Eine Familie, ein Dach über dem Kopf und eine Arbeit, die mir entspricht. »Und außerdem habe ich euch, nicht wahr?«, richte ich mich wieder an die Falin, die sich bereits über den Kuchen hermachen und mich keines Blickes mehr würdigen.
Ich seufze und lasse mich auf den Rücken fallen, während die Wolken an mir vorbeiziehen wie die Wünsche, mit denen ich Jahr für Jahr die Kerzen erlösche und die doch nicht in Erfüllung gehen.
Aber vielleicht ist das auch ein Teil unseres Vermächtnisses. Wir bleiben nicht nur unglücklich, sondern verwandeln Wünsche in Flüche.
Nachdem ich den Falin beim Essen zugeschaut und eine Skizze für die Schmuckzeichnung des Sarges angefertigt habe, erhebe ich mich von meiner Decke. Ich strecke meine Arme und den Rücken, um die Verspannungen, die seit dem Markt an mir kleben, zu lösen.
Heute wird ein langer Tag. Ich habe die todbedachte Frau entdeckt und es ist meine Pflicht, sie in den Tod zu begleiten. Ein ungeschriebenes Gesetz meiner Familie, denn nicht immer stehen wir jenen Leuten, die todbedacht sind, vor ihrem letzten Atemzug gegenüber. Manchmal träumen wir von ihnen, manchmal schickt uns der Tod tagsüber eine Vision und manchmal … manchmal sind wir zu spät. Dann gehen sie ohne den Frieden, den wir ihnen schenken können.
Ich sollte meine Energie heute also besser einteilen, um für die Nacht bereit zu sein. Doch als ich die Falin bei ihrer mühseligen Arbeit, Kieselsteine aus dem Flussbett zu räumen, eine Weile beobachte, wird mir schwer ums Herz und ich knöpfe meine Bluse auf und streife sie mitsamt dem Rock von meinem Körper.
»Ich helfe euch«, rufe ich, als ich in das eiskalte Bachwasser trete. Meine Haut zieht sich augenblicklich zusammen und ich muss kräftig ein-, zweimal ausatmen, um die Kälte besser zu ertragen. Ein Falin sieht besorgt zu mir herüber, steckt seinen spindeldünnen Finger in das Wasser und die Kälte vergeht. Ich neige meinen Kopf. »Danke.«
Von einem anderen Falin lasse ich mir zeigen, welche Kieselsteine ich aussortieren muss – jene mit zu viel Schlick – und welche nicht. Stumm arbeiten wir nebeneinanderher, bis illuminierende Punkte an meinem Sichtfeld kitzeln.
Ich drehe verwundert meinen Kopf und halte in meiner Arbeit inne.
Ein Dutzend Lumière, blau schimmernde Irrlichter, tanzen durch die Schatten des Waldes. Sie sind üblicherweise Boten des Todes und des Unglücks, ein Umstand, der meinen Blick besorgt umherschweifen lässt. Aber niemand außer mir und den Falin ist hier. Vielleicht wird einer der Falin bald –
Der Gedanke hält quietschend in meinem Kopf an, als jemand die Lichtung betritt. Panik schießt durch meinen Körper und lässt mich in die dunklen Schatten der Weide flüchten. Ich sinke tiefer ins Wasser, während die Falin verwundert zu mir blicken.
Ein Junge … nein, ein Mann … ungefähr in meinem Alter, stapft durch das hohe Gras, seine Füße setzt er voller Vorsicht auf, um die Frühblüher nicht zu zertreten.
Mit jedem Schritt, den er auf den Bach zugeht, pocht mein Herz schneller und schneller und schneller. Es hat inzwischen beinahe die Geschwindigkeit der Flügel der Falin angenommen, die neben mir summen und sich nun ebenfalls verstecken. Dabei sollten sie sich von seiner Anwesenheit kaum gestört fühlen. Vielleicht sind es die Irrlichter, die die Falin verunsichern. Die Lumière zeigen sich sonst nur nachts, wenn die Falin schlafen. Denn dieser Kerl mit seinem roten Wollmantel, den braunen Locken und dem sanften Gesicht kann nicht der Grund für ihre Unruhe sein, denn die Falin können nur von magiebegabten Menschen gesehen werden und er wirkt so menschlich, so magielos. Ich frage mich, warum er hier ist. Im verfluchten Wald der Hexen vom Château Blanc. Aber vielleicht ist er auch ein Tourist und hat von diesen Geschichten noch nichts gehört. Ein sonderbarer Vorfall.
Ich sinke tiefer in den Bach, bis das Wasser gegen meine Wangen schwappt. Der Fremde hat das Ufer erreicht und mein Herz pocht so heftig, dass ich es bereits auf meiner Zungenspitze spüre.
Er darf mich hier nicht entdecken. Dieser Ort ist meine Zuflucht, und wenn ein Mensch mich entdeckt, dann könnte ich mich hier nicht mehr so einfach vor allem verstecken. Nicht vor meiner grand-mère, nicht vor den Blicken der Städter.
Es ist mein Ort und ich kann ihn nicht teilen.
Ich drücke mich tiefer in die Schatten der Weide, beobachte ihn weiter, wie er in die Hocke geht, sein Gesicht mit dem klaren Wasser bespritzt und die Natur bewundert. Die Szenerie, mit ihm im Mittelpunkt, wirkt wie ein Kunstwerk. Es kribbelt mir in den Fingern, ihn zu zeichnen. Eine Weile sehe ich ihm zu, wie er aus seiner Tasche eine Trinkflasche holt, sie mit Wasser füllt, bis die Falin wieder meine Aufmerksamkeit erregen. Vielleicht ist da doch etwas an ihm, das sie so sehr stört. Sie wirken zornig und absolut erbost über seine Anwesenheit. Ich weiß, dass sie Menschen generell nicht leiden können, immerhin produzieren sie so viel Müll und Dreck, dass die Falin nicht hinterherkommen, ihn wegzuräumen. Das Temperament der Falin ist nicht zu unterschätzen und ich habe Sorge, dass zwei besonders impulsive von ihnen Kieselsteine werfen und mein Versteck verraten könnten. Daher flehe ich sie stumm an, sich mit Fäusteschwingen zu begnügen. Vielleicht entdeckt er mich dann nicht. Ich werde so steif wie die Weide, die über den schmalen Bach ragt. Aber der Fremde scheint etwas entdeckt zu haben. Mir wird schlecht, als ich sehe, worauf sein Blick fällt: meine Decke mit dem Kuchen, den Pinseln und der Farbe. Er lässt seinen Blick weiterschweifen und beugt sich leicht vor.
»Hallo?«, ruft er. Seine Stimme jagt Gänsehaut durch meinen Körper, so warm und weich wirkt sie. Ganz anders als das Wasser, das den Zauber der Falin bereits verloren hat und nun bitterkalt ist. »Ist hier jemand?«
Ich halte die Luft an, wage nicht, mich zu bewegen. Was wird er tun? Wird er den Bach durchqueren? Wie viel Neugier steckt in ihm und weshalb –
Da saust ein Falin an meiner Nase vorbei, sichtlich wutentbrannt mit roten Wangen und zischenden Lauten. Mein Kopf schnellt zu dem ausgesprochen frechen Kobold und ich werfe ihm einen warnenden Blick zu. Im Schutz der langen Arme der Weidenzweige tauche ich etwas auf.
»Nein«, wispere ich so streng wie möglich, doch der Kobold verengt nur seine schwarzen Augen und legt die spitzen moosgrünen Ohren an. »Hör. Auf.« Ich bewege mich vorsichtig auf ihn zu, als er einen Kieselstein nimmt und – zu spät. Der Kieselstein fliegt.
»Hey!«
Der Fremde zuckt zusammen, reibt mit einer Hand über seinen Hinterkopf – dort, wo ihn, ausgesprochen präzise, der Stein erwischt haben muss – und dreht sich in meine Richtung. Und ich … ich stehe, mit dem Wasser nur noch bis zur Brust, den Arm ausgestreckt, im Versuch, den Falin aufzuhalten, einen weiteren Kiesel zu werfen, unübersehbar hinter den luftigen Zweigen der Weide.
Seine Augen weiten sich, als er mich entdeckt. Ein, zwei, drei Momente vergehen, in denen wir uns stumm ansehen. Er am Ufer des Baches, mit Überraschung in seinem schönen Gesicht, und ich mit einem verwirrten Herzen voller Angst und … Neugier. Wie ich auf ihn wirken muss, will ich gar nicht wissen. Wie ein Geist vielleicht, so ist doch alles an mir hell und weiß, während die Schatten um mich herum dunkel und bedrohlich wirken. Ich bin mir sicher, sie verschlucken mich fast und lassen mich noch durchscheinender wirken. Wir mustern uns weiterhin durch den Zweigenvorhang, wie zwei Personen aus verschiedenen Welten. Und irgendwie ist es auch so. Er kommt aus dem Leben und ich entstamme dem Tod.
Leicht neigt er nun den Kopf wie zu einer Begrüßung oder einer Frage, und anstatt zurückzuweichen, wie er es tun sollte – wie ich es ebenfalls tun sollte –, steigt er in das Wasser. Was zur –
Sofort trete ich einige Schritte zurück, die Falin fliegen noch aufgeregter um mich herum und einer von ihnen zieht hektisch an meinen Haaren. Vermutlich will er mich beschützen, zupft mir damit aber nur einzelne Strähnen aus. Ich spüre den Schmerz kaum, mein ganzer Fokus liegt auf ihm.
»Hey! Nein, warte!« Wasser spritzt, als der Junge seine Schritte beschleunigt. Sein Mantel und das darunterliegende T-Shirt sind besprenkelt von dunklen Tropfen. Er hebt seine Hände, während ich mich gegen den Stamm der Weide presse. Nur noch wenige der kleinen Kobolde versuchen, mich zu schützen, doch auch ihnen wird die Situation zu brenzlig, als er die ersten Äste beiseiteschiebt. Er ist nur noch einen Meter entfernt, vielleicht weniger.
»Du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Ich will dir nichts tun.«
Ich? Angst vor ihm? Ich blinzle und neige meinen Kopf, was er fehldeutet. Er scheint zu glauben, das Richtige gesagt zu haben, denn jetzt lächelt er. Es ist ein schönes Lächeln.
»Hi«, setzt er langsam an. Seine Stimme trägt einen ganz eigenen Akzent, wie eine Melodie, die noch dabei ist, ihren Weg zu finden. »Ich bin Arthur.« Er legt eine Hand auf seine Brust. »Und du?«
Ich bin immer noch zu gebannt, zu angespannt, um auch nur ein Wort zu sagen. Er denkt, ich habe Angst vor ihm? Wirklich sonderbar. Darum kann ich ihn nur ungläubig anstarren, während sein Blick ebenso über mich streift. Seine braunen Locken umrahmen sanft sein Gesicht, was so gar nicht zu seinen markanten Wangenknochen passt. Wenn ich ihn zeichnen würde, bräuchten seine Kieferpartie und seine Wangen schnelle Bewegungen, seine Augen, Nase und sein Mund hingegen zarte. Ich würde ihn wirklich so gern zeichnen.
»Du verstehst mich doch, oder?«, fragt er, zieht seinen Mantel aus und hält ihn mir entgegen. »Es ist ziemlich kalt in diesem Bach und …« Seine Wangen nehmen einen zarten Rotton an, während seine Augen weiterhin an meinen haften bleiben. Er kommt langsam auf mich zu und hält mir den Mantel immer noch entgegen. »Na ja, und du … also, du zitterst und … darf ich?«
Nun schießt mir das Blut in die Wangen, zuerst aus Scham, weil ich nur in Unterwäsche vor ihm stehe und meine grand-mère das sicher rasend machen würde, und dann, weil ich realisiere, wie nah er mir ist. Angst, so entblößt wie mein Körper und so eiskalt wie das Wasser, rast durch jede meiner Zellen und wird tobender und panischer, als er mir den Mantel umlegen will.
Meine Handschuhe!
So schnell, wie ich kann, stürme ich an ihm vorbei, wobei ich ihn komplett nass spritze, was er aber kaum zu bemerken scheint. »Tut mir leid!«, ruft er. Seine Stimme klingt verzweifelt, als hätte er Angst, etwas Falsches getan zu haben. Dabei bin ich diejenige, die einen Fehler gemacht hat. Ich hätte ihn erst gar nicht beobachten sollen, ich hätte was sagen müssen.
»Tut mir leid, ich wollte nicht …« Wieder versucht er, mir hinterherzukommen, Wasser plätschert und verschluckt seine Worte.
»Bitte, bleib weg von mir!«, rufe ich, während ich mich ans Ufer kämpfe. Meine Handschuhe – ich hätte sie nicht ausziehen dürfen. Er war mir zu nah, viel zu nah, einfach viel zu nah. Tränen sammeln sich in meinen Augen, während Angst und Erinnerungen sich vermischen und sich immer enger um mein Herz schlingen, es zusammenpressen, bis das Atmen schwerer wird, als aus dem Wasser zu kommen.
Irgendwie schaffe ich es doch, mich aus dem Bach zu ziehen und meine Handschuhe, die sicher und trocken auf meiner Kleidung liegen, über meine Finger zu stülpen. Alles an mir zittert. Es war so knapp. Unsere Fingerkuppen hätten sich nur berühren müssen und … Ich presse die Lippen aufeinander und ziehe mich stoisch weiter an, während sich mein Herzschlag und mein Atem beruhigen. Das Gefühl des rauen Stoffes, der durch meine noch nasse Haut langsam klamm wird, tut gut und lässt mich zurück ins Hier und Jetzt kommen. Alles ist gut. Ich habe ihn nicht berührt. Er lebt.
Als ich den letzten Knopf meiner Bluse geschlossen habe, zittern nur noch meine Finger, die nun sicher verwahrt wieder in meinen spitzenbesetzten Handschuhen stecken. Ich atme tief ein, drehe mich um und hoffe, dass der Fremde längst über alle Berge ist, weil er bemerkt haben muss, wie sonderbar ich bin, aber … er ist noch da. Mitten im Bachlauf steht er, sein Mantel hängt nass in seiner Hand, ein überraschter Ausdruck liegt noch immer auf seinem Gesicht.
»Geht es dir gut?«, fragt er, laut genug, damit ich ihn über die Distanz klar und deutlich verstehen kann. Er bewegt sich kein Stück. Besser so.
Statt ihm zu antworten, schlucke ich schwer und klaube meine letzten Sachen auf: meine Pinsel, das Skizzenbuch, Kohlestifte, die Reste vom Apfelkuchen, die eigentlich nur aus Krümeln bestehen, und meine Decke. Ich nicke, damit er sich – warum auch immer – keine Sorgen machen muss, und gehe noch immer ihm zugewandt einen Schritt zurück.
Er tritt einen Schritt nach vorn. Sofort halte ich an und er folgt meinem Beispiel, als wäre er mein Spiegelbild.
Warum rennt er nicht davon? Warum zittert er nicht am ganzen Körper? Warum hat er keine Angst? Selbst wenn er ein Tourist ist und noch nichts von uns – von mir – gehört hat, muss er es doch spüren. Er muss meinen Fluch spüren und es sollte ihn zu Tode ängstigen. Sein Herz müsste rasen vor Panik, denn ihm stand gerade der Tod gegenüber. Ich bringe den Tod, obwohl ich ihn nicht bringen sollte. Ich habe Thomas umgebracht, obwohl ich nur einen Freund wollte. Diese Tat muss doch an mir haften wie ein böses Omen, eine grausame Vorahnung, wie das Schmerzen von Narben bei schlechtem Wetter, wie das Kribbeln im Nacken, wenn man beobachtet wird. Er muss doch spüren, was ich bin. Außer …
Ein Gedanke beginnt durch meinen Geist zu sickern. Nein. Nein, nein, nein. Das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Ich darf mich nicht in dieser Hoffnung verlieren, ich darf, um alles in der Welt, mein Herz nicht noch einmal verschenken wollen. Sofort trete ich noch einige Schritte zurück
»Bist du eine Fee?«, fragt er eilig, immer noch ohne das angsterfüllte Blitzen in seinen Augen. Unter anderen Umständen hätte ich gelacht, doch der Schreck und die bittersüße Hoffnung, die den kalten Griff um mein Herz zu lösen beginnt, zwingen mich zur Beherrschung. Und dann reiße ich mich endlich von seinem Gesicht los und tue das, was ich sofort hätte tun sollen. Ich verschwinde im dunklen Wald, während die Lumière, die auf meine Seite des Baches geflogen sind, mir als Boten des Unheils den Weg nach Hause zeigen.
3Die Stunde des Todes
Wolken verdecken den Sternenhimmel. Allein die surrende Straßenlaterne spendet mir in dieser so finsteren Nacht Licht und hilft mir, das schmale Gartentor zu finden, das mich zu dem Hintereingang des einstöckigen Hauses führt. Dort drin befindet sich die Frau vom Kunststand und ihrem Leben bleiben nur noch wenige Minuten. Keine Zeit, um zu zögern oder an diesen seltsamen Jungen – Arthur – an meinem Bach zu denken.
Darum beeile ich mich, den Garten zu durchqueren, und hoffe, dass es bereits nach meinem Verschwinden zu regnen beginnt, damit meine Fußspuren verwischt werden. Wir gehen nie durch die Haustür, wenn wir einen Todbedachten besuchen, schließlich sind wir kein Gast, kein erwarteter Besuch. Auch wenn die meisten jener Seelen, deren Bruchstücke wir uns nehmen, bereits wissen, dass ihre Zeit vorbei ist. Dennoch sollen wir nicht gesehen werden, wir sollen ein Schatten sein, ein Geist, der durch das Haus schleicht und dann verschwindet, als wäre er nie da gewesen.
Nicht verschlossene Hintereingänge und halb geöffnete Fenster sind daher unsere Wege, um in die Häuser der Todbedachten zu gelangen. Doch heute ist kein Fenster geöffnet und die einfache Holztür mit einem Griff aus Messing fest verschlossen. Ich seufze, denn wirklich viel Zeit bleibt mir nicht, und auch wenn Benoît mir beigebracht hat, Schlösser zu knacken, so geschieht es doch zu selten, als dass ich wirklich geübt darin bin.
Aber die Lebenszeit rennt ihr davon. Ich spüre es in meiner Seele, wie sie nach ihr ruft, wie ein leises Tick, tick, tick vibriert es durch meinen Körper.
Flink ziehe ich einen Dietrich aus meiner Rocktasche und rufe mir in Erinnerung, was Benoît mir gesagt hat, als ich in das erste Haus einbrechen musste: Mit Fingerspitzengefühl und einer ruhigen Hand lässt sich jedes Schloss knacken.
Trotz meiner Unerfahrenheit brauche ich nur Sekunden, bis sich die Tür mit einem Klicken öffnet. Wind bauscht auf und trägt das Geräusch mit sich, wie meinen Atem, der mir erleichtert entweicht.
Ich stecke den Dietrich zurück in meine Rocktasche und trete in das Haus.
Warme abgestandene Luft und das Knistern von Kaminfeuer begrüßen mich, als ich in die Küche trete. Es ist unsagbar heiß hier drin und immer mehr Schweiß perlt auf meiner Stirn, je weiter ich mich durch das Haus bewege. Durch die schmale Küche, das Wohnzimmer, mit einer gemütlichen Couch, einer Bilderwand über einem geöffneten Sekretär und einem großen Esstisch, in den Flur, der genauso liebevoll eingerichtet ist wie die restlichen Räume. Wehmut erfasst mich, während ich daran denke, wie kalt und schlicht unser Schloss eingerichtet ist. Es gibt keine spontanen Familienfotos, die an den Wänden hängen, keine Erinnerungsstücke aus getrockneten Blumen oder Theaterkarten, die mit Magneten an den Kühlschrank geheftet sind. Bei uns gibt es kein Leben.
Vielleicht tut es mir deshalb immer so weh, wenn ich ein farbenfrohes und lebendiges Haus betrete und nichts als Tod und Trauer hinterlasse.
Aber wir dürfen keine Gnade zeigen, wir dürfen nicht dem Leben nachtrauern, uns nicht wünschen, die Todbedachten könnten weiterleben. Denn würden wir es tun … würde ich es tun, würde es mich so sehr schmerzen, dass ich lieber sterben würde als sie.
Ich höre einen schrecklichen Husten, gefolgt von einem panischen Ringen nach Luft. Ich strecke meinen Rücken durch und laufe auf die geschlossene Tür zu, hinter der sich die Kunsthändlerin befinden muss. Es gibt kein Zögern mehr und keine Wehmut, als ich in den Raum trete. Die Todbedachte sieht furchtbar aus. Ihr Gesicht ist noch eingefallener, ihre Augen leer und erschöpft. Der abgemagerte Körper zeichnet sich scharf unter der Decke ab, die über ihr liegt. Doch das, was mein Herz so zerquetscht, ist ihre Einsamkeit. Keiner ist bei ihr. Keines ihrer Kinder, die auf den Familienfotos so freudestrahlend in die Kamera blickten, nicht ihre Enkel und auch nicht ihr Mann. Er ist bereits vor einem Jahr verstorben. Estelle hat ihn geholt.
Niemand außer dem Tod, der in den langen Schatten wartet, die die Nachttischlampe neben ihrem schmalen Bett wirft. Und mir. Vielleicht wollte sie es so. Mein Herz ist trotzdem tonnenschwer.
»Du …« Sie entdeckt mich sofort. Ihre Augen sind wie heute Morgen angsterfüllt und sie klammert sich mit ihren Händen an der Bettdecke fest. »Du Hexe. Ich wusste, dass du mich holen kommst. Ich wusste …« Ein Husten erschüttert ihren zerbrechlichen Körper. Blut landet auf ihrer Brust.
Noch vier Minuten.
»Guten Abend«, begrüße ich sie sanft und schließe die Tür hinter mir. Ihre Beleidigung und ihre Angst treffen mich nicht. Noch nicht. Jetzt geht es um sie und um ihre Seele. »Mein Name ist Genevieve und …«
»Verschwinde«, zischt sie.
Ich hocke mich vor ihr Bett, spüre den Tod hinter mir, wie unruhig er wird.
Noch drei Minuten.